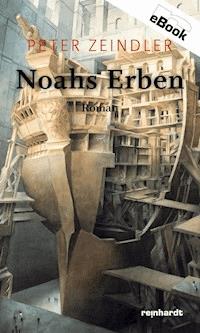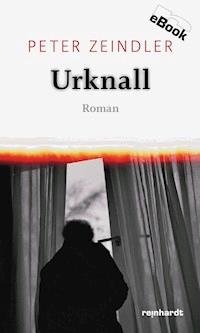
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Reinhardt, Friedrich
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der promovierte Kunsthistoriker Benjamin Lorant lebt seit zwanzig Jahren als freiberuflicher Publizist und Übersetzer in Genf. Im September 2008 nimmt ein Unbekannter, der sich unter dem Namen Petrow vorstellt, überraschend Kontakt zu ihm auf. Er spricht Lorant auf dessen Vergangenheit an, offensichtlich informiert darüber, dass er vor zwanzig Jahren seine Identität gewechselt hat und als Agent des DDR Geheimdienstes HVA in Genf zum Einsatz hätte kommen sollen. Allerdings fiel dieser Auftrag genau in die Zeit des Mauerfalls, sodass Lorant, geborener Johann Blume aus Leipzig, nicht mehr zum Einsatz kam und gezwungenermassen Gefangener seiner falschen Biografie blieb. Petrow benützt in der Folge sein Wissen über Lorants eigentliche Herkunft, die scheinbar auch dessen Frau verborgen blieb, um ihn zu erpressen: Er soll seine Beziehungen zu einem führenden Wissenschaftler des CERN ausnützen und herauszufinden versuchen, wie der grossangelegte Versuch dieses nuklearen Forschungszentrums, den Urknall zu rekonstruieren, sabotiert werden könne. Auf einer gefährlichen Reise zurück in seine nur scheinbar abgelegte DDR-Vergangenheit versucht Lorant jene Menschen wiederzufinden, die sein damaliges Leben mitbestimmt und jetzt erneut in sein Schicksal eingegriffen haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Zeindler
Urknall
Roman
Friedrich Reinhardt Verlag
Alle Rechte vorbehalten© 2011 Friedrich Reinhardt Verlag, Basel© eBook 2014 Friedrich Reinhardt Verlag, BaselTitelbild: Christine Joos, Krine/photocase.comTitelbildgestaltung: h.o.pinxit editorial design, BaselISBN 978-3-7245-2012-2
ISBN der Printausgabe 978-3-7245-1700-9
www.reinhardt.ch
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
Epilog
Peter Zeindler im Friedrich Reinhardt Verlag
1. Kapitel
Wenn der Nordostwind blies wie an diesem Sonntag Anfang September 2008, fühlte er sich ausgesetzt, nackt. Er war durchgefroren, obwohl es eigentlich noch Sommer war. Spätsommer. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass seine Frau neben ihm auf der Strassenseite ging, die der Bise zugewandt war. Sie bot ihm keinen Schutz vor deren Zugriff. Heute schon gar nicht, dachte er. Sie waren zerstritten, was ihn ungleich mehr quälte als sie. Ihr machte eine vorübergehende Disharmonie wenig aus, im Gegenteil. Grundsatzdiskussionen waren für sie das Salz in der Suppe, der Garant für eine stabile Beziehung. Sie war es denn auch meistens, die das letzte Wort hatte, während er hilflos nach Argumenten suchte, schliesslich resignierte, entweder in dumpfes Schweigen versank oder türknallend den Schauplatz des Duells verliess. Es gab nur ein Thema, bei dem sie sich nicht auf ihren Intellekt abstützte, sondern allein auf ihre Gefühle: ihre Familie.
Um ihre Vereisung zum Schmelzen zu bringen, hatte er sie scheinbar zufällig hierhin an den Quai du Mont Blanc dirigiert, wo sie sich kennengelernt hatten. Sie war ihm zwar kommentarlos gefolgt, aber mit diesem kleinen wissenden und auch verächtlichen Lächeln auf den Lippen, auf das er keine Antwort mehr fand, seit sie ihm bei seinem ersten Versuch, auf ihre Verstimmung zu reagieren, angeherrscht hatte: «Lächle nicht so falsch!»
Er war sich dabei ertappt vorgekommen. Sie hatte ja recht. Es war nicht ein Lächeln, das zu dem selbstbewussten Mann passte, der nicht nur in ihrem erlesenen Freundeskreis wegen seines Charmes und seiner souveränen Umgangsformen beliebt und geschätzt war. Es war ein Lächeln, das von weither kam.
Eine Unzahl kleiner Wellenkämme mit messerscharfen Spitzen liessen den Genfersee wie einen Nagelteppich aussehen, den die Polizei ausgerollt hatte, um die Autofahrt eines flüchtigen Verbrechers zu bremsen. Nur die Fontäne des Jet d’eau durchbohrte die scheinbar hermetische Oberfläche des Sees und schoss steil himmelwärts. Aber sie kam dort nicht an. Die Bise kappte ihre Spitze, zerfledderte sie. Den Mann im schwarzen Regenmantel, der, das Monument Brunswick im Rücken, auf der Plattform stand und auf den See hinausschaute, schien dieses Naturschauspiel zu faszinieren. Er hatte seinen dunkelgrauen Filzhut tief in die Stirn gezogen.
Benjamin Lorant wandte sich ab. Es war wohl kein Zufall, dass dieser Fremde seit Tagen immer wieder in seiner Nähe auftauchte, manchmal nur schemenhaft, dann wieder folgte er ihm wie ein treuer Hund, hielt aber immer so viel Abstand, dass er nicht angesprochen werden konnte.
«Mir ist kalt, Sela», sagte Lorant zu seiner Frau und blieb stehen. «Ich möchte jetzt einen heissen Tee.» Die Abkürzung ihres Vornamens war in einem intimen Augenblick entstanden, als er ihren Namen hauchen wollte, sich dabei aber plötzlich bewusst wurde, dass das spitze «I» in der ersten Silbe, die Harmonie ihres Zusammenseins, diese Symbiose, die ihm so wichtig war, wie mit einem spitzen Messer durchtrennen könnte.
«Jetzt und hier?», fragte Gisela scheinbar erstaunt und zeigte über ihre rechte Schulter zum Eingang des Hotels ‹Beau Rivage›.
Sie wirkte verunsichert. War es seine Aufforderung, in diesem erinnerungsbeladenen Nobelhotel einzukehren, die sie irritiert hatte, oder war ihr aufgefallen, dass er in seiner spontanen Reaktion den Schlussvokal ihres Kosenamens verformt, gepresst ausgesprochen hatte?
«Warum nicht? Ist jetzt nicht der Augenblick, schöne Erinnerungen zu wecken?»
Es war der schwache Versuch eines Friedensangebots, obwohl er aus Erfahrung wusste, dass es dauern würde, bis sie sein Angebot zur Versöhnung annehmen würde. Jetzt blieb auch sie stehen. Sie wandte sich um und schaute ihn spöttisch an. Dachte sie, dass es wohl in diesem Augenblick nicht angezeigt war, bei Kuchen und Tee ein Tête-à-Tête zu zelebrieren, wie damals, als sie sich vor beinahe zwanzig Jahren zum ersten Mal begegnet waren?
Mit Zeigefinger und Daumen zupfte er an seinem rechten Ohrläppchen. Ein Tick. Vielleicht hatte es mit den Erinnerungen an seine früheste Kindheit zu tun, als ihn seine Grossmutter jeweils kurz und heftig ins Ohrläppchen gebissen hatte, wenn er auf ihren Knien gesessen und sie ihn geherzt und gedrückt hatte.
Das Hotel ‹Beau Rivage› war für Lorant ein magischer Ort, der ihn aus verschiedenen Gründen immer wieder anzog. In erster Linie verknüpfte sich dieses Hotel mit den Erinnerungen an Uwe Barschel, den ehemaligen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, der hier im Zimmer 317 tot in der Badewanne aufgefunden worden war. Bis heute waren die Umstände, die zu seinem Tod geführt hatten, nie ganz aufgeklärt worden. Am 11. Oktober 1987, an Barschels Todestag, war es gewesen, als der Entscheid gefallen war: Benjamin Lorant würde nach Genf ziehen. Und im Hotel, in dem Barschel gestorben war, hatte er drei Jahre später, ebenfalls an einem 11. Oktober, mit Gisela, die er, nach Plan, bald nach seiner Ankunft kennengelernt hatte, Hochzeit gefeiert. Allerdings hatte an dieser Hochzeit niemand aus seiner Familie teilgenommen, aus welcher Familie auch immer! Zwei Wochen nach seiner Ankunft in Genf, im November 1988, hatte ihm ein anonymer Anrufer mitgeteilt, dass sein Vater gestorben sei.
«Welcher Vater?», hatte er gefragt. «Und wann ist er gestorben?»
Aber auf diese Fragen hatte er keine Antwort erhalten. Der Anrufer hatte aufgelegt. Drei Tage später hatte er in seiner Post einen Brief mit einer undatierten Todesanzeige gefunden. Es waren die ehemaligen Lehrerkollegen von Karl Blume, die sie verfasst hatten. Sie bedauerten den unerwarteten Tod ihres Freundes und Kollegen im Ruhestand. Ein Todesdatum war nicht vermerkt. Die Trauerfeier habe bereits im engsten Freundeskreis auf dem Leipziger Ostfriedhof stattgefunden. Und in der rechten oberen Ecke der kargen Anzeige hatte kursiv gesetzt ein Merksatz des Demokrit gestanden: Es werden mehr Leute durch Schulung, als durch natürliche Begabung tüchtig.
Diesen Satz hatte sein Vater mit Tusche auf Pergament festgehalten und ihm goldgerahmt zu seinem zwölften Geburtstag geschenkt. Hatte er etwa damit früher auch im Lehrerzimmer hausiert, wo er bei seinen Kollegen ebenfalls eine dominierende Position eingenommen hatte? Ein Leittier!
Benjamin Lorant wunderte sich über die Gelassenheit, mit der er die Nachricht vom Tod seines Vaters entgegengenommen hatte. Als ob es sich um ein Stück Literatur handelte, um Fiktion, nicht um Wirklichkeit. Letztlich folgenlos. Aber vielleicht hing dies auch damit zusammen, dass er seinen Vater in manchem als Kunstfigur erlebt hatte, einerseits als Regisseur in einem Projekt, das die Entwicklung seines Sohnes zum Gesamtkunstwerk zum Ziel hatte, andererseits in der Rolle des Liebhabers, der sich immer wieder in bildungsträchtige Bereiche verstieg, in die ihm seine in dieser Hinsicht eher unbedarfte Geliebte nicht zu folgen vermochte. Und weil Benjamin ja keine Möglichkeit hatte, Näheres über das Sterben seines Vaters zu erfahren, ohne sich selbst auszuliefern, beliess er ihn in diesem fiktionalen Bereich. Trotzdem begleitete ihn der Vater, welcher auch immer, noch heute wie ein Schatten.
Er hob den Blick. Oben auf dem Dach des monumentalen Hotelkomplexes flatterte die Schweizer Fahne im steifen Nordostwind. Es war nicht seine Flagge, obwohl er immer wieder einmal Heimatgefühle verspürte, wenn er das weisse Kreuz mit den satten Balken auf blutrotem Grund betrachtete. Unmittelbar unter der Flagge befand sich das Zimmer, in dem er mit Gisela die Hochzeitsnacht verbrachte, während im Hotelrestaurant im Erdgeschoss ihre Familie weitergefeiert hatte. Aber schliesslich hatte ihr Vater das Essen ja auch bezahlt. Dass von seiner Familie niemand an dieser Feier teilgenommen hatte, schien Gisela nicht wirklich bedauert zu haben. Er hatte ihr ja gleich zu Beginn ihrer Bekanntschaft von seiner kaum mehr existenten Familie erzählt, dass seine Eltern bei einem Autounfall in der Nähe von Pretoria ums Leben gekommen waren, Onkel und Tanten in der ganzen Welt verstreut seien. Und die einzige offizielle Blutsverwandte, Benjamins Schwester Peggy, die in Kapstadt als Buchhändlerin arbeitete, musste ihre Zusage wegen einer akuten Blinddarmentzündung zurücknehmen. Entsprechende Briefe aus Südafrika waren nie eingetroffen, und Gisela hatte diese Entschuldigung, die ihr Benjamin mündlich mitgeteilt hatte, nicht geglaubt und ihn einmal mehr gefragt, ob denn ihr geschwisterliches Verhältnis so oberflächlich sei, dass seine Schwester es nicht für nötig befände, an der Hochzeitsfeier ihres Bruders teilzunehmen. Benjamin hatte nur stumm mit den Achseln gezuckt. Was hätte er auch antworten können? Er hatte sich seine Schwester in Kapstadt vorzustellen versucht, hatte probeweise verschiedene Standorte für sie geprüft, an denen er sie auftreten liess: in ihrer Buchhandlung ganz oben auf der Leiter vor dem Bücherregal, wo sie berufshalber hinpasste, auf einem Barhocker am Tresen, wo sie sich schon wegen ihrer langen wohlgeformten Beine gut ausnehmen würde. Und er inszenierte auch immer wieder einen pompösen Sonnenuntergang am Hafen, den sie eng umschlungen mit einem schwarzen Freund bewunderte und dabei ihre Zukunft plante. Das Wichtigste für ihn bei dieser Variante war der Lichteinfall der Sonne, die ihre Schatten wachsen und das blonde Haar der Schwester oszillieren liess. Mehr fiel ihm nicht ein, und die Bilder, die er beschworen hatte, begannen sich auch bald wieder aufzulösen. Aber sie waren zumindest immer wieder abrufbar.
Gisela und Peggy hatten sich bisher nie getroffen, wie auch? Nicht einmal die Adresse dieser Schwester hatte Benjamin Lorant preisgegeben. Sie wolle keine Kontakte zu irgendwem in Europa, hatte er Gisela gesagt, die nur ungläubig den Kopf geschüttelt hatte. Mit Recht. Und übrigens sei das Verhältnis zu seiner Schwester seit dem Tod der Eltern gespannt gewesen: Ein ewiger Kampf um den Nachlass, den er schliesslich ganz ihr überlassen habe.
«Blut ist dicker als Wasser!»
Da war er wieder, dieser ominöse Satz, das Losungswort der Familie Schröder.
Benjamin Lorant betete stumm die ehernen Silben nach, die seine Ehe strukturierten. Eigentlich wusste er es ja zu schätzen, dass Gisela bereit gewesen war, den Familiennamen Lorant anzunehmen, auch wenn sie dann doch noch den Namen Schröder ohne Bindestrich hinzugefügt hatte. Sie hatte so wortlos die Distanz dokumentiert, hatte das Niemandsland abgesteckt, das sich zwischen ihrer kompakten Familie und dem zersprengten Haufen der Lorants befand: die Schwester, eine Tante in Namibia, ein Onkel in Bombay, ein Cousin in Brisbane. In regelmässigen Abständen memorierte Benjamin die Namen und Wohnorte dieser Familienmitglieder. Bis jetzt hatte er sich nie vertan. Und es hatte sich auch niemand aus diesem Kreis bei ihnen gemeldet.
«Blut ist dicker als Wasser», wiederholte er mit heiserer Stimme und zupfte an seinem Ohrläppchen.
Sie schaute ihn mit diesem wissenden Lächeln an. Die Heiserkeit, die ihn immer wieder überraschend heimsuchte, war ihr vertraut. Aber die Schlüsse, die sie daraus zog, waren wohl nicht die richtigen.
Er räusperte sich. In diesem Augenblick tauchte der Mann mit dem etwas aus der Mode gekommenen Filzhut auf dem Kopf unmittelbar neben Benjamin auf. Er warf ihm einen kurzen Blick zu und ging dann weiter. Zum ersten Mal huschte ein flüchtiges Lächeln über sein Gesicht. Dann schürzte er die Lippen und begann laut zu pfeifen. Nur ein paar Takte. Benjamin erschrak. Er hörte eine ihm wohlbekannte Melodie. Die Hymne der ehemaligen DDR.
Benjamin spürte Giselas Zeigefinger, der sich in seine Wange bohrte.
«Also dann!»
Sie ging mit ihren kurzen schnellen Schritten an ihm vorbei und steuerte das Eingangsportal des ‹Beau Rivage› an. Er folgte ihr zögernd, straffte seinen Rücken und musste sich dazu zwingen, nicht zurückzuschauen. Er dachte an Lots Weib aus der Bibel, das sich auf der Flucht aus dem brennenden Gomorra trotz des ausdrücklichen göttlichen Verbots umgewandt hatte und zur Salzsäule erstarrt war.
Im Entree blieb er stehen und sah zu, wie Gisela sich bückte und mit den Fingerspitzen ihrer rechten Hand die Oberfläche des kreisrunden Wasserbeckens in der Mitte der Halle durchkämmte. Sie wirkte so mädchenhaft, verträumt. In diesem Augenblick war sie eine andere Frau; sie war die Frau von früher, in die er sich verliebt hatte, obwohl echte Liebe nicht vorgesehen gewesen war. Er hatte das Bedürfnis, neben sie hinzuknien, doch als er sich ihr näherte, war sie mit ihren energischen Schritten bereits unterwegs zur Bar.
Gisela und Benjamin sassen schon eine Weile stumm auf den gepolsterten Stühlen in der Nähe des Fensters und warteten darauf, dass der Kellner den bestellten Tee bringen würde, als der Mann, der ihm seit Tagen auf Distanz gefolgt war, die Bar betrat. Er stand im Eingang, den Hut hatte er abgenommen, die beiden obersten Knöpfe des schwarzen Regenmantels geöffnet, und er musterte mit scheinbar spöttischem Gesichtsausdruck die wenigen Gäste im Raum.
«Kennst du den?», fragte Gisela leise.
Sie strich ihren Rock über den Knien glatt. Er nahm es aus den Augenwinkeln wahr. Er wusste, wie er diese Geste zu deuten hatte. Noch verharrte sie in ihrer unerotischen Igelhaltung. Benjamin schüttelte beinahe unmerklich den Kopf. Der Kellner stellte das Tablett mit dem Tee auf das blendend weisse Tischtuch und zog sich wieder zurück.
«Merci», murmelte Benjamin mit Verspätung. Er hatte das silberne Löffelchen in die Teetasse getaucht, nachdem er mit spitzen Fingern ein Stück Zucker hatte hineingleiten lassen, darauf bedacht, nicht zu spritzen.
Gisela hatte bereits ihre Tasse zum Mund geführt. Sie hatte dabei ihren kleinen Finger kokett abgespreizt. Ein klirrendes Geräusch liess sie zusammenzucken, als Benjamin seinen Löffel in das Untertellerchen legte. Sie schaute ihn vorwurfsvoll an, er hob entschuldigend beide Hände.
«Verzeihung. Ich wills nie wieder tun», sagte er mit einem schiefen Lächeln. Der Satz war ihm so herausgerutscht, und die Ironie war ihr nicht aufgefallen, die er zu unterlegen versucht hatte.
Sie schüttelte den Kopf. «Was für eine Formulierung! Ich bin doch nicht deine Mutter!»
Sie wirkte verstimmt. Eine tadelnde Mutterstimme. Er presste die Lippen zusammen und schwieg. Er musste warten. Sie würde wie jedes Mal ihre Hand ausstrecken und sie auf seine legen. Aber diesmal wartete er umsonst. Wieder zupfte sie an ihrem Rocksaum.
Der Fremde hatte seinen schwarzen Regenmantel ausgezogen und über die Lehne seines Stuhls gelegt. Er hatte sich den freien Tisch neben dem massiven Kamin ausgesucht. Sein Hut, dessen Krempe abgegriffen war, lag auf einer zusammengefalteten Zeitung. Es war die «Leipziger Volkszeitung». Ein Signal?
Lorant schaute weg. Er suchte nach einem Anknüpfungspunkt für ein Gespräch, das sich endlich auf einer unverfänglichen Ebene abspielen würde. Doch immer wieder drängte sich der Gedanke an die lange zurückliegende Hochzeitsnacht dazwischen, die sie in diesem Hotel zelebriert hatten. Er sah das riesige leere Doppelbett mit dem kostbaren Baldachin vor sich. Er hörte das quirlende Geräusch des Duschstrahls, der Giselas nackten Körper abtastete, als er vor dem leeren Bett gestanden und beklommen und gleichzeitig erregt auf sie gewartet hatte. Eine Hochzeitsnacht verpflichtet. Er erinnerte sich an diesen diffusen Erfüllungszwang, der seine Vorfreude gedämpft hatte. Seither waren sie lange Jahre verheiratet, aber er horchte noch immer, wenn sie im Bad war, ob sich die Qualität dieses Geräuschs, das sich für immer in sein Gedächtnis gefressen, verändert hatte, ob es sich weniger animierend ausnahm, weil die Fettpölsterchen, die sich im Laufe der Jahre wie eine Schutzschicht unter ihrer strahlend weissen Haut wölbten, den angriffigen Wasserstrahl der Dusche erstickten.
Giselas Körper war ihm je länger, je mehr abhanden gekommen; er war für ihn nur noch ein akustisches, kein optisches Erlebnis mehr, und auch der Tastsinn spielte nur noch eine untergeordnete Rolle. Aber all das hatte damit zu tun, dass die Erinnerung an die Badegewohnheiten seiner Mutter noch immer gegenwärtig waren. «Ich bin doch nicht deine Mutter», hatte Gisela zu ihm gesagt.
Die strenge Falte über ihrer Nasenwurzel hatte ihre Stirn in zwei ungleiche Hälften geteilt.
Als Jugendlicher hatte er oft vor der Badezimmertür gelauscht, wenn seine Mutter jeweils am Samstagabend vor dem einmal wöchentlich angesetzten ehelichen Geschlechtsverkehr ins Bad gestiegen war. Er konnte sie sich noch immer vorstellen, wie sie in die Wanne kletterte, sich mit der linken Hand auf dem Rand abstützte, dann das rechte Bein rückwärts ausstreckte, es auf dem Wannenrand ruhen liess, sich dabei wohl für Augenblicke in den scheinbar schwerelosen Körper einer Eiskunstläuferin versetzte, das Bein dann zögernd ins heisse Wasser eintauchte, sich etwas aufrichtete, auf dem Boden der Wanne Halt suchte, darauf das linke Bein anwinkelte und dem andern beigesellte. Eine Weile stand sie jetzt aufrecht da, bückte sich dann, umklammerte mit beiden Händen den Wannenrand und liess langsam ihren schweren Körper ins Wasser gleiten. Ihr Gesäss drängte sich mit einem dumpfen Geräusch wie eine Abrissbirne in die Wanne, schaffte Raum für ihren nachdrängenden Körper. Jetzt lehnte sie sich, die Arme auf den Rand gelegt, etwas zurück, gerade so, dass ihre Dauerwelle, die sie unter einer hellblauen Plastikhaube trug, im Nacken nicht nass wurde. Ihre etwas schlaffen bananenförmigen Brüste, die anfangs noch obenauf schwammen wie herrenloses Strandgut, tauchten ein, lösten sich begleitet von ihrem Seufzer scheinbar auf, verloren vollends ihre Form. Eine Weile war es still im Bad. Sie lag jetzt wohl regungslos auf dem Rücken. Dann endlich vernahm er dieses vertraute schneidende Geräusch, das ihn an eine Bugwelle erinnerte. Sie hatte sich aufgesetzt. Ihre beiden Knie ragten jetzt wie kleine Inseln aus dem Wasser. Sie beugte sich darüber und betrachtete sie nachdenklich.
Anfangs hatte Benjamin dieses Ritual fasziniert durch das Schlüsselloch mitverfolgt, aber bald einmal hatte er nur noch mit geschlossenen Augen mitten im Flur gestanden und sich darauf konzentriert, die vertrauten Geräusche zu interpretieren. Es gab keine Erklärung dafür, warum ihn dieses Baderitual seiner Mutter so fasziniert hatte. Und erst, wenn sie sich geräuschvoll hochgeschafft und er ihren finalen Ausruf «Voilà» gehört hatte, war er fähig gewesen, sich wieder zu rühren. Voilà! Seine Mutter war Französin gewesen, hatte während des Zweiten Weltkriegs in Paris gelebt, wo sie Benjamins Vater kennengelernt hatte, der als junger Soldat mit Hitlers Truppen in der französischen Metropole einmarschiert war. Ein Jahr nach Kriegsende hatte sich der junge Mann zu einem zweiten Eroberungsfeldzug aufgemacht, um die ferne Geliebte, die sich ja damals nicht getraut hatte, sich zum deutschen Eroberer zu bekennen, endgültig zu der Seinen zu machen. So jedenfalls lautete die Fassung, die Benjamins Vater immer wieder ein bisschen modifiziert hatte. Benjamin ballte die Fäuste. Einmal mehr hatte er sich in die falsche Biografie verirrt. Die Bilder liessen ihn nicht los, drängten sich immer wieder in sein Denken. Wenn er sich diesen Bildern völlig ausgeliefert fühlte und sie zu neutralisieren versuchte, ging er zu seinem Bücherregal, griff sich den mächtigen Bildband, der sich mit dem Werk des belgischen Surrealisten René Magritte, seinem Lieblingsmaler, beschäftigte und öffnete ihn mit traumwandlerischer Sicherheit auf der Seite, wo eine stämmige nackte Frau, deren Oberkörper sich aufgelöst zu haben schien, auf ein riesiges Blechinstrument, eine Tuba, gestützt am Meeresufer stand. Dieses Bild, das den Titel «Überschwemmung» trug, kanalisierte seine Gedankenflut, fror sie gleichsam ein. Im Laufe der Jahre war es ihm so immer besser gelungen, seine Mutter gleichsam als Kunstprodukt zu konservieren, doch oft kam es vor, dass sie diese scheinbar gefestigte Form sprengte, dass aus dem isolierten Unterleib ein neuer Oberkörper herauswuchs mit einem Kopf, aus dem ihn zwei grosse Augen vorwurfsvoll anstarrten. Dann dauerte es wieder, bis er sie, die ihm in immer neuen Anläufen ihre Geschichte aufdrängte, wieder zu bändigen vermochte, sie mit Magrittes Hilfe zurück in ein Bild drängen und sie dort zur Ruhe kommen lassen konnte. «Die symmetrische List» hiess dieses Gemälde, auf dem ein weiblicher Unterleib zu sehen war, dessen obere Ergänzung wohl mit Gewalt abgehackt worden war. Ein Tuch bedeckte die Schnittstelle, und rechts und links des Torsos waren zwei von Tüchern bedeckte Erhebungen zu sehen, unter denen wahrscheinlich Kopf und Rumpf der Frau verborgen waren.
Gisela hatte ihn die ganze Zeit beobachtet. Sie wirkte plötzlich verunsichert.
«Und jetzt?», fragte sie.
Ihre bernsteinfarbenen Augen blickten ihn über den Rand der Teetasse prüfend an.
Er räusperte sich vernehmlich.
«Jetzt? Wir wechseln das Thema, Seelchen.»
Sie lachte lautlos. Sie ignorierte, dass er sie mit ihrem zweiten potenzierten Kosenamen angesprochen hatte. Seelchen – ein Kosename, der nicht zu Gisela passen wollte. Er hatte ihn in zwei Phasen entwickelt: Von Gisela zu Sela zu Seelchen. Aber diese konturlose dahinfliessende Buchstabenkombination benutzte er selten, meist nur, um Gisela sanft zu stimmen.
«Haben wir uns denn überhaupt unterhalten? Es ist immer dasselbe. Sobald ich meine Familie ins Gespräch bringe, schweigst du verstockt. Du neidest mir meine Verwandten, weil du selbst keine wirkliche Familie hast. So ist es doch, nicht wahr? Ein kindisches Verhalten.»
«Ich empfinde eine Familie zu haben als Belastung. Wenn ich deine anschaue! Dein Bruder ist ein Alkoholiker. Er zieht dir und deinen beiden Schwestern das Geld aus der Tasche. Ihr lasst euch ausnehmen. Nur weil er von euerm Blut ist. Sippendenken! Und dein Grossvater – ach was!»
Er unterbrach sich selbst, als er das zischende Geräusch hörte, das sie produzierte, schnellte von seinem Stuhl hoch, eilte ins Foyer, zögerte und ging dann zur Toilette. Ein Fluchtversuch, bevor er wieder in sein verstocktes Schweigen verfallen würde. Dort stand er lange vor dem Spiegel und betrachtete den Mann, der ihn seinerseits freudlos musterte. Die Falten, die das Leben in dieses Gesicht geschrieben hatten, verliefen nicht in harmonischen Bahnen, sondern schienen sich gegenseitig zu bekämpfen, im Versuch, dem Gesicht ihren eigenen Stempel aufzudrücken. Er mochte diesen Mann im Spiegel nicht. Vielleicht mochte er ihn deshalb nicht, weil er, wenn er aus seinem Kopf herausschaute, sich einen andern Kopf vorstellte, als der, den er dann im Spiegel zu Gesicht bekam. In letzter Zeit hatte er sich ernsthaft überlegt, ob er sich wieder wie vor zwanzig Jahren nass rasieren sollte. Bei der elektrischen Rasur war er gezwungen, ein Gesicht ins Visier zu nehmen, das ihm eigentlich fremd war. Dieser Irritation konnte er nur begegnen, indem er sich auf eine der Parzellen dieses fremden Antlitzes konzentrierte, verbissen die stoppeligen Hautpartien attackierte, ohne dabei das ganze Gesicht betrachten zu müssen. Doch wenn er dann endlich das Resultat seiner Bemühungen begutachtete, musste er jedes Mal feststellen, dass er nur die etwas gepflegtere und auch nacktere Fassung dieses fremden Gesichts vor sich hatte, das ihm jetzt aber noch fremder geworden war. Früher, als er sich noch nass rasiert hatte, war er sich bei der Rasur jedes Mal wie im Theater vorgekommen: Wenn er mit dem Rasierpinsel sein Gesicht eingeseift hatte, hatte er sich vorübergehend in die Maske des Weissclowns geflüchtet und damit auch scheinbar gleichzeitig seine Identität gewechselt, hatte diesen weiss getünchten Kopf mit den scheinbar rotunterlaufenen Augen, den gelben Zähnen und der freiliegenden hohen Stirn als Variation seines Ichs erkannt, sich für Augenblicke in diesem Zustand scheinbarer Undurchschaubarkeit, Unverletzlichkeit eingenistet, um dann unter dieser Maske, Stück für Stück, wieder sein altes Gesicht freizulegen, das ihm aber nach dieser Metamorphose interessanter, spannender vorkam, weil es scheinbar ein Gesicht hinter der Maske war, das vielleicht ja auch nur ein nächstes, und dieses wieder ein nächstes Gesicht zudeckte.
Die Tür in seinem Rücken wurde mit Wucht aufgestossen. Der Fremde, der ihm seit Tagen folgte, stand hinter ihm und betrachtete den Mann im Spiegel. Benjamin versuchte, Distanz zu gewinnen, holte einmal mehr Magritte zu Hilfe, beschwor eines seiner Bilder, auf dem sich zwei Zwillingsfiguren, beide den linken Arm in der Schlinge, in derselben Pose eingefroren, nebeneinander standen. Benjamin Lorant tat einen Schritt beiseite. Der Fremde stand jetzt sich selbst gegenüber. Er lächelte seinem Spiegelbild zu und wandte sich dann um.
«Herr Lorant, nicht wahr?», fragte er.
Er sprach ein gepflegtes Hochdeutsch ohne Akzent. Und so sprach er Benjamins Nachnamen auch nicht französisch aus. Er war älter als Benjamin. Vielleicht sechzig? Seine Gesichtszüge waren schwammig, seine Augen wässerig. Er betrachtete Benjamin mit spöttischem Gesichtsausdruck und zeigte dabei seine etwas vorstehenden Schneidezähne. Benjamin schnüffelte. Es roch nach Desinfektionsmitteln und ein wenig nach Flüssigseife. Die untere Wandhälfte des Raumes war dunkelblau gefliest, die obere in einem warmen Gelb gestrichen. Er erinnerte sich wieder an das Badezimmer seines Elternhauses. Doch eine familiäre Atmosphäre war jetzt nicht angesagt.
«Was wollen Sie? Warum folgen Sie mir?», fragte Benjamin, bemüht, seine Stimme unter Kontrolle zu halten. Er begann den Fremden zu umkreisen wie ein Beutetier.
«Ich möchte mit Ihnen reden.»
«Wohl nicht hier!»
Benjamin blieb stehen, zupfte an seinem Ohrläppchen und drehte sich schnell um. Er bereute auch gleich diese spontane Reaktion. Aber jetzt war es zu spät. Der Spiegel befand sich in seinem Rücken. Jetzt hatte der andere ihn doppelt im Visier, von hinten und von vorn. Und ihm war nur noch eine Perspektive übrig geblieben.
«Nein, nicht hier.»
«Und wie ist Ihr Name?»
«Petrow.»
«Sie sind Russe?»
Der Fremde reagierte nicht auf diese Frage. Sein Blick galt nicht Benjamins Gesicht, sondern seiner Rückseite, die sich im Spiegel anbot. Benjamin Lorant richtete sich auf und presste die Gesässmuskeln zusammen.
«Sie lesen die ‹Leipziger Volkszeitung›! Eine versteckte Botschaft?»
«Wann würde es Ihnen passen? Morgen?», fragte Petrow, auch diese Frage ignorierend.
Benjamin bewegte sich aus Petrows Blickfeld. Eine Wasserspülung rauschte. Er hörte das Geraschel von Textilien. Eine Gürtelschnalle klickte. Die Tür der zweiten Kabine wurde aufgestossen. Ein Mann in schwarzem Rollkragenpullover, eine weisse Baseballmütze mit der Aufschrift «Chicago Bulls» auf dem Kopf, tauchte auf, ein Comicheft unter den rechten Arm geklemmt. Er zögerte kurz und ging dann stumm an den beiden vorbei. Petrow schüttelte unmerklich den Kopf.
«Ein Kollege?», fragte Lorant spöttisch, als der Mann den Raum verlassen hatte.
«Oder?», fragte Petrow gedehnt.
»Oder er hat auf uns gewartet.»
Petrow grinste.
«Etwas auffällig. Mit dieser Baseballmütze», fügte Lorant beiläufig hinzu. «Er passt nicht in diese Umgebung. Nordafrikaner? Marokko? Tunesien? Jedenfalls verkleidet.»
Er hatte sich in eine Spirale von Spekulationen hineingesteigert und fühlte sich dabei ein wenig wie ein Dichter, der seinen Figuren Biografien verpasst. Er schien Petrow beeindruckt zu haben.
«Sie sind der richtige Mann», sagte Petrow und legte seine Hand auf Lorants Schulter. Er entblösste seine Schneidezähne. «Gelernt ist gelernt.»
Lorant zuckte zusammen.
«Warum verfolgen Sie mich seit Tagen?»
Petrows Hand lag noch immer schwer auf Lorants Schulter.
«Eben deshalb. Weil Sie der richtige Mann sind.»
Petrows Griff wurde fester. Lorant befreite sich, indem er einen Schritt zurücktrat.
«Wo?»
«Im Restaurant ‹des Philosophes›. An der Rue Prévost-Martin.»
Lorant nickte. «Ist mir bekannt. Morgen um siebzehn Uhr.»
Er wunderte sich über sich selbst, dass er bereit war, sich mit dem Fremden auszutauschen. Und es war wohl nicht zufällig hier in diesem Hotel, wo Barschel gestorben war und er seine Hochzeit gefeiert hatte, zum ersten Kontakt gekommen.
Petrow zeigte ein dünnes Lächeln, hob die rechte Hand auf Schulterhöhe und wandte sich zum Gehen. Was für eine müde Variante des Hitlergrusses, dachte Lorant. Er horchte Petrows Schritten nach, bis sie verklungen waren. Dann wusch er sich die Hände und verliess die Herrentoilette. Obwohl er keinen konkreten Grund hatte, fühlte er sich in Aufbruchstimmung. Die Begegnung mit diesem seltsamen Kauz hatte auf wundersame Weise die Lethargie abgelöst, die ihn in letzter Zeit immer häufiger befallen hatte.
2. Kapitel
Benjamin Lorant liebte Bachs Musik. Dem grossen Meister der Barockmusik fühlte er sich verpflichtet. Bach war sein Übervater, und deshalb war er froh, dass in seinem Nachnamen Lorant die dominierenden Vokale von Bachs Vornamen mitklangen, selbst wenn in der deutschen Aussprache das «t» am Schluss den Wohlklang brüsk abgewürgte und nicht wie beim Vornamen Johann im finalen französischen Nasal «-ant» hoffnungsvoll nachhallte. Vielleicht hatte er deshalb in Genf eine Art Heimatgefühl entwickelt, weil in der französischen Aussprache sein Familienname nicht erstickt wurde, sondern wie ein sonores Echo aus den Tiefen einer Amphore aufzutauchen schien. Die Aneignung des neuen Namens war ihm nicht schwer gefallen. Er hatte seine neue Unterschrift nicht lange üben müssen, hatte die Vokale im Laufe der Jahre wachsen lassen, sie mit etwas mehr Sinnlichkeit gefüllt und parallel zu seiner Entwicklung in der neuen Biografie versucht, sich ein wenig von der Unterschrift, die vorgegeben war, wegzuschreiben, sich neu auszuprobieren, ohne sich zu verraten. Doch immer wieder holte ihn die Angst ein, nicht wahrhaftig zu sein, durchschaut zu werden. Doch nur ein einziges Mal hatte er seither einen Rückfall erlitten, als er in der Strassenbahn beim Schwarzfahren erwischt worden war und in Panik mit seinem alten Namen unterschrieben hatte: Blume! Kindliche Schuldgefühle hatten diesen Rückfall provoziert, aber eigentlich funktionierte er in der neuen Identität problemlos, und je länger er Lorant war, desto mehr glaubte er, Lorant zu sein.
Johann Sebastian Bach! Benjamin liebte vor allem die Oratorien, in denen er selbst, allerdings nicht lange genug, mitgesungen hatte. Die Matthäuspassion vor allen andern. Immer am Donnerstagabend, wenn Gisela ihren Yogakurs besuchte, versank er in seinem ausladenden ockerfarbenen Sessel, einem Familienerbstück, in dem sein Grossvater väterlicherseits gestorben war, und zelebrierte seine Feierstunden. Er hatte sich in seinem Leben hier in Genf an Giselas Seite eingerichtet. Viele Erinnerungen an sein früheres Dasein waren verblasst. Und auch das Zusammensein mit Gisela trug, abgesehen von diesen kleinen, scheinbar notwendigen läuternden Episoden, zu seinem Wohlbefinden bei. Immer mehr hatte er das Gefühl, mit sich im Reinen, angekommen zu sein, und nur einmal in der Woche, immer am Donnerstagabend, gestattete er sich während dreier Stunden einen Ausflug zurück in die Welt seines eigentlichen Herkommens. Er wusste alles über sich, er kannte seine Biografie auswendig. Alles, was ihm Lukas beigebracht hatte, war ihm gegenwärtig, und löste sich in einzelne Geschichten auf, eine Ansammlung von Stoffen für ein Schullesebuch. Er hatte ja schon früher seine Biografie oft frisiert. Immer wieder war es ihm gelungen, schlechte Erinnerungen zu verdrängen. Einmal hatte er im Zeugnis seine Mathematiknote gefälscht, hatte sie um einen halben Punkt verbessert, damit sie dem Durchschnitt der Noten entsprach, den er seinem Vater angegeben hatte, der sie ja auch fein säuberlich in seinem Notizbuch festgehalten hatte. Niemand hatte diese Fälschung bemerkt, weil niemand ihm zugetraut hätte, Dokumente zu fälschen. Und so war er heute selbst nicht mehr sicher, ob es wirklich so gewesen war oder ob er diese Episode erfunden hatte.
Gisela verliess das Haus jeweils gegen fünf Uhr abends. Er schaute ihr gerührt nach, wartete darauf, dass sie sich noch einmal umdrehte, ihm zuwinkte und dann die Strasse überquerte und beim Blumenladen in die Seitengasse einbog. Diese unerklärliche Rührung bemächtigte sich seiner jedes Mal, wenn Gisela wegging, auf Reisen oder nur zur Arbeit oder zum Einkaufen. Er tat sich überhaupt schwer mit Abschiednehmen, auch wenn diese Abschiede meistens nicht endgültig waren. Doch Abschiede hatten sein Leben seit seiner Kindheit strukturiert, so wie bei anderen Leute die Feiertage den Jahresrhythmus bestimmten. Immer wenn er von zu Hause weggehen musste, in Pionierferienlager – er zögerte und korrigierte schnell seine Biografie – in Klassen- oder Pfadfinderlager oder zu ausgedehnterem Besuch bei den Grosseltern, hatte ihn das Heimweh schon überfallen, bevor er aufbrach. Es war die Angst gewesen, nie mehr zurückzukommen, ein Leben lang ausgesetzt und unbehaust sein zu müssen. Vater hatte ihn sozusagen aus pädagogischen Gründen weggeschickt, um den Prozess der Mannwerdung zu fördern, und die Mutter hatte ihn nicht aufgenommen, wenn er klagte, traurig war oder kränkelte.
Sobald Gisela aus seinem Blickfeld entschwunden war, schloss er das Fenster, goss sich ein Glas Rotwein ein und startete den CD-Player. Und zehn Minuten, bevor seine Frau jeweils im Anschluss an die Yogastunde nach dem obligaten gemütlichen Zusammensein mit andern Kursteilnehmern nach Hause zurückkehrte, war der Schlusschor verklungen: «Wir setzen uns mit Tränen nieder und rufen dir im Grabe zu, ruhe sanfte, ruhe sanfte, sanfte ruh!»
Benjamin sang beinahe unhörbar mit. Seine Stimme ging im Chor der Thomaner unter. Er war jetzt nicht viel mehr als ein Nachbeter, ein Synchronsprecher. Er liess die CD mit Bachs Passion in einer Schublade verschwinden, in der er Schreibblöcke und Papier für den Drucker aufbewahrte, setzte sich an seinen Schreibtisch, startete den Laptop und begann zu schreiben. Seine Leidenschaft für Bach und sein ambivalentes Verhältnis zum Leipziger Thomanerchor passten nicht zu seiner aktuellen Biografie, und deshalb hielt er die CD vor Gisela verborgen.
Manchmal sass er auch nur da und setzte nach einer Weile das Metronom in Bewegung, das ihm damals Eleonore geschenkt hatte. Sie hatte ja seinen geheimen Berufswunsch gekannt: Er wäre gerne Dirigent geworden, und das Metronom war für sie so etwas wie ein Symbol für diese nie erfüllte Sehnsucht. Und wenn er dann im Geheimen seinen Auftritt als Dirigent inszenierte, sich aufblähte, die Arme hob und fasziniert auf das Pendel blickte, das hektisch vor seinen Augen hin- und herzuckte, bis er eingriff, das Gewicht verschob und das Zeitmass seinem Herzschlag anpasste und dann mit geschlossenen Augen in das vorgegebene Zeitmass einrastete, war er eins mit sich und dem Dasein, auch wenn das Metronom scheinbar gleichgültig und emotionslos den Takt vorgab. Die Musik fehlte in diesem zweiten Leben und manchmal fragte er sich, ob er nur deshalb manchmal das Metronom pendeln liess, weil es seinem Alltag mehr Struktur verleihen könnte. Gisela schüttelte meistens nur verständnislos den Kopf, wenn sie den Kopf durch die Tür streckte, aufgeschreckt vom monotonen Klacken des Metronoms.
Dass er ausgerechnet an diesem Abend, nach einem Tag, der nicht von ehelicher Harmonie geprägt gewesen war, vergessen hatte, den Slevogt wieder an seinen ursprünglichen Platz zu hängen, versetzte ihn erneut in die Lage des ungehorsamen Kindes, das die Abwesenheit der Mutter dazu benützt hatte, eherne Familienregeln ausser Kraft zu setzen. Ein Akt der Auflehnung. Gisela hatte ihm diese Zeichnung zum vierzigsten Geburtstag geschenkt. Er hatte dieses Geschenk freudig entgegengenommen und ihm einen Ehrenplatz an der Wand über seinem Lieblingssessel eingeräumt. Erst später hatte er erfahren, dass Gisela diese kostbare Zeichnung nicht gekauft hatte, sondern dass sie aus dem Erbe ihres Grossvaters stammte, der sich im Laufe der Zeit eine bedeutende Sammlung von Werken, die vorwiegend aus der Zeit des deutschen Realismus und Expressionismus stammten, angelegt hatte. «Im Laufe der Zeit» – das war Giselas Formulierung. Erst später hatte Benjamin herausgefunden, dass sich Giselas Grossvater die meisten Stücke dieser Sammlung zur Zeit des Zweiten Weltkriegs angeeignet hatte. Dieser Grossvater, ein Jurist und passionierter Rotwildjäger, hatte eine kleine Anwaltskanzlei betrieben, war auf Ehescheidungen spezialisiert gewesen und hatte sich dann zu Beginn des Krieges als Ortsgruppenleiter in Neustadt an der Weinstrasse zusätzlich profiliert. Benjamins Verdacht, dass der grösste Teil der Kunstsammlung aus ehemaligem jüdischen Besitz stammen könnte, war beharrlich gewachsen, doch er hatte diesen Gisela gegenüber nur einmal konkret geäussert, als er eines Tages diese Bleistiftzeichnung von Slevogt genauer untersuchte, sie dabei aus dem Rahmen nahm und auf der Innenseite des Passepartouts einen kleinen Aufkleber entdeckte: Salomon Fenigstein, Saarbrücken. «Raubkunst?» Gisela hatte diese Bemerkung als lächerliche Unterstellung bezeichnet und gesagt, er könne ja sein Geburtstagsgeschenk verkaufen und den Ertrag für wohltätige Zwecke einsetzen, zum Beispiel den Nachkommen von Holocaustopfern spenden. Damit hatte sie einmal mehr ihre uneingeschränkte Loyalität dokumentiert, die sie an den Tag legte, wenn es um Familienangelegenheiten ging. Jetzt erinnerte er sich auch an die angeblich letzten Worte, die dieser Grossvater auf seinem Sterbebett gesagt haben soll. «Alles hört auf mein Kommando.» Und dann war er gestorben.
«Blut ist dicker als Wasser.»
Benjamin hatte dieses Thema nicht mehr zur Sprache gebracht, und nur jeweils am Donnerstagabend, wenn er seine private musikalische Feierstunde zelebrierte, hatte er die Zeichnung über dem Kopfende des Sessels abgehängt, obwohl er sich über den eigentlichen Beweggrund nicht wirklich klar war. Es bestand ja kein Zusammenhang zwischen Bach und Slevogt und Salomon Fenigstein. Und Gisela trug bestimmt keine Schuld an den möglichen Vergehen ihres Grossvaters und konnte auch nichts dafür, dass in ihrem Elternhaus in Saarbrücken wertvolle Bilder von Corinth, Kirchner oder Nolde die Wände schmückten. Werke, die sie zum Teil einmal erben würde. Entartete Kunst. Und letztlich hatte ja auch sie das Recht auf ein Stück Familiengeschichte, das die Öffentlichkeit nichts anging.
«Unsere Altvordern waren – wie wir auch – dem Zeitgeist ausgesetzt», hatte sie mehr als einmal erklärt. Zu einem Leben gehörten nun einmal Visionen, und offenbar hätte das Gedankengut des Nationalsozialismus die Sehnsüchte ihrer Eltern erfüllt. Und dann hatte sie immer wieder einmal dasselbe Fazit gezogen: «Was soll dieser hypermoralische Drang der Nachgeborenen nach persönlicher Aufarbeitung der Vergangenheit? Was du bist, bist du immer gewesen! Es gibt keine Sippenhaft! Familiensinn gehört zum Überlebenskonzept eines jeden. Sonst verleugnet man sich selbst! Punktum!»
Bildende Kunst war ein wesentlicher Bestandteil von Benjamin Lorants Biografie. Seine Doktorarbeit über die Entwicklung des Hell-Dunkel-Effekts im Werk Rembrandts war allerdings nicht mit «summa» oder «magna cum laude» bewertet worden, sondern nur mit einem dürftigen «cum laude». Aber mit diesem nicht selbst verschuldeten Makel musste er leben, obwohl es ihn schmerzte, dass seine Leidenschaft für raffinierte Lichtführung, sein profundes Wissen in Sachen Lichtregie in der Theorie nicht positiv gewürdigt worden war. Dass Lorant später mit einer kleinen Publikation über René Magritte die Aufmerksamkeit eines kleinen Kreises von Kennern erweckt hatte, erfüllte ihn deshalb mit Genugtuung, weil dieser belgische Surrealist in seinem Werk immer wieder Motive aufnahm, die sein jetziges Dasein spiegelten.
Gisela hatte bei ihrer Rückkehr die leere Stelle über dem Sessel an der Wand gleich bemerkt. Sie stand in ihrem dunkelbraunen Wollmantel in der offenen Wohnzimmertür, schweigend, aber mit beredtem Gesichtsausdruck. Die Falte über der Nasenwurzel war tief. Die Lippen hatte sie zusammengepresst, die Ellbogen waren angewinkelt.
«Warum hast du das Bild abgehängt?», fragte sie mit scheinbar neutraler Stimme.
Er wirkte gefasst. Sich nie auf dem falschen Fuss erwischen lassen! Diese Regel hatte er intus. Er hatte sich insgeheim seit Jahren auf diese Situation vorbereitet. Er hatte ja damit rechnen müssen, dass sie ihn eines Tages in seiner Feierstunde überraschen und ihr dabei sofort die leere Stelle über seinem Lieblingssessel auffallen würde. Und deshalb hatte er für solche Fälle eine einleuchtende Erklärung vorformuliert: Er war dann bereit, alles von sich abzuwerfen, was ihn eigentlich ausmachte, ein Schauspieler, der seinen Text auswendig hersagen konnte. Er räusperte sich, aber seine Antwort bestand nur aus einem Krächzen. Die Welt um ihn herum war stärker.
«Wenn das Bild über meinem Kopf an der Wand hängt, kann ich es nicht betrachten. Deshalb stelle ich es in Sichtweite auf.»
Nur lag die Zeichnung diesmal neben der Obstschale auf der Biedermeierkommode, die Vorderseite gegen unten.
«Dir ist nicht mehr zu helfen», sagte sie kopfschüttelnd. «Kein barmherziger Samariter weit und breit, der sich deiner annehmen würde», fügte sie hämisch hinzu. «Und übrigens: Deine Heiserkeit wird immer schlimmer. Du solltest endlich etwas dagegen tun, anstatt das Ganze zu verdrängen.»
Sie wandte sich ab und schloss sanft die Tür hinter sich. Er hörte, wie sie draussen im Flur ihren Mantel aufhängte, die Schuhe auszog und dann in die Küche ging, um sich dort wohl ein Glas Weisswein einzuschenken. Als sie zurückkam, wirkte sie wie verwandelt. Ihre Züge hatten sich entspannt. Es war ihr in der Zwischenzeit offenbar gelungen, eine Interpretation für sein Verhalten zu finden. Er hatte die Slevogt-Zeichnung mittlerweile wieder an ihren angestammten Platz gehängt. Sie hatte es mit einem befriedigenden Lächeln zur Kenntnis genommen.
Sie setzte sich auf das Sofa vor dem Fenster, griff nach einem der dunkelroten Kissen und presste es gegen ihren Bauch. So sass sie da. Ein wenig wie ein Kind, das sich schützen will, dachte Benjamin. Er wartete ab. Vielleicht war diese scheinbar kindliche Haltung auch nur Tarnung. Er zupfte an seinem Ohrläppchen.
«Du bist so ohne Geheimnis», sagte sie unvermittelt und warf das Kissen in seine Richtung.
Er fing es erschrocken auf. Nicht der Kissenwurf hatte ihn irritiert, sondern ihre Bemerkung. Wollte sie ihn provozieren oder meinte sie es ernst?
«Wie meinst du das?», fragte er und griff zum Glas, obwohl er es bereits leer getrunken hatte.
«Wie ich es meine? Du bist so durchsichtig. Du bist so leicht zu durchschauen. Jetzt kennen wir uns seit zwanzig Jahren. Und du bist wirklich der, der mir damals begegnet ist.» Und dann schob sie überraschend noch eine Frage nach: «Oder sollte ich mich täuschen? – Oder du täuschst mich?»
Sie musterte ihn mit einem Gesichtsausdruck, den er nicht zu deuten vermochte. Irgendetwas zwischen Mitleid und Spott?
«Leer wie dein Glas jetzt», sagte sie. Und dann ergänzte sie auch diese Feststellung: «Mit Fingerabdrücken.»
Am Sinnvollsten war es wohl, wenn er jetzt eine Reaktion zeigte, die eindeutig wirkte: beleidigtes Erstaunen. Er hob verzweifelt die Arme und liess sie wieder sinken.
«Soll ich denn ein Geheimnis haben vor dir? Das ist doch nicht der Zweck einer Ehe», antwortete er. Es klang hilflos.
«Es macht eine Ehe spannend», sagte sie schnell. «Wenn du dich deiner unterdrückten Vorliebe für Bachs Matthäuspassion hingibst, sobald ich aus dem Haus bin, ist doch da nichts Geheimnisvolles dabei. Nur deshalb, weil ich Bach nicht mag. Und nicht nur Bach, auch die meisten seiner Kollegen sagen mir nichts. Warum unterdrückst du in meiner Gegenwart diesen Teil von dir?»
Sie wusste also Bescheid. Sie hatte seine CD-Sammlung in den Verliesen seines Schreibtischs entdeckt. Aber das hatte sie nicht beunruhigt. Sie hatte diesen Fund nicht zu interpretieren vermocht. Hatte sie sich gefragt, warum er nicht afrikanische Musik hortete, immer wieder einmal ein Stück seiner fiktiven Biografie reanimierte? Vielleicht hatte sie in seinem Schreibtisch auch nur nach kompromittierenden Briefen einer Geliebten gesucht, wohl eher aus einem spontanen Einfall heraus, vielleicht auch angeregt durch die Bemerkung einer Freundin, aber kaum deshalb, weil sie einen diesbezüglichen Verdacht hegte.
Sie hatte wohl gedacht, dass er sie mit seiner Vorliebe für Bach nicht provozieren, nicht ihren Widerspruch herausfordern wollte, weil sie sich nicht für Klassische Musik interessierte. Sie zog im täglichen Leben sachbezogene Diskussionen vor, Debatten über politische Themen. Beim Autofahren begleitete sie keine Musik, sondern Texte aus Hörbüchern, und auch am Radio und im Fernsehen konzentrierte sie sich auf Diskussionsrunden, Politmagazine, Nachrichtensendungen und Hörspiele. Lediglich ihre Vorliebe für Familienserien am Vorabend machte sie angreifbar; sie mochte es nicht, wenn er sie darauf ansprach. Und so würde er ihr auch nicht gestehen, warum ihm Bachs Musik so nahe war.
«Und wenn ich jetzt eine Geliebte hätte?», fragte er endlich mit einem gequälten Lächeln auf den Lippen. «Wäre dir damit geholfen?»
Er zeigte auf Slevogts Bild an der Wand und dachte an dessen Darstellung des Sängers d’Andrade in der Rolle des Don Giovanni. Als er vor zwanzig Jahren in Genf angekommen war, hatte er ja nicht zufällig Giselas Bekanntschaft gemacht. Sie war ihm als Zielperson genannt worden, hatte sie doch, aus der Perspektive eines Nachrichtendienstes betrachtet, zu einer bestimmten Kategorie von Frauen in einer beruflich interessanten Stellung gehört, mit vielfältigen internationalen Kontakten, eine Geheimnisträgerin, zudem nicht verheiratet und deshalb, so die Theorie, grundsätzlich eher bereit, sich auf eine Männerbekanntschaft einzulassen. Und so hatte er denn schon bald den Kontakt zu der attraktiven journalistischen Mitarbeiterin der bundesdeutschen UNO-Delegation gesucht, um kurze Zeit später, seinem Auftrag entsprechend, mit ihr eine operative Ehe einzugehen.
«Du hast keine Geliebte!»