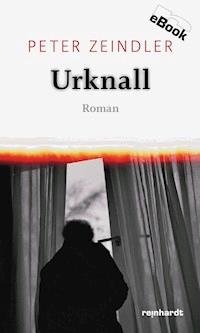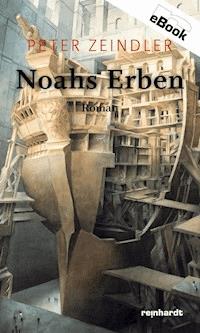
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Reinhardt, Friedrich
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In seinem Roman nimmt Peter Zeindler ein Motiv auf, das seine Prosa seit jeher bestimmt hat: die Verstellung als Überlebenskonzept. Hat er jedoch bisher seine Protagonisten vorwiegend aus dem Bereich der Spionage rekrutiert, Agenten, die ihre wahre Identität hinter einer Maske versteckten, sich in fremden Biografien bewegten, hat er diesmal einen Kunstmaler zur Hauptfigur gemacht. Dieser Künstler hat sich im Verlauf seines Lebens zu einem genialen Kopisten entwickelt, der sich immer wieder in anderen künstlerischen Identitäten, von Nolde bis Vallotton, auslebt, und so immer mehr zu seinem eigenen schöpferischen Ich auf Distanz geht. Ausgelöst durch eine Wiederbegegnung mit einem alten Schulkollegen, beginnen sich Vergangenheit und Gegenwart zu überlagern, wechselt die Erzählperspektive, wird die Grenzlinie zwischen Realität und Fiktion immer unschärfer und zwingen den desorientierten Protagonisten zu einem ultimativen Befreiungsschlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Peter Zeindler
Noahs Erben
Roman
Friedrich Reinhardt Verlag
Ich danke meinem Freund, dem Maler Willi Facen, dass ich eines seiner Arche-Gemälde als Umschlagbild für meinen Roman «Noahs Erben» verwenden durfte.
Alle Rechte vorbehalten© 2012 Friedrich Reinhardt Verlag, Basel© eBook 2014 Friedrich Reinhardt Verlag, BaselTitelbild: Willi Facen, www.facen.chISBN 978-3-7245-2013-9
ISBN der Printausgabe 978-3-7245-1854-9
www.reinhardt.ch
Inhalt
März 2011
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
April 2011
4. Kapitel
Ende April 2011
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
11. September 2011
8. Kapitel
9. Kapitel
24. Juli 2011
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
21. Oktober 2011
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
19. März 2012
Peter Zeindler im Friedrich Reinhardt Verlag
Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen ist rein zufällig und vom Verfasser nicht beabsichtigt.
März 2011
Seit drei Tagen beobachte ich diese Frau. Heute folge ich ihr auf Distanz hinunter zum See, wo sie sich auf der Uferpromenade auf eine Bank setzt, scheinbar versunken in den Anblick der orangefarbenen Bojen, die zwischen den mit blauen Planen bedeckten Segelbooten torkeln. Langsam hebt sie den Arm auf Kopfhöhe, greift in ihr schulterlanges, dunkelbraunes Haar und fingert sich mit Daumen und Zeigefinger den einzelnen Strähnen entlang abwärts, bis ihr die letzte Haarspitze entgleitet und die Prozedur von vorn beginnt. Immer wieder. Doch dann unterbricht sie dieses Ritual und wirft einen kurzen Blick auf ihre Uhr, nickt, scheinbar zufrieden, dass die Zeit des Wartens endlich ausgestanden ist.
Sie gibt sich einen Ruck und schwingt ihre schlanken Beine über die Sitzfläche, die auf zwei weit auseinanderstehenden Betonklötzen fixiert ist. Den See im Rücken hebt sie erneut ihren rechten Arm, berührt mit dem Zeigefinger ihre Stirn, dort, wo sie eine Haarsträhne kitzelt, tastet sich dann über die Schläfe nach unten, ihre Fingerspitze verharrt kurz im Mundwinkel und hakt sich endlich in der Halskuhle ein, wo sie ihren dunkelblauen Schal übereinandergeschlagen hat. Dieser bedächtige Bewegungsablauf lässt darauf schliessen, dass ihr Leben nicht hektisch verläuft, dass die Frau in sich ruht, immer wieder Pausen einlegt, in denen sie vielleicht das Stück Leben reflektiert, das sie soeben absolviert hat, und sich dann zurückzieht in ihre eigene Welt, in der sie sich aufgehoben fühlt. Nur ihre abschliessende Kopfbewegung, dieses leichte Anheben des Kinns, den Blick hinaus auf den See gerichtet, dann die leichte Drehung in südlicher Richtung, ins gleissende Sonnenlicht, deuten darauf hin, dass sie noch Sehnsüchte hat. Ihre Art, sich zu bewegen, ist nicht kokett. Vielleicht deshalb, weil sie nicht weiss, dass ich sie beobachte.
Nein, ich bin kein Stalker. Vielleicht wäre «Beschatter» der passendere Ausdruck. Sie ist ja eine Agentin. Das hat sie auf Ihrer Website augenzwinkernd erläutert: «Ich bin die Frau, die Sie suchen. Sie finden mich, wenn Sie jemanden brauchen, der zu Ihnen steht. Sofern Sie mich von sich überzeugt haben. Und dann werde ich andere von Ihnen überzeugen.»
Julia Erler ist Literaturagentin und legt renommierten Verlagen Manuskripte von angehenden oder gestandenen Autoren vor, sofern sie ihren eigenen literarischen Kriterien standhalten.
Ihre rechte Hand verschwindet jetzt in ihrer grossbauchigen Handtasche. Sie kramt darin herum, zieht ein paar zusammengeheftete Blätter heraus und faltet sie auseinander. Ihr Körper versteift sich, als sie zu lesen beginnt. Doch schon bald bricht sie die Lektüre ab, rollt die Blätter wieder zusammen und stopft sie mit einer resoluten Bewegung in die Tasche. Sie wirkt jetzt wie verwandelt. Die Anmut scheint von ihr abgefallen zu sein, hat sich auch schon verflüchtigt, als sie die Zettel überflogen hat.
Diese Veränderung im Ausdruck dieser Frau habe ich in den drei Tagen, in denen ich ihr immer wieder auf Distanz gefolgt bin, schon mehrfach festgestellt. Und jedes Mal packte mich in diesem delikaten Augenblick trostlose Ernüchterung, wurde ich vom hingerissenen Zuschauer zum kritischen Beobachter. Erst wenn ich bis gegen Mitternacht vor ihrem Wohnhaus stehe, immer wieder ihre Silhouette an einem der Fenster im Hochparterre vorbeihuschen sehe und warte, bis das letzte Licht erlischt, finde ich in diese vibrierende, sehnsuchtsvolle Stimmung zurück, in der mich alle Vorbehalte wieder verlassen und ich mich in ihrer Nähe aufgehoben fühle. Dann kehre ich glücklich und hoffnungsvoll ins Hotel zurück, in dem ich für vier Nächte abgestiegen bin, und schreibe wie im Rausch an meinem Roman weiter, bis es vom fernen Kirchturm her drei Uhr schlägt. Um acht Uhr morgens lasse ich mich wecken; denn ich will rechtzeitig wieder zurück sein, wenn meine Muse die Fensterläden ihres Schlafzimmers öffnet, das Fenster aufreisst, sich weit hinausbeugt, dreimal tief Atem holt und den Kopf schräg hält, als ob sie auf ein bestimmtes Geräusch warte, auf eine Vogelstimme vielleicht. Bisher habe ich nie einen zweiten Kopf, den eines Mannes, an ihrem Schlafzimmerfenster gesehen. Das ist beruhigend. Eine halbe Stunde später sitzt sie nahe am Fenster in ihrem Arbeitszimmer am Schreibtisch, Ich weiss, dass es ihr Arbeitszimmer ist, weil ich einen Ausschnitt davon im Internet gesehen habe.
Julia dreht langsam den Kopf, steht auf und entfernt sich in Richtung Stadtzentrum, bleibt dann aber noch einmal stehen, schaut sich um, hebt die rechte Hand, winkt einem etwas gebeugt gehenden älteren Mann zu, der ihr entgegenkommt, umarmt ihn flüchtig und zieht ihn dann mit sich fort. In diesem Augenblick stürzt sich ein Schwarm von Möwen auf die Bank, wo Julia zuvor gesessen hat, lässt sich flügelschlagend kurz nieder und stiebt dann wieder in alle Himmelsrichtungen auseinander. Nur ein einzelner Vogel bleibt zurück und würgt ein vergessenes Stück Brot in sich hinein. Wind ist aufgekommen; eine Polizeisirene zerstört die Idylle. Die Möwe hebt schreiend ab.
Hat der schon etwas angegraute Mann, mit dem Julia Erler an diesem Nachmittag im März am See verabredet war, sie als zukünftiger Autor in ihrem Stall zu überzeugen vermocht? Noch gibt es keine Anzeichen, die dafür sprechen. Mir fällt auf, dass beider Schrittrhythmus nicht synchron ist. Er bewegt sich im Synkopentakt auf ihrer rechten, der «falschen» Seite, was wohl für einen Mann seines Alters, aufgewachsen in einer Zeit, in der noch Wert auf korrekte Umgangsformen gelegt wurde, nicht selbstverständlich ist. Und er macht auch keine Anstalten, scheinbar zufällig oder absichtlich, nach ihrer Hand zu greifen oder sich bei ihr unterzuhaken, was darauf schliessen lässt, dass kein Vertrauensverhältnis zwischen ihnen besteht.
Ich folge den beiden auf Distanz. Der Mann redet auf Julia Erler ein. Seine Armbewegungen werden immer hektischer, und oft bleibt er stehen, entweder, um Atem zu holen, oder, um sie zu einer frontalen Konfrontation zu zwingen, hat sie doch die ganze Zeit nur geradeaus geschaut, schien die Zwillingstürme des Grossmünsters im engeren Blickfeld zu haben. Doch seine Versuche scheitern; sie geht unbeirrt weiter, auch wenn er stehen bleibt und er sich beeilen muss, um sie wieder einzuholen. Später, als sie in der Nähe der grossen Strassenbahnhaltestelle am Bellevue die Fahrbahn überqueren, wirkt sie etwas verkrampft. Fürchtet sie sich vor dem Augenblick, wenn ihr der Mann im Restaurant gegenübersitzen wird und die Möglichkeit, seinen Blicken auszuweichen, eingeschränkt ist?
«Ich bin die Frau, die Sie suchen. Sie finden mich, wenn Sie jemanden brauchen, der zu Ihnen steht. Sofern Sie mich überzeugen. Und dann werde ich andere von Ihnen überzeugen.»
Ja, ich möchte Julia Erler von mir überzeugen. Die Frau fasziniert mich. Sie ist ungefähr in meinem Alter, irgendwo zwischen Anfang und Mitte vierzig. Ich möchte von ihr entdeckt werden. Doch ich werde jeden persönlichen Kontakt zu ihr meiden, bis sie mein Manuskript gelesen hat. Ich will sie beobachten, so lange, bis sie mir vertraut ist und jede Befürchtung, was ihr Engagement betrifft, von mir abgefallen ist. Deshalb möchte ich ihr nicht gegenübersitzen, wenn sie meinen Text zum ersten Mal liest. Ich kann mir vorstellen, wie sie reagieren wird: Zuerst würde mir wohl dieser Ausdruck freudiger Erwartung in ihrem Gesicht auffallen, der sich aber schon bald verflüchtigt, wenn sie sich zum ersten Mal im Text verhakt, noch einmal Anlauf nimmt, die Augenbrauen zusammenzieht, die Lippen schürzt und fast unmerklich den Kopf schüttelt. Und sollte sich diese Reaktion auf jeder Seite wiederholen, sie irritiert zurückblättert, kurz den Blick hebt, scheinbar verwundert registriert, dass der Autor des Manuskripts ihr gegenübersitzt, sich zu einem kurzen Lächeln zwingt, den Blick wieder senkt, entspannt weiterliest, bis sie ein nächstes Mal ins Stocken gerät, ist der Faden endgültig gerissen. Und wenn sie dann resolut einen Bleistift zückt, eine Textseite mit wilden Wellenlinien versieht, Ausrufezeichen setzt, weiss ich sicher, dass die Liebe bereits verhagelt ist, bevor sie aufkeimt.
Immer wieder frage ich mich, warum sie Literaturagentin geworden ist. Sicher hat diese Berufswahl mit ihrer Biografie zu tun. Sollte ihr Vater die dominierende Figur in der Familie gewesen sein, haben es Männer wohl schwerer als Frauen, ihren Ansprüchen zu genügen; entweder weil der Vater noch immer das Mass aller Dinge ist, oder weil sie sich endgültig von seinem Schatten befreien will. Oder steht sie noch immer unter dem Diktat einer fordernden Mutter, deren Gesichtszüge sie jeden Tag wiedererkennt, wenn sie in den Spiegel schaut, und denen sie dann mit einer Grimasse zu entkommen versucht?
Als ich ein paar Minuten später das Restaurant betrete, in dem die beiden verschwunden sind, sehe ich sie schweigend in einer Nische sitzen. Sie thront auf ihrem Stuhl wie eine Herrscherin, mit dem Rücken zur Eingangstür. Er hockt etwas gebeugt da, ein Glas mit Weisswein vor sich, das er mit beiden Händen umklammert hält. Sie hat einen Eistee bestellt, was darauf schliessen lässt, dass sie an einem gemütlichen Zusammensein nicht interessiert ist. Die Atmosphäre ist distanziert. Ich entdecke einen freien Tisch in ihrer Nähe, von wo aus ich beide von der Seite beobachten kann.
Ist der Mann einer, der im fortgeschrittenen Alter noch einen letzten verzweifelten Versuch startet, als Autor von einer grösseren Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden? Ein Überlebenskonzept? Vielleicht, um sein gelebtes Leben aufzuwerten? Oder will er einfach nur zur Ruhe kommen, den inneren Frieden finden, sich seine Geschichte von der Seele schreiben? Vielleicht findet er sich in der heutigen Welt, in der die Jungen permanent auf Empfang geschaltet sind und umgehend ihre eigenen kurzen Botschaften, oft stillos und in Mundart, absenden, nicht mehr zurecht. Er fühlt sich möglicherweise einsam; vielleicht hat ihn seine Frau verlassen oder sie ist schon gestorben. Und nachdem er im Internet Julia Erlers Angebot gelesen hatte, liess er diese Frau nicht mehr los, und ihr gelang es nicht, sich seiner zu entledigen, obschon sie schon sehr bald festgestellt hatte, dass er ihren literarischen Kriterien nicht genügte und keine Chance bestand, ihn in einem halbwegs bekannten Verlag unterzubringen.
Ich erinnere mich an meinen ersten, gescheiterten Versuch, einen Roman zu schreiben. Er spielt in vergangener Zeit, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Die ersten Sätze, über die ich nie hinausgekommen bin, kann ich noch immer auswendig zitieren: «Die alte Dampflokomotive ratterte durch die Landschaft. Paul stand breitbeinig in der Toilette über dem dunklen Loch, unter dem die Schwellen der Schienen und die Schottersteine vorbeiflogen, und er starrte den letzten müden Tropfen nach, die sich aus seiner Blase quälten und dann träge in die Schüssel krochen, sich auflösten und im Nirgendwo verschwanden.»
Diese Sätze wirken etwas künstlich, melodramatisch. Kein zündender Anfang für einen Roman.
Wenn ich jetzt die Köperhaltung des Mannes betrachte, völlig spannungslos, in sich zusammengesunken, könnte ich mir vorstellen, dass er sich mit der Idee eines Liebesromans an sie gewandt hat, die sie ihm gleich wieder ausredete. Alterserotik sei nicht gefragt. Und es sei aussichtslos, den literarischen Erstling eines Mannes in seinem Alter in der Literaturszene durchboxen zu wollen.
Reine Spekulationen. Ich werde vielleicht später einmal versuchen, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen, ohne meine Identität preiszugeben. Ich weiss ja, wer er ist. Zumindest ansatzweise, seit ich seinen Namen kenne und im Internet recherchiert habe. Er hat Germanistik studiert, war Gymnasiallehrer, später war er auch an der Volkshochschule als Dozent tätig. Er wirkt etwas zwanghaft in seinen Bewegungen. Vor allem fallen mir seine wiederholten Versuche auf, seine Brillengläser mit einem blütenweissen Taschentuch in regelmässigen Abständen zu reinigen, erfolglos, denn jedes Mal, wenn er die Brille gegen das Licht hält, schüttelt er den Kopf und zückt das Taschentuch erneut.
Er hat offenbar noch nicht resigniert. Er verfolgt sie weiterhin. Ist es jetzt nur noch die unerwiderte Liebe, die ihn auf Trab hält, oder hat er doch noch Hoffnung, dass sie sich für ihn als Autor zu interessieren beginnt? Heute scheint eine endgültige Entscheidung anzustehen. Sie hat ihren rechten Arm auf dem Tischchen abgestützt und deckt mit den Fingern ihre Mundpartie ab. Jetzt nimmt er wohl einen letzten Anlauf, um sie von sich zu überzeugen; vorgebeugt, in Angriffshaltung artikuliert er ein einziges Wort im Zeitlupentempo. Ich starre auf seine Lippen. Der Mund ist jetzt ein wenig geöffnet, die Mundwinkel zeigen leicht nach unten. Ein bisschen dümmlich sieht er aus, doch umgehend wird dieser unentschiedene Ausdruck, auch Verachtung spielt hinein, von einem flüchtigen Glücksmoment abgelöst. G wie Glück! Ein erlöstes Lächeln, dann presst er die Lippen wieder zusammen, ihre Spannung lässt erneut nach, macht Erstaunen Platz, und schon befreit sich ein flacher rauer Luftstoss aus dem blockierten Kehlkopf: «T A – G E – BUCH!»
Er hat wohl darauf verzichtet, einen Roman zu schreiben. Jetzt will er schreiben, wie es ist. Wie es war. Oder: Wie ihm zumute ist. Oder wer er sein möchte. Und er möchte von früher erzählen. Stoff genug hat er ja wohl.
Die Agentin kann diesem literarischen Genre offensichtlich nichts abgewinnen. Da gehe ich mit ihr einig. Die Zeit der Konfessionen und aufrichtigen Bekenntnisse sei zu Ende, habe ich gerade gestern in einem Zeitungsartikel gelesen: Das Journal entpuppe sich als Ort der schockartigen Begegnung mit einem fremden Ich. Und der Schreibende nehme entsetzt zur Kenntnis, dass fremdes und scheinbar authentisches Ich nicht zur Deckung gebracht werden können.
Sie beugt sich vor und redet auf ihn ein. Hält sie ihm einen Vortrag, erinnert sie ihn an Walter Benjamins Credo, das Wort «Ich» nie zu gebrauchen, ausser in Briefen?
Der Alte ballt die Faust, schüttelt den Kopf. Immer wieder. Jetzt lächelt sie. Es ist kein glückliches Lächeln.
«Keine Selbstdarstellungen!»
Ich lese diesen Befehl von ihren Lippen ab. Vielleicht fügt sie auch hinzu, dass Ratlosigkeit kein Antrieb sei, um Literatur zu schaffen.
Ich weiss nicht, ob sie das alles sagt. Vielleicht sind mir auch nur Passagen aus einer Abhandlung im Kulturteil der «Neuen Zürcher Zeitung», den ich kürzlich gelesen habe, in den Sinn gekommen.
Er klappt den Mund auf, seine Oberlippe ist leicht gekraust, die Mundhöhle glänzt feucht. Mit weit aufgerissenen Augen schaut er sie an. Er hat nichts mehr zu verbergen; seine Biografie, seine Erinnerungen, haben ihn wie eine Tsunamiwelle überrollt. Und wenn er diese Naturkatastrophe auch scheinbar mit viel Glück überlebt hat, so sitzt er jetzt wohl auf den verseuchten Trümmern seiner Welt und versucht, sie neu zu ordnen.
Ich erinnere mich an einen alten Freund, einen Maler, der damit begonnen hatte, all seine frühen Bilder zu korrigieren. Es war vor allem der Schatteneinfall in den Bildern von damals, der seinen Ansprüchen nicht mehr genügte: Er eliminierte die schwarze Farbe, mit der er immer wieder gearbeitet hatte, und ersetzte sie durch eine Mischung verschiedener Blautöne. Er machte ein Stück seiner Geschichte als Künstler rückgängig, war offensichtlich damit beschäftigt, das Bild, das die Nachwelt von ihm haben würde, zu korrigieren, wollte seiner Biografie mit künstlerischen Mitteln auf den Leib rücken.
«Keine Selbstdarstellungen!», hat Julia Erler gesagt.
Das Lächeln, mit dem der Mann, der ihr gegenüber sitzt, dieses abschliessende Urteil quittiert, passt nicht zu seiner verkrampften Körperhaltung. Ein Versuch, die Situation ironisch zu unterlaufen? Oder forscht er verzweifelt nach Situationen in seinem mittlerweile unerheblichen Alltag, die zwar privaten Charakter haben, aber, eindringlich formuliert, einzelne Leser wachrütteln, einen Wiedererkennungsprozess auslösen und den Autor in seiner Arbeit und Weltsicht bestätigen könnten? Aber vorläufig hat die grosse Öffentlichkeit diesen Mann als Schriftsteller noch nicht wahrgenommen. Und es ist anzunehmen, dass sie sich auch zukünftig nicht für die etwas skurrilen Gedankengänge dieses Einsiedlers interessiert. Nur die Öffentlichkeit, die Literaturkritik, könnten ihn zum Schriftsteller machen. Und diese Öffentlichkeit sucht er wohl jetzt. Umsonst.
Der junge Kellner stellt ein zweites Glas Weisswein auf den Tisch, verbeugt sich andeutungsweise, nickt der Frau strahlend zu, schenkt dem männlichen Gast ein ironisches Lächeln und entfernt sich mit durchgedrücktem Kreuz, als hätte er soeben einen Sieg errungen. Der Mann steht hastig auf. Er presst die Lippen zusammen, murmelt eine Entschuldigung, dreht sich um und geht mit hastigen Schritten auf die Tür zu, die zu den Toiletten führt. Ob er noch rechtzeitig dort ankommt?
In seiner Gestik, in seinem ganzen Verhalten erinnert er mich an einen Onkel, weckt er in mir die Erinnerung an ein Stück Familiengeschichte. Es ist, als hätte er sich in meinen Roman verirrt, als wolle er die Rolle des Protagonisten übernehmen, für die ich meinen Onkel vorgesehen habe. Dessen Leben habe ich aus seinem Tagebuch, aus Gesprächen, denen ich immer wieder gelauscht hatte, und aus Äusserungen seines Hausarztes, neu zusammengesetzt und für meine Zwecke eingerichtet. Er war ein Mann, der ein grosses Geheimnis mit sich trug, eine Künstlerseele, die sich nur als Plagiator verwirklichen konnte, einer, der unter lebenslänglicher Vormundschaft stand. Dieser Onkel war für mich eine Art Vaterersatz gewesen. Inzwischen ist er tot. Ich habe ihn zu neuem Leben erweckt.
Für heute habe ich genug gesehen. Ich bin jetzt endgültig überzeugt, dass ich dieser Frau mein Romanmanuskript anvertrauen werde. Ich werde persönlich den Postboten spielen und ihr meinen Text in den Briefkasten schieben. Nicht den ganzen Text aufs Mal. In Raten. Ich könnte ihr ja das Manuskript per Mail zuschicken. Aber ich möchte mich nicht der Phantomwelt des Internets ausliefern. Die Phantasie ist nur so lange unangreifbar, wie sie sich nicht in einer künstlerischen Form einzunisten versucht.
Ich werde meine Identität erst zu einem späteren Zeitpunkt preisgeben, dann, wenn ich ihr auch diese, meine persönlichen Aufzeichnungen, die ganz ohne literarischen Anspruch sind, nachliefere.
1. Kapitel
Das Gesicht des Mannes in Weiss drückte Erstaunen, Begeisterung und Besorgnis zugleich aus. Er fixierte den Monitor, schloss dann das linke Auge wie ein Schütze, der über Visier und Korn sein Ziel sucht, schüttelte den Kopf, immer wieder. Endlich senkte er den Blick und betrachtete wohlgefällig den Unterleib seines Patienten, der mit angehaltenem Atem die Diagnose erwartete. Wagner hatte sich auf Empfehlung seines Basler Hausarztes entschlossen, sich in Zürich, bei Doktor Blarer, untersuchen zu lassen: «Ein alter Studienkollege, Freund, eine Kapazität!»
«So etwas habe ich noch nie gesehen! Einmalig!», sagte die Kapazität. Begeisterung schwang in Dr. Blarers Stimme mit.
«Einmalig!» Das war noch immer kein medizinisch überzeugendes Urteil. Der Arzt brauchte wohl Zeit, bis er sich wieder gefasst hatte. Jetzt schaute er verklärt, als ob er soeben eine weltverändernde wissenschaftliche Entdeckung gemacht hätte. Noch immer ruhte das Ultraschallgerät mit der feuchten Sonde oberhalb von Karl Wagners Penis, der schlaff und unerheblich dalag. Wagner erinnerte sich an ein frühes Foto, das sein Vater aufgenommen hatte: Der gefeierte Stammhalter des Geschlechts der Wagner, acht Wochen alt, lag rücklings auf dem Wickeltisch, mit geöffneten Beinen, das scheinbar, im Vergleich zum kleinen Körper überdimensionierte Geschlechtsteil, designierter Garant des Überlebens der Familie, ungeschützt dem fotografierenden Vater dargeboten. Es war diese Dokumentation, die verpflichtete. Eine uneingelöste Hypothek. Wagner war nie Vater geworden – mindestens offiziell nicht.
«Ihre Blase erinnert mich an die Antike – ich weiss nur nicht, weshalb. Sie wirkt so archaisch.»
Dieser unvermittelte Ausflug in eine historisch weit zurückliegende Ära kam überraschend und traf Wagner an einer neuralgischen Stelle seiner Biografie, nur naheliegend, dass ihm seine Assoziationen umgehend Gustav Schwabs Standardwerk «Die Sagen des klassischen Altertums» aufdrängten. Dieser Band hatte ihn in seiner Jugend wie ein dräuender Schatten begleitet, war ihm vom Vater, dem eine umfassende Allgemeinbildung alles bedeutet hatte, aufgedrängt worden.
«Schauen Sie!», befahl der Halbgott in Weiss und zeigte mit spitzem Finger auf den Monitor.
Karl Wagner sollte jetzt also fernsehen. Wie fern? Nach vorn oder zurück?
«Das ist ja wie zu Hause vor dem Bildschirm», murmelte er ausweichend; er wollte Zeit gewinnen.
«Ja, ein bisschen wie eine Tele-Vision», lächelte Doktor Blarer und trennte mit scharfem Schnitt das Subjekt in zwei Teile. «Ich habe ihre Blase gescannt, und die Sonde erzeugt ein zweidimensionales Schnittbild. Das ist das sogenannte Echo-Impuls-Verfahren.»
Wagner drehte den Kopf und betrachten seine Blase, die gar nicht so aussah, wie Blasen in seiner Vorstellung aussehen sollten. Seine Blase hatte Seitengänge, Nischen, Narben. Sie erinnerte eher an ein Labyrinth, statt an ein kompaktes Gebilde.
«Echo? Alles kommt zurück, was man von sich gibt? Verzerrt? Verstümmelt?»
«So stellt es sich der Laie vor. Wir wissen es besser!» Wieder klang Stolz in Blarers Stimme mit, als ob er der Erfinder dieses zerklüfteten Gebildes, Wagners Blase, sei. «Diese Verzweigungen in ihrem Innern. Mysteriös. Geheimnisvoll. Aber keine Sorge: Wir sind der Sache auf der Spur.»
«Dafür bin ich Ihnen dankbar, Doktor», murmelte Wagner. «Ein Labyrinth! Und da hockt Minotaurus, das Ungeheuer in Gestalt eines Menschen, ein bisschen Mensch, ein bisschen Stier, Gefangener des Labyrinths.»
«Respekt!», antwortete Doktor Blarer. «Ich habe eigentlich an die Hölllochgrotten gedacht. Oder irgendwo an Frankreichs Küste gibt es auch solche Höhlenformationen, vielfach verzweigt, in denen man sich verirren kann. Aber Sie denken in die richtige Richtung: Minotaurus – ein Mensch mit dem Kopf eines Stiers?»
«Der Alte hat ihn dort eingesperrt.»
«Und der unterirdische Fluss? Was war mit dem?»
Wagner zitierte, ein Versuch, diese bedrohliche Situation auf Distanz zu halten.
Die Sätze flossen ihm widerstandslos von den Lippen:
«… voll gewundener Krümmungen, welche Augen und Füsse verwirrten. Die unzähligen Gänge schlangen sich ineinander wie der verworrene Lauf des Flusses Meander, der im zweifelnden Gange bald vorwärts, bald zurück fliesst und oft seinen eigenen Wellen entgegenkommt.»
Der Arzt war sichtlich beeindruckt.
«Herr Wagner, Ihre Bildung möchte ich haben. Ihr Vergleich ist überzeugend und zutreffend. Natürlich: der Fluss Meander! Aber Sie sind ja Maler. Ich habe Ihr Angebot im Internet gelesen. Wie wärs mit uns? Würden Sie mich porträtieren? Gegen Bezahlung selbstverständlich. Geschäft und Gegengeschäft.»
Wagner nickte ohne Überzeugung. Er starrte noch immer auf den Monitor.
Blarer lachte laut heraus: «Da, schauen Sie! Kleine sackartige Ausbuchtungen in Ihrer Blase. Das sind Divertikel – lateinisch Diverticulum, Diverticula.»
Wieder lachte er laut heraus. Wagner zuckte zusammen. Doch er schwieg. Er wartete noch immer auf die Diagnose. Der Arzt liess sich Zeit.
«Ihr Fluss Meander hat sein Bett verlassen, Herr Wagner. Der Weg nach aussen jedoch ist ihm verbaut. Er meandert. In Ihrem Innern. Ja!»
Doktor Blarer wirkte glücklich: «Er sucht sich neue Wege. Er schafft sich freie Bahn. Er versucht, auszubrechen. Mit Gewalt. Er ufert aus.»
Der Urologe steigerte sich in einen wortschöpferischen Rausch hinein.
Ärzte!, dachte Karl Hypolit Wagner.
Er erinnerte sich an ehemalige Kollegen aus der Volksschule, die später den Arztberuf ergriffen hatten. Heinrich, der Sohn eines Milchmanns, ein etwas grobschlächtiger, lauter Junge, war Internist mit eigener Praxis auf dem Land geworden, und in seiner Freizeit hatte er sich als Präsident der Bibliothekskommission seiner Gemeinde kulturell zu profilieren versucht. Erich, fett und vulgär, Abkömmling eines Hufschmieds, hatte sich später nicht nur als Orthopäde einen Namen gemacht, sondern auch als Saxofonist und Leader einer Amateur-Jazzband. Und Otto, ein unscheinbarer, schwächlicher, strohblonder Junge aus der Parallelklasse, dessen Vater Schulhauswart gewesen war und der sich beim gemeinsamen Duschen nach dem Turnunterricht immer mit einer Hand sein Geschlecht abgedeckt hatte, später als Gynäkologe der Schwarm vieler Frauen, besuchte in seiner Freizeit nicht nur Volkshochschulkurse über Philosophie mit Schwerpunkt Kant, sondern wurde gleichzeitig begeisterter Anhänger des Zen-Buddhismus und pflegte seine Ferien abwechslungsweise in schweizerischen und bayerischen Zen-Klöstern meditierend zu verbringen, wie Wagners grosse Liebe Monika.
Diese drei Fälle aus Wagners Jugend, von denen er die These ableitete, dass die Mehrheit der Ärzte aus eher bescheidenen Verhältnissen stammten, den Arztberuf als Befreiung aus ihrem sozialen Umfeld begriffen und eingedenk dieser Herkunft später ihren Status als Halbgott in Weiss durch kulturelles Engagement zu adeln versucht hatten, wurde durch weitere Beispiele aus seinem späterem Bekanntenkreis erhärtet: Es gab da einen Facharzt für Lungenkrankheiten, der einen Lyrikband im Selbstverlag herausgegeben hatte, einen Anästhesisten und Aquarellmaler in Personalunion, der jährlich zu einer Ausstellung in seinen Privaträumen einlud und einen Hals-Nasen-Ohrenspezialisten, der sich mit afrikanischer Kunst beschäftigte.
Von Doktor Blarer wusste Wagner nur, dass dessen Vater als Abwehrchef die Verteidigung eines prominenten Fussballclubs in der Westschweiz dirigiert hatte. Die Urkunde, die in Doktor Blarers Wartezimmer in Gold gerahmt über dem Zeitschriftenregal an der Wand hing und auf der dem Praxisinhaber bescheinigt wurde, dass er mit dem Thema «Spezifische Sportverletzungen von Fussballern» promoviert habe, zeugte wohl von dieser väterlichen Prägung.
Dass Doktor Blarer später von der Sportmedizin zur Urologie gewechselt hatte, mochte auch mit dessen Bedürfnis zu tun haben, in neue ursprüngliche Dimensionen vorzustossen. Aber was hatte ihn dabei geleitet? Sein Wunsch, zur Quelle menschlicher Existenz vorzudringen, dorthin, wo die Wasser entsprangen, die all das wieder konzentriert aus dem Körper abtransportierten, was ihm vorher zugeführt worden war? Oder war es die Sexualität, die ihn gereizt hatte, wollte er dem mysteriösen Funktionieren oder Nichtfunktionieren dieses im Ruhezustand wenig ansehnlichen Fortsatzes des männlichen Unterleibs auf die Schliche kommen? Aber dazu hätte er ja vielleicht auch noch eine zusätzliche Ausbildung als Psychologe absolvieren müssen. Naheliegend war, dass er sich auf dem Umweg über seine eigentliche Doktorarbeit, in der er wohl auch die Sensibilität des männlichen Geschlechtsteils von Fussballern im Zusammenhang mit überraschenden Balleinschlägen berücksichtigt hatte, über die Wesentlichkeit dieses Organs in mannigfacher Hinsicht klar geworden war. Und die Tatsache, dass seine Praxis florierte, sprach ja durchaus für diesen Entscheid.
Ob Doktor Blarer verheiratet war? Der Gedanke, dass Wagners Prostata beim gemeinsamen Abendessen Gegenstand der Konversation sein könnte, war unerträglich. Überhaupt: Es war nicht anzunehmen, dass Frauen nur im entferntesten an den Details einer Prostatauntersuchung ihrer Männer oder Liebhaber interessiert sein könnten, so wenig Männer sich vorstellen wollten, wie sich Gynäkologen an den intimen Stellen ihrer Partnerinnen zu schaffen machten: ein Tabuthema, das nicht von allgemeinem Interesse war, wohl auch nicht in der Literatur Eingang gefunden hatte.
Doktor Blarer riss ein Stück von einer Papierrolle ab und drückte es seinem Patienten in die Hand. Das Blatt war diskret mit hellblauen Blümchen gemustert und erinnerte Wagner an die Rolle Haushaltpapier in seiner Küche. Die Erde hatte ihn wieder. Er entfernte etwas unbeholfen die klebrige Pampe des Gels von der delikaten Stelle seines Unterleibs, auf der Doktor Blarer das Ultraschallgerät in kunstvollen Wellenbewegungen hatte dahingleiten lassen.
«Doktor, Ihre Allgemeinbildung ist beeindruckend», murmelte Wagner. Es war sein verzweifelter Versuch, dieses Gefühl der Immunität zu konservieren, das durch den Abstieg vom Olymp in die profanen Alltagsregionen infrage gestellt wurde.
Der Urologe lachte einmal mehr lauthals. Ein homerisches Gelächter. Karl Hypolit Wagners Erinnerungspotential wurde wieder aktiviert.
Jetzt standen die Götter, die Geber des Guten, im Vorsaal; Und ein langes Gelächter erscholl, bei den seligen Göttern, Als sie die Künste sah ’n des klugen Erfinders Hephaistos.
Seines Vaters ideelle Hinterlassenschaft war noch immer präsent. Wagner schloss die Augen. Die Leiber seiner Eltern wanden sich über ihm im Netz. Bei Homer hatte Hephaistos seine untreue Gattin Aphrodite zusammen mit ihrem Liebhaber Ares in einem Netz gefangen, das er über seinem Ehebett angebracht hatte. Wagner holte Atem, um Doktor Blarer die Zusammenhänge zu erklären, ohne sich dafür zu rechtfertigen, warum er dabei an seine Eltern gedacht hatte. Aber dieser hatte jetzt offensichtlich genug von den Exkursen in die Antike. Er musste die Initiative wieder an sich reissen. Der Arzt blickte streng und wandte sich dann ab, um die Hände zu waschen. Wagners geballte Faust, darin eingeschlossen das zerknüllte Papier, ruhte auf seinem Bauch. Blarer nahm ihm die klebrige Kugel ab und liess sie in einem aufklappbaren Metalleimer verschwinden.
«Jetzt wollen wir einmal Abhilfe schaffen und diesen meandernden Fluss kanalisieren», sagte er und legte seine rechte Hand, über die er einen Plastikhandschuh gestreift hatte, auf den Unterbauch seines Patienten. Wagner spürte die harten Kanten von Blarers massivem Ehering durch den Plastik an der Vorhaut, als dieser seinen Penis umfasste, um ihn in eine für ihn günstige Position zu bringen. Dann setzte der Urologe mit Zeige- und Mittelfinger vier Akzente auf Wagners Unterbauch: G – G – G – es? Der erste Takt von Beethovens Schicksalssymphonie?
Wagner versuchte krampfhaft, noch einmal antiken Geist zu beschwören, um dem kreatürlichen Schmerz zu begegnen, den der Arzt mit seinem banalen Satz abgekündigt hatte. Er forschte in seinem Bildungsreservoir nach weiteren gehaltvollen Bildern, die ihn vor dem Absturz bewahren konnten, und ausgelöst von der Angst vor den angedrohten Schmerzen, erinnerte er sich an eine toskanische Sommernacht, als sein Vater, um seinen Sohn ein neues Bildungserlebnis zu verschaffen, die Astrologie bemüht hatte. Und als es dem Vater endlich gelungen war, am funkelnden Firmament das Sternbild und Tierkreiszeichen Wassermann auszumachen, hatte er ihm die Geschichte von Ganymed erzählt, der vom Göttervater in diesem Sternzeichen am Himmel verewigt worden war. Den griechischen Namen für Wassermann, Hydrochoos, lieferte er erst später nach. Der Vater erklärte den Wassermann als sein eigenes Leitbild, denn ihm, in diesem Sternzeichen geboren und zudem wohnhaft in Schaffhausen am Rhein, sei das Wasser ja letztlich sein Element, obwohl der Aquarius ja eigentlich ein Luft- und kein Wasserzeichen sei und er den Beruf eines Maschineningenieurs ausübe. Dass Vater Wagner in diesem Zusammenhang den päderastischen Seitensprung des Göttervaters Zeus unterschlagen hatte, erfuhr sein Sohn erst viel später. Für Vater Wagner waren die Götter zwar ausgesprochen paarungswillig, aber nur innerhalb schicklicher Grenzen. Textpassagen, die das Gegenteil anklingen liessen, nahm er nicht zur Kenntnis. Sie entsprachen nicht dem ehernen Weltbild des Akademikers, dessen Stand er überall, wo er auftrat, mit Feuer vertrat. Oder täuschte Karl sich da?
«Lernen, lernen! Darauf kommt es an im Leben. Büffeln! Wenn Du aus der Schule fliegst, wirst du nie ein Akademiker», hatte ihm sein Vater mehr als einmal gedroht. «Akademiker» – die höchste aller Weihen. Nur Akademiker nahmen nach Vaters Überzeugung Einsitz im Olymp. Zwar hatte er es nicht geschafft, Vaters Anspruch zu genügen, trotzdem war er durch diese Prägung auf Zitate sensibilisiert, die ihm im Verlauf seines nicht mit universitären Auszeichnungen gelebten Lebens begegnet waren: «Philosophieren heisst, sterben lernen.» Karl Wagner sah seinen Vater vor sich, wie er zum Bücherregal gegangen war, dort zielsicher einen Band herausgeklaubt und seinem Sohn demonstrativ das Cover präsentiert hatte: Michel de Montaignes: «Essais». Und gleichzeitig hatte er einen Kommentar von Montesquieu mitgeliefert: «Dans la plupart des auteurs, je vois l’homme qui écrit; dans Montaigne je vois l’homme qui pense.» – «Ich denke, also sterbe ich.»
Karl hatte sich später das philosophische Vermächtnis seines Vaters neu zurechtgelegt, hatte Descartes mit Montesquieu gepaart und sich so sein eigenes Lebens- und Sterbemotto geschaffen. Nur Akademiker war er nicht geworden. Und eben auch kein Schriftsteller, wie er es sich gewünscht hatte, sondern Maler, ein Kopist.
Ein stechender Schmerz in der Eichel provozierte einen spitzen Schrei.
«Wir haben es gleich: Es fliesst schon.»
Blarer wirkte jetzt konzentriert. Wie lange her war es doch, seit sein Banknachbar in der Volksschule Karl eines Tages während der Deutschstunde aufgeregt den offensichtlich ersten erwähnenswerten Aufstand seines Penis unter dem dünnen Stoff seiner Turnhose vorgeführt hatte. Karl hatte sich von der Euphorie seines Schulkameraden anstecken lassen, und so hatte er, beschäftigt damit, dagegenzuhalten, die Ohrfeige des Lehrers, der sie beobachtet hatte, kaum gespürt.
Wagner schloss wieder die Augen. Zum ersten Mal war er seinem Vater dankbar für dessen Besessenheit, den heiligen Eifer, mit dem er seinen Sohn mit Allgemeinbildung vollgestopft hatte. Er setzte wieder seine Suchmaschine in Betrieb, als er spürte, wie sich ein undefinierbares Etwas, ein sich windender Wurm, durch seine Harnröhre schob, sich immer weiter, immer tiefer in seinen Unterleib hineinbohrte.
Walle, walle / Manche Strecke / Dass zum Zwecke / Wasser fliesse, Und mit reichem vollen Schwalle / zu dem Bade sich ergiesse.
Das Wassermotiv, das sein Vater bei jeder Gelegenheit beschworen hatte, verschaffte Linderung, Goethes «Zauberlehrling» assistierte. Wagner fühlte sich mit einem Mal erleichtert. Der Blasendruck, der in den vergangenen Tagen immer stärker und unerträglicher geworden war, liess merklich nach. Er stellte sich vor, dass eine gebärende Frau ähnliche Gefühle haben müsse, wie er jetzt. Aber die Prozedur schien kein Ende zu nehmen. Wagners Langzeitgedächtnis wollte nichts mehr hergeben. Sein Bildungsreservoir war erschöpft.
Ach, ich merk’ es! Wehe! Wehe! / Hab’ ich doch das Wort vergessen!
«Heureka! Anderthalb Liter!», murmelte Blarer endlich und hielt triumphierend einen Behälter in die Luft, der mit einer goldgelben Flüssigkeit gefüllt war; er war jetzt Ganymed, der Mundschenk der Götter. Und er war Zeus zugleich. Wagners Erinnerungsvermögen setzte wieder ein. Aber die Antike verweigerte sich ihm, die deutsche Klassik dominierte.
«Das ist ein Rekord!»
Seht er läuft zum Ufer nieder; / Wahrlich! Ist schon an dem Flusse, / Und mit Blitzesschnelle weder/Ist er hier mit raschem Gusse. / Schon zum zweiten Male!/ Wie das Becken schwillt!/ Wie sich jede Schale / Voll mit Wasser füllt.
Wagner beharrte auf Goethe. Er liess Blarer schrumpfen, holte ihn vom Olymp herab und drängte ihn in die brodelnde Küche eines Hexenmeisters. Aber das war nur eine Zwischenstation.
«Ihre Prostata ist fällig, Herr Wagner. Es ist höchste Zeit», sagte der Urologe und stellte den Behälter mit dem Urin, den er abgezapft hatte, beiseite.
Jetzt waren sie beide endgültig wieder in der Gegenwart angekommen. Wagner schwieg. Was hätte er auch antworten können? Er wusste ja, dass ihn auch dieses väterliche Vermächtnis eines Tages einholen würde, vielleicht schon jetzt. Sein Vater war an Prostatakrebs gestorben, still und ohne Aufhebens hatte er sich davongemacht, ohne einen markanten Schlusspunkt zu setzen. Weder Homer noch Goethe hatten ihn bei seinem Exitus sekundiert; seine Allgemeinbildung hatte ihn im entscheidenden Augenblick wohl im Stich gelassen. Jedenfalls deutete sein verbissener Ausdruck auf dem Totenbett in diese Richtung.
«Sie können sich jetzt anziehen.»
Wagner setzte sich auf und wollte die Hose hochziehen, die als unförmige Wurst seine Kniekehle fesselte. Sein Blick fiel auf einen dünnen graugrünen Schlauch, der aus seinem Penis herauswuchs, an dessen Ende ein weisser Kippschalter angebracht war, so wie er ihn zum Aus- und Anknipsen seiner Nachttischlampe benützte.
Doktor Blarers Stimme klang sachlich, die Stimme eines Automechanikers oder die eines Elektrikers.
«Ich habe Ihnen einen Katheter gesetzt. Klemmen Sie den Kippschalter am Ende des Schlauchs unter den elastischen Bund Ihrer Unterhose. Die Methode hat sich bewährt. So scheuert es weniger. Und wenn Sie mal müssen: Einfach auf den Kippschalter drücken. Vorläufig haben Sie noch keinen Grund zur Besorgnis. Vorläufig.»
Vorläufig?
Und dann sass Wagner endlich im Sprechzimmer dem Urologen gegenüber, der ihm seinen Fall ausführlich darlegte. Die Operation sei unumgänglich, aber wegen der akuten Entzündung könne sie erst vorgenommen werden, wenn sich das Organ wieder beruhigt habe. Dies sei nur möglich durch die Einführung eines Katheters, der Herrn Wagner das Wasserlassen sehr erleichtere. In den nächsten Tagen würde der Operationstermin, spätestens in drei Wochen, festgelegt, bis dahin könne sich Herr Wagner frei bewegen. Ja, «frei bewegen» hatte der Arzt gesagt. Wagner war vorläufig auf freiem Fuss: «Auf Bewährung»!
Und die Konsequenzen?
«L’amour sec!»
«Wie soll ich das verstehen?»
«Sprechen Sie kein Französisch? – Trockene Liebe! Compris? Ausgespritzt! Danach ist keine Fortpflanzung mehr möglich. Aber auch keine Angst vor Fortpflanzung. Liebe ohne Frucht und ohne Furcht.»