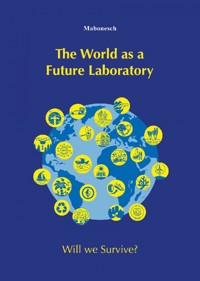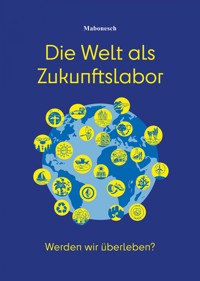
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
«Die Welt als Zukunftslabor» ist das Experiment in der Weltgesellschaft und insbesondere in heutigen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen riesen Funken Hoffnung zu entfachen. Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft. Die Hoffnung, dass wir im Stande sind, die seit der Industrialisierung von uns verursachte Erderwärmung zu stoppen und bestenfalls die 1.5 Grad Grenze nicht zu überschreiten. Dazu werden zahlreiche, vielversprechende Projekte aufgezeigt, die heute weltweit in Angriff genommen oder bereits umgesetzt werden. «Die Welt als Zukunftslabor» zeigt einen Weg auf, wie die Endzeitstimmung überwunden werden und wieder Zukunftsmut in den Menschen entstehen kann. Auch wenn die Natur langsam ihre Geduld mit uns verliert. Weltweit arbeiten unzählige innovative Startups und dynamische Individuen daran, unsere Zukunft lebenswert zu machen. Dabei ist entschiedener Umwelt- und Klimaschutz unabdinglich. Die Politiker der Weltbühne müssen sich ranhalten, damit die gesamte Menschheit ihre Grundbedürfnisse decken kann. Wenn man in knapp dreißig Jahren rund zehn Milliarden Menschen eine Zukunft geben will. Hierfür sind mutige Volksvertreter erforderlich, die Innovationen gegenüber offenstehen, ihre Scheuklappen ablegen und grünes Licht für nachhaltige Projekte geben. «Die Welt als Zukunftslabor» ist kein Ratgeber und auch kein visionäres Buch. Nun gut, ein bisschen visionär vielleicht schon. Es erzählt von meinem Traum einer intakten Umwelt sowie intakten Menschen und den Weg dorthin. Es wird detailliert auf insgesamt ACHT Lösungsvorschläge eingegangen, wie dieser Traum mit unerschütterlicher Disziplin und Leidenschaft verwirklicht werden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Welt als Zukunftslabor
Texte: © MaboneschCovergestaltung: © www.goldmaki.net - Syl Hillier
Verlag:Martina BonenbergerChutzenstraße 67CH-3007 [email protected]
Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
In eigener Sache
Im Sommer 2019 war mein Sohn in Griechenland und mein Partner auf Mission in Nepal. Ich erholte mich von einer erbarmungslos harten Lungenentzündung und war oft müde. Der Fernseher war nah und die Inhalte sinnlos. Deshalb wechselte ich zu Wissenssendungen und Dokumentationen. Sendungen von ARTE, GEO, Galileo und Co. zeigten mir, dass es weltweit viele interessante und hoffnungsvolle Projekte gibt, im Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel. Dank Video-on-Demand konnte ich mein Programm eigenhändig zusammenstellen. Ich hockte also gebannt vor dem Fernseher und machte mir Unmengen Notizen. Endlich hatte ich ein Thema für ein Buch gefunden, das ich eigentlich schon vor zwanzig Jahren schreiben wollte. Gleichzeitig hörte ich wieder vermehrt Musik und bin dabei auf Udo Lindenberg und sein gnadenlos trostloses Video von You Can’t Run Away gestoßen. Die erste Version nannte sich No Future. Lindenberg singt von einem Fünfzehnjährigen, der für sich keine Zukunftsperspektive sieht. Knapp zwanzig Jahre später sieht es auch nicht besser aus. Das Video bestärkte mich dabei dieses Buch zu schreiben. Mitgewirkt hat aber auch die Generation Klimawandel. Also krallte ich mir den Laptop und fing zu schreiben an.
Und wie aus Mist können aus schlechten Tagen fruchtbarer Boden entstehen, auf dem letztlich neue Entwicklungen wachsen
Zeitblüten
Greta Thunberg hat es geschafft und die Weltgesellschaft für den Klimaschutz mobilisiert. Ja, begeistert. Sie handelte aus Verzweiflung. Aus Angst keine Zukunft zu haben. Anders als der junge Mann in Lindenbergs‘ Video, rannte Greta nicht davon, sondern handelte. Es ist schon erstaunlich, wie ein Mädchen ganz alleine Massen dazu bewegen kann aufzustehen. Zu sagen, so jetzt reicht es. Wir wollen eine Zukunft. Schließlich werden wir den von euch verwüsteten Planeten schon bald erben. Ende 2018 wurden viele Medien auf sie und ihr Anliegen aufmerksam. Dann brach ein Riesenhype aus. Viele junge Menschen wurden aktiv. Die Friday for Future Bewegung entstand. Und schon 2019 wählten viele Menschen Grün. Oder rechts. Die globale Aufbruchsstimmung hat auch mich so richtig wachgerüttelt. Da mir bewusst war, dass wir eine Chance auf eine gute Zukunft haben, wenn wir richtig handeln, habe ich mich seit dem besagten Sommer geweigert negativen Gedanken nachzuhängen und lasse mich (meist) nicht mehr ablenken vom allgegenwärtigen Weltschmerz. Sei es durch den Rechtsrutsch in vielen Staaten oder der gruseligen Endzeitstimmung. Auch wenn manche Menschen immer noch der Meinung sind, es werde einen Knall geben und dann sind wir Menschen vom Planeten Erde verschwunden. Und, es muss so sein, weil wir es nicht anders verdient haben. Recht haben sie wahrscheinlich. Wir haben unseren Planeten nicht verdient. Wir haben ihn ausgeplündert und mit Füßen getreten. Aber ich sage, wie Udo Lindenberg schon Anfang der 1980er Jahre, ich mache da nicht mit. Wenn es keine Hoffnung mehr gibt. Was nützen dann noch Lieder? Oder Bücher? Viele Musiker wollen ihre Fans nicht nur unterhalten, sondern motivieren. Die Hoffnung oder den Sinn in ihrem Leben entfachen. Dies ist Udo Lindenberg bei mir gelungen. Trotz der Negativität des jungen Mannes im Video. Nach einer Woche gezielten Medienkonsums, verspürte ich ein unglaubliches Glücksgefühl und entschied mich dieses Buch zu schreiben. Ich möchte auch euch zeigen, dass die Hoffnung auf eine Zukunft gar nicht so abwegig ist. Seit einigen Jahrzehnten ist die ganze Welt ein zu einem Zukunftslabor geworden. Und das ist gut so!
Was erwartet euch?
Dieses Buch ist kein Ratgeber und auch nicht esoterisch oder visionär. Nun gut, ein bisschen visionär vielleicht schon. Es erzählt von meinen Traum einer intakten Umwelt sowie intakten Menschen und den Weg dorthin. Es soll die Weltgesellschaft und insbesondere junge Menschen sachlich darüber informieren, an welchen Projekten – ab Anfang 2019 bis Anfang 2023 - schlaue Menschen arbeiten, um unser aller Überleben und das künftiger Generationen zu sichern. Natürlich bin ich nicht in der Lage in einem Buch über alle Projekte weltweit zu schreiben. Deshalb habe ich Projekte im Rahmen meiner acht Lösungsansätze ausgewählt. Für eine Welt, in der wir unseren Planeten nicht mehr ausbeuten. Ich weiß nicht, ob der prophezeite Knall trotzdem stattfindet. Vielleicht morgen schon? Ich glaube zwar nicht an einen Knall, sondern eher an ein langsames Dahinsiechen. Wenn wir Menschen und unsere Nachfahren noch Jahrhunderte auf dem Planeten Erde leben wollen, müssen wir aufhören uns noch länger mit der Natur anzulegen und gemeinsam auch unser kapitalistisches System überwinden.
Wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Der Erde ist egal, ob es Menschen gibt oder nicht. Die hat Milliarden Jahre ganz gut ohne uns gelebt.
Eckart von Hirschhausen
2020
Wenn Politiker bereit sind ihre Scheuklappen abzulegen, von ihren Kollegen oder von innovativen Startups zu lernen, wie man unsere Umwelt wieder ins Gleichgewicht bringen kann, ist schon eine große Hürde genommen. Da Politiker für uns Menschen wichtige Entscheidungen treffen, sind diese nun an der Reihe die Forderungen der jungen Generation umzusetzen. Den Druck, den junge Menschen mit der Friday for Future Bewegung auf Politiker aus aller Welt ausüben, kommt etwas spät. Doch es ist (noch) nicht zu spät. Wenn auch der letzte Politiker realisiert hat, dass die Uhr tickt kann es Step by Step in Richtung gesunde Menschheit gehen. Die Natur ist unglaublich widerstandsfähig und kann sich schnell erholen. Vorausgesetzt der Mensch mischt nicht mit. Dies belegt die nukleare Apokalypse Tschernobyl in der Ukraine. Für den Menschen eine Todeszone, für die Natur jedoch eine unglaubliche Chance. Wer sich in die Todeszone wagt, erlebt wohl Natur im Urzustand. Wölfe, Füchse oder Rothirsche streifen durch unberührte Wälder in einer Schutzzone der Größe von Luxemburg. Die Menschen sollen durch die Schutzzone vor Radioaktivität geschützt werden. Den Tieren kann diese wohl nur wenig anhaben. Bereits ein Jahr nach der Katastrophe kehrten die Nagetiere zurück. In der Welt der Pflanzen nahmen strahlenresistente Birken den weitgehend abgestorbenen Nadelwald in Besitz. Voraussichtlich und zum Glück, wird das Sperrgebiet dreißig Kilometer um das Kraftwerk herum für den Menschen noch tausende Jahre bestehen bleiben. Jetzt ist die Zeit gekommen uns Menschen zu retten.
Back To The Roots? Oder wie?
Meiner Ansicht nach, müssen wir nicht zurück zur vorindustriellen Zeit, um zu überleben.
Anmerkung: Der Weltklimarat nutzt den Referenzzeitraum 1850 bis 1900 als vorindustrielles Niveau.
Wir können viele unserer heutigen und künftigen technischen Errungenschaften einsetzen, um auf ähnlichem Standard zu leben wie heute. Allerdings muss Nachhaltigkeit noch mehr Beachtung finden. Sicher geschieht nicht alles von heute auf morgen. Doch es existieren bereits viele Tropfen in den Bereichen Umweltschutz, nachhaltige Mobilität, Konsum, Ernährung oder dem Übergang zu sauberen Energiequellen. Wenn es mir gelingt meinen Zukunftsmut auch in euch zu entfachen, habe ich mein Ziel erreicht.
Starke Worte und Bilder können Menschen dazu bringen zu handeln, ambitiöse Taten hingegen, haben die Macht die Welt zu verändern
Mabonesch
Das Problem: Menschengemachter Klimawandel
Die Temperaturen haben sich schon immer verändert und werden es immer tun. Solange der Planet Erde existiert. Auch ohne Menschen. Doch seit wir gierig geworden sind, vollzieht sich der Temperaturanstieg in rasender Geschwindigkeit. Manche Menschen glauben zwar noch immer nicht, dass unsere Aktivitäten Waldbrände, Stürme oder den Verlust der Biodiversität auslösen. Ich weiß nicht, wie sie sich diese Ereignisse erklären.
On n’a qu’une terre
Stress, 2006
Trotz der voranschreitenden Erderwärmung, sehe ich Licht am Ende des Tunnels. Medien abseits des Mainstreams haben mir sehr dabei geholfen zu meiner positiven Einstellung zu gelangen. Die digitale Revolution machte es möglich. Gut recherchierte Artikel aus dem Internet und Filme informierten mich über nachhaltige Projekte, die Hoffnung geben. Weltweit. Mit «Die Welt als Zukunftslabor» möchte ich diese Informationen mit euch teilen. Die ersten sieben Lösungsansätze bauen aufeinander auf. Bei allen Ansätzen versuchen tüchtige Menschen letzten Endes die Erderwärmung aufzuhalten. Das ist auch höchste Zeit. 2020 lag die Erderwärmung bereits bei 1.2 Grad über der Temperatur der vorindustriellen Zeit. Im ersten Kapitel beschreibe ich verschiedene Wege, durch die der Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid (CO₂) gesenkt, gespeichert oder kompensiert werden kann. Die erste betrifft unseren Lebensraum der Zukunft: Die Städte. Beachtung finden Projekte zur grünen Architektur, zu (intelligenten) Waldstädten sowie der innovative und nachhaltige Häuserbau. Das Copyright der Bilder im gesamten Buch befindet sich, aufgrund der Formatierungsvorgaben für ein eBook, bei «Copyright Bilder».
Lösungsansatz EINS
Kohlenstoffdioxid senken, speichern und kompensieren
Grüne Architektur im Kampf gegen den Klimawandel
Mehr Grünflächen für Stadtbewohner
Grünflächen in Städten verbessern das Klima und die Naherholung wird in die Stadt gebracht. Bäume an Straßen helfen unterirdisch dabei den öffentlichen Raum vor Schäden durch Unwetter zu schützen. Zugleich verringern sie die Luftverschmutzung. Forscher*innen vom Massachusetts Institute of Technology haben den Green View Index entwickelt. Bei diesem Index steht der Eindruck den Fußgänger von einer Stadt haben im Vordergrund. Deshalb werden keine Satellitenaufnahmen ausgewertet, sondern Daten von Google Street View. Parks finden keine Beachtung bei der Berechnung. Das Institut hat über dreißig Großstädte berücksichtigt und über das Open-Source Projekt Treepedia veröffentlicht. Die Liste wird von Tampa angeführt mit etwas über sechsunddreißig Prozent Grünflächen. Eine Stadt mit knapp vierhunderttausend Einwohnern an der Golfküste Floridas. Auf Platz zwei folgen Singapur und Breda (Niederlande) mit je rund dreißig Prozent. Schlusslicht bildet Paris mit knapp neun Prozent.
Singapur - Asiens grünste Stadt
Während für europäische Augen stark begrünte, moderne Bauten noch etwas ungewöhnlich erscheinen mögen, gehören solche in Singapur längst zum Stadtbild. In Singapur werden grüne Bauprojekte zur Hälfte staatlich finanziert. Der Stadtstaat gilt im asiatischen Raum schon lange als Vorbild für mehr Nachhaltigkeit im Städtebau. Die Begrünung von Flächen, sogenanntes Green Replacement ist per Gesetz vorgeschrieben. In möglichst allen Gebäuden sollen Pflanzen integriert werden. Neun Prozent von Singapurs Landfläche besteht aus Parks und Naturreservaten. Und dies bei einer Einwohnerzahl von mehr als fünfeinhalb Millionen. Die Stadt der Superlative hat hochfliegende Ambitionen und möchte bald zur grünsten Stadt der Welt werden. Ein spannendes grünes Objekt in Singapur ist der Nebelwald Cloud Forest. Es handelt sich um eine Pflanzenausstellung mit dem weltweit größten Wasserfall in einem Innenraum. Im Cloud Forest befindet sich auch der Flower Dome. Dort werden bedrohte Pflanzen aus aller Welt ausgestellt.
Treescrapers inmitten von Skyscrapers?
Das Projekt OAS1S steht für hundert Prozent grüne Architektur. Hinter dem Projekt steht der niederländische Architekt Raimond de Hullu. Er entwirft begrünte Turmhäuser für Städter, die wieder zur Natur zurückfinden wollen. Die etwas futuristisch anmutenden Häuser nennt de Hullu Treescrapers. Diese sind vollkommen mit Pflanzen bedeckt und stehen vorzugsweise in Stadtparks.
Es sollen müllfreie, energetische und autarke Siedlungen entstehen. Bislang existieren allerdings nur Baupläne der Treescrapers. Obwohl nach der Lancierung der OAS1S Website Projektvorschläge aus aller Welt eingingen. Etwa aus den USA, Brasilien, Belgien, Indonesien oder Deutschland. Sind Treescrapers zu grün, um wahr zu werden? De Hullu sagte mir, die Realisierung der Treescrapers-Projekte gehe derzeit sehr, sehr langsam voran. Hauptsächlich aus Gründen der Finanzierung sowie gesetzlichen Regulierungen. Dennoch ist De Hullu überzeugt davon, dass die Zeit für hundert Prozent grüne Architektur reif ist. Ich denke, es kann nur von Vorteil sein mehr Natur in unseren Wohnräumen zuzulassen und sich als Mensch selbst als Teil des ökologischen Kreislaufs zu sehen.
Der Natur wird in die Städte geholt
Für den Städtebau musste die Natur viel zu lange den Städten weichen. Die Insektenvielfalt nahm drastisch ab. Vor allem weil der Mensch aus Platzmangel in die Höhe baute. Genau hier kommt die vertikale Begrünung des italienischen Architekten Stefano Boeri ins Spiel. Er ist sowohl Visionär als auch Macher. Seine ersten beiden mit Pflanzen bedeckten Hochhäuser stehen in Mailand. Für den sogenannten vertikalen Wald erhielt Boeri mehrere Auszeichnungen. Ein aufstrebender Wald direkt in der Stadt hat viele Vorteile. Pflanzen filtern Feinstaub, geben tagsüber Sauerstoff ab, im Sommer mildern sie die Hitze und im Winter verhindern sie ein zu rasches Abkühlen. Außerdem reduzieren sie den ungehemmten Wasserabfluss in die Kanalisation und damit die Überschwemmungsgefahr der Flüsse. Boeri will die grüne Architektur in die ganze Welt tragen, um in den Städten etwas gegen die Erderwärmung beizutragen. Weitere vertikale Waldprojekte von Boeri sind in Shanghai, Nanjing, Frankfurt, Lausanne und Utrecht geplant oder stehen bereits. Im niederländischen Eindhoven wird das Konzept des vertikalen Waldes erstmals im sozialen Wohnungsbau umgesetzt. Es entsteht ein Wohnkomplex in dem über hundert einkommensschwache Familien auf neunzehn Stockwerken leben werden. Durch solche Projekte sollen die Probleme Wohnungsmangel und Klimawandel in Städten bekämpft werden. Wenn immer möglich werden für Boeris Waldprojekte einheimische und kräftige Bäume ausgewählt. So haben die Pflanzen die bestmöglichen Wachstumsmöglichkeiten.
China: Waldstädte
Heute plant Stefano Boeri auch ganze Städte. Beispielsweise in China. Die erste Waldstadt der Welt befindet sich bereits im Bau. Liuzhou Forest City soll von dreißigtausend Menschen bewohnt und vollkommen mit Sträuchern und Bäumen bepflanzt werden. Vierzigtausend Bäume und fast eine Million verschiedene Pflanzenarten werden kultiviert. Die Energieversorgung erfolgt durch Photovoltaik und Geothermie. Mit diesem Projekt wird eine städtische Siedlung erstmals aus nachhaltiger Energieversorgung, geplanter Biodiversität sowie Verminderung der Luftverschmutzung aufgebaut.
Mexiko: Smart Forest City Cancún
Südlich der Stadt Cancún hat Boeri eine weitere Waldstadt geplant. Auf einer Fläche von knapp sechshundert Hektar sollen 130 000 Menschen wohnen. Inmitten von über sieben Millionen Pflanzen. Gemeinsam mit dem deutschen Unternehmen Transsolar soll die Waldstadt autark werden. Die Energieproduktion läuft über eine Photovoltaikanlage. Die Wasserversorgung erfolgt durch einen unterirdischen Wasserkanal, der direkt mit dem Meer verbunden ist. Dieser Wasserkreislauf ist ein zentrales Element des Projekts und soll für das Thema Kreislaufwirtschaft sensibilisieren. Am Eingang zur Stadt befindet sich ein großes Hafenbecken und ein Turm, in dem das Meerwasser entsalzt wird. Auch die Mobilität in der Smart Forest City Cancún ist nachhaltig. Diese ist ausschließlich elektrisch und mit intelligenten Ladestationen ausgestattet. Gerne hätte ich euch Bilder von Boeris Waldstädten oder einzelnen begrünten Häusern gezeigt. Sie sind einfach fantastisch! Allerdings sind diese nur gegen (viel) Geld zu erstehen. Beispielsweise über Gettyimages.ch. Deshalb schaut doch einfach im Internet nach und lasst euch beeindrucken.
Seattle: Wintergärten auf dem Dach des Amazon Campus
Margaret Montgomery ist eine weitere Architektin, die grün plant. Sie ist Nachhaltigkeitsbeauftragte des globalen Architekturbüros NBBJ in Seattle. Die Abkürzung NBBJ besteht aus dem ersten Buchstaben des Nachnamens der vier Gründer im Jahr 1943. Das Architekturbüro hat die kugelförmigen Wintergärten auf dem Firmenareal von Amazon geplant. Die sogenannten Amazon Spheres befinden sich in der Innenstadt von Seattle und sind Teil des Amazon Geländes. Bis zu 800 Mitarbeiter*innen können in einer mit 40 000 Pflanzen umfassenden Kugel arbeiten. Ein Arbeitsplatz in einer dieser Kugeln ist bestimmt sehr begehrt. Leider muss man auch für die Bilder der Amazon Spheres bezahlen. Auch abseits von grüner Architektur und (Smart) Forest Cities werden weltweit vermehrt städtische Projekte durchgeführt, die bestehende Städte grüner machen. Man denke an Biodiversität, Haltestellendächer oder an die Begrünung von Straßen. Jetzt stelle ich euch ein paar spannende Projekte zum nachhaltigen Häuserbau vor. Vermutlich haben nicht viele Leser*innen vor in solchen Häusern zu leben oder die vorgestellten Materialien zum nachhaltigen Häuserbau zu verwenden. Informieren möchte ich euch trotzdem. Wer weiß, vielleicht werden einige von euch so begeistert sein und beim Hausbau auf Nachhaltigkeit großen Wert legen.
Vereinigte Staaten: Revolutionäre und zukunftsweisende «Erdschiffe»
Das Konzept des sogenannten Earthship wurde bereits in den 1970er Jahren entwickelt. Vom Amerikaner Mike Reynolds. Damals war Umweltschutz und Energieeffizienz noch nicht in aller Munde. Micheal Reynolds:
«Earthships sind Schiffe, die auf dem stürmischen Ozean der Zukunft nicht untergehen».
Die Erdschiffe bestehen fast komplett aus Recycling- und Naturmaterialien. Einzig die Solarzellen auf dem Dach bestehen aus modernen Bauteilen. Durch die Solarenergie haben die Bewohner warmes Wasser zum Duschen oder Abwaschen. Wenn die Energie einmal nicht ausreicht, gibt es zwei Alternativen. Mit einem Holzofen oder einer Gastherme kann das Wasser aufgewärmt werden. Die Häuser sind völlig autark und müssen deshalb auch nicht an ein Versorgungssystem angeschlossen werden. Wie ein Schiff auf dem Meer, kann sich das Erdschiff selbst versorgen. Das nachhaltige Haus ist sehr ausgeklügelt konzipiert.
Auf den Dächern wird Regenwasser gesammelt und in Tanks gespeichert. Durch Filtersysteme wird das Wasser gereinigt. Nur das Trinkwasser fließt durch alle Filter. Es wird kein Wasser verschwendet. Duschwasser etwa wird durch die Pflanzenbeete geleitet, grob gereinigt und fließt danach durch die Toilette. Jedes Erdschiff hat eine eigene Kläranlage. Mikroorganismen reinigen das Abwasser der Toiletten. Das Wasser wird dann für die Bewässerung des Gartens verwendet. Drei Wände der Erdschiffes bestehen aus dicken Wänden. Hergestellt aus der Wiederverwertung alter Reifen oder Dosen. Zu einer festen Wand werden sie durch Materialien wie Erde, Sand oder Lehm. Auch alte Glasflaschen werden in den Mauern verarbeitet. Dadurch kann Licht die Räume auf natürliche Weise aufhellen. Die Häuser sind optimal isoliert. Ein Teil führt ins Erdreich und sorgt für eine konstante Temperatur im Earthship. Die vierte Wand ist eine Glaswand, die immer nach Süden ausgerichtet ist. Durch die Wärme und das Licht entsteht genügend Energie, um den Strombedarf und die Heizenergie auf ein Minimum zu beschränken. Außerdem bauen viele Hausbewohner an der Glasfront Gemüse, Kräuter oder auch Früchte an und können sich damit selbst versorgen. Manche besitzen auch kleine Fischteiche. Für die Innenräume werden nachhaltige Materialien verwendet. Wenn möglich Altholz. Da Unternehmen Earthship ist in New Mexiko ansässig und kann besucht werden. Wer will, kann in einem Earthship übernachten. Reynolds vermietet manche für eine Nacht.
Über das Vorgehen beim Bau eines Earthships kann natürlich der Schöpfer am besten Auskunft geben: https://www.youtube.com/watch?v=8LjHFAbBJr4. Interview mit Micheal Reynolds von 2018. Nach dem Tsunami in Asien (2004) begann Reynolds Earthships nach Naturkatastrophen zu bauen. Heute stehen Häuser in Haiti, Honduras oder auf den Philippinen. Außerdem hat er mit dem Windship ein Wohnkonzept für Taifun betroffene Gebiete entwickelt. Weltweit gibt es heute 3 000 Erdschiffe (Stand 2020) aus dem Hause Reynolds.
Niederlande: Häuser aus Pappe – Wikkelhäuser
Das niederländische Startup Fiction Factory in Amsterdam macht den Traum aus Kindertagen wahr in einem Haus aus Karton zu wohnen. Das klingt nicht gerade stabil. Doch das Unternehmen bewies nach vierjähriger Forschung am sogenannten Wikkelhouse, dass es durchaus möglich ist in einem Haus aus Pappe zu wohnen. Die Wände bestehen aus vierundzwanzig Schichten Pappe. Diese sind aus skandinavischen Bäumen hergestellt und mit einem Naturstoff zusammengeklebt. Anschließend wird die Pappkonstruktion mit Holz verkleidet. Die Hersteller versprechen das Papphaus werde bis zu hundert Jahren halten. Folgende Wikkelhäuser befinden sich auf Helgoland (Deutschland), im Ferienpark De Kleeperstee (Niederlande) und in Chile (Ort nicht bekannt).
Die große Herausforderung lag darin das Haus wind- und wetterfest zu machen. Dazu nutzen die Designer*innen ein wasserabweisendes und dennoch atmungsaktives Membran namens Miotex. Dieses kann man auf die Außenhülle auftragen. Lediglich alle dreißig Jahre muss der Miotex-Film erneuert werden. Die Struktur des Hauses wurde so entwickelt, dass man beliebig viele Bauteile aneinanderreihen kann. Die Fläche des Standardhauses beträgt vierzig Quadratmeter und ist inklusive Inneneinrichtung für 80 000 Euro zu haben.
Wenn man mehr Zimmer benötigt, kann man beliebig viele Bauteile einsetzen. Allerdings ist ein solches Bauteil nicht gerade ein Schnapper. Ein fünf Quadratmeter großes Bauteil kostet 25 000 Euro. Originell ist das Wikkelhouse aber auf jeden Fall. Die zwei offensichtlichsten Vorteile gegenüber konventionellen Häusern sind, dass alle Bauteile vollständig recyclebar sind. Und das Haus innerhalb eines Tages aufgebaut ist. Bis jetzt hat die Fiction Factory über hundert solcher Häuser gebaut und diese kommen vielerorts zum Einsatz. Neben den Niederlanden etwa in Chile, Deutschland, Frankreich oder England.
Lowtech statt High-Tech: Strohballenhäuser
Bereits seit über hundert Jahren werden Häuser mit Strohballen gebaut. Besonders in Nordamerika. Zahlreiche Projekte haben gezeigt, dass man mit diesem Baumaterial gesunde und lange haltbare Häuser bauen kann. Nachhaltig und auch mindestens zwei Stockwerke hoch. Seit mehreren Jahren wächst in Europa das Interesse an eben diesen Häusern. Vermehrt beschäftigen sich auch Architekten mit der ökologischen Bauart. Allerdings stellt sich die berechtigte Frage, wie viel graue Energie verwendet wird bis ein solches Haus fertiggestellt ist. Man denke an die Energie, die für die Gewinnung der Rohstoffe wie Steine oder Beton gebraucht wird. Auch die Herstellung sowie der Transport sind auf Energie angewiesen. Stroh hingegen gewinnt man durch ein landwirtschaftliches Nebenprodukt. Es gibt Vieles zu beachten beim Bau eines Strohballenhauses. Wenn man es aber richtig angeht, trägt man viel zum Umweltschutz bei. Die Pflanze nimmt während ihrem Wachstum CO₂ aus der Atmosphäre auf. Im Vergleich zu den meisten gängigen Baustoffen braucht man ein Vielfaches weniger Herstellungsenergie. Stroh verfügt über sehr gute Wärmedämmeigenschaften. Durch nachwachsende und regional verfügbaren Rohstoffe wie Lehm, Stroh und Holz, kann man sehr umweltfreundlich bauen. Mein Dank, dass ich dieses spannende Baumaterial in das Buch aufnehmen konnte, geht an meine ehemalige Studienkollegin Yvonne. In der Schweiz wurde eine kleine Strohballensiedlung gebaut.
Schweiz: Ein Dörfchen aus Stroh und Holz
Das Architekturbüro Atelier Schmidt aus dem Kanton Graubünden, arbeitet schon länger erfolgreich in der Nische des Häuserbaus mit Stroh. Atelier Schmidt steht für nachhaltiges, autarkes und ökologisches Bauen. Nicht nur in der Schweiz stehen Gebäude des Architekturbüros, sondern auch in Deutschland oder Italien. Der Auftrag für die schweizweit erste Strohballensiedlung kam aus Nänikon im Kanton Zürich. Die Eigentümer in dritter Generation wollten unbedingt eine nachhaltige Überbauung ihres ehemaligen Fabrikareals verwirklichen. Mitten im Dorf und inmitten des alten Baumbestandes entstand die Siedlung im Vogelsang. Die Architekt*innen arbeiteten gemeinsam mit Holzbau-, Bedachungs- und Sanitätsunternehmen aus verschiedenen Kantonen. Die Bauherrin stellte einige Bedingungen auf. Nicht nur die Produktion der verwendeten Baustoffe sollte energiesparend sein, sondern auch der spätere Betrieb der Liegenschaften. Beim Rückbau der Siedlung sollte für einmal kein Sondermüll auf der Deponie landen. Für das Wohlbefinden der künftigen Bewohner setzte das interkantonale Team natürliche Baumaterialien wie Stroh, Holz, Lehm und Kalk ein. Von den insgesamt achtundzwanzig Wohnungen werden elf von der Bauherrin vermietet und die restlichen waren schnell verkauft.
Lebende Häuser - Revolution oder Science Fiction? The Mushroom Man
Phil Ross ist Künstler, Erfinder, Biotechnologe und Amerikaner. Er hat sich auf Biotechnologie im Allgemeinen und Pilzstrukturen für Skulpturen, Inneneinrichtung und Architektur im Besonderen spezialisiert. In der Weltstadt New York aufgewachsen, wollte er eine Verbindung mit der Natur aufbauen. In den 1980er Jahren jobbte Ross in einer veganen Küche. Dort lernte er das erste Mal den Umgang mit Speisepilzen. Später züchtete er Reishi-Heilpilze. Dabei entdeckte er, dass sich das Wurzelgeflecht der Pilze (Myzel) als formbares plastisches Material eignet. Erst stellte er Kunstformen aus dem «Naturbeton» her. Dieser verhärtet sich nach kurzer Zeit, bleibt aber für lange Zeit lebendig und gestaltbar. Ross schuf Möbel, Skulpturen und weitere Kunstwerke und war erstaunt, dass Myzel härter ist als Zement. Ein Ziegelstein aus Myzel kann Zement sogar zermalmen. Um einen Myzel-Ziegelstein zu gestalten, muss das Material in der gewünschten Form eine Woche lang trocknen und danach wird es gebacken. Durch die Hitze werden die Sporen abgetötet und der Pilz wächst nicht mehr weiter. An der Stanford University besetzt Ross einen Gastlehrstuhl für Biotechnologie. Er hält Pilzstrukturen für das Industriematerial von morgen. Also tat er seine Überzeugung bei den Kollegen kund. Doch diese betitelten ihn als Fungus-Freak. Ross aber forschte unbeirrt weiter und ließ seine Idee 2012 patentieren 2013 gründete er zusammen mit Sophia Wang das Startup Mycoworks. Ein paar Jahre später konnte er und sein Team sich von Anfragen kaum mehr retten. Ross meinte dazu:
«Wir sagen das Gleiche wie vor fünf Jahren. Der Unterschied ist lediglich, dass wir heute gehört werden».
Eine spannendes Interview mit dem Mushroom Man findet ihr hier: https://www.youtube.com/watch?v=Ck-IlOeUN8M. Alta Live, 04.08.2021.
Heute werden auch Einwegverpackungen und weitere Produkte aus Myzel hergestellt. Doch dazu mehr beim Lösungsansatz SECHS. An dieser Stelle möchte ich euch aber noch auf die Forschungen der TERRE-formative beziehungsweise Terreform ONE hinweisen. Auf der Website terreform.org findet ihr viele Projekte, wie man Biodiversität und Gebäudebau in Zukunft verbinden will. Etwa in der öffentlichen Kunst, lebenden Häusern, Stadtdesign oder im Gebäudebau. Die Design- und Architekturszene betrachtet Mikroorganismen heute als Möglichkeit zur Verbesserung des menschlichen Wohnraums. Manch ein*e Forscher*in betrachtet die Biotechnologie als nächsten Entwicklungsprozess der industriellen Revolution. Wegbereiter beschäftigen sich mit der Frage, wie man Wohnen nachhaltiger und ökologisch verträglich gestalten kann und gleichzeitig nicht auf Komfort verzichten muss. Da die Urbanisierung in großen Schritten voranschreitet, könnten neo-ökologische Konzepte unseren Wohnraum der Zukunft langfristig verändern.
Kinosnack erhält neue Bestimmung: Häuser dämmen mit Popcorn
Bereits seit über einem Jahrzehnt ist das sogenannte BalanceBoard im Handel erhältlich. Dabei handelt es sich um eine Spanplatte, die aus etwa einem Drittel Popcorngranulat besteht. Diese sind wesentlich leichter als konventionelle Spanplatten.
Der Werkstoff aus Popcorn wurde an der Uni Göttingen entwickelt. Professor Alireza Kharazipour gab sich damit aber nicht zufrieden. Heute stellt er Gegenstände aus hundert Prozent Popcorngranulat her. Kharazipour und sein Team pressen fleißig Popcorngranulat in vorgefertigte Formen und bestreichen diese mit Leim. Das Naturstyropor kann als Dämmstoff, für Trennwände in Büros, Spanplatten, Verpackungen oder auch für Möbel und Spielzeug verwendet werden. Aufgepoppte Maiskörner sind ideal geeignet als Rohstoffe für umweltschonende Verbundwerkstoffe. Forscher*innen untersuchen noch viele weitere Naturstoffe von denen sie hoffen, dass man sie in Zukunft für das Dämmen von Häusern einsetzen kann. Etwa Kork, Jute, Holzspäne, Schafwolle oder Seegras. Allerdings eignen sich die meisten noch nicht für den kommerziellen Gebrauch.
Ein weiterer Weg CO₂ in der Umgebungsluft zu senken ist die Aufforstung. Auch wenn derzeit viele Wälder lodern und dadurch das von den Bäumen absorbierte CO₂ wieder in unsere Atemluft gelangt, ist Aufforstung wichtig. Insbesondere um die Kippunkte aufzuhalten. Aber auch zugunsten der Biodiversität.
Kohlenstoffsenke Wald
Forscher*innen der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich gehen davon aus, dass wir mit 1 000 Milliarden Bäumen die Kippunkte um zehn bis fünfzehn Jahre nach hinten verschieben könnten. Das ist nicht viel Zeit.
Anmerkung: Kohlenstoffsenken oder Kohlendioxidsenken bezeichnen in den Geowissenschaften ein Reservoir, das vorübergehend oder dauerhaft Kohlenstoff aufnimmt und speichert. Kohlenstoffsenken sind dynamisch und wachsen (zum Beispiel aufgeforstete Wälder oder Moorlandschaften). Kohlenstoffspeicher hingegen sind statisch. Soll heißen, die Speicher können eine gewisse Menge an CO₂ binden.
Globale Wiederaufforstung
2019 veröffentlichten Wissenschaftler*innen des Crowther Lab an der ETH Zürich eine Studie für die sie berechneten, welche Fläche Wald weltweit gepflanzt werden müsste, um die Erderwärmung zu stoppen. Laut den Forscher*innen 900 Millionen Hektar Wald. Weltweit. Bestenfalls in Russland, den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Brasilien und China. Bei den berechneten Flächen handle es sich um wirtschaftlich ungenutztes Land. Die Studie wurde allerdings von Wissenschaftler*innen aus aller Welt heftig kritisiert. Die Kritik bezog sich unter vielen anderen Punkten, auf die in der Zusammenfassung gemachten Aussage die globale Aufforstung sei die «effektivste Lösung gegen den Klimawandel». Eine Gruppe von Kommentatoren hält diese Aussage «wissenschaftlich einfach falsch» und auf «gefährliche Weise irreführend». Ein anderer Kritikpunkt war, dass die Vielfalt der Erde nicht ausreichend beschrieben worden sei. Zahlreiche Regionen Afrikas seien für eine Bewaldung ausgewiesen worden, obwohl diese oft dicht von Menschen besiedelt sind. Savannengegenden und Graslandschaften wurden als mögliche Ziele für eine Bewaldung in der Studie aufgenommen. William John Bond, Emeritus Professor an der Universität Kapstadt allerdings hält nichts von Aufforstung, die dort stattfindet wo früher kein Wald stand. Zum Beispiel Neuaufforstung im Grasland oder Savannen Afrikas. Da bin ich ganz seiner Meinung. Damit das natürliche Gleichgewicht wieder hergestellt werden kann, muss man einerseits einheimische Pflanzen nutzen, andererseits wiederaufforsten und nicht neuaufforsten. Nun möchte ich euch ein paar interessante Aufforstungsprojekte vorstellen. Diese werden von Staaten, Organisationen oder Privatleuten durchgeführt.
Alle Freunde dieser Welt, pflanzt einen Baum
dieZwei, Cover Outkast Whole World, 2012
Russland
In Russland gibt es Umweltorganisationen, die sich von der Laissez-faire Haltung in der Klimapolitik distanzieren und eigene Projekte auf die Beine stellen. Russlands Wälder brannten 2021 nicht das erste Mal. Schon 2010 wurden über zwei Millionen Hektar Wald vernichtet. Die junge Russin und heutige Umweltaktivistin Marianna Muntianu, war damals zwanzig Jahre alt und geschockt als sie die Bilder im Fernsehen sah. Vergeblich wartete sie und mit ihr viele junge Menschen darauf, dass irgendjemand die verkohlten Flächen wieder aufforstet. Als aber niemand etwas unternahm, trat Marianna der russischen Umweltschutzorganisation ECA beiund übernahm die Koordination für die Aufforstung in ihrer Heimatregion Kostroma. Mit der finanziellen Unterstützung eines Kosmetikproduzenten sowie einer Vielzahl von Freiwilligen, gelang es der ECA-Bewegung bis 2015 in vierzig Regionen Russlands zehn Millionen Bäume aufzuforsten. Die Arbeit für die russische Umweltbewegung hat das Leben von Muntianu grundlegend verändert. Die Organisation ernannte sie zum Plant a Forest Leader. In dieser Position entwickelte sie eine Kommunikationsstrategie, um in der Bevölkerung das Bewusstsein für das Klima und die Umwelt zu stärken. 2019 veröffentlichte Muntianu das gemeinsam mit ihrem Team entwickelte Handyspiel Plant the Forest. Die Nutzer haben die Möglichkeit auf Brachland virtuell Bäume zu pflanzen und danach vor Feuer und Schädlingen zu schützen. Gleichzeitig können sie Geld an ECA spenden und dadurch echte Bäume pflanzen lassen. Für diesen innovativen Ansatz erhielt die Umweltaktivistin im selben Jahr den Young Champions of the World Award. Dieser Preis wird seit 2017 vom United Nations Environment Programme (UNEP) an junge Menschen vergeben, die sich in besonderem Maße für die Umwelt einsetzen und zwischen achtzehn und dreißig Jahre alt sind. Heute leitet Muntianu den Russian Climate Fund und will bis 2030 eine Milliarde Bäume pflanzen.
Australien
Australien erlebte in der Feuersaison 2019/2020 so verheerende Buschbrände wie noch nie. Menschen starben im Feuer oder standen vor den Trümmern ihrer Existenz. Zu den Opfern gehörten aber auch weit über hunderttausend Nutztiere sowie drei unglaubliche Milliarden Wildtiere. Insgesamt sind rund neunzehn Millionen Hektar Wald abgebrannt. Der World Wide Fund For Nature