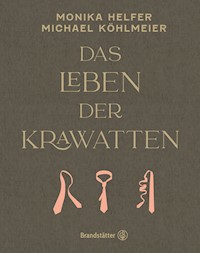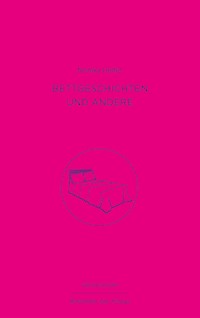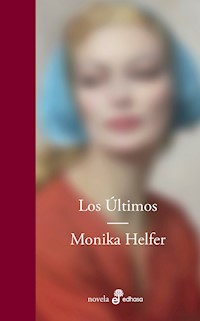Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung u. Jung
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es gibt Geschichten, die uns das Elend der Verunglückten unserer scheinbar ordentlichen Gesellschaft vor Augen führen. Wie soll, wie kann man sie aufrichtig und wahrhaftig erzählen? So vielleicht! Die Schriftstellerin macht eine Entdeckung: Auf dem Friedhof, den sie jeden Tag besucht, hängt ein totes Baby im Geäst einer Thuja. Ist es der kleine Bruder von Samira, den das neunjährige Mächen bei der Polizei als vermisst meldet? Mit ihm, ihrer Mutter Mirjam, Onkel Wolf und seinen Freunden Orang und Utan lebt sie in einer Welt, in der so manches in Unordnung ist, in der die Armen, Elenden und Opfer häuig Kinder sind. Diese Welt kennt auch Inspektor Swini nur zu gut (wäe alles in bester Ordnung, es bräuchte keinen Inspektor). Swini hat Talent zur Tragödie, er wird zu Samiras Beschützer, aber er weiß auch, wie schwer eine Schuld wiegen kann, die einem ein Leben lang keiner abnimmt.Es war einmal – so beginnen nicht selten Geschichten, die alles andere als märchenhaft sind. Das ist auch bei Monika Helfer so. Was sie uns erzählt, erzählt sie uns lakonisch und direkt. Feinfühlig und ohne Sentimentalität, berührend und auf aufrührerische Art heiter. Wer sich von Literatur Empathie und glänzende Sätze erwartet, wird nicht enttäuscht werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Welt der Unordnung
Umschlagbild: Tobias Helfer
© 2015 Jung und Jung, Salzburg und Wien
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-99027-073-8
MONIKA HELFER
Die Welt der Unordnung
Roman
Friede und Unordnung
Das Buch der Weisheit 3, 1–3 – Die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand, und keine Qual kann sie berühren. In den Augen der Toren sind sie gestorben, ihr Heimgang gilt als Unglück, ihr Scheiden von uns als Vernichtung; sie aber sind in Frieden.
Es war einmal ein Baum, der stand mitten auf dem Friedhof. Es war eine Thuja, sie wuchs schmal und hoch, ihr Gefieder war dicht, ein Wichtelmann hätte in ihr wohnen können. Er hätte von Ast zu Ast klettern können wie Tarzan, hätte sich ein Häuschen bauen können mit einem kleinen Balkon und einem Leiterchen; nachts hätte er ein Feuerchen angezündet in seinem kleinen Herd, nur ein winzig dünner Rauch wäre aus dem Kamin gestiegen – das alles wäre den Friedhofsbesuchern unsichtbar geblieben.
Eines Tages aber hing im Geäst der Thuja ein totes Baby. Eine Frau hatte es gefunden, eine Schriftstellerin, die jeden Tag auf den Friedhof ging und manchmal in der Thuja Kerzen versteckte, wenn sie zu viele mitgebracht hatte und sie nicht nach Hause zurücktragen wollte. Das Baby war zusammengebunden und obendrein mit einem breiten braunen Klebstreifen umwickelt, es sah aus wie ein Rugbyball, war oval und war hart, und es hing tief unten, unter dem Versteck für die Kerzen. Ameisen und Käfer krabbelten darüber, auch Schneckenspuren waren zu erkennen.
Die Frau rief mit ihrem Handy die Polizei, sie wartete an Ort und Stelle. Die Beamtin fragte sie, ob sie psychologische Hilfe benötige. Die Frau sagte: »Nein.«
Vermisst
Das Polizeigebäude war erst vor kurzem renoviert worden. Es sah aus wie eine Heil- und Pflegeanstalt.
Ein Mädchen trat durch die Schwingtür, stellte sich vor die Frau dort und sagte: »Ich muss etwas Dringendes melden.«
»Wie heißt du?«, fragte die Frau. »Und wer schickt dich?«
»Ich heiße Samira und komme von allein.«
»Samira und weiter?«
»Zubromawi.«
Das Mädchen trug Jeans und ein kariertes Hemd, das ihr zu groß war. Ihre schwarzen Haare standen ab wie Antennen.
»Was willst du uns sagen?«, fragte die Frau hinter der Scheibe.
»Ich würde gern den Chef sprechen«, sagte das Mädchen.
Es wartete nicht ab, rannte durch den langen Flur, hörte die Frau hinter sich rufen, drückte eine Türklinke, irgendeine, und stand in einem Raum mit vier Polizisten. Ein fünfter Mann lehnte am Fenster und sah auf den Parkplatz hinunter. Er trug keine Uniform.
»Darf ich etwas sagen?«, fragte das Mädchen. Es redete laut und deutlich. Aber die Stimme zitterte ein wenig.
»Jeder darf«, sagte der Mann, der keine Uniform trug. »Was willst du sagen?«
»Ich muss eine Vermisstenanzeige melden«, antwortete das Mädchen.
Der Mann bat es in sein Büro. »Ich bin hier der Inspektor«, sagte er, »und Vermisstmeldungen nimmt meine Kollegin auf.« Er sah das Mädchen lange an. »Ich bin für das Böse zuständig«, sagte er. »Ich bin für das Verbrechen zuständig. Ich wäre lieber für die Vermissten zuständig. Obwohl auch das sehr traurig sein kann. Sehr traurig.«
Das Mädchen hielt seinem Blick stand, sagte aber nichts.
»Wen vermisst du?«, fragte der Mann. »Tun wir so, als wäre ich für die Vermissten zuständig. Das tu ich gern. Versuch, so klar wie möglich zu erzählen. Ich höre dir zu, wenn es nicht zu lange dauert, und dann bringe ich dich zu meiner Kollegin, und du antwortest auf ihre Fragen und erzählst alles noch einmal. Dann kannst du es besser, weil du es schon einmal gemacht hast. Willst du auch eine Cola?«
Er holte zwei Dosen aus dem Kühlschrank in der Ecke und öffnete sie. Das Mädchen trank und sah weiter in die Augen des Inspektors.
»Ich heiße Samira, und ich komme von allein.«
»Willst du jetzt erzählen?«, fragte der Inspektor.
Das Mädchen nickte und erzählte.
»Mein Bruder, der ist erst zehn Wochen alt, ist verschwunden. Er hat noch keinen Namen, weil sich die Mama noch für keinen Namen entscheiden konnte. Wir nennen ihn jetzt noch Poppele. Er ist krank, weil meine Mama krank ist. Ich bin mit Poppele im Kinderwagen durch den Friedhof spaziert, das mach ich oft, da ist es so schön. Es ist ruhig. Eine Schulfreundin hat mir über die Mauer etwas zugerufen, und ich bin schnell zu ihr hin, ich hab Poppele im Kinderwagen stehenlassen. Die Schulfreundin hat gesagt, dass ihr Opa, der eigentlich schon gestorben ist, auf dem Mäuerchen gesessen war, nur jetzt, wie ich gekommen bin, ist er verschwunden. Sie hat es geschworen. Das tut sie sonst nicht. Sie ist nicht plemplem, sie ist ganz normal. Ich glaube so etwas sonst nicht, aber das habe ich geglaubt. Wir haben nicht lang geredet, ich hab ihr nur gesagt, dass sie einen Blödsinn erzählt, obwohl ich das gar nicht gedacht habe, aber ich habe es halt eben trotzdem gesagt, da war sie beleidigt, und ich bin wieder zurück zum Kinderwagen. Der aber war leer. Kein Poppele mehr in dem Wagen. Ich lupfte die Decke, da war nur die kleine Wärmflasche, die wie ein Herz aussieht. Kein Poppele in dem Wagen, nicht eine Spur vom Poppele. Ich bin in unsere Siedlung gerannt und hab den Wagen stehenlassen und hab alle Leute gefragt, die haben nichts gewusst. Meine Mama hat mich angebrüllt, und wir sind zurück zum Friedhof, beide miteinander, die Mama hat geheult, da war auch der Wagen nicht mehr da. Darum bin ich zur Polizei.«
Der Inspektor sagte: »Es ist gut, Samira. Es wird sicher alles gut. Sicher wird alles gut. Bestimmt wird alles gut.«
»Muss ich jetzt zu der Frau gehen von der Vermisstenanzeige?«, fragte das Mädchen.
»Nein, das musst du nicht«, sagte der Inspektor. »Das musst du nicht. Es wird bestimmt alles gut. Alles wird gut, Samira.«
»Das haben Sie schon gesagt«, sagte das Mädchen.
»Ich sag es so gern«, sagte der Inspektor. »Ich sage es manchmal einfach so. Stell dir vor, Samira, ich wach manchmal am Morgen auf und sage es. Nur weil ich es so gern sage.«
Alles wird gut, Inspektor!
Du musst dem nachgehen, du musst dir das alles anhören, denn du bist der Inspektor. Du musst aufklären. Du musst dir das ansehen. Aber es wird alles gut. Du musst nicht für immer bodenlos unglücklich sein. Du wirst unter dem Federngebirge liegen, da wird es an die Tür klopfen, und die Frau wird davorstehen. Sie wird behaupten, sie habe sich ausgesperrt, was nicht stimmt, aber du wirst es ihr glauben, und auch das mit ihren kalten Füßen wirst du ihr glauben. Du wirst sie einladen, unter dein Federngebirge zu kriechen, und ihr werdet es über alle Maßen gemütlich haben. Und die traurigen Gedanken werden verlöschen, und die traurigen Erinnerungen werden verlöschen, und die traurigen Bilder der Vergangenheit werden verlöschen, und die Bemühungen, die alle nicht fruchteten, werden verlöschen, der gute Wille, der Böses angerichtet hat, wird ebenso verlöschen. Wirst nicht hundertundvierzig Jahre leben wie Hiob und wirst nicht sehen Kinder und Kindeskinder bis in das vierte Glied. Aber alt sterben wirst du, Inspektor, und lebenssatt.
Aber noch ist es nicht so weit.
Die drei Könige
Samira hatte die drei schon durch das Küchenfenster gesehen. Sie war stark und stolz auf ihre Muskeln. Sie wohnte mit ihrer Mutter, mit Poppele und mit Hund im zweiten Stock. Sie wusste, heute galt der Besuch ihr.
Die drei trugen dunkles Leder an den Beinen, die Geschenke waren in den schwarzen Restmüllsäcken, die über ihren schwarzen Lederschultern hingen. Samira hatte die drei lieb, besonders den einen, der Wolf hieß und auf der Brust eine blaue Madonna tätowiert hatte, die er ihr zeigte, wann immer sie wollte, auch im Winter, wenn er erst umständlich die Lederjacke, den Pullover, das Hemd und das Unterhemd ausziehen musste. Außerdem hatte sie auch von seinem Blut, denn Wolf war ihr Onkel.
Die Nachbarn hatten die drei Männer ebenfalls durch ihre Fenster beobachtet und Mutmaßungen angestellt, als sie mit ihren schwarzen Säcken auf dem Rücken durch die Siedlung gegangen waren, mit ihren langen Schritten, Orang rechts und Utan links von Wolf, Zigaretten unter den scharf geschnittenen Oberlippenbärten, Wolf einen halben Schritt vor den anderen wie der Kaspar vor dem Melchior und dem Balthasar. Die Nachbarn wussten ja, dass Samira in diesen Tagen neun Jahre alt wurde. Die drei schwarzledernen Könige waren mit den gleichen Säcken vor drei Wochen gekommen, nach Poppeles Geburt, und vor einem halben Jahr, zu Weihnachten, waren sie auch gekommen und davor am Geburtstag von Samiras Mutter auch. Wer sonst trägt schon Geschenke in Restmüllsäcken?
Samira hatte jeden, den sie erreichen konnte, von ihrem Geburtstag in Kenntnis gesetzt. Damit noch weitere Geschenke dazu kämen. Auch hatte sie in harmlose Sätze eingewoben, was sie sich nicht wünschte: nämlich ein Rüschenkleid, auch wenn es noch so gut zu ihren Locken gepasst hätte. Sie wünschte sich einen Baseballschläger und eine Baseballkappe, könnten gebrauchte Sachen sein, wäre kein Problem.
Den Nachbarn waren die drei Könige gut bekannt. Sie kamen einmal in der Woche in die Siedlung, normalerweise ohne Restmüllsäcke auf dem Rücken. Sie blieben oft über Nacht. Sie waren höflich, grüßten jeden, ob schön oder hässlich, und halfen gern. Und sie brachten immer etwas mit. Zufällig war immer etwas in einer ihrer Taschen. Und immer etwas, was der Mann, die Frau, das Kind, die sie zufällig unten bei den Fahrrädern oder im Stiegenhaus oder im Lift trafen, brauchen konnten. Da waren, um Beispiele zu nennen: eine Zigarettenspitze mit eingelegten Glasdiamanten, eine echt vergoldete Brosche in Edelweißform für Frau Brederis, ein echter Schlangenlederstiefel aus Wyoming, zu gebrauchen als Briefbeschwerer, Verschiedenes zum Rauchen, in Silberpapier eingewickelt, selbst gemachte Pralinen, eine Drachenfrucht, über die in der Siedlung niemand etwas wusste, nicht einmal, ob man sie überhaupt essen kann. Jeder mochte die drei Könige gut leiden, das folgte daraus. Und die drei mochten gut leiden, dass man von ihnen als von den drei Königen sprach. Der Wolf sagte zwar, das sei kindisch und katholisch, die anderen beiden aber mochten es gern. Sie sagten zu Samira, die Menschen hier in der Siedlung seien die freundlichsten, die sie auf der ganzen Welt kennengelernt hätten. Das hieß einiges. Die beiden waren schon viel herumgekommen.
Einmal – das sollte ich Ihnen eigentlich nicht erzählen, Herr Inspektor – waren die drei Könige in einem Lieferwagen vorgefahren, hatten, Handkante auf den Klingelknöpfen, bei allen Parteien gleichzeitig geläutet und Olivenöl verteilt, in kleinen Flaschen zwar, aber frisch gepresst, 1a-Qualität. Nur das Ehepaar im 6. Stock, Tür 9, hatte abgelehnt. Wobei der Mann zögerte. »Nein, danke«, sagte die Frau. Das war in Ordnung, die wollten halt kein Olivenöl. Manche mögen Olivenöl, manche nicht. Wolf sagte: »Jeder hat das Recht, kein Olivenöl zu mögen.«
Herr Hellbock vom dritten Stock sagte: »Kann man für euch auch einmal etwas tun?« Da wurde ihm geantwortet: »Wenn die Zeit kommt.« Darüber hat er nachgedacht, und er hat es weitererzählt.
Da war er, auf den sie gewartet hatte. Und dann durfte sie ihm nicht einmal einen Kuss geben.
»Sag Samira, dass sie Poppele nehmen soll und spazieren gehen soll und auf keinen Fall vor einer Stunde zurückkommen soll«, rief die Mutter aus dem Schlafzimmer, und Wolf sagte: »Du sollst Poppele nehmen und spazieren gehen und auf keinen Fall vor einer Stunde zurückkommen.« Und als sie widersprechen wollte, sagte er: »Tus einfach.« Und als sie nicht aufgab, sagte er: »Und nimm Hund mit.«
»Hunde sind auf dem Friedhof verboten«, sagte sie.
»Dann geh irgendwo anders spazieren«, sagte Wolf. »Nur schau, dass du endlich rauskommst!«
»Wo denn?«, fragte Samira. »Ich will nicht mit dem Kinderwagen in der Siedlung herumgehen.«
»Dann lass Hund da«, sagte Wolf, »und geh zum Friedhof.«
Das Messer
Auf dem Friedhof traf Samira die Schriftstellerin, die an diesem Tag das Grab ihrer Tochter schmückte.
»Warum zündest du so viele Kerzen an?«, fragte Samira.
»Weil sie heute Geburtstag hätte«, sagte die Schriftstellerin.
Da waren bunte Laternen, nicht schwarze wie sonst überall, sondern bunte, wie für ein spätes Sommerfest. Schwere rohe Steine umgrenzten den Erdhügel, Efeu wuchs, Eidechsen aus Plastik schlängelten sich darin. Das Bild am Kreuz zeigte eine junge Frau mit einem Tuch um den Kopf und einer Zigarette im Mund. Sie war die einzige Tote auf dem Friedhof, die rauchte. Einmal war ein Mann vor dem Grab gestanden und hatte einen Bleistift in die Erde gedrückt.
»Ich habe heute auch Geburtstag«, sagte Samira.
Da schenkte ihr die Schriftstellerin eine Kerze. Samira fragte nach dem Feuerzeug, zündete sie an und stellte sie zu den anderen aufs Grab. »Ich kann leider gar nichts mit einer Kerze anfangen«, sagte sie.
»Was kann ich dir sonst schenken?«, fragte die Schriftstellerin.
»Ich weiß nicht«, sagte Samira.
»Ich weiß eben auch nicht«, sagte die Schriftstellerin. Sie machte ein verzagtes Gesicht, sodass sie Samira leidtat. Die Schriftstellerin hielt ein Messer in der Hand. Damit hatte sie die Rosen geschnitten.
»Das Messer?«, fragte Samira. Es war wirklich sonst nichts da, was ihr die Schriftstellerin hätte schenken können.
Aber die Schriftstellerin sagte: »Nein, das Messer gebe ich nicht her.«
Talent zur Tragödie
Swini, Inspektor, hatte Talent zur Tragödie, aber er spielte darin keine Hauptrolle. Die Armen, die Elenden, die Opfer waren immer Kinder.
So färbte Samiras Geschichte das letzte Jahr vor seiner Pensionierung ein: dunkel. Die Geschichte bedrückte ihn, sodass seine Gesundheit litt und er viel Zeit im Bett verbringen musste. Der Schlaf überschwemmte ihn. Das Ende der Nacht bekam er kaum zu Gesicht. Die Haut juckte, er knipste das Licht an, suchte nach kleinen Tierchen auf dem Leintuch, aber da war nichts. Warum bin ich so einsam, fragte er sich, wenn ich mit Menschen zusammen bin? Allein fühle ich mich zu zweit. Ich bin mein bester Freund.
Klingelte jemand an der Tür, stellte er sich tot. Einmal drang eine Kollegin gewaltsam in seine Wohnung ein. Sie hatte befürchtet, er würde nicht mehr leben. Aus der peinlichen Angelegenheit wurde dann eine lustige, mit Gin und abgelaufenen Nüssen. Hinter seinem Rücken redeten sie. Die jungen Kollegen fühlten sich in seiner Gegenwart nicht wohl. Sie erinnerten sich an den Fall mit den beiden Romakindern, die erschossen aufgefunden worden waren. Swini hatte einen der mutmaßlichen Täter verhört. Daraufhin war ihm der Fall entzogen worden. Um ihn vor sich selbst zu schützen. Was immer das auch heißen mochte.
Irgendwann war auch Swini zehn Jahre alt gewesen, und da kam er von der Schule, ging auf dem Weg am Wasser entlang. Es war Winter, er trug seine derben Schuhe, seine Wollmütze, die verfilzten Fäustlinge und den weichen Anorak. Nach einem Streit mit seinem einzigen Freund war er allein auf dem Nachhauseweg. Sie waren sich nicht einig gewesen, wer größer sei, der Tiger oder der Panther. Beleidigt hatten sie sich getrennt. Swini nahm den Umweg über die Seepromenade. Beim Fischersteg sah er ein Mädchen, das balancierte auf dem Mäuerchen sehr graziös, bei jedem Schritt hob es ein Bein und streckte es durch. Gerade hatte er sich noch gedacht, dass er sich das nicht trauen würde, weil es rutschig war, da fiel das Mädchen ins Wasser, so elegant, wie es balanciert war. Swini sah sich um, er war der einzige, und er musste der Retter sein. Er konnte schwimmen, er zog auch seine Schuhe aus, aber mehr nicht, er traute sich nicht, es war Februar. Als er wieder aufs Wasser schaute, war von dem Mädchen nichts mehr zu sehen, und keine Bewegung war mehr, alles glatt. Er lief nach Hause. Kein Wort sagte er über den Vorfall. Am nächsten Tag erzählte man sich, ein Mädchen sei ertrunken, da war er verzweifelt und wusste, er konnte niemandem von seiner Schuld erzählen.
Lief dann im Leben umher, hatte viel Magenweh und ein graues Gesicht. Sah kaum den Frauen nach. Eine gefiel ihm am Vormittag, sie stand gerade im Morgenlicht und ihre Haare schillerten. Klaudia war Anfang zwanzig. Die Affäre weitete sich aus. Sie klebt ein bisschen, dachte er, sie sagte, sie sei schwanger, da bekam er die Panik. Niemals könnte er ein Kind haben, jetzt nicht, erst wollte er in den Beruf einsteigen, das Zepter seines Vaters übernehmen, der ein Inspektor war. »Nein«, sagte er zu Klaudia, »ich bin der Falsche.« Klaudia ließ sich an einen anderen Posten versetzen. Swini arbeitete an seiner Karriere, bis zum Inspektor lagen noch etliche Steine.
Er wusste nicht, hatte Klaudia abgetrieben oder hatte sie nicht. Nach einem halben Jahr sah er sie zufällig und starrte auf ihren uniformierten Bauch. Sie war Verkehrspolizistin und stand schmuck auf einer Verkehrsinsel, die weichen hellbraunen Haare zu einem Schwanz gebunden. Also kein Kind, was für eine Erleichterung.
Und doch: keine Erleichterung, nur ein Aufschub. Jahrelang verfolgte ihn dieses Kind, das nie eines geworden war. Er ertappte sich dabei, dass er es Merle nannte, wie eine Figur aus einem Kinderbuch. Merle war ein mutiges Mädchen, das allein zurechtkam, ohne Vater, ohne Mutter.
Merle wäre jetzt erwachsen, eine Meeresbiologin vielleicht. Hätte vielleicht selber eine Tochter inzwischen. Wenn sie früh angefangen hätte, wäre sich eine wie Samira ausgegangen.
Durchs Schlüsselloch
Durchs Schlüsselloch sah Samira nicht viel. Sie kniete sich nieder, da war sie wieder zu klein, ging in die halbe Hocke, da war sie wieder zu groß, das war anstrengend. Es glitzerte im Zimmer. Bitte, dachte sie, keine Lampe, die wie eine Katze aussieht. Das wäre typisch für die Mama gewesen.
Der Spaziergang durch den Friedhof hatte Poppele nicht beruhigen können. Poppele weinte. Hund schnuffelte an Samiras Füßen. Sie gab Hund einen Hieb und hob Poppele auf, wiegte es in ihren Armen, flüsterte ihm Unsinn ins Öhrchen, trug es zum Schlüsselloch. Es glitzerte immer noch. Keine Boxhandschuhe. Kein Baseballschläger.
Poppele war drogensüchtig. Samira wusste das. Sie suchte den Schnuller, fand ihn nicht. Fand ihn aber doch. Zerbissen von Hund. »Hund«, schrie sie, »ich hasse dich!« Wieder gab sie ihm einen Hieb. Hund war das gewohnt.