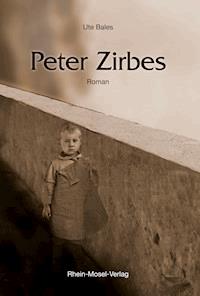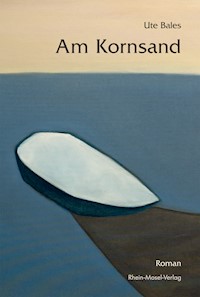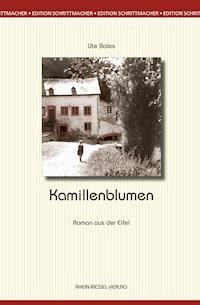Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
'Die Welt zerschlagen' erzählt die Geschichte einer jungen Frau im Köln der 20er Jahre. Eine Geschichte, die unauflöslich mit der Vergangenheit unseres Landes verstrickt ist. 'Ich habe keine Tochter mehr', sagt der Vater, als Angelika gegen seinen Willen im Juni 1919 den aufstrebenden Maler Heinrich Hoerle heiratet. Angelika ist 19 Jahre alt und empfindet den Bruch mit dem Elternhaus wie eine Befreiung. Aber die Zeit ist hart. Die Novemberrevolution scheitert, die Folgen des Ersten Weltkriegs sind augenfällig. Britische Militärs haben die Kontrolle über die Stadt übernommen, Kriegsversehrte dominieren das Straßenbild; die Leute hungern. Für die Künstler, mit denen Angelika arbeitet, ist das Vertrauen in die Zukunft verloren. Sie attackieren die bürgerliche Gesellschaft mit radikalen Kunstwerken, Lautgedichten und turbulenten Dada-Aktionen, feiern Karneval, geben Zeitschriften heraus. Alle sind von der Idee getragen, eine neue und bessere Welt zu kreieren. Für kurze Zeit gehört Angelika zum Kreis um Max Ernst, Hans Arp und Johannes Theodor Baargeld. Dann schließt sie sich mit Freunden zur Gruppe Stupid zusammen. Sie ist 22, als sie an Tuberkulose erkrankt. Mittellos lässt Heinrich sie zurück.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© E-Book-Ausgabe 2016Rhein-Mosel-VerlagBrandenburg 17, D-56856 Zell/MoselTel. 06542/5151, Fax 06542/61158www.rhein-mosel-verlag.deAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-89801-835-7Ausstattung: Marina FollmannUmschlag: Cornelia CzernyLektorat: Michael DillingerTitelfoto: David und Angelika Littlefield, Toronto/Kanada
Ute Bales
Die Welt zerschlagen
Die Geschichte der Dada-Künstlerin Angelika Hoerle
Roman
RHEIN-MOSEL-VERLAG
***
»Habt ihr eigentlich Angelika Hoerle gekannt? Es wird noch einiges zu fragen und zu sagen sein, hoffe ich mit der Zeit.«Marta Hegemann, 1968
***
Nicht mehr weit
Alles ist erfüllt vom tiefen Keuchen ihres Atems: der Himmel, die Häuser, die Autos und Menschen. Auch er, der sie trägt, weil ihr jede Kraft fehlt. Er hat sie in eine Decke gepackt, denn sie friert, obwohl es warm ist. Die Straße scheint unendlich und während er sie stützt, dann wieder ein Stück trägt, denkt er daran, dass sie sterben könnte und diese Gedanken erfassen ihn ganz, nehmen jeden verfügbaren Raum. Ihr eingefallenes Gesicht vor Augen geht er wie ein Schlafwandler vorwärts, sieht nicht, dass Leute von ihnen abrücken und einen Bogen machen, hört nur nach dem rasselnden Geräusch ihres Atems, nach ihrem Stöhnen und Husten, ist taub für alles andere. »Es ist nicht mehr weit. Wir haben es bald geschafft.«
In der Dürener Straße schleppt er sie in eine Straßenbahn. Die Bahn ist überfüllt. Bis zum Wallrafplatz müssen sie stehen, aber dann steigen Leute aus und er schiebt sie auf einen freien Sitz. Er kramt ein Fläschchen aus seiner Jackentasche, öffnet den Verschluss und hält es ihr vor den Mund. »Tief einatmen«, sagt er und als sie es nicht tut, packt er sie an den Schultern: »Jetzt atme doch!« Sie sitzt da, schwitzend und erschöpft, sieht auf das Fläschchen und dann aus dem Fenster. Gerüche, Gedanken, Gesichter ziehen vorbei. Die Luft hat jene bläulichweiße Klarheit, die Erde und Himmel gleich macht. Die Rasenflächen sind braun geworden von der Sonne. Kinder spielen mit einem Hund. Ein Zeitungsjunge klopft ans Fenster der Bahn. »Extrablatt! Stresemann wird Reichskanzler! Dat Allerneuste! Schon jehört? Stresemann wird Reichskanzler!« Sie blickt über den Jungen hinweg. Ihr Gesicht ist knochig und abgespannt, die Augen sind fiebrig. »Ich kann nicht mehr.« Der Platz neben ihr wird frei und er setzt sich. »So was darfst du nicht sagen.«
Am Dom steigen sie um. Sie fahren über Eigelstein und Neusser Straße. Hier sind sie früher oft gewesen und in Gedanken sieht er sie die Straßen und Plätze überqueren, das Malergepäck auf dem Rücken, heimkehren von den hellen Ufern des Rheins. Damals waren ihre Bilder bunt wie der Fluss und die Landschaft, später waren es Zeichnungen mit Bleistift und jetzt nichts mehr, nur noch der gepferchte schwere Atem und die wirre Unruhe ihres schweißbedeckten, abgemagerten Körpers. »Es ist nicht mehr weit«, flüstert er, »der Vater wartet. Er ist froh, wenn du wieder daheim bist.« Sie reagiert nicht.
An der Agneskirche steigen sie aus. Wieder muss er sie stützen, dann tragen. Eine Bäckerei atmet ihren fettigen Dampf auf die Gassen. Langröckige Talmudstudenten gehen mit Büchern hausieren. Misstrauisch sehen sie herüber. Neben einem Blumenstand trocknet jemand Fische; aufgereiht hängen sie über einer Schnur; grätige Hälften, platt und breit wie eine Hand. Aus einem hochrädrigen Kinderwagen dringt Weinen, aus einem offenen Fenster Tonleitergeklimper. Zwei Wandermusikanten mit geschulterten Blechinstrumenten kommen die Straße herauf. Sie sind vor einem Geschäft verjagt worden und beziehen jetzt Position an einem Brunnen, von wo aus sich ihre Blechtöne über der ganzen Straße entladen.
Sie hustet wieder stärker. Vor einem Laden stehen Gemüsekisten. Kurz setzt er sie ab, wischt sich den Schweiß von der Stirn. Dann legt er sich wieder ihren Arm in den Nacken, hebt sie unter den Knien und schleppt sie weiter. 40 Kilo, denkt er, wenn überhaupt.
Drei Jahre ist sie nicht zu Hause gewesen. Er hat den Vater überreden müssen, sie wieder aufzunehmen und jetzt klammert er sich an den Gedanken, dass sie dort zur Ruhe kommen und alles wieder gut werden würde. »Es ist nicht mehr weit, gar nicht mehr weit«, flüstert er, spürt, wie sie sich an seiner Jacke festkrallt, wie ihre Hände kraftlos werden und immer wieder abrutschen. Ihr Leben, das sie schon bald nicht mehr haben könnte, scheint ihm so kostbar, so unendlich vertraut und dieses Gefühl bringt eine heftige, fast absurde Zärtlichkeit mit, die er schon als Junge für sie empfunden hat. Während er so mit ihr geht, hat er plötzlich ihr Kinderlachen im Ohr. Der weiche und helle Klang macht den Himmel höher und weiter, ändert die Farben der Bäume und Häuser, er meint stehen bleiben zu müssen in der transparenten Luft: »Nur noch ein kurzes Stück, Geli. Bald sind wir da.«
Et hät noch emmer jot jejange
Am Krefelder Wall, im Hinterhof eines Mietshauses, spielen Kinder. Ein Junge in einem Matrosenanzug schöpft mit einer Konservendose Wasser aus einer Pfütze, ein anderer bohrt dünnes Gezweig in den Schlamm und gibt Kommandos: »Alles festhalten! Die Brücke kippt! Wer nicht schwimmen kann, ist tot!« Er springt auf, tritt in die Pfütze, Schlamm spritzt, kreischend fahren sie auseinander. Dann hocken sie wieder zusammen, die Köpfe aneinander, beratschlagen, erheben sich erneut, suchen Hölzer und Steine, hocken wieder zusammen, bauen einen Wall aus Schlamm. Am Tag zuvor ist die im Bau begriffene Südbrücke über den Rhein eingestürzt, hat 40 Arbeiter von den Gerüsten gerissen, von denen der Fluss vier behielt. Die Ertrunkenen beherrschen alles Denken und Tun der Kinder, die mutmaßen, wie es ist, zu ertrinken.
Zwei Mädchen sind dabei. Sie tragen helle Kittelkleider und Holzpantinen. Beide haben die langen Haare zu Zöpfen geflochten und hochgebunden. Eines von ihnen erklärt, dass es mit dem Ertrinken schnell gehe, dass sie es wisse, weil erst im Frühjahr ein Onkel ins Hochwasser geraten sei und seither nicht mehr gesehen wurde. Das andere schüttelt den Kopf. »Und woher weißt du, ob es schnell ging?« Es fasst sich an den Hals, drückt zu, fängt an zu röcheln: »Nein, man kriegt keine Luft mehr, so lange, bis die Lungen leer sind und man tot ist!« Es drückt fester und fester, bis der Kopf rot wird, die Augen hervortreten und einer der Jungen entsetzt aufspringt: »Geli! Was machst du? Hör auf damit!«
Angelika hat keine Angst. Auch nicht vor dem Ertrinken. Willy, ihr Bruder, sechs Jahre älter, erschrickt oft über das, was sie sagt und tut. Angelika ist beharrlich und unbeugsam in einer Weise, die ihn beunruhigt und ihm ständig das Gefühl gibt, sie beschützen zu müssen. Obwohl ihm ihre Waghalsigkeit, der Leichtsinn und das Trotzige fremd sind, bewundert er ihren immensen Willen. Sie hat sich das Lesen nahezu selbst beigebracht, noch bevor sie in die Schule kam, weil man ihr die Geschichten von Fipps, dem Affen, vorenthalten wollte. Sie ist oft hochfahrend und eigensinnig, stellt kuriose Fragen, bohrt nach, gibt schlagfertige Antworten, vergisst nichts. Alles was verboten ist, reizt sie: das Rutschen auf dem Treppengeländer, der abgeschlossene Bücherschrank im Wohnzimmer, das Rauchzeug des Vaters. Einem Schaukelpferd hat sie den Schweif abgeschnitten, der Heiligen Anna, abgebildet im Gebetbuch der Mutter, bunte Haare gemalt.
Als Jüngste interessiert sie sich für alles, was die Geschwister tun und meinen und macht sich eigene Gedanken. Sie sind zu viert: Maria, mit 19 die älteste, Richard, gerade 18 geworden, dann Willy, 15, und Angelika, 9.
Die Mädchen ähneln einander. Beide sind schlank und groß, haben die lockigen dunkelblonden Haare und das längliche Gesicht der Mutter. Auch an den dunklen Augen kann man erkennen, dass sie Geschwister sind. Maria arbeitet bei einer Schneiderin am Heumarkt. Dass sie nähen kann, sieht man ihr an. Ihre Kleider fallen auf. Sie ist imstande, selbst aus winzigsten Resten Schönes zu schneidern.
Willy, quirlig und an allem interessiert, mit kurz geschnittenen, seitlich gescheitelten braunen Haaren und dunklen Augen, will Möbelschreiner werden wie der Vater. Er lernt bei einem Tischler nur ein paar Straßen weiter. Richard, groß und schlaksig, mit einem dünnen Bärtchen in einem fein geschnittenen Gesicht, hat die Lehre bereits hinter sich. Er ist als Stenograf am Gericht angestellt. Seine Geschwindigkeit im Schreiben ist enorm. Keiner kann ihn einholen. Sieben Strophen von Goethes Zauberlehrling schreibt er in knapp anderthalb Minuten.
Das Haus, in dem sie wohnen, liegt mitten in Köln, nicht weit von Rhein und Dom, direkt an einer Straße, wo Schuster, Schneider und Sattler ihre Werkstätten haben, wo es einen Gemüseladen gibt und eine Fleischerei, wo gespielt und geschimpft wird und fast immer Leute auf dem Trottoir stehen und schwätzen. Das Haus ist vierstöckig und von sechs Familien bewohnt. Auf der gelb gestrichenen Fassade wirbt ein Reklameschild für Eau de Cologne. Es gibt einen Hinterhof mit einem ausladenden Kastanienbaum, darunter Mülleimer und eine Wäscheleine. Auch von Fenster zu Fenster sind Leinen gespannt, die an Waschtagen fast durchhängen. Die Straße ist laut von Kindern, auch das Haus. Manche sind schmutzig und voller Flöhe. Im Treppenhaus stehen mittags Schwaden von Kohldampf. Oft riecht es auch säuerlich nach Hering, manchmal satt und warm nach Pellkartoffeln, oder, wenn der Vater in der Werkstatt arbeitet, nach Holz und Leim.
Die Wohnung ist eng und verbaut. Von einem langen Flur aus geht es rechts in die Stube, links ins Schlafzimmer der Eltern und geradeaus in die Küche. Die Kinder teilen sich ein großes Zimmer, das über eine Stiege zu erreichen ist. Die Toilette befindet sich draußen, auf halber Treppe zum ersten Stock.
Maria und Angelika schlafen gemeinsam in einem hohen Eisenbett. Richard und Willy in einem Bett, das der Vater gemacht hat. Der Raum der Jungen ist durch einen mit Vögeln bemalten Paravent von dem der Mädchen abgetrennt. Die Mädchen haben mehr Platz in ihrem Teil des Zimmers, sogar für einen Tisch und Stühle.
Der Vater, ein hagerer Mann mit gezwirbeltem Schnauzbart, ist Möbelschreiner. Sie wohnen im Parterre, die Schreinerwerkstatt ist Teil der Wohnung und von den Kindern vormittags nicht zu betreten. An seltenen Abenden und nur dann, wenn keine Kunden da sind, sitzen Angelika und Willy auf der Hobelbank und sehen zu, wenn der Vater schleift oder sägt oder leimt. Wenn er gut gelaunt ist und Zeit hat, erzählt er von den Großeltern in Pommern, von der Weltausstellung in Paris, wo er gerne dabei gewesen wäre oder von Kunstausstellungen im Glaspalast auf dem Gelände der Flora. Meist spricht er Kölsch, aber manchmal, bei wichtigen Dingen, hochdeutsch. Manchmal legt er ihnen süße Rosinen oder Bärendreck[1] in die kleinen Handflächen. Seine Geschichten sind zum Staunen und voll von skurrilen Erfindungen, von fliegenden Objekten, von Wunderwerken wie beweglichen Treppen und Bürgersteigen. Der Vater interessiert sich für alles Neue, besonders in der Politik. Er bezieht die Kölner Zeitung, in der seine Kinder blättern und Bilder betrachten dürfen. Sie sehen ein Foto von Louis Blériot, der als erster in einem Flugzeug den Ärmelkanal überflogen hat, Bilder von gigantischen Fabriken mit glühenden Hochöfen, vom Eiffelturm, von König Eduard von Großbritannien, von einer Frau, die einen Apparat erfunden hat, mit dem man durch Menschen hindurchsehen kann, von Puyi, dem fünfjährigen Kaiser von China, von Leuten, die eine Aeronette tanzen, einen Tanz, bei dem man die Arme wie Flügel kreisen lässt. Oft ist der Kaiser in der Zeitung abgebildet, bei Jagdgesellschaften oder Autorennen, auch vor der Kulisse großer Schiffe und immer in Uniform. Der Vater verzieht das Gesicht, wenn er ihn sieht, nennt ihn einen preußischen Säbelrassler und erzählt Dinge, die nicht in der Zeitung stehen. Zum Beispiel, dass der Kaiser einen Arm nicht gebrauchen kann, weswegen man ihn als Kind in Hasenblut gebadet und in eine Streckmaschine gesteckt hat. Der Vater ist sicher, dass die Monarchie bald ein Ende haben wird, tippt mit dem Finger auf den Kopf des Kaisers und sagt: »Diesem System keinen Mann und keinen Pfennig.« Er weiß Bescheid über das Elend in den Armenvierteln, schimpft, dass die Länder Europas zwar vom Frieden reden, aber heimlich aufrüsten würden, lobt die russische Arbeiterbewegung, ihren Zusammenhalt und die Streiks, die er als einzig wirksames Mittel gegen Unrecht und Hunger sieht und betont, dass man das in Deutschland bloß noch nicht verstanden habe und der Kaiser nicht das Volk, sondern nur kostspielige Flotten und Kolonialmanöver im Kopf hätte. Willy ist voller Respekt für den Kaiser. Er sammelt Kaiserbilder und ist besonders stolz auf das Sammelbild No. 132 mit den neuen deutschen Kriegsschiffen, das er Weihnachten in einer Tafel Stollwerck-Schokolade gefunden hat. Wenn von Schiffen und Flotten die Rede ist, hört er immer genau hin und ist verstört, als Angelika fragt, ob der Kaiser auch aufs Klosett müsse und falls ja, wie das vonstatten ginge. Der Vater schüttelt auf diese Frage hin den Kopf, was Willy in seiner Meinung nur bestätigt, wonach der Kaiser direkt nach Gott käme und ergo nicht aufs Klosett müsse. Angelika bleibt er die Antwort schuldig, was häufig vorkommt. Der Vater bleibt gern vage in den Antworten. Es gebe so viele Meinungen und so viel Neues, man müsse sich gut überlegen, was man glauben könne und jeder sei selbst angehalten, Augen und Ohren aufzusperren, um eigene Betrachtungen über die Welt anzustellen.
Die Mutter ist eine stille und geduldige Frau mit dunkelblondem, dicht gekräuseltem, von Silberfäden durchzogenem Haar, einer durchscheinenden Haut und Augen mit der graugrünen Farbe ferner Berge. Sie erzählt gern Geschichten von früher, vom Großvater aus Randerath, wo sie als Kind oft war, von den vielen Tanten, die dort ein- und ausgingen. Sie ist es, die dafür sorgt, dass sie ins Hänneschen gehen, ein Theater im Martinsviertel mit Klappbänken und Gaslampen, wo sie Tränen lachen über Tünnes und Schäl und sich dann ganze Nachmittage nicht mehr einkriegen können. Manchmal kauft sie Karten für das Stadttheater an der Glockengasse, wo es literarische Nachmittage gibt, wo Goethes Iphigenie auf Tauris und Shakespeares Sommernachtstraum aufgeführt werden, Schauspieler Gedichte singen oder rezitieren. Auch zu Hause gibt es gelegentlich kleine Vorstellungen der Kinder, für die eigens Zipfelmützen genäht oder Bärte angeklebt werden: »Wie war zu Köln es doch vordem mit Heinzelmännchen so bequem. Denn war man faul, man legte sich, hin auf die Bank und pflegte sich …«
Mittwochs und sonntags wird musiziert. Die Mutter kommt aus einer musikalischen Familie, in der jeder ein Instrument spielt, sie selbst Klavier und Geige. Jedem ihrer Kinder hat sie das Klavierspiel beigebracht. Mit Willy übt sie zusätzlich Geige.
Das Klavier ist alt, aus dunklem Holz, mit Kerzenhaltern und Tasten aus Elfenbein und Ebenholz. Stundenlang kann Angelika spielen. Nie wird sie müde. Die Musik verändert alle Geräusche des Hauses, überdeckt das Türenschlagen nebenan, das Säuglingsgeschrei und das beruhigende Summen der Amme von oben, das Gekreische von der Straße, das Gekeife, wenn wieder einer der Arbeiter seine Lohntüte versoffen hat. Musik greift ihr ans Herz, besonders die Romanzen von Clara Schumann. Was die Musik angeht, so ist die Mutter streng. Manchmal vergisst Angelika das Notenblatt, spielt, was ihr in den Kopf kommt. Dann schimpft die Mutter und sagt, sie soll sich konzentrieren und sich nicht gehen lassen. Manchmal spielen sie vierhändig: Angelika mit Willy, Willy mit Maria, Maria mit Richard, die Mutter mit Angelika. Angelika genießt es, wenn die Mutter sich Zeit nimmt und ihr allein gehört.
Abends nehmen sie ein Buch zur Hand und lesen zusammen. Die Mutter liest viel. Lessing und Fontane, den Faust und die Gedichte der Hülshoff. Auch mit Theaterstücken kennt sie sich aus und mit modernem Tanz. Am meisten aber weiß sie über Musik. In der Weihnachtszeit lädt sie Nachbarn und Freunde zu Kammermusikabenden mit Stücken von Mendelssohn Bartholdy, Brahms oder Haydn ein. In der Stube ist dann ein Baum aufgestellt mit Lametta, Glaskugeln, goldenen Tannenzapfen und kleinen Äpfeln. Alle sind dabei – Angelika, Willy, Richard und Maria – und als Musiker oder Sänger meist Teil des Programms.
Es gibt aber auch politische Veranstaltungen, zu denen die Eltern eingeladen werden oder selbst einladen. Bis weit in die Nacht wird dann diskutiert und debattiert. Willy und Angelika haben keinen Zutritt. Oft lauschen sie an der Tür und es verirren sich Worte und Sätze in ihre Ohren, die fremd und fern klingen.
Sonntags gehen sie nach St. Ursula, um die Messe zu hören. Angelika hat ein Gesangbuch mit Goldschnitt, aber während der Predigt darf sie nicht darin blättern. Sie sitzt in der hohen Bank, die vielen Kerzen machen alles hoch und hell, betrachtet die schwarzen, blanken Votivtäfelchen mit den Fotos der Verstorbenen, die Marmor- und Gipsfiguren, die Bilder von der heiligen Ursula, die Engel und Teufel aus Stuck, das Herz Jesu, das so aussieht, als blute es wirklich. Tröstlich kommt ihr der Heiland vor, der, schwebend und mit Heiligenschein, umflort vom schweren Duft der Blumen, seine Hand hebt und ihr zuwinkt.
Bei gutem Wetter gehen sie nach der Messe zum Leystapel oder in den Zoo, wo es einen Seelöwenfelsen gibt, ein Elefantenhaus und riesige Volieren. Immer wieder klettern sie den taubenumflatterten Südturm des Doms hinauf, von wo aus die Leute auf dem Vorplatz wie Ameisen aussehen. Sie spazieren zum Deutzer Rheinufer, opp die schäl Sick, wie sie sagen, wo sie den Wechsel der Wasserstände beobachten, den Schiffen und Raddampfern zusehen oder im Sommer dem Badeschiff, das immer voller Leute ist, vor allem Damen mit Sonnenschirmen. Angelika mag den Teergeruch, die Schiffsglocken, die weit geschwungenen Ufer.
Das Schönste ist die Fronleichnamsprozession in Mülheim. Wenn am Morgen die Schützenbrüder in ihren Trachten durch die geschmückten Straßen zum Rhein ziehen, dort ein mit Fahnen und Wimpeln geschmückter Dampfer das Sanctissimum aufnimmt, wenn unzählige Kähne und Schiffe das Prozessionsschiff begleiten, von dem aus nach allen Seiten der Segen erteilt wird und der Schützenfähnrich mit gespreizten Beinen hochragend im Boot steht und die Schützenfahne schwenkt und eine unübersehbare Menge von Gläubigen und Schaulustigen die Ufer säumt, ist die Kirmes nicht mehr weit. Schon Tage vorher ist Angelika wie im Fieber: »Morje fängk uns Kirmes aan, hör ens dat Jebimmel, wääde mr e Leve han, wie ne Boor em Himmel …«
Was für Richard und Willy Schiffe, Raddampfer und Brücken sind, ist für Angelika und Maria die Kurzwarenhandlung Isay am alten Posthof mit großen Schaufenstern, in denen die neuesten Stoffe ausliegen: Leinenballen, Kattun für Schürzen, feine Wolle, bestickte Tücher und Kopfkissen.
Manchmal essen sie Apfelkuchen mit Schlagsahne in einer Konditorei, das Stück zu 20 Pfennig. Vor dem Café hat oft ein Leierkastenmann einen Tisch mit Dominosteinen aufgebaut und einen Guckkasten, durch dessen Linsen man die im Inneren aufgestellten Fotografien betrachten kann: Einen vermummten Eskimo im Rentierschlitten, eine Ansicht der Lorelei, ein Sultan auf einem Kamel, eine Geisha in einem Seidengewand.
Wenn es regnet, bleiben sie zu Hause, spielen Mühle, zeichnen oder musizieren. Oder sie spielen Verkleiden mit den Schlafzimmergardinen. Angelika ist die Braut, Willy der Bräutigam.
Die Schule liegt in der Nachbarschaft. Es ist ein massiger Bau mit riesigen Klassenräumen für über 30 Kinder, in denen es muffig riecht. Nicht alle Kinder, die im Haus wohnen, besuchen diese Schule. Manche gehen in die evangelische, andere in die jüdische. Die Schule ist für Angelika ein unbehaglicher Ort. Beim Aufstellen in Zweierreihen, beim Abzählen und dem Marschierkommando eins – zwei – drei, eins – zwei – drei, ist ihr permanent mulmig. Beim ›Guten Morgen, Herr Lehrer‹ versucht sie nicht aufzufallen. Der Kommandoton des Lehrers, das schwarzholzige Katheder, der Rohrstock und das Eckestehen für die, die die Antwort nicht wissen oder Falsches sagen, wirken wie ständige Drohungen. Angelika begreift, wenn sie alles so macht, wie der Lehrer es haben will, ist sie eine gute Schülerin. Macht sie es nicht, ist sie eine faule. Angelika ist froh, wenn sie in Ruhe gelassen wird.
Die wenigen Stunden, die sie mag, sind die Deutschstunden, in denen gelesen wird, Bilder vom Dom und vom Rhein betrachtet, Vulkangesteine aus der Eifel herumgereicht und Gedichte vorgetragen werden. Der Lehrer, ein untersetzter Mann mit scharf geschliffenem Zwicker, buschigen Augenbrauen, einem flammenden Blick und einem zerknitterten, von einem Schmiss gezeichneten Gesicht, ist ebenso streng wie zerstreut, wechselt die Themen, wie es ihm in den Kopf kommt. Wenn er sich ärgert, geht er energisch auf und ab, fuchtelt mit dem Rohrstock, stampft mit dem Fuß, dass die Rockschöße sich bewegen wie Flügel von Krähen. Er zwingt alle schön zu schreiben und ordentlich vorzutragen, schnell im Kopf zu rechnen und wenn das nicht geht, hebt er den Stock. »Wer nicht hören will, muss fühlen!« Fast täglich muss einer vortreten, mit dem linken Fuß zuerst, dann strammstehen und Beleidigungen über sich ergehen lassen. Welch jämmerliche Gestalten sie doch seien, wie armselig der Nachwuchs für ein Land wie Deutschland. Dann droht und flucht er, dass seine Augen hervorquellen und die Stimme sich überschlägt, ordnet Kniebeugen an oder Eckestehen. Unermüdlich spekuliert er über die Folgen des Krieges von 70/71, dass es wegen der Eroberung Elsass-Lothringens sicherlich irgendwann Revanche gebe, der man sich stellen müsse. Was sich niemand richtig zusammenreimen kann: Manchmal bewitzelt er die Offiziere und spricht die unterschiedlichen Dienstgrade, sogar die der Generäle, mit Abscheu und Ekel aus. Trotzdem begeistert er sich für die Luftfahrt und bringt in seinen Klassen diese Leidenschaft zum Kochen, als der Zeppelin sich ankündigt und er mit allen das Lied einübt: »Zipp – zapp – Zeppelin, seht, wie stolz rauscht er dahin, unser Graf von Zeppelin, wie rauscht er dahin …« In Zweierreihen marschieren sie singend zum Landeplatz nach Bickendorf. Die Straßen und Häuser, die das Luftschiff überfliegt, sind mit Fahnen und Blumen geschmückt, die halbe Stadt ist unterwegs. Radfahrer klingeln heran, Straßenbahnen, Pferdefuhrwerke und Droschken sind bis auf den letzten Platz besetzt. Würstchenbuden und Saftverkäufer werben lautstark um Kunden, Postkartenfotografen gehen herum, auch Zauberkünstler in bunten Kostümen. Als der Graf den Dom umkreist, werfen Leute ihre Hüte in die Luft, die Kaiserglocke klingt, der Männergesangverein von Bickendorf holt tief Luft: »Deutschland, Deutschland über alles …«. Jubelrufe, Sirenengeheul und Böllerschüsse nehmen kein Ende. Auf einer Wiese drehen sich Karussells, die Militärkapelle spielt das Kaiserlied und dann das neue Karnevalslied: »Et hät noch emmer, emmer, emmer jot jejange un et jeht noch emmer joht!« Ein improvisierter Festzug bildet sich aus einer Reihe von knatternden Automobilen. Diese laute Masse bleibt Angelika lange im Gedächtnis. An den Zeppelin kann sie sich später nicht mehr erinnern.
Die Mutter lacht, der Vater auch
Sie kann sich auch nicht mehr erinnern, wann es mit dem Zeichnen angefangen hat. Es ist immer schon da, gehört dazu wie die Musik und die Bücher. Über dem Bett der Jungen hängen Zeichnungen von Schiffen. Sie sind fast alle von Willy. Detailgetreu und fein hat er gestrichelt; alle technischen Raffinessen sind erkennbar. Er hat auch die Wellen exakt erfasst, das Gesträuch des Ufers, die Grashalme und den Himmel.
In sein schwarzes Heft zeichnet er alles, was er sieht: Züge, Schiffe, Flugzeuge, Tiere, Gesichter und den Halleyschen Kometen, der wie eine Drohung am Himmel steht und Weltuntergangsstimmung verbreitet. Willy hat ihn mit einem riesigen Schweif gezeichnet, daneben die Erde, ganz klein, weil er gehört hat, dass sie durch den Schweif hindurch muss. Er hat auch Gasmasken und Flaschen mit Atemluft gezeichnet und ist überzeugt, dass giftige Gase im Schweif des Kometen stecken. Der Vater belustigt sich über Willys Befürchtungen: »Erst mal abwarten. Wenn wir sterben, sterben wir ja alle.« Aber er erkennt, dass Willy Talent hat und verspricht ihm, falls der Halleysche Komet nicht alles auslöscht, Zeichenstunden an der Kunstgewerbeschule.
Der Halleysche Komet löscht nichts aus. Willy darf einen Abendkurs besuchen.
Nach der Lehre ist er als Schreiner bei der Stadt eingestellt worden, wo er tagsüber die Fahrgasträume der Straßenbahnen mit Mahagoniholz verkleidet und poliert. Mit dem Geld, das er verdient, bezahlt er die Kunstschule. Einmal bringt er Kollegen mit nach Hause, die er den Eltern vorstellt. Sie stehen in der Stube und trinken Likör aus Weingläsern. Sie sehen alle aus, wie Angelika sich Maler vorstellt: zusammengewürfelte Kleider, zerbeulte Mützen, geflickte Hosen. Sie sind laut und reden durcheinander.
Angelika ist elf, als sie sich zu interessieren beginnt, was Willy aus der Schule mitbringt. Sie durchstöbert seine Mappe, studiert seine Striche, sieht ihm beim Zeichnen zu. Bald versucht sie es selbst. Die Striche sind noch dünn und zag, aber was sie malt, gefällt ihr, und sie denkt darüber nach, eine Malerin zu werden.
Die Mutter lacht, der Vater auch.
Selbst bei Richard spürt sie dieses Gelangweilte und Unbeteiligte, wenn sie ihre Zeichnungen zeigt. Sein spöttischer Blick und das abwimmelnde »schön, sehr schön«, sorgen dafür, dass nur noch Willy und Maria ihre Sachen zu Gesicht bekommen. Willy ist ihr besonders wichtig. Seine Meinung zur Kunst scheint fundiert. Sie weiß, dass sie ihm oft lästig ist mit den ständigen Bitten, ihre Bilder anzugucken und etwas dazu zu meinen. Aber er lässt sich nichts anmerken, rückt ihr einen Stuhl an seinen Arbeitstisch, demonstriert Farbmischungen und Pinselführung und erklärt ihr, was es mit dem Fluchtpunkt auf sich hat. Sie fragt und fragt und weiß, dass ihm ihre Beharrlichkeit gefällt. Auch der Wille, etwas zu verstehen und durchzusetzen, imponiert ihm.
Einmal zieht er einen Katalog mit grell leuchtenden Landschaftsbildern und Portraits aus der Tasche. Eine Frau mit grüner Nase, blauen Haaren und gelber Haut ist auf dem Titelbild zu sehen. »Das sind die Modernen«, verrät er Angelika und blättert die Seiten so vorsichtig, als seien sie zerbrechlich. Angelika darf den Katalog nicht berühren. »Ja, das sind die Modernen«, wiederholt Willy und zeigt auf eine Gruppe nackter Mädchen vor einem Großstadtpanorama. »Sieh mal. Die Franzosen haben damit angefangen. In Dresden gibt es eine Gruppe, die ähnlich malt. Sie malen frei und schon lange nicht mehr so, wie es an den Schulen gelehrt wird. Es gibt nämlich gar keine Regeln in der Kunst. Wer was anderes behauptet, lügt.« Willy ist so begeistert, dass seine Stimme vibriert. »Sieh doch nur! Das ist eine Kunst, die sich gegen alles Alte stellt. Die halbe Welt ist schockiert. Aber lass sie doch! Wir wollen die alten Bilder nicht mehr, dieses Abmalen von Gipsmodellen und die Salonkünstler.« Angelika gefallen die Bilder, die Willy aufblättert: blaue Bäume, Nackte, darunter Kinder, außerdem Bilder von Zirkus und Varieté und immer wieder Badende in der Natur, an einem Fluss oder unter Bäumen. Sie findet die Bilder überhaupt nicht schockierend. Willy redet wie ein Wasserfall: »Was zählt, ist das Gefühl. Sie machen alles anders. Es ist auch ein Protest gegen diese verlogene Gesellschaft mit ihren ganzen Zwängen.« Angelika betrachtet die Bilder lange und genau. »Was ist eigentlich richtige Kunst?« Auf diese Frage weiß Willy keine Antwort. Vielleicht hat er auch keine Lust zu antworten, denn er verstaut den Katalog wieder in seiner Tasche, steht auf und geht, ohne einen Blick auf Angelikas Modezeichnungen zu werfen, die sie für ihn bereitgelegt hat.
Angeregt von Marias Näharbeiten, paust Angelika wochenlang Kleider aus Modezeitschriften ab. Bald aber findet sie das Durchpausen langweilig und geht dazu über, eigene Kleiderentwürfe zu zeichnen. Als ihr eine von Marias Freundinnen verrät, dass sie, um gute Entwürfe zu machen, Körpervorlagen brauche, weil ohne diese Vorlagen die Relationen nur schlecht gerieten, misst sie Marias Brust-, Taillen- und Hüftumfang, auch die Proportionen des Gesichts, vergleicht mit den eigenen, skizziert und rechnet, vergrößert und verkleinert die Vorlagen, beklebt die Entwürfe. Dann zeichnet sie wieder: Mädchen mit Hüten, floralen Frisuren, Halsketten und Schleifen sowie einem Schal mit einem vorn bis zu den Knien auslaufenden Kragen aus Marquisetteseide, verziert mit Bändchenfransen. Für Kinder entwirft sie Röcke und Matrosenblusen, weiße, sommerliche Kleidchen aus lichten Stoffen und mit feinen Stickereien. Auch Schleifen für die Haare.
Die Schwestern verfolgen alles, was mit Mode zu tun hat. Stunden verbringen sie mit Modejournalen und Bildern von Modenschauen und eleganten Frauen, Vorführdamen genannt, die in die Kameras lächeln, unnahbar und schön. Für alles, was neu ist, begeistern sie sich, vertiefen sich in stundenlange Gespräche über Stoffe und Schnitte, wickeln sich in Stoffbahnen, drehen sich vor dem Spiegel, bewundern gegenseitig ihre schlanken Figuren, geraten außer sich über Organzabänder, emaillierte Gürtelschnallen oder Handwärmer aus Pelzen.
Eine Tante hat Maria eine Maschine geschenkt und das Nähen beigebracht. Es ist ein wuchtiges Gerät, aus Gusseisen gefertigt und mit einem Fußpedal angetrieben. Angelika darf nicht an der Maschine arbeiten. Das traut Maria ihr nicht zu. Bis Ostern will sie ein neues Kleid fertig haben. Stunde um Stunde sitzt sie hinter der Maschine, die Stirn gekräuselt wegen des schlechten Lichts, dreht das Schwungrad, tritt die Pedale, schiebt unter dem Surren des Rädchens eine Naht nach der anderen unter den Stepper, befeuchtet den Finger, fädelt immer neue Fäden ein. Angelika sieht, wie sie sich manchmal aufrichtet und den Rücken streckt.
Es wird ein Kleid aus einem Batist mit kräftigen Rot- und Gelbtönen, ohne Korsett und mit einem Rock, dessen Weite in Wadenhöhe gebauscht ist, der die Füße bis zu den Knöcheln sehen lässt und dort durch eine enge Passe zusammengehalten wird. Einen Humpelrock also, ganz nach der Mode. Angelika mag den Rock nicht, weil man damit nur kleine Trippelschritte machen kann. Auch Glockenröcke und ausgestellte Bahnenröcke kann sie nicht leiden. Sie sagt es Maria, aber Maria bleibt bei ihrem Humpelrock. Angelika ist mehr für gerade Röcke mit breiten Faltenpassen. Was ihr außerordentlich gefällt, sind große Hüte. Sie zeichnet einen mit breitem, geschwungenem Rand, einen anderen mit einer überdimensionalen Schleife und langen, lila eingefärbten Pleureusenfedern, aufgeputzt mit Kornähren und Rosengirlanden; einen dritten mit riesigen Edelweißblüten und Glitzerspangen. Bizarre Formen erscheinen auf dem Papier: eckig und spitz, drapiert mit Schmetterlingen, Käfern und Vögeln. Maria schüttelt den Kopf: »So was kann man nicht machen.«
Im Sommer lässt sich Maria überreden, einen von Angelikas Kleiderentwürfen auszuarbeiten. Eine Tunika aus durchsichtigem Musselin hat sie ausgesucht, bei der das untere Kleid durchschimmert und in einer breiten, mit Blumen bestickten Bordüre endet. Stunden verbringen sie damit. Immer wieder muss Angelika anprobieren, steht vor dem Spiegel und dreht sich, und als es endlich fertig ist und sie an einem Sonntagmorgen darin zum Frühstück erscheint, vergisst Willy das Kauen. »Geli, wie schön du aussiehst!« Nie ist ihm Angelika so weiblich vorgekommen. Alle sind dieser Meinung. Die Mutter klatscht in die Hände: »Dreh dich mal, dreh dich!« Angelika breitet die Arme aus und dreht eine kleine Pirouette. »Alle Achtung«, sagt der Vater und pfeift anerkennend durch die Zähne. »Das hast du dir also allein ausgedacht …« Das helle Rot des weichen, duftigen Stoffes lässt die Konturen ihres Körpers erahnen. Die seidigen Haare, mit Perlmuttklammern aufgesteckt, die aufrechte Haltung und die Art, wie sie den Kopf dreht und lacht, sorgen für ein Seufzen des Vaters. »Ihr werdet mir alle viel zu schnell groß.« Maria ist stolz. Immer wieder zupft sie an ihrer Schwester herum. Als sie so alt war wie Angelika hat sie von einem ähnlichen Kleid geträumt. Aus Leinen und Seide hätte es sein sollen, mit einer Posamentenborte und einer gemusterten Bluse aus Batist mit Spitzen und Àjour-Stickereien an den Ärmeln. Aber damals war der Stoff zu teuer.
Im Frühjahr bietet eine Putzmacherin Maria Näharbeiten an und bald schon sitzt sie über kleinen Aufträgen wie Taufkleidern und Brautschleiern, näht Blüten, Federn und Goldvögel auf ausladende Strohhüte, repariert Atlasrosetten und Spitzen, bessert Handschuhe aus. Angelika gefällt, was Maria tut und wieder beginnt sie Hüte zu entwerfen. Bizarre, absonderliche Gebilde bringt sie aufs Papier und bittet Maria, sie der Putzmacherin vorzulegen. Maria zieht die Sache hinaus. Als die Putzmacherin vorbeikommt, um Marias Arbeiten abzuholen, zögert Angelika keinen Moment. Sie rennt in ihr Zimmer, greift sich einen Stapel Skizzen, die sie in der Stube auf dem Tisch ausbreitet und sagt zu der verwunderten Frau: »Alles von mir. Und ich kann Ihnen noch viel mehr zeigen.« Die Putzmacherin tritt an den Tisch, zieht eine Brille aus ihrem Etui, sieht die Blätter flüchtig durch und fängt an zu lachen: »Was für eine blühende Fantasie! Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Du scheinst dich zu interessieren. Aber weißt du, was vor den Entwürfen kommt?« Sie wird ernst. Forschend sieht sie Angelika ins Gesicht. Dann hebt sie den Finger: »Zuerst muss man die Materialien kennen. Was du da zeichnest, ist nicht machbar. Hüte werden jedenfalls nicht draus.« Ihr Lachen springt Angelika nach. Noch am Abend ist sie wütend, schimpft auf den Kunstverstand der Putzmacherin, verteidigt ihre Entwürfe, erklärt, sich nur noch richtiger Kunst widmen zu wollen. Mode sei etwas ganz anderes.
Die moderne Zeit
Weihnachten ist vorbei und das neue Jahr hat noch keine Kontur. Da steht Willy in der Küche und schwenkt Einladungskarten durch die Luft: »Sie machen einen Kunstklub auf. Im Gereonshaus, grad um die Ecke. Mit einer Ausstellung französischer Künstler geht es los. Vier Karten hab ich. Mutter, Vater und Angelika, ihr müsst mit! Sie zeigen ganz moderne Sachen, nicht das Übliche. Da werden wir was zu sehen kriegen.« Willys Stirn ist gerötet, seine Augen eifern. Er hat Informationen fast aus erster Hand. Schon Wochen vorher hatte es Gerüchte gegeben, aber nichts Genaues. Zwei Frauen hätten die Idee gehabt und auch der Maler Jansen sei mit dabei. Eine der Frauen, Olga Oppenheimer, eine Jüdin, wolle im Gereonshaus ein Atelier und eine Mal- und Zeichenschule einrichten; die andere, Emmy Worringer, werde sich um Ausstellungen kümmern. Stadtbekannte Malweiber seien es, sagt Willy und lacht. Er ist voller Bewunderung für Olga Oppenheimer. Alles, was er über sie weiß, sprudelt aus ihm heraus, wo und mit wem sie studiert hat und was sie malt. Und welche Ideen hinter dem Klub stecken. »Sie arbeiten ganz frei, ohne festes Programm. Vor allem wollen sie moderne Kunst zeigen – endlich!«
Tagelang spricht er von nichts anderem. Angelika lässt sich anstecken. »Vielleicht kann ich dort Zeichenunterricht bekommen?« Der Vater sieht sie an, als habe sie Unerhörtes ausgesprochen.
Angelika kann kaum erwarten, dass es endlich los geht mit den Ausstellungen. Unbedingt will sie dabei sein. Wochenlang bettelt sie. Der Vater will selbst sehen, was sich im neuen Klub tut, auch die Mutter und Maria. Richard verzichtet, weil es keine Karten mehr gibt. Angelika hat Glück und darf mitgehen. Sie ist jetzt 12 Jahre alt.
Nochmal so viele Jahre bleiben ihr nicht. Die Hälfte ihres Lebens liegt hinter ihr.
Am Eröffnungstag trägt sie das neue Kleid, das ihr Maria genäht hat. Sie fällt auf. Auf der Straße drehen sich Leute nach ihr um.
Am Gereonshaus hängt ein Schild:
Mal- und Zeichenschule Olga Oppenheimer
Kopf-Modelle, Akt-Modelle, Stillleben,
Anfragen, Prospekte usw., Gereonshaus, V. Stock
Zimmer 198, Telephon B. 1797
Angelika ist gespannt Olga Oppenheimer zu sehen. Sie legt sich zurecht, wie sie sie ansprechen und von ihren Bildern erzählen könnte. Als Leiterin der Zeichenschule wäre sie sicher interessiert. Vielleicht würde Frau Oppenheimer sie auffordern, ihre Sachen mitzubringen und zu zeigen. Vielleicht würde sie sich dafür einsetzen, dass sie einen Platz in der Zeichenschule bekäme.
Aber Olga Oppenheimer sieht Angelika nicht. Sie steht in breiten Gesundheitsschuhen und einem weiten, blau-gelb-gestreiften Reformkleid ohne Korsett vor einem unruhigen Gemälde mit zackigen Linien und gibt jedem der Hereinkommenden die Hand. Sie hat eine rundliche Figur, trägt die Haare kurz, dazu einen handtellergroßen Ohrschmuck aus Perlen, der fast bis auf die Schultern baumelt. Neben ihrer Freundin Emmy Worringer und dem Maler Jansen wirkt sie überlegen und Angelika findet, dass sie zu dem gezackten Bild passt, vor dem sie steht: modern und selbstbewusst.
Während die Eltern mit dem Maler Jansen im Gespräch stehen, bleibt Angelika in ihrer Nähe; aber so sehr sie sich auch bemüht, Frau Oppenheimer hat keinen Blick für sie. Zu beschäftigt ist sie mit anderen Besuchern, schüttelt Hände, lacht und gestikuliert, hebt das Sektglas, während ihre Perlenohrringe funkeln.
Willy kommt und zieht Angelika von Bild zu Bild: Sérusier, Delaunay, Picasso, Hodler und Klimt. Es sind auch zwei Bilder von einem Holländer namens van Gogh dabei. »Es sind die ersten, die von ihm nach Köln kommen. Sie kosten das Stück 2000 Mark. Sieh dir das an!«, schwärmt er vor einem Bild mit blauen Blumen, aber Angelika hat nur Augen für Olga Oppenheimer. »Ich will sie fragen, ob sie mich in ihrer Schule aufnimmt«, flüstert sie Willy zu, der ihr einen Vogel zeigt und zornig den Kopf schüttelt: »Bist du verrückt? Also was du bloß im Kopf hast! Was meinst du, was der Vater sagt? Mach erst mal die Schule fertig. Dann kann ich dir vielleicht helfen. Aber jetzt halt den Mund davon!« Er lässt sie vor einem riesigen Bild von Picasso zurück. Sie steht da, sieht auf bunte Farbfelder, hört, wie jemand das Bild lobt, woraufhin alle klatschen. Sie dreht sich um und in diesem Moment sieht Olga Oppenheimer zu ihr hinüber und lächelt.
Alle Monate gibt es wechselnde Ausstellungen, auch von jüngeren und unbekannten Künstlern. Die Räume sind ständig gefüllt mit Bildern und Menschen. Einmal liest der Dichter Däubler aus seinem ›Nordlicht‹ vor, ein andermal spielt der Komponist Ramrath sein neuestes Werk. Immer wird hinterher diskutiert.
Angelika hat das Gefühl, die moderne Welt sei in die Nachbarschaft gezogen. Mit Willy studiert sie Zeichnungen von Max Slevogt, Franz von Stuck, Alfred Kubin, Käthe Kollwitz und Lyonel Feininger. Die Farben und Formen, denen sie begegnet, finden sich bald auf Entwürfen für Stoffe, die sie sich ausdenkt. Maria ist ganz begeistert davon. »Solche Stoffe müsste es geben«, sagt sie und ist sicher, dass man sie gut verkaufen könne. Leider kennen sie niemand, der Stoffentwürfe sucht.
Willy hat sich ein Bärtchen stehen lassen. Es macht ihn männlicher und ein bisschen verwegen. Neuerdings sammelt er Noten für Operetten, hängt über Büchern, liest alles, was er von Bakunin, einem russischen Anarchisten, in die Hände bekommen kann. Die Schriften verändern seine Sprache, sein Denken, ja sogar seine Stimme. Die Kaiserbilder hat er feierlich verbrannt. Stattdessen spricht er über Revolutionen, ist überzeugt davon, dass sich das Schicksal der vielen Benachteiligten nur mit Revolten verbessern lässt und dass dieser Kampf gegen all die Institutionen geführt werden müsse, die Privilegien schaffen. Mit dem Buch in der Hand steht er da, rezitiert, was er mit Rotstift unterstrichen hat: »Entfesselt die soziale Revolution! Zerstört alle Einrichtungen der Ungleichheit, gründet die wirtschaftliche und soziale Gleichheit aller, und auf dieser Grundlage werden sich Freiheit, Sittlichkeit und Menschlichkeit aller erheben!« Fragend sieht Angelika ihn an, was ihn zum Lachen bringt. »Ach, für dich hab ich was anderes«, sagt er und kramt in einer Schublade, aus der er ein zerfleddertes Heft zieht, befeuchtet den Finger, blättert darin herum. »Hier ist es. Hör mal! Das Stück heißt Weltende.« Er macht eine bedeutsame Pause und liest: »Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut, in allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei und an den Küsten – liest man – steigt die Flut. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken.« Angelika muss lachen über die entzweigegangenen Dachdecker. Willy meint, dass damit der Kaiser und die Auswirkungen des Halleyschen Kometen beschrieben seien. Damit ist Willy in seinem Element. »Keiner braucht künstliche Autoritäten, weil kein Mensch das Leben eines anderen bestimmen darf.« Angelika versteht nicht. »Heißt das, dass keiner dem anderen was zu sagen hat?«
»Nicht ganz. Natürlich erkenne ich Autoritäten an. Aber nicht alle. Wenn es sich um Stiefel handelt, wende ich mich an einen Schuster; handelt es sich um ein Haus, so befrage ich einen Architekten. Dennoch gibt es keine unfehlbaren Autoritäten, nicht einmal in ganz speziellen Fragen. Ich setze in niemanden unbedingten Glauben. Das würde aus mir nur einen dummen Sklaven machen.« Er kommt auf den Kaiser zu sprechen, auf dessen Politik und endet bei der Kunst.
Angelika weiß nicht immer, was er meint. Aber Willys Reden und Meinungen, auch seine Zeichnungen, hinterlassen Spuren. Die Modezeichnungen verändern sich. Gesichter und Körper werden ausdrucksstärker, Schmuck und Beiwerk weniger. Sie arbeitet ohne müde zu werden, verliert sich ganz in Skizzen, Linien und Perspektiven. Oft zerrinnt jedes Zeitgefühl. Manchmal kommt sie spät zu den Mahlzeiten und vergisst Dinge für die Schule. Sie träumt davon, die Schule zu verlassen und eine Malerin zu werden. Immer wieder fängt sie davon an. Die Mutter hört nicht mehr hin, der Vater schimpft auf Willy, meint, dass der ihr Flausen in den Kopf setze, dass Frauen an Kunstschulen gar nicht zugelassen seien und sie Pläne dieser Art streichen könne. Woraufhin Angelika aufspringt, die Tür hinter sich zuknallt und sich für den Rest des Tages nicht mehr sehen lässt.
Sie fühlt sich nicht ernst genommen. Willy, der sie mit verheulten Augen und einem zerknüllten Papier in der Hand auf dem obersten Treppenabsatz des Hauses findet, rät ihr, nichts mehr davon zu sagen. Für ein Mädchen sei das ein schwerer Weg, wenn nicht sogar unmöglich. Sie schimpft und tobt. »Sag mir einen Grund! Nur einen guten Grund. Sind meine Sachen nichts? Sag es ruhig. Dann werde ich dran arbeiten! Aber Willy, nur dass du es weißt, aufgeben werde ich nicht!«
Nur der Eltern wegen gibt sie sich Mühe in der Schule. Die Schullektüren sind Pflicht; lieber liest sie die verbotenen, die ihr Willy beschafft: ›Hauptmanns Ratten‹ und ›Ibsens Nora‹. Gerne würde sie zeichnen, aber gezeichnet wird nicht. Handarbeit steht im Stundenplan. Socken und Tischdecken sind die Ergebnisse dieser Stunden; sie sind für die Aussteuer gedacht. Die Handarbeitslehrerin ist streng und lässt keine Ungenauigkeiten durchgehen. Sie lobt nur selten. Die anderen Mädchen sind stolz auf ihre Arbeiten. Für Angelikas Lust am Zeichnen haben sie nichts übrig.
Sie ist froh, dass die Eltern ihr erlauben, in Begleitung von Willy die Ausstellungen im Gereonsklub zu besuchen. Die Abendveranstaltungen allerdings verbieten sie ihr. Das käme alles noch früh genug, sagt der Vater. Haarklein muss Willy ihr dann berichten, ganz genau will sie alles wissen: wer alles da war, wer was gesagt hat, wer wie aussah.
Im Oktober gibt es 15 Bilder eines Malers zu sehen, der in München für Furore sorgt. Er heißt Franz Marc und Willy hat alles an Informationen beschafft, was zu diesem Künstler greifbar ist. Er ist auch im Bilde über eine neue Münchener Kunstvereinigung, der er Großes vorhersagt. Angelika betrachtet die vielen Tierdarstellungen, besieht sich die Farben, die Bewegungen, versucht sich die Linien einzuprägen, die sie zu Hause nachmalt.
Monate später wird ein Vortrag eines Bonner Künstlers angekündigt, dessen bunte, leuchtende Bilder Angelika besonders gefallen. Dass man das nicht verpassen dürfe, dessen ist sich Willy sicher und setzt alles daran, Angelika mitnehmen zu dürfen. Der Vater ist skeptisch. Angelikas Interesse an der neuen Kunst ist ihm nicht geheuer. »Sie ist doch viel zu jung für so was.«
»Aber es fängt schon um halb sieben an und spätestens um neun ist Schluss. Lass sie doch dabei sein. August Macke hat uns was zu sagen. Er war in Paris, hat die Modernen gesehen.«
Es dauert zwei Tage, bis sich der Vater durchringt. Er ist selbst interessiert und erlaubt ihr für eine Stunde mitzugehen.
August Macke fällt schon auf, als er den Raum betritt. Er ist jünger, als Angelika erwartet hat, vielleicht ein paar Jahre älter als Richard. Er ist von dunklem Typ, die Haut seines Gesichts noch braun vom Sommer. Seine Haare sind kurz und gescheitelt, die Augen lebendig und forschend; der schwarze Schnurrbart passt zu ihm. Selbstsicher kommt er näher, lacht nach allen Seiten, schüttelt Hände. Er hat so eine ellenbogenkräftige Art, die Angelika gefällt. Er trägt ein Tweed-Jackett und dunkle Flanellhosen. Mit ihm strömt eine Menge Leute in den Saal, darunter seine Frau, die ein auffallendes selbst genähtes Kleid aus grüner Seide trägt, das Angelika genau betrachtet, um Maria davon zu berichten.
Macke referiert zum Thema »Worte, Töne, Farben«. Zuerst liest er alles vom Blatt ab. Streng und steif steht er vorne am Pult. Ab und zu fällt ihm eine Haarsträhne in die Stirn, die er immer wieder zurechtrückt. Er hat geübt, man sieht und hört es, aber irgendwie passt dieses Steife und Angespannte nicht zu ihm. Dass er sich beim Sprechen zum Ernst zwingen muss, reizt ein paar Künstler, die im Hintergrund sitzen. Kichern kommt auf. Angelika sieht, wie sie geduckt glucksen, wie alles in Gelächter übergeht, wie sich einer ein Taschentuch vor den Mund hält und ihm Tränen über das Gesicht laufen. Als er es nicht mehr aushält, schließlich herausplatzt und die ganze Reihe zu prusten anfängt, fällt auch alles Offizielle von Macke ab. Grimassen schneidend steht er vorne, fängt an, in einer undefinierbaren Sprache zu sprechen, was sich ulkig anhört und immer neue Lachsalven provoziert. Angelika versteht nicht, was daran so lustig sein soll. Willy flüstert ihr ins Ohr, dass Macke die japanische Schauspielerin Hanako nachahme. Angelika weiß nicht, wer Hanako ist, denkt, dass es eine lustige Figur sein muss, denn alle kreischen und johlen. Macke steht jetzt seitlich vom Pult, zieht mit den Fingern die Augen zu Schlitzen, bewegt sich mit Trippelschritten hin und her, imitiert die piepsige Stimme einer Frau, die etwas zählt und immer wieder zählt, weil etwas zu fehlen scheint. Er verzieht das Gesicht zu einem Fragezeichen, zählt erneut, kratzt sich am Kopf, die Stimme wird gehetzter, weinerlicher, bis er im allgemeinen Gelächter so tut, als bräche er zusammen. Einer fängt an zu applaudieren, dann alle. Sie bestürmen Macke mit Fragen, jeder will etwas von ihm wissen oder ein Bild erklärt haben.
Dann entsteht ein plötzliches Tohuwabohu. Leute klettern auf Stühle und Bänke, alles schreit durcheinander und Emmy Worringer versucht vergebens, durch Schellen dem Lärm ein Ende zu machen. Angelika begreift nicht, weshalb es so laut wird, warum alles so dermaßen durcheinander gerät und sogar der Vater wütend aussieht. »Jetzt gibt es was!«, ruft Willy amüsiert, als sich ein bärtiger Mann in einem doppelreihigen Ulster durch die Reihen zwängt und auf ein Bild des Malers Campendonk zeigt, das eine hagere Kabarettsängerin mit einem verlebten Gesicht darstellt. »Warum holen sich die Maler von heute ihre Objekte am liebsten aus der Kloake?«, schreit der Mann, woraufhin ein anderer zurück schreit: »Sie Korsettfabrikant, Sie haben doch die meisten Kunden aus der Kloake!« Neues Geschrei erhebt sich; im allgemeinen Tumult versuchen Damen mit Erfrischungen für Ruhe zu sorgen. Angelika will nach einer Limonade greifen, als der Vater sie fortzieht: »Du gehst jetzt sofort nach Hause. Und Willy geht mit.«
»Endlich tut sich was«, sagt Willy, als er mit Angelika um die Ecke biegt. Es nieselt ein wenig, aber Willy merkt nichts davon. »Das ist es, was Kunst ausmacht. Sie muss was auslösen! Verstehst du? Die Leute sollen drüber nachdenken!« Willy ist außer sich. »Das ist erst der Anfang«, sagt er, während er sich eine Zigarette anzündet und von Macke anfängt. Angelika wird aus Willys Erklärungen nicht klug. Sie denkt an das Bild von Campendonk. »Warum hat sich dieser Mann so aufgeregt?«, fragt sie. »In deinem Katalog haben wir auch solche Bilder gesehen. Sie waren von einem Maler aus Paris.« Willy betrachtet sie von der Seite und grinst. »Du meinst Toulouse-Lautrec. Gutes Beispiel. Der passt auch nicht jedem. Es gibt immer noch zu viele, die meinen, dass Kunst nur schön zu sein hat. Blumen und bunte Felder, du weißt schon. Da bist du mit deinem kleinen Denken schon viel weiter, Schwesterchen«, lacht er und schiebt sie, zu Hause angekommen, zur Tür hinein. »So, jetzt aber … Gute Nacht. Ich geh noch mal zurück. Wenn du brav schlafen gehst, erzähl ich dir morgen die Fortsetzung.«
Willy gefällt es, als es heißt, August Macke habe die Geschicke des Gereonsklubs übernommen. Die Mutter verzieht das Gesicht. »Und was ist mit den beiden Frauen? Es ist überall das Gleiche. Da haben Frauen eine Idee und was passiert? Ein Mann kommt und jeder meint, damit ginge alles besser.«
»Macke ist ein Segen für den Klub. Er hat beste Kontakte zu Sammlern und Künstlern«, hält Willy dagegen, »dadurch wird der Klub bekannter und internationaler. Er will die Leute vom Blauen Reiter nach Köln bringen. Das ist die Künstlergruppe. Das bedeutet was.«
»Das kann die Oppenheimer auch.« Angelika ist sicher, dass Macke sich in den Vordergrund drängt, aber Willy wiegelt ab. »Es ist doch gleich, wer was für den Klub tut. Hauptsache, es geht voran.«
Angelika findet trotzdem, dass Macke sich zu sehr in den Vordergrund spielt. Überhaupt stehen in allen wichtigen Ämtern Männer in der vordersten Reihe: in der Schule, in der Kirche, in den Parteien. An Kaufhausecken und belebten Straßen sieht sie manchmal Frauen der Arbeiterorganisationen stehen. Sie halten Transparente in die Luft, fordern gleichen Lohn für gleiche Arbeit, Wahlrecht und Bildung für Frauen.
Anfang des neuen Jahres geschieht, worauf Willy gehofft hat. Der Gereonsklub stellt Bilder der Gruppe ›Blauer Reiter‹ aus: Campendonk, Kandinsky, Kirchner, Marc, Rousseau und Macke sind dabei. Zeitungen berichten und aus dem gesamten Rheinland strömen die Besucher. An allen Wochenenden ist Willy dabei. Er hat Angelika und dem Vater freien Eintritt verschafft, was beide auskosten. Angelika ist stolz und glücklich, vergleicht Farben und Motive. Wochenlang ist die Ausstellung Gesprächsthema.
Gleichzeitig feiert der Vater den Erfolg der SPD bei den Reichstagswahlen, schimpft auf Bismarck und glaubt an ein großes Zeichen. »Stärkste Partei! Hab ich es nicht gesagt?« Er entkorkt eine Flasche Wein und füllt Gläser. »Ihr werdet sehen: Damit ist die Klassenherrschaft in Deutschland endlich vorbei! Doppelt so viele Stimmen wie das Zentrum! Das muss man sich mal vorstellen.« Auch Willy ist sicher, dass sich einiges ändern wird. »Das bedeutet, dass die Hälfte des Volkes genug hat vom Säbelrasseln. Und genug vom Wettrüsten, vom Kaiser und diesen preußischen Junkern.«
Es ist April, als die Kölnische Zeitung ein Riesenschiff auf der Titelseite abbildet. »Eines der größten Schiffe der Welt, der der englischen White Star Line gehörige Riesendampfer Titanic, ist auf seiner ersten Fahrt von Europa nach Amerika schwer zu Schaden gekommen, wenn er nicht ganz verloren ist.« Die Zeitung liegt auf der Hobelbank, in der Werkstatt des Vaters, dem Angelika jeden Mittag Kaffee bringt. Sie stellt sich vor, wie Wasser durch Bullaugen, Ladeluken und Lüftungsschächte dringt, wie Menschen um Hilfe schreien, im kalten, schwarzen Wasser ersaufen und das Riesenschiff auf den Grund des Meeres sinkt. Der Vater bleibt gelassen. »Alles reiche Leute«, meint er, »die werden sie schon nicht sinken lassen. Unsereins, ja das wäre was anderes.« Da ist er wieder bei seinem Thema: bei ungerechten Verhältnissen, bei den Arbeitern, die alles schlucken müssen, deren Löhne kaum zum Leben reichen. »Sie glauben nicht, dass sie Macht haben. Aufstehen müssten sie endlich, aktiv werden. Stattdessen lassen sie sich abschieben in die Elendssiedlungen am Stadtrand.« Der Vater traut den Sozialdemokraten einen Wandel zu, besonders jetzt nach den gewonnenen Reichstagswahlen. Auch Willy ist überzeugt davon. Von ihm weiß Angelika, dass sich die Sozialdemokraten für Gleichberechtigung und bessere Bildungschancen für Frauen einsetzen. »Ist es nicht ungerecht, dass Frauen für gleiche Arbeit so viel weniger bekommen als Männer? Wir brauchen Gleichberechtigung in allen Belangen. Ich bin sicher, dass bald auch Frauen Universitäten und Hochschulen besuchen dürfen.«
»Auch Kunstschulen?« Willy nickt. Er sitzt beim Mittagessen, hat sich den Teller mit Kartoffeln vollgeladen. »Übrigens ist eine Riesenschau in Planung. In einer neuen Halle am Aachener Tor. Eine internationale Sache wird das. Überhaupt, wie jetzt alles voran geht. Die Hohenzollernbrücke ist fertig und eine direkte Bahnverbindung Berlin-Paris soll es auch geben. Das ist die moderne Zeit. Alles wird international. Auch die Kunst. Wir sind anders als die Düsseldorfer, die die Ausstellung nicht haben wollen, weil sie die Franzosen fürchten. Namen wie Cézanne und Matisse darf man ja dort kaum aussprechen. Der Kaiser mag so was auch nicht. Das macht ihm Angst, weil er es nicht versteht. Aber er soll seine konservativen Kunstansichten in Berlin lassen. Jedenfalls ist das Gerüst für die Halle schon hochgezogen. Im Mai ist Eröffnung. Ich wette, dann wackelt der Dom.« Er hebt die Hand und zählt an den Fingern auf, was es in Köln demnächst noch alles zu sehen gibt.
Die Ausstellung, von der Willy so angetan ist, füllt Zeitungen und Litfaßsäulen. Auf Straßenbahnen und Plätzen kleben Plakate. Von der Ausstellungshalle am Aachener Tor zieht sich die Schlange der Wartenden so lang, dass man das Kartenhäuschen nicht sieht. Über zwei Stunden dauert es, bis Angelika und Willy an der Kartenkontrolle vorbei sind. »Was du jetzt zu sehen kriegst, ist das Beste, was es momentan gibt«, sagt Willy und grinst. »170 Künstler, über 600 Werke. Ausschließlich moderne Kunst.« In der Zeitung hat Angelika etwas von umstrittener Malerei gelesen und will von Willy wissen, um was denn gestritten wird. »Um alles«, sagt Willy und schiebt Angelika in den Saal. Vor manchen Bildern stehen die Leute in Trauben. Die meisten Namen hat sie schon gehört: Kandinsky, Marc, Kirchner, Kokoschka, Hodler. Viele Franzosen sind dabei. Angelika weiß nicht, wo sie hinsehen soll. Ihre Augen sind in ständiger Bewegung. Ein ganzer Saal ist einem jungen Spanier namens Picasso gewidmet, ein anderer dem Norweger Edvard Munch. Anders als in den kommerziell ausgerichteten Salons sind die Exponate in schwarzen Leisten auf kalkweißen Wänden und mit einreihiger Hängung ausgestellt, was eine völlig ungewohnte Wirkung hat. Zudem hängen sie nicht dicht gedrängt, sondern seltsam luftig: Bilder mit bunten, schrillen Farben, verzerrten Perspektiven und groben Pinselstrichen. Da sind Hände, gemalt wie rohe Fleischklumpen, verrenkte Glieder, Gestalten mit leeren Gesichtern und bläulichem Teint.
Wie alle anderen Besucher auch, so stehen sie oft orientierungslos vor den Bildern. Willy macht Witze über die Organisation: »Da haben sie einen Ehrenausschuss mit Industriellen, Honoratioren und Intellektuellen, drucken Plakate, lassen in der ganzen Stadt Postkarten verteilen und dann vergessen sie den Bildern Namen der Künstler und Titel beizufügen. Wie soll man denn 600 Bilder identifizieren? Mit den Nummern kann doch keiner was anfangen. Und ein Ausstellungskatalog ist auch noch nicht erschienen.«
Auch wenn sie nicht immer weiß, wer was gemalt hat, spürt Angelika doch, dass das, was sie sieht, etwas zu sagen hat. Willy, immer einen Schritt hinter Angelika, schafft es kaum, ihr zu folgen. Er ist froh, als sie endlich in einen Erfrischungsraum gelangen, wo sie in hochlehnigen Korbstühlen an einem Glastisch sitzen und Limonade trinken.
Dann stehen sie wieder vor den Bildern, oft lange, amüsieren sich oder diskutieren. Manchmal verlangsamen sie ihre Schritte, um die Bemerkungen der Leute zu hören. Einige machen sich lustig. Viele reagieren mit Kopfschütteln und Beschimpfungen. Von Koloritexzessen und Linientobsuchtsanfällen ist die Rede. Wo Angelika Neues entdeckt, sehen die meisten nur Kokolores: »Was sind das für Verrenkungen und Verzerrungen? So bewegt sich doch niemand!« Eine Frau in einem Pelzmantel, auf dem Kopf trägt sie einen Reiherfederbusch, der senkrecht nach oben stehend einen Turban ziert und zu jeder Bewegung wippt, spricht von einer Schreckenskammer und schüttelt sich. Ein Mann tritt mit seinem Monokel dicht an eine Leinwand: »Das hat doch mit Kunst nichts zu tun! Schmierereien der übelsten Sorte sind das!«
Während sich Angelika in eine Federzeichnung von Paul Klee vertieft, entdeckt Willy einen Bekannten. Der Mann hat auffallend blaue Augen und ist gut gekleidet. Sie stehen zusammen und reden und als Willy sich endlich von ihm verabschiedet und sich wieder bei Angelika einhakt, flüstert er ihr zu: »Der will auch Maler werden. Ist mit Macke befreundet und hat gute Kontakte zur Galerie Feldmann am Hansaring. Ein merkwürdiger Kerl! Er kommt aus Brühl und studiert Kunstgeschichte und Psychologie in Bonn. Vielleicht hört sich deshalb alles ziemlich abstrus an, was er sagt.«
Eine ganze Weile steht Angelika vor einem Frauenkopf aus Gips von Milly Steger. Als eine Besucherin vor dem Werk ein Gedicht vorliest und erwähnt, dass es Milly Steger nicht erlaubt worden sei, an einer Kunstakademie zu studieren, denkt Angelika an die Sozialdemokraten und das Bildungsversprechen und ruft: »Das wird jetzt alles besser!« Auch die Bilder von Marie Laurencin beeindrucken sie. Willy hat gelesen, dass sie mit einem Dichter liiert ist, was Angelika den Bildern anzusehen glaubt. Es sind luftige und blasse Motive, grazile Mädchen, umsäumt von Blumen oder begleitet von Katzen und Hunden. »Siehst du, Willy. Als ob Frauen in der Kunst nichts zu suchen hätten. Dabei sind sie genauso in der Lage, große Werke zu schaffen wie Männer auch.« Der Gedanke, dass auch Marie Laurencin an die Kunst glaubte, macht sie froh. Seit diesen Bildern schwärmt sie für Katzen.
Zu Angelikas Geburtstag hat die Mutter Streuselkuchen gebacken. Sie hat auch ein weißes Damasttuch auf dem Tisch ausgebreitet und eine Vase mit Barbarazweigen geschmückt. Die Mutter sieht schlecht aus. Sie hat eine Totgeburt hinter sich und geht gebeugt. Sie streicht Angelika über den Kopf: »Schon wieder ein Jahr.«
Maria und Richard schenken Angelika eine Haarspange, von den Eltern kommt Nützliches: Strümpfe und ein Unterhemd. Willy bringt ihr eine in buntes Papier gewickelte Zigarrenkiste mit Kohlestiften. Dankbar sieht sie ihn an. »Ich hab noch was«, sagt er und tut geheimnisvoll. »Nach dem Essen nehm ich dich mit, aber psssst.« Den Finger am Mund zwinkert er ihr zu.