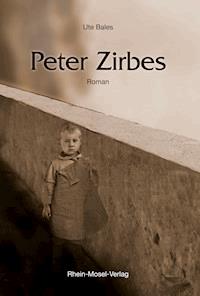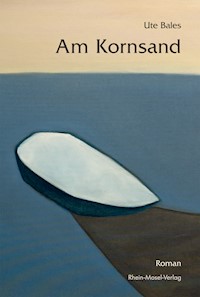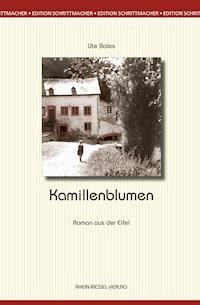Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1907 eröffnet Johanna Ey unter ärmlichen Bedingungen einen Backwarenladen in Düsseldorf. Sie ist 43 Jahre alt und nach einer leidvollen Ehe mit einem Alkoholiker, in der sie zwölf Kinder geboren hat, von denen nur vier am Leben blieben, völlig auf sich gestellt. Weil bei ihr Kaffee und Brötchen billig sind, wird der Laden bald zum Treffpunkt von Studenten der nahen Kunstakademie. Johanna, selbst ein entbehrungsreiches Leben gewöhnt, fühlt sich den mittellosen Künstlern verbunden. Wer kein Geld hat, darf anschreiben lassen, gelegentlich auch mit Bildern bezahlen. Bald beginnt hinter der Brötchentheke eine Kunstsammlung zu wachsen. Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges muss Johanna ihr Geschäft schließen. Die ihr verbliebenen Bilder verkauft sie und entdeckt, dass man damit Geld verdienen kann. Sie spielt mit dem Gedanken, eine Kunsthandlung aufzumachen. 'Was meinst du, kann ich das schaffen, jetzt, wo ihr alle im Krieg seid?', fragt sie einen der Künstler. 'Wenn eine es schafft, dann du', antwortet der.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 725
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2014 e-Book-Ausgabe Rhein-Mosel-Verlag Brandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel. 06542/5151, Fax 06542/61158 www.rhein-mosel-verlag.de Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-89801-829-6 Ausstattung: Marina Follmann Lektorat: Michael Dillinger Korrektorat: Melanie Oster-Daum Titelfoto: Johanna Ey, 1929 © Galerie Remmert und Barth, Düsseldorf
Ute Bales
Großes Ey
Die Lebensgeschichte der Johanna Ey
Roman
RHEIN-MOSEL-VERLAG
* * *
Friedrichplatz, 1933
Sie waren zu fünft. Mit Fäusten und Pistolenkolben schlugen sie gegen die Tür. Glas splitterte, dann flammte Licht auf. Es waren nur Sekunden, in denen sich ihre Blicke trafen. Sie sah schwere Marschstiefel, Koppelzeug und Schulterriemen, lederne Patronentaschen. Die Stimmen der Männer waren schrill, die Gesichter jung. »Kannst du nicht grüßen?« Einer von ihnen kam auf sie zu, riss ihr den Arm in die Höhe. »Du sollst grüßen!« Sie stand barfuß, in einem geblümten Hausmantel, den sie fest um den Körper zog. Ihr Puls jagte. »Raus hier! Die Galerie ist geschlossen. Ihr habt hier nichts …«
»Pass auf, was du sagst.« Breitbeinig stand er vor ihr: »Weißt du, was mit Leuten passiert, die nicht grüßen?« Seine Schritte dröhnten, als er auf den Wandschrank zuging, die Schubladen aufriss. Sie stürzte ihm hinterher, zerrte an seiner Schulter. »Finger weg!« Dann ging alles rasend schnell. Blätter flogen aus der Lade, Bilder von den Wänden, Rahmen platzten, Glas zerschellte. Fassungslos taumelte sie zurück, zitternd, sah gehetzte Augen, fluchende Münder, brutale Hände, hörte das heisere Lachen des Anführers. »Was erlaubt ihr euch? Was tut ihr? Die Bilder!« In ihrer Not rief sie um Hilfe, stellte sich schützend vor eine Flusslandschaft, versuchte einzugreifen, als einer ein Messer zückte, sie beiseite schob, die Leinwand aufschlitzte, von der Sekunden später nur noch Fetzen an der Wand hingen. Immer mehr Bilder flogen auf den Boden, der schwarze Inhalt einer Tuscheflasche ergoss sich über einen Stapel Zeichnungen, tropfte auf das Portrait eines Mädchens. »Das ist die Stunde der Säuberung!«, schrie ihr einer ins Gesicht. »Ausmerzen werden wir diese Schmierereien von Geisteskranken! Alles Schund und Schande!« Er zertrat ein Aquarell, zerriss Zeichnungen, die auf der Chaiselongue lagen, zeigte auf lose Blätter: »Raus mit dem Dreck! Alles raus hier! Raus!« Hände rafften, rissen, zogen; Münder brüllten, grölten, lachten. Sie spürte, wie ihr Schweiß ausbrach, wie eine klebrige, dunkle Angst sie würgte. Wie ein Strudel war diese Angst; sie sah sich darin versinken, wollte schreien und konnte es nicht. Die Knie knickten ihr ein. Schritte entfernten sich, kamen zurück. Etwas schleifte über den Boden. Dann quietschte die Tür.
Neben dem Sofa kauerte sie und horchte. Lange wusste sie nicht, ob sie allein war. Draußen schlugen Hunde an. Die Geräusche der Nacht waren andere geworden. Männer gingen herum, vernichteten, zerstörten, schändeten.
Nicht die kleinste Illusion hatten sie gelassen. Es gab keine Lügen mehr.
Ratinger Straße, 1907
Bis weit in die Nacht hatte sie Kisten geschleppt, Schränke und Regale eingeräumt, Geschirr gewaschen. Jetzt kniete sie auf nassen Dielen und schrubbte den Boden. Auf und nieder gingen die Schultern. Kreuz und quer rieb sie jedes einzelne Brett, kratzte Dreck aus den Fugen zwischen den Hölzern, den sie mit einem Wasserschwall aus dem Blechkübel wegschwemmte.
Der Rücken schmerzte, als sie sich aufrichtete. Das Hemd klebte. Sie trat ans offene Fenster, atmete nach Kühle. Über ihr hielt der große Wagen, die Deichsel flackerte. Schwan und Leier, mit ausgebreiteten Flügeln kopfüber fliegend, stürzten sich vom breiten Band der Milchstraße in eine flimmernde Weite. Schwarz und scharf hoben sich Häuser und Bäume in ein bläuliches Licht. Filigranes Pflanzengerank war wie mit der Schere geschnitten, stand leicht und körperlos, wie Tintengekritzel auf Papier.
Die Straße war ihr vertraut. Die letzte Wohnung lag nur ein paar Häuser entfernt. In dieses Haus waren sie vor Jahren schon einmal eingezogen, nur in ein anderes Stockwerk. Die Sicht aus dem Fenster hatte sich kaum verändert.
Auch damals war Sommer gewesen, der Umzug eine Plackerei wegen der Hitze. Die Kinder hatten mit angepackt und selbst Hermann, schmächtig, in Marias Mädchenkleidern, hatte sich bemüht, Küchenzeug und Wäsche die Stiegen hinaufzuschaffen. Einzig Robert, der seinen Durst nicht bezähmen konnte, war durch die Kneipen gezogen, in der Nacht volltrunken heimgekehrt, hatte die Kinder aus den Betten gerissen, allen Prügel angedroht, zu denen es nur deshalb nicht gekommen war, weil es ihr, aus welchem Grund auch immer, gelungen war, ihn zu mäßigen. Damals hätte sie ihn verlassen sollen.
Eine Weile stand sie, dann rissen sie Stimmen und Schritte auf dem Trottoir aus ihren Gedanken. Sie schloss das Fenster und ging ins Zimmer zurück.
Die Stube war hoch und ohne Enge. Ein Spiegelschrank und ein plüschgrünes Sofa hatten Platz, ein Regal mit zwei Gipsengeln und einer eckigen, gelben Vase, ein grob gezimmerter Tisch mit unterschiedlichen Stühlen, abgewaschen und ordentlich hingestellt, eine Wanduhr mit Pendel, ein Kanonenofen.
Die angrenzende Kammer war durch einen Vorhang abgetrennt. Hermann und Paul schliefen dort, im Kabuff dahinter die Mädchen. Sie hörte, wie Paul stöhnte und sich im Schlaf drehte.
Mit staksigen Schritten überquerte sie die nassglänzenden Dielen.
Im Flur blieb sie vor dem Spiegel stehen, löste den Haarknoten, betrachtete ihr Gesicht, strich eine Haarsträhne hinters Ohr. Mit der dickglasigen Brille, den wirren, lose zusammengebundenen Haaren, den geraden Schultern, dem formlosen, von vielen Geburten in die Breite gegangenen Körper, fand sie sich streng aussehend. Sie legte die Brille ab, betrachtete sich von der Seite: die braune Weste mit den abgenutzten Ärmeln, den verwaschenen Rock, die von der Arbeit rissigen Hände, das Futter, das unter dem Rock hervorsah, die nackten Füße.
Drei Stunden Schlaf blieben noch. Spätestens um vier würde sie den Ofen feuern und die Brotreste vom Vortag, darunter Brötchen und Gebäck, die Bäcker Theisen günstig abgab, aufbacken. Um fünf müsste sie Maria mit den Milchkannen losschicken. Um sechs den Backladen aufschließen. Und dann würden die ersten Kunden den Laden betreten und nach Brot und Semmeln verlangen. Das Fräulein Venske – in einem Bügelzimmer arbeitete sie – hatte zugesagt, ab sofort alles Brot bei ihr zu holen. Auch der Koch vom Ochsen und die Stallburschen aus der Schmiede wollten zu den ersten Kunden gehören, die beiden Kindermädchen von Rechtsanwalt Marx und der Notar Küpper. Sie trat näher an den Spiegel. Nur noch wenige Stunden. Tief atmete sie. Ihre Brust hob sich. Sie setzte die dicken Gläser wieder auf und horchte nach dem schweren Ticken der Wanduhr.
Wickrath
1864, in einem Schaltjahr, war Johanna im Zeichen der Fische geboren, was Mitgefühl und Herzlichkeit, aber auch Kraft und Mut sowie eine hervorragende Intuition ahnen ließ. Als jüngste von fünf Geschwistern hatte sie ständig um etwas zu kämpfen und so war sie geübt in Ausdauer und Zähigkeit, aber auch im Aushalten von Angst.
Der Vater, ein dickwanstiger Mann mit roten, kräftigen Händen und einem breiten Gesicht, das ganz von grauen, kritisch blickenden Augen beherrscht wurde, arbeitete als Tagelöhner in der Wickrather Lederfabrik. Er war ein Choleriker, der das Trinken nicht lassen konnte, was ihre ohnehin ärmliche Lage hoffnungslos machte und für eine unablässig schwelende Angst sorgte. Bei der geringsten Kleinigkeit blitzte er auf und schlug zu. Unzählige Male hatte Johanna gesehen, wie die Mutter zusammenzuckte, wenn er die Tür aufschloss und mit beduseltem Kopf, nach Schnaps stinkend, über den Flur torkelte, wie sie versuchte, ihn zu besänftigen, wie sie sich die Hände vor das Gesicht hielt, wenn er sie packte, wie sie sich duckte, wenn er auf sie einschlug, sie verdammte und beschimpfte, wie dünn ihre Stimme wurde, wenn sie sich wehrte, wie hilflos ihr Gewimmer, wenn er sie im Waschkeller einschloss.
Auch die Kinder waren Opfer seiner brutalen Launen. Der Trost der Mutter blieb vage: Alles würde besser, wenn erst das Frühjahr käme, wenn der Regen aufhörte, wenn der Krieg gegen Frankreich gewonnen, wenn König Wilhelm Kaiser wäre.
Oft dachte Johanna, dass sie die Ursache der Schläge sei, dass sie nur gehorsamer sein müsse, fleißiger im Haushalt, besser in der Schule. Sie half, wo sie konnte, putzte und nähte, brachte gute Noten nach Hause. Seine Ausbrüche musste sie trotzdem aushalten.
Den Schlägen, den bitteren Worten und Enttäuschungen setzte sie Träume entgegen: Abhauen, weglaufen, fortgehen – einmal hätte sie es fast getan. Als nämlich ein Wanderzirkus ins Dorf kam, vom Marktplatz bis zum gegenüberliegenden Haus ein Drahtseil spannte, vier Meter hoch, und eine Tänzerin in einem blauglitzernden Kostüm mit einer Balancierstange über das Seil ging und ein anderes Mädchen, mit brauner Haut und funkelnden Ohrringen, in einem bunten, weiten Rock auf dem Platz tanzte, wäre sie fast in einen der Wagen gestiegen. Unter dem staunenden Gemurmel der Menge hatte der Vater der Mädchen das Horn geblasen, ein alter Mann die Trommel geschlagen. Die Mutter mit hoher Frisur, rot gemalten Lippen, in einem schwarzen, eng anliegenden Samtmieder über einem grünschimmernden Rock hatte die Spielorgel gedreht. Später war sie mit einer Schellentrommel herumgegangen. Einen Pfennig hatte Johanna hineingeworfen und den Kopf gehoben, als die Frau ihr zunickte. Stolz war sie gewesen auf ihren Beitrag. Fortgeträumt hatte sie sich in eine Welt der schönen Farben, der lachenden Eltern, der glücklichen Kinder. Wenn sie doch auch so hätte tanzen können. Vielleicht hätte dann der Vater das Horn geblasen, die Schwestern hätten gesungen, die Brüder das Tamburin geschlagen. Alle hätten sie bewundert, die Biegsamkeit ihres Körpers, die Eleganz, mit der sie über das Seil tanzte.
Aber zu Hause gab es keinen Vater, der das Horn blies, keine fröhliche Mutter.
Die Jahre wurden lang.
Nichts wünschte sie sehnlicher herbei als das Ende der Schulzeit. Als es endlich soweit war, schickte der Vater sie zum Arbeiten in den Haushalt eines Wickrather Apothekers. Zwar musste sie für drei Mark im Monat kochen, backen, waschen und putzen, Stunden am Plättbrett stehen, nach den Kindern sehen und Botengänge erledigen – auch ließ man sie keine Minute aus den Augen und auch nicht ohne Arbeit – aber wenigstens blieben ihr die Schläge und Beleidigungen erspart. Das Geld, das sie verdiente, nahm der Vater. Immer wieder versuchte sie, heimlich etwas davon der Mutter zu bringen; aber jedes Mal prügelte der Vater ihr auch den letzten Pfennig heraus: »Betrügerin, Nestbeschmutzerin! Den eigenen Vater bestehlen!«
Neusser Straße, Düsseldorf
Sie sah sich noch in diesen Kleidern, in denen sie von zu Hause fortgegangen war: dem grob gewebten Rock aus blauem Leinen, der bis auf die schweren Holzschuhe reichte, der hellen Bluse, darüber ein schlecht sitzendes Mieder, dem grauen Schultertuch mit Fransen. Auch an einen Pappkoffer erinnerte sie sich, der mit einer Kordel zugeschnürt war. Mit einer Pferdebahn war sie gefahren, die sich vom Bahnhof aus in die Stadt bewegte. Immer, wenn jemand die Hand streckte, hielt die Bahn und als auch sie schließlich das Zeichen gab und kurz darauf mit ihrem Gepäck auf der Straße stand, wusste sie zunächst nicht, in welche Richtung sie ihre Schritte lenken sollte. Zwei Straßenarbeiter hatte sie gefragt, die in unterschiedliche Richtungen wiesen. Dem Hinweis des Älteren war sie gefolgt, hatte einen umtriebigen Markt überquert, war dann auf eine Einkaufsstraße gestoßen, wo es Läden gab mit Schlipsen und Taschentüchern, optischen Geräten, Stoffen und Tüchern. Laut war es gewesen, ungewohnt die Geschäftigkeit. Satte Basstöne von Hupen mischten sich ins Geklingel der Radfahrer, ins Poltern der Fuhrwerke, ins Klappern der Pferdehufe. Bäckerjungen liefen mit Körben auf dem Rücken, Damen in Ausgehkostümen mit Parasols und Federhüten trippelten auf Knopfstiefeln, Herren in Trenchcoats mit Pelzkragen und dunkle Passanten in abgetragenen Kaftanen gingen vorbei, ein Zeitungsverkäufer schrie: »Der längste Tunnel der Welt ist eröffnet! Gotthardeisenbahn nimmt Verkehr auf! Der längste Tunnel der Welt! 15 Kilometer lang …«
Vor einer Musikalienhandlung musizierten Liliputaner. Eine sehr kleine Frau spielte Xylophon und sagte dabei Gedichte auf. Sie trug einen Glasvogel auf dem Kopf, der bei jeder Bewegung wippte. Am Ende der Straße war Johanna in eine schmutzige Gasse mit Kneipen gebogen. Aus geöffneten Fenstern tönten Gläserklirren und Stimmengewirr; es roch nach Fettgebackenem. Es beruhigte sie zu sehen, wie die Leute sich veränderten, wenn sie die schmalen Gassen betraten. Wie der eine ausgiebig schnäuzte, weil er dachte, nicht gesehen zu werden. Wie ein anderer heimlich, vor dem matten Spiegel des Fensters einer Schneiderei, einen Kamm zückte.
Erleichtert war sie gewesen, endlich aus Wickrath wegzukommen. Das Angebot einer Tante, in einem Düsseldorfer Haushalt in Stellung zu gehen, hatte sie bereitwillig angenommen und sofort ihren Dienst im Haus des Apothekers aufgesagt. Der einzige Wermutstropfen blieb die Mutter. Sie litt und sorgte sich. »Düsseldorf is eso groß un du eso jung und eso allein …«
Groß war Düsseldorf wirklich. Überall wurde gebaut: Wohnungen, Schulen, Kirchen, eine Kanalisation, Kesselwerke, Drahtziehereien, Schmieden. Es war also wahr, was sie der Herrschaft abgelauscht hatte: dass Düsseldorf noch in diesem Jahrhundert eine Großstadt würde, dass ein enormes Wachstum angesagt sei, dass die Stadt bald aus allen Nähten platzen und selbst das Umland in außerordentlicher Weise profitieren würde. Von einer Kunsthalle war die Rede gewesen, von neuen Rheinbrücken, von Eisenbahnanschlüssen. »Wer et jetzt schafft, nach Düsseldorf zu kommen, hat ausgesorgt. Von überall kommen sie, aus Belgien, aus der Eifel.« Von Stahl- und Eisenwerken hatte die Tante gesprochen, von Kesselfabriken und Blechwerken. Namen wie Poensgen, Henkel, Haniel & Lueg waren gefallen. Bedeutsam genickt hatte die Tante und dabei die Augenbrauen hochgezogen.
Das Haus, in das Johanna einzog, lag direkt an der Neusser Straße. Es war ein langgestreckter schmutziggrauer Bau, in dem sich Dienstboten und Küchenpersonal Zimmer teilten und auf engstem Raum lebten. Aus dem ganzen Rheinland kamen sie; auch aus Wickrath war eine dabei, eine verhärmte Alte, die ihrer Herrschaft alles nach dem Feinsten richtete, in der Neusser Straße aber in Unrat und Lumpen lebte.
Im Zimmer No. 15 wurde Johanna ein eisernes Bettgestell zugewiesen, dessen Drahtnetz gerissen war, weswegen die dünne, verwanzte Matratze bei jeder Bewegung in den Rücken stach. Gleich daneben stand ein weiteres Bett, mit einem Strohsack belegt, das eine Schneiderin gemietet hatte, die Johanna in aller Frühe gehen und spätabends kommen sah. Manchmal redeten sie miteinander. Meist aber waren sie zu müde. Sie schliefen Rücken an Rücken.
Der Haushalt der Bolaerts, in dem Johanna Anstellung fand, war aufwändig und kostspielig; die Herrschaft alt und selbstgefällig. Das Haus war überladen mit Stuck, verschnörkelten Schnitzereien und riesigen Gemälden. Es gab einen Eingang für Herrschaften, wo sich am Eisenportal eine Messingschale für Visitenkarten befand. Der Eingang für Dienstboten und Lieferanten befand sich hinter dem Haus. Ein schmaler Weg führte durch den Hof, vorbei an einem Teich, in dem bemooste Karpfen schwammen.
Eigenhändig und mit mahnenden Worten hatte ihr der Hausherr ein helles, gestreiftes Waschkleid für den Sommer gegeben, ferner ein wollenes für den Winter, zwei Schürzen, zwei Häubchen.
Dr. Justinus Bolaert war früher Unternehmer gewesen. Seine Erfahrungen gab er in regelmäßigen Treffen an seinen Sohn weiter, der seit kurzem der neugegründeten Maschinenfabrik Losenhausen vorstand. Neben Kochen und sonstiger Küchenarbeit gehörte es zu Johannas Pflichten, bei den Treffen der beiden Herren Kaffee und Kuchen zu servieren und bei sämtlichen Empfängen behilflich zu sein. Außerdem übernahm sie das morgendliche Wickeln der Beine des Hausherrn, die geschwollen und voller Wasser waren. Dr. Bolaert war in einem bejammernswerten Zustand, klagte unaufhörlich über Schmerzen in den Knochen, bewegte sich nur selten, was den übergewichtigen Körper noch anfälliger machte. Seine Unzufriedenheit ließ er am Personal aus. »Nix schaffen wolln se, aber Milch trinken und Eier essen. Hier glaubt jeder, das Geld läge auf der Straße und man bräucht es nur aufzuheben.« In Johannas Beisein schimpfte er über das Lumpenvolk, das er sich ins Haus geholt hätte, klagte, dass man für Haus und Garten nur noch Gesindel bekäme, das einem die Haare vom Kopf fräße. Er schimpfte auf die Politik, besonders über einen irischen Unternehmer namens Mulvany, der im Zuge der Überlegungen eines neuen Hafens für Düsseldorf vorgeschlagen hatte, die große Rheinschleife zwischen Heerdt und Lörick durch ein gradliniges Flussbett abzuschneiden und das alte Flussbett zu einem Hafen auszubauen. »Das ist doch nicht zu fassen! So eine Borniertheit! Wenn die das machen, wenn sie das wirklich machen, liegt Düsseldorf nicht mehr am Rhein! Stellen Sie sich das mal vor, Frollein Stocken. Wenn Düsseldorf nicht mehr am Rhein läge …«
Die gnädige Frau konnte ebenso unausstehlich werden. Jeden Pfennig drehte sie dreimal um. Manchmal kam sie in die Küche gelaufen, sah in die Töpfe, beschwerte sich, dass Kohle vergeudet und Kartoffeln zu dick geschält würden.
Anfangs war Johanna unsicher, wenn sie Wein- oder Sektflaschen öffnen, Gläser bis zu einem bestimmten Punkt füllen, Teller und Besteck ordnungsgemäß platzieren musste. Sie wusste auch nicht, wie sie sich auf den dicken Teppichen bewegen sollte, in den Salons mit den Kronleuchtern, dem Stuck und dem kostbaren Mobiliar. Bald aber ging es; auch mit den 14 Mark Lohn kam sie leidlich zurecht. Der Arbeitstag zog sich über zwölf Stunden, jeden zweiten Sonntag hatte sie Ausgang. Meist nutzte sie die freie Zeit, um sich auszuruhen und die eigene Wäsche zu waschen. Manchmal ging sie mit Auguste und Bertha – Weißnäherinnen, mit denen sie Tür an Tür wohnte – an den Rhein, sah auf die schleppende, lichtgrüne Flut, spazierte mit ihnen über die Königsallee oder durch den Hofgarten. Nach Wickrath fuhr sie selten und wenn, dann nur um die Mutter zu sehen.
Robert
Robert Ey stammte aus einem Dorf in der Nähe von Breslau und war durch einen Onkel in einer Düsseldorfer Brauerei untergekommen. Auf Hochglanz hatte er seine Stiefel gebracht und die Härchen auf der Oberlippe gezwirbelt, um ihr zu imponieren. Jeden Morgen und immer an der gleichen Stelle kreuzten sich ihre Wege. Wie eine heimliche Verabredung schien ihr das. Irgendwann nickte er ihr zu. Von da an dauerte es nicht lange, bis er sie ansprach.
Er war 19, ein halbes Jahr älter als sie, und seine dunklen Augen, das Lachen, die Lücke zwischen den Schneidezähnen gefielen ihr. Auch sein selbstbewusster, aufrechter Gang. Versunken stand sie in der Bolaertschen Küche am Herd, starrte auf den blubbernden Topf, dessen Deckel sich beständig hob, dabei knallende, zischende Wassertropfen auf die heiße Fläche spritzte, und dachte an das, was er ihr am Morgen zugeflüstert hatte: »Von Mittwoch an arbeite ich in der Mälzerei. Vierzig Mark im Monat krieg ich. Später gibts mehr. Und Radfahren lernen werd ich auch. Ich hab schon eins, so gut wie neu. Am Sonntag, wenn du frei hast, gehn wir in den Hofgarten. Dann wolln wir mal leben. Immer nur schuften und schaffen hält doch keiner aus. Ausführen werd ich dich. Was es kostet, ist egal. Am Sonntag warte ich auf dich, am Mittag, an der Hauptwache, Kasernenstraße!«
Die ganze Woche dachte sie an nichts anderes als an den Sonntag. Sorge mischte sich in diese Gedanken, weil sie kein Geld hatte und kein richtiges Kleid. Bis sie auf die Idee kam, sich bei Auguste Rock und Weste zu leihen, war es Samstag. In der Nacht zum Sonntag konnte sie kaum schlafen. In aller Frühe musste Auguste ihr mit dem Brenneisen die Haare wellen, aber die Strähnen blieben widerspenstig und ließen sich nur an den Spitzen formen.
Breitbeinig stand ein Uniformierter vor der Hauptwache. Jugendliche Radschläger warteten auf Zuschauer. Einer grinste sie an: »Eene Penning, dann schlonn ech en Rad.« Eine Frau mit einem Kinderwagen mühte sich, einen Bordstein zu überwinden. Gewinsel drang aus dem Wagen. Ein Stück die Straße hinauf lehnte Robert an einem Laternenpfahl. Eine Kappe seitlich übers Ohr geschoben, die Haare rechts und links mit Pomade hinter die Ohren gebürstet, eine Hand in der Hosentasche, in der anderen eine Zigarette, die er aus der hohlen Hand rauchte, kam er ihr entgegen. Er trug einen hellen Anzug, den sie nie an ihm gesehen hatte, sein Schnurrbart glänzte. Verlegen gab sie ihm die Hand.
Sie hatte nichts dagegen, als er vorschlug, zuerst durch die Gassen zu spazieren und dann eine Fahrt zu machen. Das Reden übernahm er. Scheu ging sie neben ihm. Von der Schützenallee aus fuhren sie mit der Pferdebahn den Wehrhahn hinauf über die Grafenberger Chaussee bis Grafenberg. Von dort gingen sie zu Fuß.
So weit draußen war sie nie gewesen. Die Luft tat gut. Monatelang hatte sie nur den Küchenbrodem geatmet, den Qualm der Kohlen, und jetzt hatte sie den weiten Himmel über sich und strotzende Alleebäume. Der Himmel war wie mit Schleiern verhangen, ein schwimmendes Grau, dann und wann kam die Sonne durch, fiel durch erstes Baumgrün, fleckte den Weg und wärmte. April war es. Kinder in hellen Kleidern hüpften an der Hand der Eltern, Ammen schoben hochrädrige Kinderwagen, ein junges Paar stolzierte Arm in Arm. Johanna sah ihnen nach: sie, mit fest korsettierter Taille und weit fallendem Rock, das Haar mit einem Florentinerhut bedeckt; er in einem blauen Paletot mit Pelzkragen und einem Kaiser-Franz-Joseph-Bart. Polizisten mit Pickelhauben und Schnurrbärten begutachteten ein Automobil, eine Bahn klingelte vorbei. Eine Windböe ließ Knaben jubeln, die sich auf einer Wiese mit einem Drachen vergnügten.
Lange saßen sie auf einer Bank, erzählten sich von ihrer Arbeit. Manchmal sahen sie sich an. Robert hätte sie gern umarmt, aber Johanna war scheu. Immer wieder wies sie ihn zurück.
In ein Restaurant lud er sie ein. Alte Männer standen an der Theke, eine rauchende, dichte Traube. Musik gab es keine, dafür aber Limonade und Bier. Sie verzogen sich in einen entfernten Winkel, rückten dicht zusammen. Immer wieder versuchte Robert ihre Hand zu fassen. »Einen Tabakladen werd ich aufmachen«, schwärmte er, »Pfeifen soll es dort geben, hölzerne und irdene, auch Tabak, Zigaretten aus Russland und der Türkei und Etuis für Zigarren. Auch für Zigaretten. Wenn ich das Geld zusammen habe, gehts los. Ein Leben lang in der Brauerei, wie mein Vater, das halt ich nicht aus. Nein, wirklich nicht.« Er zog eine Dose aus der Hosentasche.»Sieh mal. Compagnie Laferme. Tabak- und Zigarettenfabriken Dresden.« Eine lächelnde Frau in einem bauschigen Kleid war abgebildet, die sich eine Zigarette anzündete. »Rococo, Nummer 85a«, las Johanna, während Robert die Dose öffnete und zwei halbe Zigaretten aus einem Papier wickelte. »Der Tabak kommt aus der Türkei. Palmenbäume gibt es dort und Leute mit Turbanen.« Er nahm eine der Hälften, klemmte sie zwischen die Lippen, tastete nach einem Schwefelholz, das er in der Brusttasche seines Hemdes verwahrte, ratschte damit über den Absatz seines Schuhs, zündete die Zigarette an, indem er kräftig daran zog. Für einen Moment schloss er die Augen und lehnte sich genüsslich zurück. Tief inhalierte er. Dann richtete er sich auf und blies Johanna lachend den Rauch ins Gesicht.
Mit Robert war alles hell gewesen. Jeden Abend, auf dem Weg von Bolaerts zu ihrer Pension, hatte er vor dem Frisörsalon am Carlsplatz auf sie gewartet, sich, wenn sie näherkam, bei ihr eingehakt und ihr Schönes ins Ohr geflüstert. Schönes, so viel Schönes, wie sie nie gehört hatte. Jedes Mal, wenn sie ihn warten sah, jubelte etwas in ihr. Bis in die Neusser Straße hatte er sie begleitet, ihr im Hauseingang einen schnellen Kuss gegeben und war dann, ohne sich umzusehen, in Richtung Kasernenstraße gegangen, wo er ein Zimmer in einer Mansardenwohnung bewohnte.
In diesem Zimmer war sie nie gewesen, die Wirtin duldete keinen Damenbesuch. Jeden zweiten Sonntag, wenn sie frei hatte, führte er sie aus, schlenderte mit ihr durch den Hofgarten, die Königsallee entlang, die Bilkerstraße hinunter über den Carlsplatz, von dort zum Corneliusplatz, wo sie manchmal im Café Cornelius einkehrten und Sahnekaffee tranken. Auch zum Ananasberg waren sie gegangen, hatten am Selterswasserbüdchen eine Selters mit einem Schuss Himbeersaft und zwei Strohhalmen bestellt und um die Wette getrunken. Einmal, am Rhein, hatte er ihr eine Tasche geschenkt, eine Pompontasche aus schwarzem Samt mit aufgestickten grünen Vögeln und einem Verschluss aus Perlen. Innen liegend ein Brief: Du bist mein. Auf einer Brücke war das gewesen, von der er in die Fluten gespuckt hatte. Sie erinnerte sich, wie sein weißer Speichel hintrieb und sich in den Wellen des Rheins auflöste.
Für diese Sonntage lebte sie, denn da spürte sie das, was andere Leben nannten. Der Mutter hatte sie von ihm geschrieben. Dass er gut zu ihr sei und sie beschenke. Zurückgekommen war nur Sorge: dass sie auf sich aufpassen müsse, sich hüten solle vor großen Versprechungen, zu viele seien schon ins Unglück geraten.
An Robert mochte sie alles. Seine Gestalt, die Stimme, den überlegenen Ausdruck in den Augen, den Duft seiner Rasierseife. Vor allem seine Pläne. Immerzu redete er von seinem Tabakladen, erläuterte ihr den Unterschied zwischen Tabaksorten aus Arabien und den westindischen Inseln, erklärte ihr die Wirkungen von Kau-, Schnupf- und Rauchtabak, wusste alles über das Schneiden, Zerfasern, Trocknen und Rösten, hatte vor, in einer Dosenfabrikation eigene Tabaksdosen herstellen zu lassen, mit Gravur seines Namens und seines Geschäftes, auch eigene Streichholzschachteln. »Das wird was. Du könntest dort arbeiten, wenn wir erst mal richtig zusammen sind.«
Richtig zusammen sein mit ihr wollte er und hatte ihr auch dargelegt, wie er sich das vorstellte: Zuerst der Tabakladen, in dem sie beide arbeiten würden, dann heiraten, dann eine Wohnung in der Nähe des Hofgartens, später vielleicht ein Haus und Kinder. Längst gab es für Johanna keine wohligeren Momente als die, in denen er von Zukünftigem sprach. Eine festliche Hochzeit würde es geben, mit gutem Essen und richtiger Tanzmusik. Einen glitzernden Brautschleier würde sie tragen und einen Ring, die Stelle bei Bolaerts aufkündigen, stattdessen im Tabakladen bedienen, eine weiße Schürze mit Rüschen tragen, eine Kasse mit Kurbel bedienen. »Jawohl, gnädiger Herr, sehr gern, zwei Ägyptische.« Auch die Wohnung war in ihrer Vorstellung groß und geräumig, mit genügend Platz für Kinder. Eine richtige Familie würden sie sein, Robert ein guter Vater. Anders als in Wickrath. Alles wäre wärmer und liebevoller. Alle wären glücklich.
Uccle, Belgien
»Jetzt biste int Unglück jekommen«, hatte die Mutter gesagt, bevor Johanna abreiste. Dabei empfand Johanna es als Glück, dass sie das Kind nicht in Wickrath zur Welt bringen musste. Dort war alles dunkel und drohend. Nach einem schrecklichen Wutanfall hatte der Vater ihr die Tür gezeigt. Nutzlos war der Versuch der Mutter gewesen, sich ihm entgegenzustellen. Zu dünn hatte sich ihre Stimme erhoben, dann war sie unter Schlägen verstummt.
Ein paar Tage war Johanna bei einer Tante untergekommen. Auch die Tante geizte nicht mit Vorwürfen, hielt Strafpredigten, warf ihr Leichtsinn vor, prophezeite ihr, auf der Straße zu landen.
Am Schlimmsten aber war es mit Robert. Weggestoßen hatte er sie, als sie heulend vor ihm stand und sie betrachtet, als sei sie aussätzig. Alle Schuld hatte er ihr zugeschoben, ihr vorgeworfen, ihn ruinieren zu wollen. Danach war er tagelang nicht aufgetaucht. Als sie ihn vor der Brauerei abfing, tat er so, als kenne er sie nicht. Mehrfach schrieb sie ihm, schilderte ihre Angst und bat um Hilfe, bis sie schließlich einsehen musste, dass sie allein war mit der Angst, mit der Sorge, mit der Bitterkeit.
Die Straßen lagen voller Matsch, als sie ihre Tasche packte.
Mit einem Pferdefuhrwerk, das Fässer geladen hatte, kam sie bis Gladbach, verbrachte den halben Tag auf dem Bahnhof. Reklametafeln priesen Persil an und Kölnisch Wasser, Reisende saßen auf Bänken, ein Liebespaar stand eng umschlungen. Sie hatte nur eine Hoffnung und einen Gedanken: dass es in Belgien besser würde. Dort lebte Barbara, ihre Schwester, die sich nach Uccle verheiratet hatte und ihr mit Zustimmung des Schwagers ein Zimmer räumte.
Die Zeit bis zur Geburt überbrückte sie mit Küchenarbeit in einer Schänke. Ständig hielt sie sich den Bauch, zuletzt konnte sie sich kaum noch auf den Beinen halten.
Mit dem Kind kamen Fieber, Schmerzen und Blut.
Klara war ein dralles Kind mit Roberts Augen, das ihr mit der Milch auch alle Kraft aussaugte. Monate blieb Johanna schwach. Sie aß nicht, litt unter den Umständen, für die sie sich selbst die Schuld gab, warf sich vor, dass sie sich auf Robert eingelassen, dass sie ihm seine Versprechen geglaubt hatte. Dann wieder vermisste sie ihn, dachte, dass es doch Liebe gewesen war, fühlte Stolz, dass er um sie geworben hatte. Obwohl sie nichts von ihm hörte, hoffte sie insgeheim auf ein Wiedersehen.
Je länger sie in Uccle war, desto deutlicher spürte sie in den Gesten und Blicken, die Barbara mit ihrem Mann austauschte, dass sie zu einer Belastung wurde. Sie mühte sich, im Haushalt mitzuhelfen, kümmerte sich um die beiden Neffen, nähte und putzte. Ständig dachte sie an Düsseldorf. Einmal, als sie mit Barbara zusammensaß, sprach sie auch darüber, woraufhin ihr die Schwester Faselei und Dummheit vorwarf. »Wo zum Teufel willst du denn hin mit dem Kind? Wer, glaubst du, nimmt dich? Ich kenn eine, die auch so gedacht hat. In der Gosse ist sie gelandet. Du könntest dich und die Kleine doch niemals durchbringen. Ganz schön leichtsinnig warst du mit deinem Robert. Alles hast du dir verpfuscht! Wo soll Klärchen denn bleiben, wenn du arbeitest? Einen Vater hat es nicht. Dein Robert wird sich nicht kümmern. Wenn der sagt, dass es noch andere Männer gegeben hat, ist er fein raus.« Zusammengesunken saß Johanna in der Stube und dachte an Robert. Tränen schossen ihr in die Augen. »Jetzt heul doch nicht«, sagte Barbara und schob eine dampfende Tasse in Johannas Richtung. »Ich muss es dir ja sagen. So wie jetzt kann es hier nicht weitergehn. Die Wohnung wird zu klein für uns alle. Hans mokiert sich. Er hat gemeint, das Beste wäre, wenn du Klara hier lässt. Stell dir vor, er wäre bereit, sie zu nehmen. Dann könntest du zurück nach Düsseldorf, dir eine Stelle suchen. Und uns Geld schicken für das Kind.« Johanna hatte nicht geantwortet, nur mit der Tasse in der Hand dagesessen und obwohl sich alles in ihr sträubte, doch zu dem genickt, was Barbara sagte. »Glaub mir, es ist das Beste. Lass Klärchen bei uns. Hier ist sie versorgt. Wir werden dir sicher nicht den Hals zuhalten. Was braucht so ein Kind denn schon? Mit ein paar Mark sind wir zufrieden. Später, wenn es größer wird, vielleicht etwas mehr.«
Mit erstaunlicher Regelmäßigkeit schrak Johanna aus dem immer gleichen Traum. Es war ihr, als wolle sie etwas zwingen zurückzukehren in die Jahre der Kindheit, ins Haus der Eltern, wo sie so viel Angst ausgestanden hatte. Sie sah den Kiesweg vor sich, der sich hell vom Boden abhob. Der Kies knirschte nicht beim Gehen, sondern war weich wie Moos. Sogar in ihren schweren Holzschuhen fühlte sie sich schwebend. Aber jedes Mal, wenn sie die Tür berühren und das Haus betreten wollte, hinderte sie etwas daran. Es war eine unsichtbare Kraft, die ihr Beine und Arme lähmte. Manchmal, während ihr Blick über das von den Jahren gedunkelte Holz der Tür mit dem verbogenen Griff ging, konnte sie durch den halboffenen Eingang ins Dunkle des Flures sehen: In diesem Moment wusste sie, dass sie alles nur träumte. Noch während des Traumes wartete sie auf das Erwachen, aber richtig wach wurde sie nicht; es war ein quälender Zustand zwischen Schlaf und Traum, der nur selten vor dem Morgen abbrach. Im Erwachen lag eine große Sehnsucht nach etwas Warmem, Schönem. Sie hoffte, dass der Traum zurückkehren möge, dass die Tür sich auftun und jemand mit offenen Armen sie hereinbitten würde. Aber auch andere Träume brachten immer nur Trauer und Bitternis.
Nie mehr Angst
Während der Jahre in Belgien hatte sie ständig an ihn gedacht. Obwohl alles dagegen sprach – hundert Mal hatte ihr Barbara vor Augen geführt, dass sie sich hatte täuschen lassen, dass er sie ins Elend gestürzt, dass sie ihm niemals hätte glauben dürfen – ihre Gedanken an Robert waren begleitet von einem warmen, vertrauten Empfinden, das sich nicht vertreiben ließ, auch nicht in Momenten, in denen sie sich einsam und verlassen fühlte.
Als sie dank der Vermittlung des Schwagers Anstellung und Unterkunft im Haushalt eines Düsseldorfer Notars fand, wühlte sie die Vorstellung, Robert zu treffen, tagelang auf. Das einzige, was sie schwankend machte, war Klärchen. Barbara musste ihr lange zureden, bis sie schließlich einwilligte.
Schon auf dem Weg zurück nach Düsseldorf hatte sie das Gefühl gehabt, als reiße man ihr etwas aus dem Herzen. Das Schnaufen des Zuges, das Pfeifen und Türenschlagen waren nicht so laut gewesen wie Klärchens Wimmern, das sich in ihrem Ohr hielt. Auch die vorbeiziehenden Dörfer, grünende Felder und Wiesen konnten das Bild kleiner Hände, die sich nach ihr reckten, nicht verscheuchen.
Die Arbeit im Haushalt des Notars war eintönig. Sie wäre geblieben, wenn der Notar nicht Monate später an Schwindsucht gestorben wäre. Fortan diente sie bei einem Kommerzienrat, vor dem sie große Befangenheit empfand. Der Kommerzienrat war viel auf Reisen und wenn sich seine Rückkehr ankündigte, mussten tagelang das Haus gereinigt, Kleider aufgebügelt und Blumengestecke gerichtet werden. Dann wurde auch besser eingekauft und gekocht als sonst. Aufgeregte Köche und Kindermädchen schnatterten herum, und wenn er schließlich eintraf, roch es nach herbem Parfum und starken afrikanischen Zigarren, was sie an Robert erinnerte.
An Robert erinnerte sie vieles. In ihrer Vorstellung war er voller Reue, schämte sich für das, was er ihr angetan hatte. Sie malte sich aus, wie es wäre, wenn er Klara sehen könnte. Klara, vor allem Klara. Keine Stunde gab es, in der sie nicht an das Kind dachte. Manchmal spürte sie die Trennung körperlich. Aber bis Uccle war es weit, das Fahrgeld teuer. Ständig nagte die Sorge, dass das Kind sie vergessen könnte. Jeden Pfennig, den sie erübrigen konnte, schickte sie Barbara. Sie schrieb Briefe mit immer gleichem sehnsüchtigem Inhalt, wartete auf Nachricht, hoffte und wünschte.
Es war einer dieser Tage gewesen, an dem das Heimweh nach Klara quälte und marterte. Die Luft war noch kühl, kurz vor Ostern, aber die ersten Sonnenstrahlen wärmten schon. In den Vorgärten blühten Primeln und Vergissmeinnicht. Der Kommerzienrat hatte sie zum Abholen einer Hose in eine Schneiderei am Burgplatz geschickt. Vor den Auslagen eines Hutgeschäfts stand sie, als Robert plötzlich um die Ecke bog. Sie erschraken beide. Als sie grüßte, blieb er stehen. Er redete sich über den Anfang hinweg; sie sah, dass seine Hände zitterten. Dass er in der Benrather Straße einen Tabakladen eröffnet habe, berichtete er, dass das Geschäft gut ginge und er sein eigener Herr wäre, dass er ein Fahrrad angeschafft habe und eine Taschenuhr. Es verletzte sie, dass er sich nicht nach dem Kind erkundigte und sie spürte Betroffenheit, als sie ihn darauf ansprach. »Das Kind, ja, das Kind …« hatte er gestottert und genickt, als sie ihn fragte, ob er wissen wolle, wie alles gegangen sei.
Während der Zeit in Belgien hatte der Vater nie geschrieben. Sie war schon Wochen in Düsseldorf, als die Hauswirtin ihr einen Brief aushändigte, dessen breite, ausufernde Schrift den Absender verriet. Im Öffnen hoffte sie auf Tröstendes, Freundliches. Der Brief enthielt nichts davon. Der Vater empörte sich, dass sie nicht schon längst etwas geschickt habe, wo er sie doch mühsam aufgezogen hätte und sie genau wisse, in welcher Armut sie lebten. »Undankbar bist du! Obwohl wir uns für dich alles vom Mund abgespart haben.«
Sie war daraufhin nach Wickrath gefahren, nicht des Vaters, sondern der Mutter wegen, die sie traurig und verhärmt vorgefunden hatte. Der Vater, die Schnapsflasche in der Hand, umgeben von einem üblen Geruch, hatte ihr Niedertracht und Arglist an den Kopf geworfen und gleichzeitig die Mutter, die heulend, mit verquollenem Gesicht, am Tisch gesessen hatte, beschimpft und beleidigt. »Guck sie dir an, deine Tochter. Da hast du das Ergebnis deiner feinen Erziehung! Zu einem Kind hat sie es gebracht. Hat aber weder für uns noch für das Balg was übrig. Wird in der Gosse landen. Den Anfang hat sie ja schon gemacht.«
Lange war Johanna der leere Ausdruck im Gesicht der Mutter im Gedächtnis geblieben und sie hatte sich vorgenommen, hin und wieder nach Hause zu fahren. Aber immer wieder fand sie Ausflüchte, es nicht zu tun. Fehlende Zeit und mangelndes Fahrgeld waren Gründe, aber auch die wiederkehrenden Träume, in denen ihr das Haus der Eltern verwehrt wurde, hielten sie ab. Auch ein Bild des Vaters verblasste nicht: Wie er sich mit geballten, starken Fäusten, dem roten Gesicht mit den blitzenden Augen vor ihr aufbaute, sie seine Schnapsfahne roch, seine Flüche hörte.
Vor allem aber war es Robert, der sie daran hinderte, nach Wickrath zu fahren.
Obwohl sie sich Jahre nach ihm gesehnt hatte, fehlte ihr zunächst der Mut zu einem Treffen, so dass er sie fast zwingen musste. In einem Café am Corneliusplatz hatte er alles über Klara wissen wollen, jeder noch so kleinen Erwähnung Beachtung geschenkt. Er versprach, mit ihr nach Uccle zu reisen, brachte ihr bei weiteren Treffen eine Holzrassel, eine Spieluhr sowie das Porto für ein Paket an Klara. Als hätte er sie für die Zeit in Belgien entschädigen wollen, schenkte er ihr einen Mantel, lud sie ins Schiffchen zum Tanzen ein, machte Ausflüge mit ihr. Wieder empfand sie dieses Warme und Vertraute in seiner Nähe. Bald reservierte sie alle Sonntage für ihn. Seinetwegen verhandelte sie um einen freien Nachmittag und half im Tabakladen aus.
Robert arbeitete akribisch und ohne Pausen. Es imponierte ihr, wie er sich mit seiner Ware auskannte, seltene Tabaksorten am Duft erkannte, sich beim Feilschen der Kunden nicht beirren ließ. Es beeindruckte sie, wie er stundenlang über den Büchern saß, kalkulierte und Preise festsetzte, geschickt war im Verkauf.
Lange hatte sie sein Drängen abfangen können. Immer, wenn er sich ihr näherte, wenn seine Hände über ihren Körper tasteten, hatte sie von Klara angefangen, von der Zeit in Uccle, von der Angst und dem festen Vorsatz, so etwas nie mehr erleben zu wollen.
Aber dann war dieser Sonntag gekommen. Draußen hatte es geregnet und sie war durchnässt im Tabakladen angekommen. An diesem Tag war Robert so feinfühlig mit ihr umgegangen, hatte Kaffee gekocht und ihr seine Jacke um die Schultern gehängt. Lange hatte er sie im Arm gehalten, fest und immer fester, hatte von Heirat gesprochen und dass sie keine Angst mehr haben müsste, er sie immer schützen würde. »Nie mehr Angst«, hatte sie geflüstert und alles war so hell und leicht geworden. Da waren seine dunklen, ernsten Augen gewesen, die Hände auf ihrer Brust, die weichen Lippen, sein warmer Körper. Fallen gelassen hatte sie sich, alle Schwere losgelassen, jegliche Angst war wie weggeweht, sicher und aufgehoben fühlte sie sich, angekommen an einem guten, wohligen Ort. Nie mehr Angst.
Dann war die Blutung ausgeblieben. Jede Stunde hatte sie sich die Röcke aufgeknöpft, um nachzusehen. Auf Augustes Rat hin setzte sie sich in einen Bottich mit heißem Wasser, aß Petersilie, besorgte sich billigen Rotwein, den sie mit Nelken versetzt eiskalt trank, sprang vom Tisch, wenn sie wusste, dass die Mieter unter ihr nicht zu Hause waren. Nichts davon half. Die Tage und Nächte waren voll von Angst, die immer dichter wurde, zermürbte und lähmte. Die Brüste spannten, schmerzten. Mehrfach hatte sie angesetzt, es Robert zu sagen, aber in der Hoffnung, dass es doch nicht so sei und sie sich vielleicht geirrt hätte, alles wieder verschoben. Verkriechen wollte sie sich, bis die Welt wieder heil wäre.
Sie konnte sich noch an sein Gesicht erinnern, als es endlich heraus war. Gezuckt hatte es um seinen Mund, kalt hatte er sie angesehen. Aufgestanden war er und zum Fenster gegangen. Sie erinnerte sich an das Lachen spielender Kinder, als er einen der Flügel öffnete und hinaussah. Irgendwann hatte er sich umgedreht und gesagt: »Dann heiraten wir eben.« Am gleichen Tag noch hatte er ihr gestanden, dass es um den Tabakladen schlecht bestellt sei, dass er die Außenstände seit März nicht mehr beglichen hätte, auch die Miete nicht. »Ich werde aufgeben und wieder in der Brauerei anfangen. Wenn es so aussieht, bleibt mir nichts anderes übrig.«
Die Hochzeit war ohne jedes Gepränge gewesen. Sie fanden ein möbliertes Zimmer mit Küchenbenutzung in der Grabenstraße. Die Möbel waren abgeschabt, die Tapeten verblasst, die Küche gedunkelt von täglichem Gerauch und Gedampf. Hellhörig war es; ständig polterten Schritte, schrien Kinder, klapperten Teller. Im schmutzigen Treppenhaus stank es permanent nach Sauerkraut und Urin.
Von Anfang an hasste Robert die Arbeit in der Brauerei. Morgens stand er schlecht gelaunt auf. Abends löffelte er mürrisch und wortkarg die Suppe, die Johanna für ihn kochte, beklagte sich, dass er ihretwegen den Tabakladen nicht fortführen könne, ihretwegen die Taschenuhr verkauft habe.
Obwohl ihr die letzten Wochen zusetzten, arbeitete sie bis kurz vor der Geburt im Haushalt des Kommerzienrates. Immer wieder versuchte sie Robert zu überzeugen, Klara zurück nach Düsseldorf zu holen. »Wir sind doch jetzt eine Familie.« Hatte Robert anfangs noch Verständnis für dieses Anliegen gezeigt, so wies er sie jetzt ab: »Ständig liegst du mir in den Ohren. Gleich zwei Bälger? Ich weiß doch nicht mal, wie es mit einem zu schaffen ist!«
Wenn sie an die Jahre dachte, die dann folgten, hatte sie Schwangerschaften und Tod, Schläge und Sorgen um Brot vor Augen. Das zweite Kind, das sie zur Welt brachte – ein Junge – starb bei der Geburt. 26 war sie, als im Jahr darauf, auf Gertrudistag, Maria geboren wurde. Sie im Arm zu halten empfand Johanna wie eine Entschädigung für das Warten und Denken an Klara.
Nach Maria kam Paul. Auf Paul folgten Hermann, Anna Elisabeth, danach Rudolf. Mehrfach wechselte Robert die Brauerei und sie waren von Düsseldorf nach Duisburg, von Duisburg nach Frimmersheim, von Frimmersheim nach Königshoven, von Königshoven nach Kerpen und von dort wieder nach Düsseldorf gezogen, wo sie von einem Jungen entbunden wurde, der nur wenige Stunden lebte. Einen Sommer später, nachdem Robert sie eine Treppe hinuntergestoßen und eine Nacht ausgesperrt hatte, stand sie eine Fehlgeburt durch. Auf die Fehlgeburt folgten Totgeburten: zwei Mädchen, ein Junge. Zwölf Mal hatte sich ihr Bauch gewölbt, vier Kinder waren am Leben geblieben. Rudolf war nur zwei Jahre alt geworden. Abgezehrt und greisenähnlich hatte er zuletzt in seinem Korb gelegen – durchsichtig die gekrampften Händchen auf dem Leinen. An einem Januarmorgen hatten sie ihn aus dem Haus getragen. Spitz und weiß war sein Gesicht gewesen. Den ganzen Weg bis zum Grab hatte sie auf den kleinen Holzsarg mit dem Tannengrün gestarrt, der sich auf den rumpelnden Rädern des Friedhofwagens zuckend hin und her bewegte.
Robert ließ allen Hass auf sein Leben an ihr aus. Verpfuscht nannte er es, vertan. Ein falsches Wort reichte und er prügelte sie windelweich. Nie gab es Ruhe. Wenn er heimkam, stank er nach Schnaps und Rauch, schrie herum, beschimpfte und beleidigte vor allem die Mädchen, denen er regelmäßig an den Kopf schleuderte, dass sie nichts wert seien und ihm nur die Haare vom Kopf fräßen. Die Kinder lebten in ständiger Angst.
Anders als ihre Mutter widersetzte sich Johanna seinen Schikanen wo es möglich war, schlug sogar zurück, vor allem, wenn es um die Kinder ging. Oft, wenn er besoffen dalag, nahm sie ihm Geld aus der Tasche, um Brot zu kaufen. Die hungrigen Kinderaugen, die geduckten, scheuen Blicke, wenn Robert heimkam, die Angst, die sie nur allzu gut kannte, verliehen ihr bisweilen eine Stärke, die Robert zur Weißglut brachte. Außer diesem Mut hatte sie nichts einzusetzen, viel zu wenig brachte das, geknebelt fühlte sie sich, sah keinen Weg, der weiter oder herausführte.
Zwei Mal in all den Jahren hatte sie Klara gesehen. Es waren Treffen gewesen, die ein dumpfes, dunkles Gefühl der Trauer zurückließen. Klara war scheu, hielt Abstand, sprach wenig. Johanna erzählte Barbara von Robert und der Angst der Kinder, bat darum, Klara weiterhin in Uccle lassen zu dürfen. »Bei euch hat sie es besser. Viel besser sogar.« Bei diesen Worten liefen Tränen über ihr Gesicht: »Es ist so, wie es mit Vater war. Vielleicht noch schlimmer. Wie gern würde ich mit allen meinen Kindern fortgehn.«
In der Kaiserswerther Straße war es gewesen. Auf Michaelstag war Robert unerwartet früh aufgetaucht, hatte herumgeschrien, weil das Essen nicht fertig und der ganze Haushalt eine einzige Schlamperei sei. Sie erinnerte sich, dass Lisbeth sich an ihrer Schürze festgekrallt und das Gesicht in den Stoff gedrückt hatte, als Robert mit erhobener Faust und aufgerissenen Augen auf sie zukam, wie die Küche voll gewesen war von seinem widerlichen Atem und seinem grölenden Geschrei. Mit einem schnellen Griff hatte er Lisbeth fortgerissen, dann wie im Rausch auf sie eingeschlagen. Sie sah das Kind über den Boden kriechen, sah Blut an seiner Schläfe, wollte Lisbeth greifen, aber da hatte er ihre Hand gepackt, ihr das Gelenk gedreht, bis sie vor ihm auf dem Boden kniete. »Du Schlampe! Nicht mal was zu fressen kriegt man hier!« Sein Atem ging laut und rau, hart schlug er ihr ins Gesicht, trat nach ihr, griff ihr in die Haare, zerrte sie, presste sie an die Wand, schlug wieder zu, schleuderte ihren Kopf von einer Seite auf die andere, drückte sie erneut gegen die Wand, würgte sie, sie röchelte, er schlug wieder und wieder und wieder. Sie hörte Lisbeth schreien, spürte einen Schmerz im Auge, sah Blut an seinen Händen.
Als er mit ihr fertig war, war ein Auge zugeschwollen, ein rotes Netzwerk feiner Äderchen durchzog das andere, die Lippe war geplatzt, von der rechten Schläfe lief Blut. Als sie es abzuwischen versuchte, lösten sich Haarbüschel unter ihren Fingern. Schniefend und japsend klammerte sich Lisbeth an ihr Bein. Das Kind zitterte, die Augen blickten leer und verloren. Im Nebenzimmer stopfte Robert Kleidungsstücke in eine Tasche. »Mir reichts! Du dreckiges Aas! Jetzt kannst du sehn, wie du fertig wirst!«
Immer wieder war das passiert. Immer wieder war das Essen verkehrt gewesen oder die Essenszeit, etwas stand nicht am richtigen Platz, jemand hatte ein falsches Wort benutzt. Einmal hatte er ihr einen Topf mit heißem Eintopf in den Nacken geschüttet, ein anderes Mal die Pfanne auf den Kopf geschlagen. Ständig hatte sie seine Drohung im Kopf: »Irgendwann schlag ich euch alle tot!«
In der Kaiserswerther Straße war es am schlimmsten gewesen. Wenn sie zurückblickte auf die unzähligen Demütigungen und Lügen, die es vor seinem Verschwinden gab, konnte sie nicht verstehen, dass sie so lange durchgehalten hatte. Eine Nachbarin war gekommen, hatte ihr Andeutungen ins Ohr geflüstert. Auch ohne die Nachbarin hatte sie es gewusst, aber nicht wissen wollen und deshalb fortgeschoben. Dann war Robert immer öfter weggeblieben, zuletzt auch nachts.
An einem Mittwoch war er gegangen. Die letzten Groschen hatte er ihr aus der Kaffeedose geschüttelt, hastig alles zusammengekratzt, ihr Beleidigungen an den Kopf geworfen, mit Schlägen gedroht. Als die Tür hinter ihm zuschlug, war sie zunächst erleichtert gewesen. Dann aber bekroch sie Angst. Angst davor, sich und die Kinder allein durchbringen zu müssen. Angst davor, keine Arbeit zu finden. Angst, mit allem allein zu sein. Ihr halbes Leben hatte sie mit ihm verbracht. Anfang 40 war sie jetzt und klammerte sich an den Gedanken, dass jeder Mensch das Recht hätte, mit seinem Leben etwas anzufangen. Wie so ein Leben anzufangen wäre, wusste sie nicht.
Ratinger Straße 45
Wenn sie nach all den Jahren an Robert dachte, war sein Gesicht verschwommen und dunkel. Auch die Faust, mit der er ihr so oft ins Gesicht geschlagen hatte, war weit weg, ohnmächtig geworden und schwach. Im Backladen in der Ratinger Straße war sie ganz auf sich gestellt. Dafür musste sie aber seine Schläge nicht mehr fürchten.
Nur wenige Schritte waren es bis zum Rheinufer. In der anderen Richtung verlief die Alleestraße; dahinter lag der Hofgarten und nicht weit der Weiher an der Landskrone. Wenn sie aus der Tür trat, linkerhand: Eisenwaren en gros, rechterhand: Hermesmeier & Cie., daneben eine Destillation, weiter unten ein Barbier, der Zähne zog. Gegenüber hatte ein Flickschuster eine Bleibe gefunden, der sich mit seiner Ahle und dem Verkauf von Kohle durchbrachte. Jede Menge Gaststätten gab es: Füchschen, Uel, Goldenes Einhorn, ganz nah die Brauerei ›Zum Uerige‹, auch das Lokal von Benders Marie. Samstags schlug ein Trödler einen Stand vor dem Haus auf: Tücher, Bänder und Knöpfe, manchmal Seifen.
Die letzten Jahre hatte sie beim Bäcker Theisen als Verkäuferin gearbeitet, sich jeden Pfennig vom Mund abgespart und gejubelt, wenn ein Groschen voll war. Niemand hätte ihr eine eigene Frühstückstube zugetraut, schon gar nicht Robert. Sie hörte sein zynisches Lachen, sah seine missbilligend zuckenden Augen. Jahrelang hatte er ihr eingeredet, dass sie ohne ihn nichts sei und nichts zustande bringen würde, dass sie auch die Kinder nicht durchbringen könne, die man ihr ohnehin wegnehmen würde, wenn er nicht wäre.
Für ihren eigenen Laden hatte sie sich alles so gedacht wie beim Bäcker Theisen. Aber dann war es doch ein anderes Gefühl gewesen, als die Tür aufging, die Ladenglocke schellte, Kunden hereinkamen und sich umsahen. Es war wie ein Fest, als sie das erste Brot über den Tresen reichte, das erste Geld kassierte. »Frau Ey! Wenn Sie mir …«
»Ja, ja, gleich!«
»Zwei Brötchen bitte!« Eine Magd mit einem unterm Kinn verknoteten Kopftuch reckte die Hände. »Ja, sofort!« Eine Frau wühlte in ihrer Handtasche, die vollgestopft war mit Papieren und legte einen Groschen auf die Theke. »Und die Brötchen, können Sie die nicht auch morgens vorbeibringen? Ich meine jeden Morgen …«
»Aber sehr gern doch, ja natürlich, wenn Sie mir Ihren Namen und die Hausnummer aufschreiben.« Johanna wickelte zwei Brötchen in Papier. Die Frau notierte etwas und schob den Zettel über die Ladentheke. »Und abrechnen dann jede Woche?«
»Ja, jede Woche, immer montags. Das macht dann meine Tochter.« Johanna warf Maria, die in einem verschossenen Leinenkleid, die braunen Haare streng nach hinten gebunden, neben ihr stand und dampfende Milch in eine Tasse füllte, einen vielsagenden Blick zu. Seit einer Woche trug Maria mit Lisbeth Brötchen aus und jeden Morgen wurden die Wege länger. »Frau Ey, einen Weck bitte! Haben Sie auch Zopf? Und können wir anschreiben lassen?«
»Für mich ein Brot mit Wurst! Und eine Zigarette!«
»Kommt gleich, Herr Schenten.«
Zwei Mal schon war das Fräulein Venske dagewesen, hatte Streuselkuchen für die Herrschaft geholt. Der Notar Küpper hatte Brot verlangt, die Köchin vom Ochsen und die Stallburschen aus der Schmiede waren wegen der Teilchen gekommen. Ununterbrochen reichte sie Ware über die Theke, kassierte, nebenbei schmierte sie mit aufgerollten Ärmeln Brötchen, bediente den schwarzen, eisernen Ofen, dessen Hitze ihr Gesicht rot werden ließ, fuhr mit der Kohlenschaufel in glühende Scheite, bestückte Bleche mit Altbackenem, bepinselte die Brotlaibe und Brötchen mit Wasser und hob bald darauf mittels eines Holzschiebers alles wieder heraus.
»Ja, machen Sie dat denn all ganz allein?« Die Leute fragten, wollten alles Mögliche wissen, blieben und kauften. Dienstfrauen kamen und Soldaten, gegen Mittag waren es Arbeiter aus der Brauerei und ein paar Studenten von der Akademie, die sie noch vom Theisen kannte. Sie besetzten die wenigen Stühle, stützten die Ellbogen auf den verkrusteten Marmor der einfüßigen Tische, bestellten Schmalzbrote und Süßes, aßen und lasen Zeitung, rauchten und unterhielten sich, sahen aus dem Ladenfenster auf die Straße.
Kaum dass Johanna ein wenig verschnaufen konnte, füllte sich der Laden wieder. Nach der ersten Woche fühlte sie sich, als ob sie ein Gebirge bewältigt hätte. Die Beine schmerzten, aber die Einnahmen stimmten; sie konnte Vorräte anlegen und die Miete begleichen.
Gut, dass sie die Kinder hatte. Alle vier handelten, als hätten sie begriffen, dass sich Hunger und Elend nur durch Zusammenhalt und Arbeit fernhalten ließen. Maria, mit 17 die älteste, kümmerte sich um den Haushalt, wusch und putzte. Nachmittags half sie im Laden, schnitt Brötchen auf, spülte. Sie sah Johanna ähnlich, hatte nicht nur die krausen Haare, sondern auch die grauen, wachen Augen geerbt. Paul war 16, Hermann 14. Frühmorgens vor der Arbeit trugen sie Brote und Brötchen aus, an Wochenenden Zeitungen. Sie lernten bei Haniel & Lueg, einer Maschinenfabrik an der Grafenberger Allee; Paul als Dreher, Hermann als Schlosser. Tagsüber waren sie aus dem Haus. Mit den kurzgeschorenen Haaren und den ernsten Augen glichen beide ihrem Vater, waren aber verständig, beinahe altklug, mit einem immer melancholischen Ausdruck im Gesicht. Lisbeth, mit zehn die jüngste, half vor der Schule in der Backstube. Nachmittags bediente sie die Kasse. Sie war empfindlicher als Maria, still und scheu, litt unter Roberts Verschwinden. Oft sah Johanna sie dastehen, den Blick in eine unbestimmte Weite gerichtet. Sie stand dann in der immer gleichen Haltung, drehte die blonden Locken mit dem Finger, bewegte den Oberkörper vor und zurück und Johanna wusste, dass sie in Gedanken weit weg war.
Bei Johanna war alles ärmlich, aber sauber und aufgeräumt. Der Vorbesitzer hatte ihr die Ladentheke geschenkt, weil er sie nicht mehr verkaufen konnte. Für das Buffet hatte sie ihm ein paar Mark gegeben, obwohl es nicht wertvoller war als die Theke. Das Buffet gefiel ihr. Es war aus dunklem Holz, hatte links und rechts gläserne Schiebetüren mit eingeritzten Blumenranken, dazwischen breite Brotregale, im unteren Teil einen Schrank mit Fächern und Schubladen. Hinter den Schiebetüren standen Tüten mit Mehl, Nudeln und Semmelbröseln, Dosen mit Zucker und Reis, Büchsen mit Rosinen, Schachteln für Gebäck. Ein Arbeitsbrett konnte man wie eine Schublade herausziehen. Ein langes Messer lag darauf, daneben ein Kringel Schwarzwurst. Ein Ofen aus Gusseisen stand mittig, umrundet von drei Tischen, eine hölzerne Garderobe seitlich daneben, ein Schirmständer reckte seine verrosteten Messingstäbe nach der Tür. An den Verkaufsraum schloss sich die Backstube an, eng und im Sommer schon in aller Morgenfrühe stickig und drückend. Der Backofen hatte seine Tücken. Bis er richtig heizte, musste Johanna ihn ordentlich feuern, was zu einer permanenten Aufgabe wurde. Ein gebrauchter Backtrog stand seitlich vor einem Regal mit Brotkörben, Holzmodeln, Tortenplatten und Backblechen. Auch eine Semmelbröselmühle hatte sie angeschafft. Hinter der Backstube gab es noch eine Küche, ein Raum wie ein Schlauch mit einer Wasserpumpe und einem Herd.
Am Freitag vor Maria Himmelfahrt war die Backstube voller Leute. Zwei Kunststudenten drängten sich an den Wartenden vorbei, rückten ihre Stühle an den Tisch vor dem Fenster. Sie bestellten Brezeln mit Marmelade, die Maria ihnen auf einem Teller servierte. Inmitten des Lärms saß einer von ihnen und strichelte. Er wirkte entrückt, weit weg von dem, was um ihn herum vor sich ging. Er war bleich und dünn, seine Brille aus billigem Metall saß schief, die Jacke war fadenscheinig, der Hut abgegriffen. Der andere, dicker und robuster, sah zu und rauchte. Irgendwann schob der Dünne das Blatt in die Mitte des Tisches und signierte es. »Das Leben«, hörte Johanna ihn sagen, »ich nenne es: Das Leben.« Dann aber kamen ihm Zweifel am Titel. »Nein, ich schreibe nur Leben, einfach Leben, das klingt besser, ist kürzer, eindringlicher.« Der Dickere nickte. »Leben. Hmm. Klingt zwar poetischer, ist aber irgendwie unbestimmter. Es kann alles sein und auch nichts.« Der Dünne antwortete nicht, strichelte wieder. Der Dickere gab Maria einen Wink. »Ich hab so nen schrecklichen Durst. Zu trinken haben Sie wohl nichts? Ein Selters vielleicht? Oder einen Kaffee?« Maria schüttelte den Kopf. Der Student zeigte aus dem Fenster. »Darf ich rübergehn zur Selterswasserbude und was holen?«
»Milch könnt ich Ihnen bringen.« Maria sah fragend nach Johanna. »Wenn Sie wollen, mach ich Ihnen schnell ne Tasse Kaffee«, entschied Johanna, griff nach der Kaffeemühle, füllte Bohnen hinein und begann zu kurbeln.
Bald dampfte Kaffee aus geblümten Tassen. Die Studenten waren zufrieden. Johanna beobachtete, wie sie nippten, den Dampf abbliesen, heimlich Kunden skizzierten, dann mit kritischen Gesichtern über die Striche urteilten. Sie blieben den ganzen Nachmittag, unterhielten sich über ihre Seelenzustände, die sie zu Papier bringen wollten. Als Johanna ihnen zehn Pfennig für den Kaffee abnahm, fragten sie, ob sie wiederkommen dürften. »Aber natürlich. Sie dürfen es auch weitersagen, den anderen Malern.«
Noch am gleichen Tag kamen weitere Studenten.
Johanna begann sich darauf einzurichten. Jeden Tag ließ sie sich jetzt acht Liter Milch bringen, verkaufte das Glas für fünf Pfennig, Kaffee und Tee für zehn, Altgebäck ebenso für zehn, Brötchen mit Blut- oder Leberwurst für 30 Pfennig. Heimlich bot sie auch Flaschenbier und Likör an. »Das floriert richtig gut«, flüsterte sie Maria ins Ohr, »hier ist viel mehr los als beim Theisen.«
Sie hatte kaum damit gerechnet, dass die Königlich-Preußische Kunstakademie, die um die Ecke lag, ihr Kundschaft zuspielen würde, aber jetzt, wo sich das billige Kaffeeangebot herumgesprochen hatte und immer mehr Studenten den Weg zu ihr fanden, schien es ihr folgerecht. Schon morgens besetzten sie die Tische, standen herum, verzehrten Brötchen und rauchten. Manche blieben den ganzen Tag, auch wenn sie nur einmal ein Wurstbrot bezahlt hatten. Johanna hörte sie über den Unterricht an der Akademie reden, über die Professoren und deren Marotten, über die Modelle in den Künstlerhäusern. Viele kamen aus dem Rheinland, aber es waren auch Bayern dabei und Sachsen.
Die meisten Studenten bekamen einen Monatswechsel, weswegen Johanna bald ein Pumpbuch anlegte. Walter Ophey war der erste, der sich eintrug. Er hatte Johannas Laden sozusagen entdeckt und kam nie allein. Er trug farbenprächtige Schlipse und schmierte sich Pomade ins schwarze, wellige Haar, eine stark parfümierte Pomade, deren Duft sich genauso schnell im Laden verbreitete wie sein einnehmendes Lachen. Er war immer gut gelaunt und diskutierte an allen Tischen gleichzeitig. Sein Schnurrbart erinnerte Johanna an Robert und daran, wie dessen feine Härchen früher an ihrer Wange gekitzelt hatten. Ophey erzählte ihr, dass er Meisterschüler für Landschaftsmalerei bei einem in Russland geborenen Lehrer sei und der Sammler Flechtheim Interesse an seinen Bildern habe. »Flechtheim weiß ganz genau, was er kauft. Zweimal schon hat er angefragt. Hat sozusagen eine Nase dafür. Er unterstützt unsere Idee mit dem Zusammenschluss. Wir brauchen ihn dringend, denn er hat Ahnung und Geld.« Die Künstler, die er mitbrachte, hatten erst vor kurzem miteinander ausgestellt, was sich, laut Ophey, bald wiederholen sollte. »Flechtheim hat Neues angekündigt. Er hat schon beim letzten Mal einiges finanziert. Er steht voll und ganz hinter uns!« Ausführlich redete er über moderne, französische Malerei und stiftete Johanna an, unbedingt Absinth und Rotwein bereitzuhalten. »Alle verlangen danach. Sie werden sehen, Frau Ey, das bringt noch mal mehr Kundschaft.«
Auch ein Student in einem hölzernen Rollstuhl kam regelmäßig. Er hieß Thuar, wurde von seinen Freunden die Stufe hinaufgeschoben und an den Tisch am Fenster gerollt. Er aß für sein Leben gern Apfelteilchen und trank eine Menge Kaffee. Ohne Scheu, aber mit Sarkasmus in der Stimme, erzählte er Johanna, dass er, anders als andere Studenten, seine Zeche wohl bezahlen könne, da ihm eine Versicherung bis ans Ende seiner Tage Geld schulde. »Das mit meinen Beinen war ein Unfall. Sie sind beide weg. Aber Sie sehn ja, Frau Ey, man darf sich das Leben nicht vermiesen lassen!« Dabei hob er die Tasse wie ein Schnapsglas und lachte. Meist kam er mit einem Studenten aus der Eifel, einem ernsten, stillen Mann mit markanten Gesichtszügen und brennenden Augen, mit dem er über Kunst philosophierte. Die beiden wohnten zusammen, saßen oft lange in der Bäckerei, verzehrten wenig, diskutierten heftig, rauchten viel.
Für August Deusser, einen Maler aus Monheim, waren es neben Landschaften auch Menschen, die ihn zum Stricheln zwangen. Nach einem seiner Besuche schmückte eine schnell hingeworfene Zeichnung einer drallen Bäckerin, die mit Broten jonglierte, die Wand neben dem Fenster. Deusser, groß und dünn und mit einem energischen Auftreten, organisierte Ausstellungen, erklärte Johanna, was die französischen Impressionisten mit richtigem Sehen meinten, was sie wenig interessierte und auch sofort wieder vergaß. Sein Freund Clarenbach kam seltener, blieb aber dafür umso länger. Er versuchte alle von der Wichtigkeit der Künstlergruppen zu überzeugen. »Zusammenschlüsse machen stark, wir müssen uns verbinden. Überall wird gekämpft, sogar hier! Nicht wahr, Frau Ey, an der Kunstfront genauso wie an Ihrer Backtheke.«
Um Kunst ging es ständig: um van Goghs Gelbtöne, Munchs Schatten, um Farben und Techniken, um Licht und Fluchtpunkte, um Ausstellungen und Galeristen. Irgendwann kam Zeichenprofessor Spatz von der Akademie mit seinen Studenten und bestellte Kaffee für alle. »Das glaub ich, dass es euch hier besser gefällt als drüben.« Johanna warnte er: »Dass Sie mir mal nicht zu große Konkurrenz machen. Studieren solln sie. Und ordentliche Künstler werden.«
Spatz brachte jeden Tag andere Leute mit. Einmal war es Professor Gebhardt, der sehen wollte, wo seine Studenten ihre Zeit verbrachten. Franz Karl Eduard Gebhardt war ein origineller Mensch, an die siebzig und ein lebhafter Diskutierer. Mit seinem breiten, zerzausten Bart, dem schütteren Haar und den klugen Augen glich er den Figuren aus dem alten Testament, die er mit Vorliebe malte. Er kam aus dem Baltikum, hatte in Petersburg studiert und war schon an die 30 Jahre Professor an der Akademie. Manchmal war er schwer zu ertragen, aber gutmütig und den Studenten zugetan.
Oft, wenn er in seinem schwarzen, fadenscheinigen Gehrock, flankiert von Kollegen, nahte und grüßend die Hand hob, spürte sie Stolz. Nie hätte sie gedacht, dass in ihrem Laden einmal Professoren ein- und ausgehen würden. Zwei neuwertige Schürzen schaffte sie sich ihretwegen an.
Den Kunstakademikern folgten Musiker, Schauspieler, Journalisten. Mit ihren Brötchen fühlte sich Johanna angenommen wie nie. Sie arbeitete rund um die Uhr; unermüdlich rührte und schaffte sie, kurbelte die Kaffeemühle. Mit vollgeladenem Tablett umkreiste sie die Tische, verteilte Rosinenweck auf geblümten Tellern, sammelte die schmutzigen ein, stapelte sie turmhoch und balancierte sie hinaus in die Küche. Mit sauberem Geschirr kam sie wieder zurück; jedes Mal gab die Tür zur Küche ein Seufzen von sich.