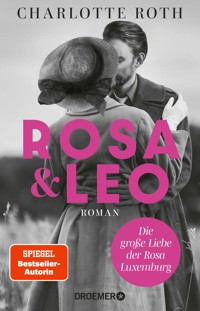9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Wintergarten-Saga
- Sprache: Deutsch
Der Start der großen Wintergarten-Trilogie um drei Frauen und ihre Lebensträume im Paperback von der Bestseller-Autorin Charlotte Roth Berlin in den 20er Jahren. Musik, Tanz, Zauberei, Tierdressuren, Akrobatik, Kabarett – Berlins 'Wintergarten' bietet alles, was das Herz begehrt, und so manches, was anderswo undenkbar wäre. Auch die junge Nina von Veltheim ist von Anfang an fasziniert von dem Varieté. Ganz unscheinbar und auf Fotos diejenige, die man gerne mal übersieht – so wirkt sie auf den ersten Blick - aber nur, solange sie stillsteht. Sobald sie in Bewegung gerät, ist sie ein Vulkan, das sagt nicht nur ihr Zwillingsbruder Carlo, und wer sie einmal von ihrer Begeisterung für die Bühne hat sprechen hören, der vergisst sie nie wieder. So ist es denn auch kein Wunder, dass es sie aus der Uckermark ins brodelnde Berlin zieht, wo sie sich ihren Traum vom Theater erfüllen will. Doch anders als viele andere junge Frauen will sie nicht auf den Brettern stehen, die die Welt bedeuten: Sie will ganz nach oben – an die Schalthebel von Theater und Film, an denen Männer sitzen. Ihr Weg wird nicht leicht sein – und gäbe es nicht ihre Freundinnen Jenny und Sonia, die genau wie sie das berühmte Varieté "Wintergarten" zu ihrem Zuhause machen, könnte sie manches Mal verzweifeln. Der Auftakt zu einer großen Trilogie über drei Frauen und ihren schillernden Freundeskreis und den "Wintergarten", das berühmte Varieté in Berlin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 617
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Charlotte Roth
Die Wintergarten-Frauen
Der Traum beginnt
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Drei Frauen und die schillernde Welt des Wintergarten-Varietés
Berlin in den 20er-Jahren: Ganz unscheinbar und auf Fotos diejenige, die man gerne mal übersieht, das ist Nina von Veltheim – aber nur, solange sie still steht. Sobald sie in Bewegung gerät, ist sie ein Vulkan, das sagt nicht nur ihr Zwillingsbruder Carlo, und wer sie einmal von ihrer Begeisterung für die Bühne hat sprechen hören, der vergisst sie nie wieder. So ist es denn auch kein Wunder, dass es sie aus der Uckermark ins brodelnde Berlin zieht, wo sie sich ihren Traum vom Theater erfüllen will. Doch anders als viele andere junge Frauen will sie nicht auf den Brettern stehen, die die Welt bedeuten: Sie will ganz nach oben – an die Schalthebel von Theater und Film, an denen Männer sitzen.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Auftakt
1. Kapitel
Erste Nummer
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Zweite Nummer
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
Dritte Nummer
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
Glossar
Für Lucy
›Willkommen, bienvenue, welcome …‹
Ich möchte schlafen, aber du musst tanzen.
Theodor Storm
Meine geschätzten Damen und Herren, hochverehrtes Publikum – willkommen in meinem Varieté!
Was ein Varieté ist, kann ich Ihnen nicht erklären, denn das eben ist das Besondere am Varieté: Es ist Mannigfaltigkeit, es erfindet sich Abend für Abend neu, und als Regel gilt einzig: Unmöglich ist nichts.
So wie für den Wintergarten, den Lustgarten der Sensationen im Herzen Berlins, ganz speziell: Vom Guten nur das Beste.
Kommen Sie mit?
Lassen Sie sich eine Nacht lang aus Ihrem Alltag entführen – bei uns ist nichts wirklich, aber alles echt, nichts gelogen, aber alles erfunden, nichts unschätzbar, aber alles unwiederbringlich.
Wer im Spiel zwischen Wirklichkeit und Illusion historisch verbürgt ist und wen sich meine Fantasie hinzugedacht hat, möchte ich Sie gern selbst herausfinden lassen – nur in drei Fällen ist es mir wichtig, die Fakten klarzustellen:
Zum Ersten: Einen Direktor Ernst-Egon Neugebauer hat es im Wintergarten nie gegeben. Da ich eine Figur brauchte, die im Zuge meiner Geschichten eine ganze Menge mitmachen muss, habe ich mich entschieden, keinem Verstorbenen, der sich nicht mehr wehren kann, diesen Packen aufzuladen, sondern einen ins Bild zu stellen, der seine Existenz allein mir verdankt und sich somit nicht zu wehren hat, und basta. Seine Marotten – unter anderem das Drehen an Knöpfen – habe ich mir jedoch von den verschiedenen Direktoren, die den Wintergarten im Laufe der Jahre begleiteten, für meinen Ernst-Egon geborgt.
Zum Zweiten: Den Regisseur Leopold Jessner hingegen hat es gegeben. Er gehörte zu den unzähligen großen Begabungen, die der faschistische Wahnsinn Deutschland geraubt hat, und starb in Hollywood. Sein 1922 gedrehter Wedekind-Film hieß jedoch Erdgeist, nicht Frühlings Erwachen. Um ihn ohne Bedenken an meine Bedürfnisse anpassen zu können, habe ich mich hier für eine Erfindung entschieden.
Und zum Dritten: Den Van-Kater Ypsilantis hat es ohne jeden Zweifel gegeben. Er hieß Joschi-Oschi, gehörte meiner Freundin Corinna und ist mir in seiner majestätischen Selbstgenügsamkeit unvergesslich.
Ich hoffe, Sie amüsieren sich – denn wozu wären wir sonst hier?
Charlotte Roth
London, Frühling 2022
Auftakt
am Tag des Programmwechsels
Gut Neu-Mahlen bei Templin, Uckermark
März 1917
1
Lass mich vorbei, Carlo!«
Wieder einmal hatte sich Ninas Bruder, das Faultier, auf der untersten Stufe der Hintertreppe breitgemacht, weil er zu bequem war, sich seine Reitstiefel im Stehen auszuziehen.
»Weshalb hast du’s denn so eilig?«, fragte er in dem verschlafenen Tonfall, der Nina zuverlässig auf die Palme brachte. Mit seinen sechzehn Jahren war Carlo bei Weitem schwerfälliger als Oma Hulda mit irgendetwas zwischen sechzig und siebzig.
»Hast du vergessen, was heute für ein Tag ist?« Ruppig drängte sie ihn zur Seite und sprang schon mit einem Satz zwei Stufen hinauf. »Heute kommt er nach Hause!«
»Und was macht dich so sicher?« Mit dem Fingernagel kratzte Carlo eine Art Muster in die Schlammkruste auf seinem Stiefelschaft. »Auf den Tag genau kann das doch keiner wissen.«
»Das Telegramm steht auf dem Sims im Salon!«, konterte Nina triumphierend. »Da heißt es Ankunft 6. März – und er ist keiner, der zu spät kommt. Er ist wie ich.«
Sie drehte sich nicht noch einmal um, sondern eilte durch den Korridor bis zur Tür ihres Zimmers, riss sie auf und lief ans Fenster. Das riss sie ebenfalls auf. Beide Flügel zugleich. Die eisige Luft, die ihr entgegenströmte, fand sie nicht schneidend, sondern belebend. Obwohl der Frühling so nah war, lagen der Vorhof, die von Kastanien gesäumte Allee und der Flickenteppich der Felder noch in diesiges Weiß getaucht, und der Tag, den kein Vogel begrüßt hatte, schien sich schon wieder verkriechen zu wollen. Für Nina aber hätte ihre Welt schöner nicht sein können, nicht einmal am Weihnachtsabend, wenn die Lichter aus allen Fenstern den Schneedecken Glanzpunkte aufsetzten, als hätte jemand im All eine Kiste ausgekippt und sämtliche Sterne verstreut.
Er kommt nach Hause, er kommt heute nach Hause!
Von ihrem Fenster aus würde sie ihn schon von weit her sich nähern sehen – zuerst als weiße Staubwolke inmitten von aufgewirbeltem Schnee, aus dem sich mit jedem Galoppsprung klarer die dunkle Silhouette von Pferd und Reiter schälen würde. Nina hatte sich eigens ein Zimmer im Haupthaus ausbedungen, weil man aus den Fenstern der beiden Seitenflügel einen Ankömmling erst sehen konnte, wenn er bereits auf dem Vorhof war.
Das war nichts für sie. Sie wollte alles, was auf sie zukam, im Voraus sehen und darauf vorbereitet sein. Dass heute ihr Vater auf eine Woche Urlaub nach Hause kommen würde, wusste sie, seit letzten Freitag sein Telegramm eingetroffen war. Daran, dass er pünktlich wie angekündigt eintreffen würde, bestand für sie kein Zweifel, denn so kannte sie ihn: verlässlich wie das Amen in der Kirche, in die sie allerdings schon ewig nicht mehr gegangen war. Dann eben verlässlich wie die Heuernte, wie das Blühen der Luzerne, die Heimkehr der Kraniche, die bald wieder in ihrem weiten Delta über den Himmel ziehen würden, und die Storchennester auf den Dachfirsten.
Verlässlich wie Nina selbst.
»Mein Sohn und seine Tochter sind wie zwei Erbsen in derselben Schote«, pflegte Oma Hulda zu sagen, und Tante Sperling, Vaters Schwester, hatte schon vor Jahren angesichts einer Kinderfotografie von Nina erklärt: »Hätte mein Bruder je Zöpfe getragen, ich würde Stein und Bein schwören, dass er das Kind auf diesem Bild ist. Und wie merkwürdig – der kleine Carlo hat in den Zügen gar keine Ähnlichkeit mit ihm.«
Carlo und Nina waren Zwillinge, aber unterschiedlicher als sie beide konnten zwei Menschen kaum sein. Wann immer Carlo sich noch halb in Träumen aus dem Bett kämpfte, war Nina längst unterwegs. Hase und Igel, das war eines der ersten Schauspiele gewesen, die sie im Dachboden des Herrenhauses aufgeführt hatte. Carlo hatte in einer Doppelrolle den Igel sowie dessen Frau gegeben und Nina mangels weiterer Schauspieler den Hasen. Da Carlo aber viel zu langsam von einer Rolle in die nächste schlüpfte, war es am Ende nicht der behäbige Igel, sondern sie selbst als Hase gewesen, die über die Bühne geflitzt war und verkündet hatte: »Ich bin schon da!«
So war es zwischen Nina und Carlo geblieben. Wer sie nicht kannte, hielt sie nicht einmal für Geschwister, und die Zwillinge im Geiste waren Nina und ihr Vater. Pippa und Pappi. Vor drei Jahren, bevor er so plötzlich aus ihrem Leben verschwunden war, hatte sie zu ihm gesagt, er solle aufhören, sie Pippa zu nennen, das sei kindisch und sie mit dreizehn dafür viel zu groß. Jetzt war sie sechzehn, und auf nichts freute sie sich so sehr wie auf den Augenblick, in dem er aus dem Sattel glitt, ihr Gesicht in seine behandschuhten Hände nahm und »Da ist ja meine Pippa« zu ihr sagte.
Der Spitzname stammte aus einem Stück von Gerhart Hauptmann, das er in einem Berliner Theater gesehen hatte, als Nina vier Jahre alt gewesen war. »Sämtliche Kritiker haben es verrissen, und ich glaube ja selbst, dass es ein ziemlicher Käse war«, hatte er zu Ninas Mutter gesagt. »Aber ich habe nur dieses glaszarte Püppchen gesehen, das nicht aufhören konnte, von einem Ende der Bühne zum andern zu tanzen. Wie unser Ninchen. Unser Perpetuum mobile.«
Wie es bei Zwillingen häufig der Fall ist, war Nina – die kleinere, zweitgeborene der beiden – tatsächlich in ihrer Kinderzeit glaszart und zerbrechlich gewesen, und über die schmächtige Statur, die sie mittlerweile erreicht hatte, würde sie wohl nicht mehr hinauswachsen. Dennoch fühlte sie sich wie aus Eisen. Als kleines Mädchen hatte sie nicht nur einmal einen Bühnenraum für sich erobert, indem sie so lange darüber hinweggetanzt war, bis sie ohnmächtig wurde.
Inzwischen erschuf sie ihre Tänze im Kopf, doch für ihren Vater blieb sie seine Pippa, und für ihn wollte sie es nun auch immer bleiben. Er war es, der all ihre Komödien und Tragödien, ihre Inszenierungen und Choreografien begleitet hatte, seit sie mit Kastanienmännchen und Kasperlefiguren angefangen hatte. Als Nächstes hatten die Stallkaninchen als Schauspieler herhalten müssen, die sich immerhin besser schlugen als die Hühner, und danach war es Carlo gewesen, der in sämtliche Rollen gezwängt wurde und eine jede in den Sand setzte.
Nach einem kurzen erfolglosen Gastspiel an einem Züricher Lyzeum war Nina schließlich zu Festspielen übergegangen: Weihnachten, Ostern, Jubiläen, Erntedank – jeder Anlass wurde mit einer Inszenierung im Dachboden begangen, zu der sie die Kinder von den Nachbargütern als Ensemble zusammentrommelte.
Ohne Publikum spielten sie nie. Still und leise sorgte ihr Vater dafür, dass die Erwachsenen sich als Zuschauer einfanden und am Ende gebührend applaudierten.
»Ich bin stolz auf dich, meine Pippaloni Tagliazzoni«, hatte er gesagt – so häufig, dass es Nina peinlich war und sie ihm kein Wort mehr glaubte. »Er lobt mich nur, weil er mein Vater ist«, hatte sie sich bitter bei Tante Sperling beklagt. »Ob ich wirklich gut bin, interessiert ihn gar nicht. Er würde auch klatschen, wenn ich wie ein Kleinkind Purzelbäume schlage oder in der Nase bohre.«
»Über das Nasebohren bin ich mir nicht so sicher«, hatte Tante Sperling erwidert. »Aber für deinen Vater ist eben alles, was sein Töchterchen zustande bringt, großartig und könnte besser nicht sein.«
Und was nützt er mir dann als Kritiker?, hatte Nina gedacht. Es machte sie wütend, dass Erwachsene Kinder nie ernst nahmen und ihr Vater in ihr nur seine Tochter und keine künftige Künstlerin sah.
Dann war ihr Vater fortgegangen, war von einem Tag zum andern nicht mehr da. »Wir werden uns wehren bis zum letzten Mann und Ross«, hatte der Kaiser den Zeitungen zufolge verkündet, und Ninas Vater hatte sich von seinem Leibdiener in seine Majorsuniform helfen lassen und war auf Pierrot, seinem geliebten Pferd, nach Templin geritten, um sich seinem Regiment der Garde du Corps anzuschließen. Die nächste Aufführung auf Gut Neu-Mahlens Dachboden hatte vor ausschließlich weiblichem Publikum stattfinden müssen. Als der Vorhang fiel, waren Mütter, Großmütter und Tanten mit sorgenvollen Mienen zurück in den Salon gezogen, und über Ninas Feuerwerk von einer Inszenierung hatte niemand mehr ein Wort verloren.
Der Vater begann ihr zu fehlen. Er kämpfte an einem Fluss namens Marne und schien endlos weit weg. Was Krieg war, konnte sich Nina nicht vorstellen, denn hier gab es ja keinen. Hier wucherte Futterklee, keimte Hafer, steckte Spargel seine Köpfe aus Erdhügeln, peitschte Wind das Land und kündigte die Zeit der Ernte an. Fohlen wurden geboren, Stuten gedeckt und Jährlinge an Sättel gewöhnt, und während alledem sollte ihr Vater irgendwo in der Fremde in einem Graben hausen, der mit Minen und Granaten beschossen wurde? Es ging nicht in ihren Kopf. Nina erkannte, wie viel Sicherheit es ihr verliehen hatte, dass er immer da gewesen war – mit seiner Stille, mit seinem Lächeln, über das sie sich ärgerte, das ihr aber beständig vermittelt hatte: Ich stehe hinter dir, ich unterstütze dich in allem, was du tust.
Sie hatte begonnen, auf die Tage hinzuleben, an denen er auf Urlaub nach Hause kam. Seltene Gelegenheiten. Zweimal zu Weihnachten, einmal zur Ernte und einmal im vergangenen Frühling, um sein jüngstes Kind willkommen zu heißen, die überraschend geborene kleine Otta, die inzwischen bereits ›Mama‹ rief und laufen lernte. Und heute. Nina blickte über die verschneiten, sich in Abendnebel hüllenden Felder hinweg und entdeckte die Wolke, auf die sie gewartet hatte. Anfangs hob sie sich kaum gegen die verschwommene Umgebung ab, doch mit jedem zurückgelegten Wegstück wurde sie größer und klarer. Nina konnte nun den Schnee aufspritzen sehen und erahnte darin den dunklen Leib des Pferdes.
Pierrot, der Bruder ihres eigenen Pferdes, war ein Dunkelfuchs, während ihr Palü bis auf die Mondsichel auf seiner Stirn schwarz war. Auch der Waffenrock des Vaters war dunkel, ganz anders als die weiße Galauniform, die vor dem Krieg in seinem Schrank gehangen hatte. Im Schneegewirbel wirkten Pferd und Reiter wie miteinander verwachsen, wie aus einem einzigen dunklen Guss. Sie kamen näher. Pierrots edler Kopf war schon erkennbar, auch der Helm des Vaters und die typische Haltung des Kavalleristen, leicht vorgebeugt in den Steigbügeln aufgerichtet.
Jetzt sprengten sie die Kastanienallee entlang, und die Schatten der kahlen Kronen raubten Nina die Sicht. Sie sprang von der Fensterbank. Zeit, dem Vater entgegenzulaufen, wie sie es jedes Mal tat. Auch diesmal würde sie stehen bleiben, sobald er Pierrot aus dem wilden Jagdgalopp in den Trab zügelte, sie würde ihn lachen sehen und dem Pferd, das er vor ihr zum Stehen brachte, in die Zügel greifen.
»Da ist sie ja«, würde er rufen. »Meine Pippaloni Tagliazzoni.«
»Und da ist mein Pappi Pappinsky«, gäbe sie zur Antwort, »mit der eisernen Butterglocke auf dem Kopf!«
Er würde abspringen, sie in die Arme nehmen und im Kreis herumwirbeln, wobei sie seinen Duft nach Pferd und Tabak und warm gerittener Wolle auffing. Dann würde er fragen: »Und? Was bekommen wir vor dem Abendessen geboten? Eine Neufassung von Emilia Galotti?«
Das hatte sie inszeniert, als er das letzte Mal auf Urlaub gekommen war – ihre eigene Fassung natürlich, nicht den öden Schinken, den sie bei Hauslehrer Habicht hatte durchackern müssen. Leider war es ziemlich misslungen, weil Carlo den Odoardo gespielt und eine schauderhafte Pleite hingelegt hatte. Er war einfach unbegabt und außerdem für die Rolle zu unreif, doch alle älteren Jungen standen jetzt an den Fronten in Frankreich, Belgien oder im Osmanischen Reich und hatten keine Zeit mehr, Theater zu spielen.
»Das, was es heute zu sehen gibt, ist nur für dich«, würde sie zu ihrem Vater sagen.
»Nur für mich?«, glaubte sie ihn zu hören. »Jetzt machst du mich aber neugierig und musst mir sofort verraten, was es ist.«
»Und Pippa tanzt.« Nina rannte durch den Korridor und flüsterte die drei Worte vor sich hin. Sie hatte das Stück, das unmöglich zu verstehen war, von Grund auf abgewandelt, hatte es ganz auf die Beziehung zwischen Pippa, der Tänzerin, und ihrem Vater, dem Glasmacher, konzentriert. Auf die Bühne bringen wollte sie, wie der Vater sich die erträumte Tochter aus Glas blies, wie sie ihm davontanzte, leicht wie Funke, Vogel und Schmetterling, und doch an einem dünnen gläsernen Faden seiner Glasmacherpfeife hängen blieb.
Er würde verstehen, was sie ihm damit sagen wollte: Ich bin deine Pippa, und die werde ich bleiben. Auch wenn ich jetzt so gut wie erwachsen bin und herausfinden muss, was ich selbst aus mir machen will – mein Anfang bist immer du.
Er würde den Arm um sie legen, Pierrot dem Knecht übergeben, und sie würden Seite an Seite nach Hause gehen. Vielleicht würde er ihr diesmal sagen, dass der Krieg nicht mehr lange dauerte, dass er bald nie wieder von ihnen fortmusste und dass das Leben wieder so sein würde, wie es immer gewesen war.
Statt wie vorhin die hintere Stiege zu wählen, stürmte sie jetzt die breite Treppe hinunter in die Halle. Im Laufen hatte sie sich nur ihre nachthimmelblaue, mit Gold bestickte Lieblingsstola übergeworfen, denn einen Wintermantel, der ihr passte, besaß sie nicht mehr. Aus den Ärmeln ihres Mantels ragten die Handgelenke wie Stöcke an einer Vogelscheuche, doch die Marken auf der Kleiderkarte reichten nicht für einen neuen. »Man muss sich eben nach der Decke strecken«, sagte Oma Hulda. »Andere Leute nähen sich ihre Kleidung aus Tischwäsche, Betttüchern, Vorhängen und brechen sich dabei nichts ab.«
In Ninas Familie gab es zwar reichlich Wäsche und Vorhänge, aber niemanden, der daraus etwas hätte nähen können. Nina machte es nichts aus. Sie rannte in ihre Stola gehüllt ins Freie und spürte die Kälte kaum. Ihr Vater kam in großen Sprüngen in den Hof geritten, ein wenig ungelenk, so schien es ihr, ohne rechte Harmonie, als wäre das Pferd nicht Pierrot. Aber es musste ja Pierrot sein, denn von seinem Pferd, das er gezüchtet und ausgebildet hatte, war ihr Vater nicht zu trennen. Nina war von klein auf an seiner Seite geritten und wusste, was für ein vortrefflicher Reiter er war. Heute aber schien er nervös und abgelenkt. Zum ersten Mal sah sie, wie er Mühe hatte, Pierrot zu zügeln, wie der Wallach sich leicht bäumte, den Kopf warf und seinem Reiter alle Hände voll zu tun gab.
Und noch etwas sah sie. Das Fell des Tieres war zwar dunkel vor Nässe, aber es war nicht das Fell eines Dunkelfuchses. Das Pferd stand nicht wie Pierrot an ihres Vaters Hilfen, weil es nicht Pierrot war.
»Pappi!«, rief Nina und klang wie ein verzweifeltes kleines Kind.
Der Reiter hatte es endlich geschafft, sein Pferd zum Stehen zu bringen, auch wenn es noch immer unwillig tänzelte. Er trug die Uniform der Garde du Corps und den Offiziershelm mit der Spitze, den Nina eiserne Butterglocke getauft hatte. Ihr Vater hatte darüber gelacht und beteuert: »Dass einem in dem Ding das Hirn zu Butter schmilzt, ist keineswegs auszuschließen.«
Der Mann zog den Helm vom Kopf und blickte zu Nina hinunter. Sein Gesicht war von dem scharfen Ritt gerötet und sah so jung aus, dass sie erschrak.
»Ulrike Freifrau von Veltheim?«, fragte er.
Vielleicht brauchte er eine Brille. Eine starke. Jeder halbwegs des Sehens Mächtige hätte erkannt, dass es sich bei Nina um keine vierzigjährige Freifrau handelte.
»Ich bin Nina von Veltheim«, antwortete sie schließlich.
Mit einem zackigen Nicken verbeugte er sich. »Ich bin Hauptmann Bertram von Brink, aus der Kompanie Ihres …«
»Vaters«, half Nina ihm aus.
»Ihres Herrn Vaters, ja. Ich stamme auch von hier. Aus Zichow. Keine Stunde entfernt.« Seine Augen waren geweitet, und die Traurigkeit, die darin stand, brannte sich ihr ein. Sie wusste in diesem Moment, sie würde diesen Blick nicht vergessen, und während ihre Hände sich in den Wollstoff der Stola krallten, wusste sie auch: Sie würde diese weiche, wärmende Stola in ihren Lieblingsfarben Nachtblau und Gold nie wieder tragen können, weil sie unweigerlich diesen Blick in ihr wachgerufen hätte.
»Auf Heiratsurlaub bin ich.« Der Hauptmann aus Zichow nuschelte jetzt, als hätte er Angst vor der Klarheit der Worte. »Habe mich bereit erklärt, die Familie des Herrn Major persönlich aufzusuchen, denn eine solche Nachricht, die kann man doch nicht in einem seelenlosen Telegramm übermitteln.«
»Was für eine Nachricht?« Ninas Körper zog sich zusammen. Die Kälte, die sie bis eben nicht gespürt hatte, vereiste ihr nun die Glieder, und die blau-goldene Stola glitt zu Boden.
Der Hauptmann auf Heiratsurlaub riss das Pferd im Maul und straffte den Rücken. Sein Blick war unverändert und verlor sich in der Weite. »Mein aufrichtiges, tief empfundenes Beileid, gnädiges Fräulein. Ihr hochverehrter Herr Vater, Major von Veltheim, hat im heldenhaften Einsatz für Kaiser und Vaterland das höchste Opfer erbracht und sein Leben gelassen.«
Er zuckte zusammen. Nachdem er diesen Wortschwall, den er auf dem Weg wohl eingeübt hatte, losgeworden war, hielt er inne und sah Nina wie in plötzlichem Erkennen an. »Sie sind Pippa, nicht wahr? Die, die Tänze erfindet? Von seiner Pippa hat der Herr Major ja immer erzählt.«
Um Nina drehte sich die Welt, drehten sich Haus und Weg und Bäume und Felder, doch in ihr selbst, in ihrem Kopf blieb alles klar und still.
»Nein, ich bin’s nicht«, sagte sie. »Pippa ist meine Schwester. Nicht ich.«
»Verstehe.« Der Hauptmann aus Zichow nickte. »Ich bitte um Verzeihung. Von einer Schwester wusste ich nichts. Beim Herrn Major ging’s ja immer nur um seine Pippa.«
Erste Nummer
in der einer Jongleuse zwar sämtliche Bälle herunterfallen,
jedoch keineswegs die Felle davonschwimmen
Gut Neu-Mahlen und Berlin, Hauptstadt der brandneuen Republik
Januar 1921
2
Carlo
Irgendeine der uralten Freundinnen, die von Zeit zu Zeit auftauchten, um Carlos Großmutter zu besuchen, hatte sie einmal gefragt, was für ein Gefühl es sei, eine Freifrau von Veltheim zu sein.
»Woher soll ich das wissen?«, hatte Carlos Großmutter zurückgeschnauzt. »Jedes Mal, wenn ich mir vornehme, über diese weltbewegende Frage nachzudenken, stehe ich bis über die Stiefelschäfte in Pferdemist.«
Im Übrigen insistierte Oma Hulda, diese zuweilen auftauchenden Besucherinnen seien keineswegs Freundinnen von ihr, sondern Schmarotzerinnen. »Freundinnen habe ich nie gehabt. Wer braucht so was schon? Wenn ich gesteigerten Wert darauf lege, mich ausnehmen zu lassen, melde ich mich als Weihnachtsgans.«
Bei der Erinnerung musste Carlo grinsen. Ehe er versucht hätte, Oma Hulda auszunehmen, wäre er lieber in die Bank von England eingebrochen. Dass sie die meiste Zeit des Tages bis zu den Knien in Pferdemist stand, stimmte ebenfalls. So kannte er sie, so sah er sie vor sich, wenn er an sie dachte. Sie war eine gewiefte, mit allen Wassern gewaschene Geschäftsfrau, der selbst sein Vater die entscheidenden Verhandlungen mit Freuden überlassen hatte, doch wer mit ihr sprechen wollte, der brauchte sie hinter keinem zierlichen Damenschreibtisch zu suchen, sondern fand sie im Pferdestall.
»Ich habe nun einmal einen Pferdezüchter geheiratet«, hatte sie Carlo vor Jahren auf eine entsprechende Frage erwidert. »Also kümmere ich mich um das Wohl und Wehe von Pferden. Hätte ich Brotteig kneten wollen, hätte ich meine Eltern anbetteln müssen, sich nach einem Bäcker für mich umzusehen. Auch wenn ich dazusagen muss, dass zu meiner Zeit Eltern auf die Betteleien ihrer Töchter herzlich wenig gaben.«
Carlo liebte sie, und wenn er sich der Existenz eines Gottes sicher gewesen wäre, hätte er diesem dafür gedankt, dass er Menschen wie Oma Hulda schuf. Menschen, die man wie einen Pfahl irgendwo in den Boden rammen konnte und die dort stehen blieben, einerlei welche Stürme über sie hinwegtobten. Menschen, die schon wissen würden, was zu tun war, selbst wenn niemand sonst einen Schimmer hatte. Genau deshalb machte sich Carlo an diesem Januarvormittag auf den Weg zu ihr, ehe er mit jemand anderem sprach. Wenn ein Mensch in der Lage war, aus seinen vagen Ideen einen Plan zu formen, der sich in die Tat umsetzen ließ, dann war es Oma Hulda.
Sie stand in der Box des dreijährigen Hengstes Sternenbanner, der am Sonntag in Berlin-Mariendorf seinen Vorlauf für das deutsche Traberderby absolvieren sollte. Wie nicht anders erwartet, trug sie einen Stallmantel aus grobem Leinen, ausgebeulte Reithosen und Stiefel, deren Schäfte ihr bis weit über die Knie reichten. Auf einem Knie balancierte sie den linken Hinterhuf des einschüchternd breit gebauten Pferdes, den sie mit einem metallenen Hufkratzer von eingetrockneten Erdkrumen befreite. Ihr zu sagen, dass dies die Aufgabe von Ferdi, dem Stallknecht, war, wäre vergebliche Liebesmüh gewesen. Carlo versuchte es gar nicht erst, sondern fand Oma Huldas Haltung nicht wenig sympathisch. Was immer ihr in Haus und Hof nicht gut genug gemacht erschien, nahm sie selbst in die Hand:
»Glaubst du etwa, die Leute ändern sich davon, dass du dich über sie ärgerst? Damit kannst du deine Zeit verschwenden, nicht ich.«
Jetzt drehte sie den Kopf nach ihm, ohne den Huf des Pferdes zu bewegen. »Carlo«, stellte sie fest. »Dem Himmel sei Dank.«
»Und warum das?«, fragte Carlo.
»Weil du weder zum Trampeln noch zum Kreischen neigst«, bekundete Oma Hulda. »Auf beides lege ich keinen gesteigerten Wert – schon gar nicht mit dem Huf eines hysterischen Trabers auf dem Schoß.«
»Kann ich dir nicht verdenken«, erwiderte Carlo. Die Begeisterung seiner Familie für Pferde hatte er nicht geerbt. Dabei war es nicht etwa so, dass er gegen die Tiere etwas hatte – sie waren ihm nur zu groß. Hätte er wählen können, hätte er seinen Lebensunterhalt bevorzugt mit der Zucht von Stallkaninchen oder Pfingstrosen verdient. Oma Hulda behauptete, ihr sei das alles Jacke wie Hose. »Was gemacht werden muss, wird eben gemacht.«
Genauso war ihre Reaktion ausgefallen, als im November 1918 der Kaiser abgedankt hatte und damit die Welt des preußischen Adels, wie sie sie kannte, in den Trümmern des verheerenden Krieges versunken war. Mit den Worten »das Alte, Morsche ist zerfallen« hatte der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann von einem Fenster des Reichstags aus begeistert die Republik ausgerufen, doch für Unzählige war dieses Alte, Morsche das einzig Vertraute. Eine der sogenannten Freundinnen hatte sich mit Arsen vergiftet, weil sie sich »der kalten neuen Welt« nicht gewachsen fühlte. Oma Hulda hingegen, die ihren einzigen Sohn verloren hatte, hatte einfach weitergemacht.
»Ich weiß nicht, wie du das schaffst«, hatte eine andere der Freundinnen mit einem Seufzen erklärt. »Du bist doch auch nicht jünger als ich.«
»Ich kenne das Geheimnis ewiger Jugend«, hatte Oma Hulda gekontert. »Meine Schwiegertochter ist ein Prinzesschen und meine Tochter ein Sperling – beide entzückend, aber ganz und gar lebensunfähig. Ich kann es mir schlicht nicht leisten, alt zu werden.«
Sie hatte sich darauf eingestellt, künftig das Steuer des Familienschiffs allein in den Händen zu halten und es obendrein durch eine Zeit zu manövrieren, in der es keine Kavallerie mehr geben würde und auch keine begüterten Adelsfamilien, in denen es zum guten Ton gehörte, edle, auf Gut Neu-Mahlen gezüchtete Reitpferde zu halten. Der Besitz, auf dem Carlo und Nina ohne jede Sorge aufgewachsen waren, war verschuldet, die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse sanken, und der blühende Handel mit dem Osten kam zum Erliegen. Oma Hulda aber hatte sich geweigert, aufzugeben. »Irgendwie wird es schon weitergehen«, hatte sie gesagt. »Etwas anderes kann ich für meinen Sohn ja nicht mehr tun, als seinem Sohn den Besitz zu erhalten.«
Zu ihrer Verblüffung hatte sie das jedoch nicht allein tun müssen. Eines Tages hatte ihre Schwiegertochter, Carlos Mutter, die verwöhnte Freifrau Ulrike, in der Sattelkammer gestanden, hatte sich ebenfalls hohe Stiefel und einen Mantel aus Ölzeug übergestreift und verkündet: »Das Prinzesschen meldet sich zum Arbeitsdienst. Lebensunfähig war ich lange genug, und die Familie, die es zu erhalten gilt, ist auch meine. Im Übrigen bin ich der Meinung, wir sollten auf Traber umsatteln. Mit Pferden für Offiziere ist kein Geld mehr zu machen, aber wo jetzt so vielen von ihnen der Absturz droht, wird jegliches Geschäft mit dem Glücksspiel – legal oder illegal – blühen.«
Die Logik leuchtete Oma Hulda ein, und ohne Federlesens packte sie an. Sie gaben ein Vermögen, das sie nicht besaßen, für den Ausbau einer Trainingsbahn, zwei gedeckte Stuten und zwei vielversprechende Fohlen aus und vermieden es fortan, das Thema Geld auch nur zu erwähnen. Ihr Möglichstes taten sie alle – selbst Tante Sperling, die dünn wie ein Bleistift war und ständig kränkelte. Sie versuchte, die Bücher zu führen, wofür sie leider kein sonderliches Talent mitbrachte. Weit besser war sie darin, der kleinen Otta, die Oma Hulda »das Mühlrad« nannte, weil sie fortwährend plapperte, Geschichten vorzulesen, wenn sie auch zur praktischen Kinderpflege völlig ungeeignet war. Diese übernahm die Haushälterin Fritzi, wann immer Mutter Ulrike auf Auktionen und Rennplätzen von Mariendorf bis Daglfing unterwegs war.
Eine teure Kinderfrau konnten sie sich sparen, ebenso weiteres Personal bis auf Ferdi, den Stallknecht, und Max, Vaters alten Leibdiener, dem niemand den Laufpass geben mochte und der sich seither als »Männchen für alles« bezeichnete. Niemals hätte Carlo erwartet, dass ein so großer Besitz wie Gut Neu-Mahlen sich mit so wenigen fest angestellten Bediensteten betreiben ließe, aber die patenten Frauen seiner Familie übertrafen sich selbst. Oma Hulda verschloss kurzerhand sämtliche Räume, die sie nicht unbedingt brauchten, und ließ die Möbel abdecken. »Wenn wir uns in dem einen Salon, den wir heizen, alle auf der Pelle sitzen, wird’s obendrein wärmer«, sagte sie.
Statt der Hausangestellten bezahlten sie nun Harro Wackermann, einen Kriegsversehrten, der sich einer in Splitter geschossenen Kniescheibe zum Trotz auf das Training von Trabern verlegt hatte. Neben ihm kümmerte sich Carlos Mutter selbst um die Ausbildung der Pferde und bewies darin erstaunliches Talent.
»Ich habe schon als kleines Mädchen lieber mein Wägelchen gelenkt, als mir im Sattel meine Röcke schmutzig zu machen«, behauptete sie lapidar.
Erste Anzeichen deuteten darauf hin, dass die Mutter recht behalten würde. Unzählige Männer aus Offiziersfamilien hatten im Kaiserreich auf großem Fuß, jedoch mehr oder minder auf Pump gelebt und mussten nun feststellen, dass Glanz und Gloria, die ihnen Kredit verschafft hatten, verpufft waren. In der jungen Republik der Kriegsverlierer, die nur noch ein auf gut hunderttausend Mann beschränktes Friedensheer unterhalten durfte, gab es für Säbelrassler keine Verwendung mehr. Um ihren gesellschaftlichen Status zu erhalten, blieben ihnen zwei Arten von Glücksspiel: Roulettetisch und Rennbahn auf der einen und der Heiratsmarkt auf der anderen Seite.
An Gut Neu-Mahlens junger Traberzucht wuchs mithin das Interesse. Fohlen wurden in Pension und in Training gegeben, Rennställe meldeten Interesse am Kauf von Jungpferden an. Bis die Neuausrichtung sich allerdings rentierte, würde es noch dauern, und Monat für Monat musste die kleine Gemeinschaft auf Neu-Mahlen erleben, dass auch eine Kapitaldecke, die gar nicht vorhanden war, beständig dünner werden konnte. Ein sonntäglicher Sieg von Sternenbanner, dem ersten hier aufgezogenen Traber, wurde dringender gebraucht als Regen in der Wüste – nicht nur des Preisgeldes wegen, sondern auch weil ein solcher Triumph Gläubiger und Geldgeber gnädig stimmen würde. Dem Gestüt und Rennstall eines potenziellen Derbysiegers würde hoffentlich keine Bank so schnell den Kredit aufkündigen. Kein Wunder also, dass Oma Hulda sich der Vorbereitung des Pferdes mit aller Hingabe widmete.
»Wenn Sternenbanner uns im Stich lässt und das Darlehen bei Bleichröder platzt, werden wir uns etwas Neues einfallen lassen müssen«, hatte sie erst gestern beim Abendessen gesagt.
Was das bedeutete, wussten sie alle, auch wenn niemand es aussprach. Die Familie von Veltheim würde sich wie so viele nach einer vorteilhaften Heirat umsehen müssen, in der Hoffnung, dass ein über dreihundert Jahre alter preußischer Adelstitel auf betuchte Kandidaten noch immer anziehend wirkte – auch wenn das Ende der Monarchie sämtliche Privilegien und selbst entsprechende Anreden hinweggefegt hatte. Carlo hatte stumm von einem zum anderen gesehen und war sicher gewesen, die Gedanken hinter ihren Stirnen lesen zu können. Aus diesem Grund hatte er in der vergangenen Nacht keinen Schlaf gefunden und aus diesem Grund stand er jetzt hier im Gang vor Sternenbanners Box und hielt eine abgeschabte Geldbörse und ein dünnes Buch in der Hand.
»Und?«, fragte Oma Hulda, noch immer ohne den Huf des Hoffnungsträgers zu bewegen. »Kann ich dir irgendwie behilflich sein, oder bist du nur gekommen, um Löcher in die Luft zu starren?«
»Ich muss mit dir sprechen«, sagte Carlo.
»Das dachte ich mir. Erfahre ich auch noch, worüber?«
»Über Nina«, antwortete Carlo.
»Du wirst lachen, aber auch das habe ich mir bereits gedacht.« Seine Großmutter stellte endlich den Huf des Pferdes zurück auf den sicheren Boden und ließ sich auf einen Schemel sinken, der in der Box stand, als wolle sie den Traberhengst melken.
»Warum?«, fragte Carlo perplex.
»Wenn einer wie du mit einem solchen Bittstellergesicht um die Ecke kommt, geht es nie um ihn selbst«, antwortete Oma Hulda. »Dein Vater war genauso. Selbstlos bis auf die Knochen, und wenn er ein Anliegen hatte, dann betraf es meist sein herzallerliebstes Schwesterlein, für das er sich hätte prügeln lassen, der kleine Ritter. Warum, meinst du, ist dieser Sperling von einer Frau so gänzlich weltfremd und lebensuntüchtig geworden und hat obendrein nie geheiratet? Weil sie es nicht nötig hatte, sich auch nur um eine einzige ihrer Angelegenheiten selbst zu kümmern. Sie hatte ja Guntram. Und Nina hat dich.«
»Nina ist aber nicht weltfremd und lebensuntüchtig«, protestierte Carlo. »Bei uns ist es eher umgekehrt.«
»Stattgegeben«, sagte Oma Hulda. »Trotzdem würdest du dein letztes Hemd für deine Schwester geben, und wie es aussieht, mehr als nur das.«
Sie wies auf das Buch, das er in der Hand hielt. Nun warf plötzlich der Hengst seinen Kopf auf und tänzelte nervös. »All das Geschwätz in seiner Box zerrt ihm an den Nerven«, befand Oma Hulda und stand auf. »Komm mit. Dass unser Freund mit den goldenen Beinen sich verletzt, ist das Letzte, was wir wollen.«
Sie trug den Schemel aus der Box und marschierte Carlo voran in die Sattelkammer, die so etwas wie ihr Empfangszimmer darstellte. Unter den Haken, an denen die nach Leder und Sattelseife riechenden Geschirre der Traber hingen, stellte sie ihre Sitzgelegenheit wieder auf und bot Carlo einen zweiten Hocker ihr gegenüber an. Dann streckte sie die Hand nach dem Buch und der Geldbörse aus. »Dein Sparbuch«, stellte sie fest, ehe sie die blanke, abgegriffene Börse in die Höhe hielt. »Und was ist das hier? Soweit ich weiß, ist das deiner Mutter ausgehändigt worden, nachdem man ihr mitgeteilt hat, dass sie auf die Rückkehr ihres Mannes nicht länger zu warten braucht.«
Carlo nickte. »Vaters Geldbörse. Mutter fand, ich sollte sie als Andenken haben. Seither habe ich darin alles an Geld gespart, das ich in die Finger bekam.«
Oma Hulda öffnete die Börse und blätterte verblüfft durch die Banknoten. »Wie du von nichts so viel hast sparen können, wirst du mir erklären müssen. Spuckst du Geld? Warum machen wir uns dann so viel Mühe mit den Trabern?«
»Ich hatte schon vorher eine ganze Menge«, gab Carlo zu. »Was immer ich von meinen Paten, von Mutters Verwandten und von dir geschenkt bekam, habe ich aufgehoben. Früher gab es Süßes, das ich mir aufsparen wollte und das dann schlecht wurde, und später eben Geld.«
»Das ist auch schon ein bisschen schlecht geworden«, konstatierte Oma Hulda. »In amerikanischen Dollars bekommst du für deine mühsam gehamsterten Reichsmark gerade noch ein Zehntel von dem, was sie vor dem Krieg wert waren.«
»Ich weiß«, sagte Carlo. Zwar kamen nicht länger wie zu Zeiten seines Vaters täglich drei Zeitungen ins Haus, aber die eine, die Vossische, die sie behalten hatten, las er jeden Morgen mit Sorgfalt. Der rasche Wertverfall des Geldes war eines der zahllosen Probleme der jungen Republik. Dennoch musste man ja optimistisch bleiben, vor allem wenn man jung war und sein Leben vor sich hatte. Seine Schwester Nina war ihm darin ein Vorbild. Ihre Energie und Lebenskraft ließen sich durch keine Gräuelnachricht dämpfen. »Mein Geldberg ist mächtig zusammengeschrumpft, aber ein kleiner Hügel ist noch da. Und das Guthaben im Sparbuch sieht ziemlich ordentlich aus.«
»Kein Wunder«, bemerkte Oma Hulda. »Das hat dein Vater auf meinen Rat hin für dich angelegt. Und zwar in einer Zeit, in der seine sämtlichen Bekannten um die Wette gerannt sind, um ihre Spargroschen dem Kaiser für seine Kriegsanleihen in den Rachen zu werfen.«
Carlo lächelte. »Du hättest Bankier werden sollen, Oma Hulda.« Nicht wenige Gutsbesitzer in der Uckermark hatten die Überreste einst beachtlicher Familienvermögen in Rauch aufgehen sehen, weil die gezeichneten Kriegsanleihen nach der Niederlage wertlos waren, doch wenigstens das war der Familie auf Neu-Mahlen erspart geblieben.
»Frauen werden nichts«, beschied sie ihn. »Frauen heiraten oder bleiben Mädchen wie Sperling.«
»Wir haben das Jahr neunzehnhundertzwanzig«, begann Carlo vorsichtig und ließ sich endlich auf dem Hocker nieder. »Heutzutage sitzen Frauen im Reichstag, Oma. Und immer mehr entscheiden selbst, was aus ihrem Leben werden soll.«
»Ach, ich vergaß«, bemerkte Oma Hulda trocken. »Du wolltest ja über Nina sprechen.«
»Sie kann nicht heiraten«, platzte Carlo heraus. »Sie sagt nichts dazu, weil wir ja alle nichts sagen. Aber ich weiß, dass sie vor dem Augenblick zittert, in dem einer von uns ihr erklärt, sie müsse, um Neu-Mahlen zu erhalten, mit irgendwem eine Ehe eingehen.«
»Bis jetzt ist mir nicht bekannt, dass ein Bewerber vorgesprochen hätte«, sagte Oma Hulda. »Weißt du etwas, das ich nicht weiß, oder reden wir hier über ungelegte Eier?«
Carlo entschied sich zur Flucht nach vorn. »Nina muss nach Berlin«, sagte er. »Sie hockt dort oben im Dachboden, zwischen ihren zusammengestückelten Bühnenutensilien, studiert ein Stück nach dem anderen und liest jede Zeile im Feuilleton, aber was sonst soll sie denn machen? Als Kinder haben wir alle sie um eine Rolle in ihren Inszenierungen angebettelt, aber inzwischen sind wir erwachsen, und sie sitzt allein da und vergeudet ihr Talent.«
»Du hast sie angebettelt?« Oma Hulda hob ihre halbrunden Brauen bis fast an den Haaransatz. »Das ist mir aber anders in Erinnerung.«
»Nun ja. Ich war zweifellos ihr untauglichster Schauspieler«, gab Carlo zu. »Aber eine wie Nina reißt selbst mich mit. Sie ist begabt, Oma. Sie ist so begabt, dass sie einfach nicht hier sitzen bleiben und vor Puppen und kaputt geliebten Plüschtieren spielen darf, sondern etwas daraus machen muss.«
»Und woher willst du das wissen, wo du deiner eigenen Einschätzung nach von der Materie doch herzlich wenig verstehst?«
»Ich weiß es eben«, sagte Carlo. »Und du weißt es auch.«
»Ich?« Oma Hulda zog den Vokal in die Länge. »Zu meiner Zeit ging man ins Theater, nicht um zu sehen, sondern um gesehen zu werden. Man saß brav seine drei Stunden vor einem Drama von Goethe oder Schiller ab, anschließend wedelte man auf der Freitreppe ein wenig mit seiner Nerzstola und fuhr wieder nach Hause. Ich muss dich enttäuschen, mein Junge. Falls in diesem Haus überhaupt jemand etwas vom Theater versteht, bin es nicht ich.«
»Aber von Nina verstehst du etwas«, sagte Carlo. »Von Menschen.«
»Schon möglich. Das lässt sich in siebzig Jahren Leben nicht völlig vermeiden.«
»Du weißt, dass Nina von klein auf eine Bühne im Kopf hatte und sich ihre Welt darauf inszeniert hat«, beschwor sie Carlo. »Sie ist wie ein Rennpferd im Startblock: Solange sie darin eingesperrt ist, mag man sie vollkommen unscheinbar finden – ein schmächtiges Mädchen mit blasser Haut und glattem braunen Haar. Doch im Innern bebt sie vor Energie. Sobald der Block aufspringt und sie von der Sehne schnellt, ist nichts mehr unscheinbar an ihr, und kein Mensch, der ihr zusieht, wird sie je wieder aus dem Kopf bekommen.«
»Im Trabrennsport gibt es keinen Startblock«, sagte Oma Hulda.
»Trab ist für Nina auch nicht rasant genug«, gab Carlo zurück. »Für diese Energie, die sie hat, ist Gut Neu-Mahlen in der verschlafenen Uckermark viel zu klein. Ich möchte, dass wir sie nach Berlin schicken. Dahin, wo die Theater und Kinos wie Pilze aus dem Boden schießen.«
»Und was genau soll sie unter diesen schießenden Pilzen bitte anfangen?«, fragte Oma Hulda.
»Das weiß ich nicht«, antwortete Carlo prompt. »Schauspielunterricht nehmen, eine Stellung beim Theater suchen, das muss sie selbst herausfinden. Und das wird sie auch. Wir müssen sie nur wissen lassen, dass wir ihr den Weg bereiten wollen. Dass es ein gemeinsames Vorhaben der Familie von Veltheim ist, genau wie die Traberzucht und der Anbau von Braugerste. Und wir müssen ihr Geld geben, damit sie sich in der Hauptstadt eine Unterkunft mieten und sich die erste Zeit über Wasser halten kann.«
»Du willst eine von Veltheim, die noch nicht einmal volljährig ist, allein nach Berlin schicken und ihr dort – wie hast du dich ausgedrückt? – eine Unterkunft mieten?« Ein wenig zittrig wurde Oma Huldas Stimme in den Spitzen jetzt doch.
»Nicht irgendeine von Veltheim«, sagte Carlo. »Sondern Nina. Du weißt, dass sie anders ist, als du es warst, und auch anders, als Mama und Tante Sperling es waren. Du weißt, dass die Zeit anders ist und wir unseren Platz darin erst finden müssen. Ich bin zu dir gekommen, weil du nie vor etwas die Augen verschließt, egal, ob es dir schmeckt oder nicht. Im Grunde weißt du genau wie ich, dass wir Nina nicht in eine Heirat um des Gutes willen zwingen dürfen. Sie würde einwilligen, weil wir in diesen vier Jahren seit Vaters Tod eben zu dieser verschworenen Gemeinschaft zusammengewachsen sind, in der es unmöglich ist, den anderen Hilfe zu verweigern. Aber sie würde daran kaputtgehen. Vielleicht würde man ihr auf den ersten Blick nichts anmerken, weil dieses kleine Geschöpf ja genau wie du aus Eisen zu sein scheint. Aber sie wäre nicht länger die Nina, als die wir sie kennen und als die sie gedacht war.«
Seine Großmutter gab nicht sofort Antwort, was ungewöhnlich für sie war. Stattdessen suchte sie seinen Blick und hielt ihn fest. »Ist dir klar, dass es das ist, was das Leben ausmacht?«, fragte sie dann. »Sich den Gegebenheiten anpassen, sich nach der Decke strecken und irgendwann nicht mehr der sein, als der man gedacht war? Die hübschen goldenen Knollen, die wir aus unseren Pflanzbeeten buddeln, sind schließlich auch nicht dazu gedacht, als Stampfkartoffeln zu enden. Aber mit Stampfkartoffeln kann man einen großen Haushalt ziemlich gut satt bekommen, und gestorben ist auch noch niemand daran.«
Carlo öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, doch seine Großmutter hob die Hand und sprach weiter. »Dieses bisschen Geld, das du gerade mit so großer Geste wegschenken willst, ist übrigens ein sogenannter Notgroschen, der eingezahlt wurde, als dein Vater das letzte Mal hier bei seiner Familie war. Was geschehen würde, hat er absehen können, und er wollte, dass dir zumindest der Weg in ein ordentliches Leben offensteht. ›Das Gut mag verloren gehen‹, hat er gesagt. ›Früher hätten wir unseren Söhnen Offizierspatente gekauft, um sie halbwegs versorgt zu wissen, doch ich bezweifle, dass es nach diesem Krieg dafür noch ein Heer geben wird. Machen wir uns nichts vor: Unsereins hat ausgedient. Das Geld soll sicherstellen, dass Carlo ein Studium absolvieren kann, das in der neuen Zeit von Nutzen ist.‹«
Carlo schluckte trocken. Er hatte nie das Gefühl gehabt, seinem Vater sonderlich nahezustehen, und oft sogar befürchtet, ihn zu enttäuschen. Nun zu erfahren, wie liebevoll er sich um ihn gesorgt hatte, berührte ihn so sehr, dass er sekundenlang nicht weitersprechen konnte. Gleich darauf aber riss er sich zusammen und suchte den Blick seiner Großmutter wie diese zuvor den seinen.
»Ich bin hier zufrieden«, sagte er. »Reich werden wir wohl nicht wieder werden, doch solange wir unser Auskommen haben, wüsste ich nichts, das ich lieber täte, als hier vor mich hin zu leben. Um Nina aber steht es anders. Sie zieht es fort – und wenn der Vater nicht gestorben wäre, hätte er dafür gesorgt, dass sie geht.«
3
Nina
Etwas auch nur annähernd Vergleichbares hatte sie noch nie gesehen. Der Verkehr in der Berliner Friedrichstraße floss oder sickerte nicht, sondern toste und tobte, und so geschickt der Chauffeur ihre Kraftdroschke auch zu lenken versuchte, er steckte dennoch alle paar Meter fest. Automobile hupten, Omnibusse waren vollgestopft bis auf die Trittbretter, Fußgänger und Radfahrer schlängelten sich im Slalom von einer Straßenseite zur andern, Straßenbahnen zogen ratternd ihre Spur. Der Lärm war atemberaubend. Tante Sperling, die mit der zarten Arbeit in ihrem Stickrahmen beschäftigt gewesen war, ließ diesen sinken und presste sich die Hände auf die Ohren.
»Ist das hier immer so?« Ihre Stimme vibrierte. »Wie willst du denn dann verstehen, was diese Herren, bei denen du dich vorstellen musst, zu dir sagen, Ninchen?«
Die Augen der Tante waren wasserblau, wie die von Ninas Vater gewesen waren, doch ihr Blick hatte mit seinem nichts gemein. Während er voller Zuversicht und Weltvertrauen ins Leben geblickt hatte, schien sie sich ständig vor etwas zu fürchten.
»Wir schreien einfach«, antwortete Nina und lachte. »In Berlin schreien alle, Tante Sperling. Das ist hier gang und gäbe.«
»Biest.« Carlo, der neben ihr saß, stieß ihr den Ellenbogen in die Seite.
Nina grinste ihn an, dann wandte sie sich dem Fenster des Automobils zu, um den belebenden Tumult der Hauptstadt in sich aufzusaugen. Natürlich hatte ihr Bruder recht. Es war nicht fair, sich über Tante Sperling lustig zu machen, aber zuweilen konnte Nina einfach nicht widerstehen. Sie meinte es ja nicht böse. Die kleine Tante mit dem verschrobenen Weltblick und dem Kopf in den Wolken gehörte zu den Menschen, die sie auf der Erde am meisten liebte. Seit ihr Vater gestorben war, liebte sie sie womöglich noch zärtlicher, denn sie war das, was ihr von ihrem Vater geblieben war – die Hälfte eines in der Mitte auseinandergebrochenen Zwillingsgespanns.
Sie hatte des Vaters Güte, wenn diese sich bei ihr auch ganz anders zeigte. Tante Sperling bastelte einem Hühnerküken eine Schiene für seinen gebrochenen Flügel, bestickte Taschentücher für das Waisenhaus in Templin und hatte einmal einen Mann, der aus der Remise Geräte hatte stehlen wollen, ins Haus eingeladen, in dem sie zu dieser Zeit allein gewesen war. Als der Rest der Familie zurückkam, fanden sie den Einbrecher, der als Infanterist in Flandern eine Hand verloren hatte, wie er an der Tafel im Speisezimmer saß und Suppe löffelte. Selbst die Kerzen in den jahrhundertealten Leuchtern aus Königsberger Silber hatte Tante Sperling ihm angezündet.
»Er hat mich so an unseren lieben Guntram und all die anderen armen Soldaten und Offiziere denken lassen, für die jetzt niemand mehr ein gutes Wort hat«, hatte sie zu ihrer Erklärung vorgebracht.
»Tatsächlich?«, fragte sie jetzt und schüttelte ungläubig den Kopf. »Den ganzen Tag nur schreien? Also, für mich wäre das nichts, Ninchen, da hätte ich am Abend ja gar keine Stimme mehr. Außerdem denke ich immer, ich hätte etwas Dummes gesagt, wenn jemand mich anschreit.«
Es gehörte zu Tante Sperlings bezaubernden Eigenschaften, dass sie Ironie nicht verstand, sondern jedes Wort, das einer ihrer Lieben zu ihr sprach, für bare Münze nahm und mit aller Sorgfalt auf eine Goldwaage legte.
»Eene meene Mopel, wer frisst Popel«, sang Otta und schlenkerte mit den Beinen. Auf dem Bahnhof, einem gigantischen, aus Stahl und Glas errichteten Ameisenhaufen, auf dem sie unbedingt hatte Fassbrause trinken müssen, hatten drei Jungen den Abzählreim vor sich hin gesungen, und die blitzgescheite Brandenburger Göre hatte sich die Worte im Handumdrehen eingeprägt.
Nicht nur die Worte, sondern auch die Gewissheit, dass sie damit die Erwachsenen aus der Reserve locken konnte.
Ihre Mutter, die zu ihrer Rechten saß und ihre Jüngste mit einem Arm auf dem Sitz festhielt, stöhnte lediglich und verdrehte gottergeben die Augen.
»Herzelein, das gehört sich nicht«, sagte Tante Sperling. »Nicht für ein so nettes kleines Mädchen wie dich.«
»Ich bin kein nettes kleines Mädchen«, trumpfte Otta auf.
»Wo sie recht hat, hat sie recht«, bekundete Oma Hulda.
»Wieso, klein ist sie doch noch«, kam es von Fritzi, der Haushälterin, die Nina gegenüber neben der Oma am Fenster saß und einen Korb mit Proviant auf den Knien balancierte.
Ehe sie lachen musste, wandte Nina sich erneut dem strudelnden Verkehr zu. Ihre Familie hatte es sich nicht nehmen lassen, sie im Tross nach Berlin zu begleiten, und da Fritzi samt ihren hart gekochten Eiern, eingelegten Gurken und Mettwurststullen zur Familie gehörte, mussten Ferdi und Max, das Männchen für alles, eben einen Tag lang auf dem Gut allein zurechtkommen. Falls uns ein Theaterleiter begegnet, denkt der, ich habe mir gleich ein Wanderensemble mitgebracht, dachte Nina und winkte einer Klasse von Schulkindern zu, die in Zweierreihen versuchten, die Fahrbahnen zu überqueren. Auf dem offenen Oberdeck eines Busses der Linie acht saßen junge Männer mit Studentenmützen und winkten in wilder Aufregung zurück.
So war sie eben, ihre Familie – wer einen von ihnen wollte, bekam die übrigen gratis mitgeliefert. In den letzten Kriegstagen hatte Otta in Templin zum Zahnarzt gemusst, um sich eine Zahnfleischentzündung pinseln zu lassen. Wie selbstverständlich waren sämtliche Familienmitglieder – allerdings ohne Fritzi – mitgezogen, hatten zu sechst in dem überfüllten Wartezimmer gehockt und sich auch zu sechst in den engen Behandlungsraum gequetscht.
Der Zahnarzt war eine Zahnärztin, die allerdings mangels Approbation nur den Titel ›Zahnkünstlerin‹ führen durfte. Es war schließlich Krieg, und die Herren der Schöpfung waren mit anderem als Zähnen beschäftigt. Kurzerhand schnappte die resolute Zahnkünstlerin sich Oma Hulda, drückte sie in den Stuhl und sperrte ihr den Mund auf, um sie zu untersuchen.
»Der muss raus«, verkündete sie, und wenig später war Oma Hulda um einen Backenzahn ärmer.
Die nahm es fatalistisch. »Mitgefangen, mitgehangen«, bekundete sie und kühlte sich die Wange mit geeistem Korn.
Und genauso war es auch jetzt. Tante Sperling mochte Ohrenschmerzen haben und die Mutter sich sorgen, weil sowohl das Derby als auch die Frühlingsauktionen bevorstanden, aber keiner von ihnen ließ es sich nehmen, Nina in ihr neues Zuhause zu begleiten.
Neues Zuhause.
Wie ganz und gar unglaublich das klang. Diese Stadt vor dem Wagenfenster, die mit jedem Pumpen ihres Herzens das Unterste zuoberst kehrte, würde von nun an ihr Zuhause sein.
Ihre Familie hatte ihr ein Geschenk gemacht, das zu groß war, um es zu begreifen. Im Grunde war es vor allem zu groß, um es anzunehmen. Als sich die sechs – einschließlich Otta und Fritzi – aneinandergedrängt wie Verschwörer vor Nina aufgebaut hatten, um ihr ein brandneues Kontobuch vom Berliner Bankhaus S. Bleichröder zu überreichen, hatte sie sich mit Händen und Füßen gewehrt. Natürlich steckte Carlo dahinter, der Bruder, den sie einfach nicht verdient hatte, den niemand verdiente. Er hatte das Geld aufgegeben, das für seine Ausbildung beiseitegelegt worden war, und die anderen angestiftet, ähnlich exorbitante Opfer zu bringen. Tante Sperling hatte ihre Aussteuer verkauft, und Fritzi hielt ihren etliche Male gestopften Sparstrumpf in der Hand.
»Ihr seid der großartigste, wundervollste Haufen, der auf diesem Planeten herumläuft«, hatte Nina gesagt. »Aber das, was ihr hier zusammen ausgekocht habt, kommt nicht infrage. Ihr behaltet alle euer Geld, und ich bleibe hier und heirate jemanden, der was von Pferden versteht. Das Ende der Welt ist das schließlich nicht. Ich liebe Pferde, besonders meinen Palü …«
»In der Tat, das tust du«, hatte Oma Hulda sie unterbrochen. »Leider muss ich dich aber darüber in Kenntnis setzen, dass es kein Pferd wäre, das du heiraten würdest. So einfach, wie du es dir in deinem jugendlichen Leichtsinn vorstellst, ist es nicht.«
Ninas Mutter lachte auf, was viel zu selten geschah. »Also, ich persönlich hätte die Ehe mit meinem Mann der mit einem Pferd vorgezogen. Aber darum geht es ja nicht, denn du, mein Ninchen, willst keines von beidem, selbst wenn du reitest wie die tollste Amazone. Davon hat Carlo uns höchst eloquent überzeugt.«
»Was ich will, spielt dabei keine Rolle«, hatte Nina gesagt. »Carlo braucht das Geld für seine Ausbildung, und Fritzi …«
»Bist du keine Frauenrechtlerin?«, war ihr von Neuem ihre Oma ins Wort gefallen. »Nur um das klarzustellen: Ich bin keine, mir ist vor dir nie eine begegnet, und ich kenne mich mit derlei Belangen nicht aus. Ich habe mir aber eingebildet, als Frauenrechtlerin müsstest du der Ansicht sein, ein junges Mädchen habe ebenso ein Recht auf eine Ausbildung wie ein junger Mann. Liege ich damit falsch?«
»Natürlich nicht!«, hatte Nina gerufen. »Aber bei uns ist doch nun einmal nicht genug Geld für beide da.«
»Also bekommt das Geld derjenige, dem es wichtiger ist«, hatte Carlo kurzerhand erklärt. »Mir geht es gut hier, Nini. Ob ich mich wirklich durchringen könnte, ein Studium zu absolvieren, bezweifle ich. Vermutlich wäre ich zu träge dazu. Du dagegen bist ungefähr so träge wie ein Taifun.«
Sie sahen sich an, sie lachten sich in die Augen, und Ninas Herz begann heftig zu klopfen, weil ihr klar wurde, dass es wahr werden könnte, dass es ein Stern war, nach dem sie nur zu greifen brauchte: Nina von Veltheim in Berlin. Nina von Veltheim am Theater. Nina von Veltheim auf dem Weg in eine Welt, die immer ihre gewesen war, obwohl sie sie in Wahrheit doch gar nicht kannte. Dennoch protestierte sie: »Himmelherrgott – ihr wisst doch alle besser als ich, dass wir hier jeden Pfennig brauchen, wenn aus der Traberzucht Neu-Mahlen etwas werden soll!«
Daraufhin war ihre schmale Mutter, die sie mit ihrer Zähigkeit alle überraschte, vorgetreten und hatte ihr in die Augen geblickt. »Glaubst du an dich?«, hatte sie gefragt. »Ist es so, wie Carlo sagt, dass du dir für deine Zukunft nichts anderes vorstellen kannst als das Theater und dass du, wenn du dich am Theater siehst, keine Angst verspürst, sondern einzig Zutrauen? Ich habe die große Duse und die Bernhardt erlebt, aber ich könnte dennoch niemals beurteilen, ob jemand für diese Dinge begabt ist. Bist du begabt, Ninchen?«
Nina hatte Nein sagen wollen. Sie hatte schließlich keine Duse und keine Bernhardt erlebt, sondern nur eine Handvoll Provinzaufführungen in Templin, das Laientheater am Lyzeum und ein paar wundervolle Filme im Kino. Auf welcher Grundlage sollte also ausgerechnet sie sich einbilden, sie sei begabt? Einigermaßen verblüfft über sich selbst hatte sie stattdessen genickt. Sehr langsam zwar. Aber überzeugt. Sie war erst zwanzig, doch ihr war, als hätte sie ihr ganzes Leben lang Welten auf eine Bühne gestellt.
»Na bitte«, hatte ihre Mutter gesagt. »Wenn es so ist, ist unser Geld bei dir doch gut angelegt, und wir können sicher sein, dass du es uns eines Tages zurückzahlen wirst.«
Lauthals waren die anderen eingefallen und hatten nicht zugelassen, dass Nina diesem frappierenden Argument noch etwas entgegensetzte. Also gut, hatte sie gedacht. Wenn ihr daran glaubt, werde ich es ab heute auch tun und alles daransetzen, dass ihr recht behaltet. Anschließend war der ganze Rest so schnell gegangen, dass sie mit dem Denken nicht hinterherkam. Oma Hulda hatte über Bekannte eine Offizierswitwe aufgetan, die im frisch eingemeindeten Berliner Bezirk Kreuzberg Zimmer vermietete, und heute, drei Wochen später, waren sie bereits in Berlin, auf dem Weg zu Ninas Unterkunft. Sie hatte die Zeit genutzt, um sich die Adressen etlicher Theater aus den Zeitungen herauszuschreiben, und würde gleich morgen anfangen, sich bei ihnen zu bewerben.
War sie ehrlich zu sich selbst, so hatte sie keinen Schimmer, wie man so etwas anfing, aber das mochte ihr sogar zum Vorteil gereichen: Wenn man nicht wusste, wie eine Sache bewerkstelligt wurde, wusste man auch nicht, was man dabei alles falsch machen konnte.
Am Abend vor der Abreise hatte Tante Sperling sie außerdem beiseitegenommen und ein wenig beruhigt: »Mach dir wegen des Geldes nicht allzu viele Sorgen, mein Liebes. Ich habe ja noch mein Sparbuch, in das ich, solange ich denken kann, jeden kleinen Pfennig einzahle. Das ist für euch drei gedacht, für die Kinder von meinem lieben Bruder Guntram, als Erinnerung, wenn ich einmal nicht mehr bin. Falls aber Not am Mann ist, brauche ich ja nur nach Templin auf die Bank zu gehen, und prompt haben wir das Geld.«
Das wird nicht nötig sein, schwor Nina ihr stumm. Und Geld als Erinnerung an dich brauchen wir schon gar nicht, denn wie könnte irgendwer, der dich gekannt hat, dich je vergessen?
Stockend ging die Fahrt voran. Jetzt bogen sie in eine schmalere, aber umso belebtere Straße ein, zu deren Seiten sich mehrstöckige Häuser mit unzähligen Geschäften und Lokalen erhoben. Unter den Markisen, entlang der Schaufenster und Werbeplakate eilten oder flanierten mehr Menschen, als Nina je auf einmal gesehen hatte. Sie war als Kind ein paarmal in Berlin gewesen, fand in ihrem Gedächtnis jedoch keine Bilder davon. Die ›Saison‹, die sie hier hätte absolvieren sollen, die Runde durch Salons und Ballsäle auf der Suche nach geeigneten Heiratskandidaten, hatte der Krieg verschluckt, und inzwischen gab es keine Saison für höhere Töchter mehr.
Nina war nicht böse darüber. Ihr Berlin war hier und jetzt und wie für sie gemacht. Es schien aus den Nähten zu platzen, ein riesiger Hut, aus dem unablässig Neues gezaubert wurde. Vier Millionen Einwohner hatte die Stadt und war damit nach New York und London die drittgrößte Metropole der Welt. Wie leicht musste es sein, sich in dieser Stadt zu verlieren wie in einem Labyrinth, in dem hinter Häusern nichts als weitere Häuser auftauchten. Und wie oft würde sie sich hier finden können! Die allumfassende Fremdheit, das nie Dagewesene, Unvertraute machte Nina keine Angst. Im Gegenteil. Seit sie aus dem Zug gestiegen waren, konnte sie es kaum erwarten, sich in den Rausch ihres neuen Lebens zu stürzen.
Dazu würde sie von den anderen Abschied nehmen und das erste Mal seit ihrer Flucht aus dem Schweizer Lyzeum die Nacht ohne sie verbringen müssen. Damals war sie vor Sehnsucht nach ihren Lieben krank geworden. Heute dagegen schämte sie sich, weil der Gedanke an die Trennung sie nicht mit Traurigkeit erfüllte, sondern sie den Augenblick geradezu herbeisehnte.
Hinter der Brücke über den Fluss lag zur Rechten eine riesige Baustelle mit einer halb fertigen Glaskugel, die wohl eine Bahnhofshalle werden sollte, wenn sie vollendet war. Gleich darauf, nach dem Verkehrsgewimmel einer weiteren Kreuzung, erhob sich an der Straßenecke ein prächtiges Haus mit einer Kuppel, auf der im Frühlingswind eine Fahne wehte. Central-Hotel stand in geschwungenen Buchstaben darauf. Nina hatte davon gehört: Der Vossischen zufolge war es Berlins größtes Hotel und eines der luxuriösesten dazu.
Seine Fassade zog sich schier endlos die Straße entlang. Über einer Reihe gläserner, goldverzierter Türen prangte eine ebenfalls goldene Leuchtreklame, die im kräftigen Nachmittagslicht jedoch noch nicht eingeschaltet war: Wintergarten, las Nina, Varieté. An den Glastüren klebten in Schwarz und Gold gehaltene, mit Sternen verzierte Plakate, die ein ›Dayalma-Ballett‹ und ›Berinelli, größter Jongleur aller Zeiten‹ ankündigten. Hotel mit Varieté? Ganz genau wusste Nina nicht, was in einem Varieté geboten wurde, aber sie hätte es liebend gern auf der Stelle herausgefunden.
Viel zu schnell waren sie an der glitzernden, lockenden Fassade vorbei, und schon tauchten weitere Attraktionen auf: eine Galerie mit verglastem Dach, die ein Panoptikum beherbergte, ein sich über drei Stockwerke ausbreitendes Restaurant, ein Tanzlokal und eine Mokkadiele, was auch immer man sich darunter vorzustellen hatte. Ninas Augen waren wie betrunken, und zugleich verspürte sie unbändigen Durst.
Mit einiger Mühe bog die klobige Kutsche schließlich in eine Querstraße ein, wo der Verkehr ein wenig behäbiger floss. Auch hier reihte sich ein elegantes Geschäft, ein einladend aufgemachtes Lokal ans andere, und erst als sie noch einmal abbogen, überwogen reine Wohnhäuser und Bürogebäude. »Jerusalemer Straße«, brummte der Fahrer. »Und welche Nummer wollten se nu’?«
»Welche Nummer?«, fragte Tante Sperling. »Wir möchten gern zur Wohnung der Frau Rottenheimer, bitte schön.«
Nina blickte an den fünf oder sechs Stockwerken der Häuser samt ihren Nebengebäuden hinauf und hätte um ein Haar laut aufgelacht.
Oma Hulda war weniger amüsiert. »Weißt du eigentlich, warum ich dich seit deiner frühesten Kindheit Sperling und nicht bei deinem Taufnamen Gundula nenne?«, blaffte sie ihre Tochter an. »Weil du vor dich hin zwitscherst, ohne zu denken.« Dann wandte sie sich dem Fahrer zu, der von einem zum andern blickte, als wäre er nicht sicher, welcher Spezies die Fahrgäste, die er sich da aufgegabelt hatte, angehörten. »Setzen Sie uns hier irgendwo ab. Bedauerlicherweise haben wir uns keine Hausnummer notiert und werden nun eben suchen müssen.«
»Sie woll’n hier nach ’nem Namen suchen, zu dem Se keene Nummer hab’n?«, fragte der Fahrer fassungslos. »Frauchen, da sind Se bis morjen früh um sechse noch nich’ fertich. Und dunkel wird’s ooch demnächst.«
»Man fügt sich eben in das Unvermeidliche«, erwiderte Oma Hulda und angelte über Fritzi und den Proviantkorb hinweg nach dem Türgriff. »Auch daran, dass sie sich neuerdings mit Frauchen betiteln lassen muss, geht eine Preußin schließlich nicht zugrunde.«
Der Fahrer lachte. »Junge, Junge. Den Schneid lassen Se sich so schnell nich’ abkoofen, wat? Hamse denn wenigstens ’nen Anhaltspunkt? Hat der, der Ihnen die Adresse jejeben hat, noch irjendwat jesacht?«
»Aufgang im Seitenflügel«, fiel Carlo ein, der vom Gasthaus in Templin aus mit der Witwe telefoniert hatte. »Und irgendetwas über einen Zeitungskiosk, glaube ich.« Er schlug sich vor die Stirn. »Ich könnte mich treten, weil ich mir die Nummer nicht aufgeschrieben habe.«
»Davon hat nun auch niemand mehr etwas.« Oma Hulda war bereits damit beschäftigt, die Mitglieder ihrer Familie sowie Ninas Habe aus dem Wagen zu bugsieren. An den Fahrer gewandt, fragte sie: »Können Sie mit dem Hinweis Zeitungskiosk etwas anfangen? Hilft uns das weiter?«
»Zeitungskioske ham wa in der Jerusalemer mindestens drei«, antwortete der Fahrer und wies in verschiedene Richtungen. »Aber sind Se sicher, dat Se nich’ dat Mossehaus suchen? Eener von unsere dicksten Zeitungsfritzen sitzt da drinne. Also nich’ im Moment, der Kasten hat ja bei die Krawalle vor zwee Jahren janz schön wat abjekricht, aber zum Ausgleich baut der Mosse sich den jetz’ noch ’n Zacken jrößer.«
Er zeigte geradeaus auf ein hohes Eckhaus, das sich aus dem beginnenden Dämmerlicht schälte und ganz und gar von einem Baugerüst umgeben war.
»Das kann sein«, murmelte Carlo kleinlaut. »Die Leitung war schlecht, und im Schankraum probte ein Männergesangverein. Ich habe nur irgendetwas mit Zeitung verstanden.«
»Also suchen wir zunächst sämtliche Aufgänge um dieses Mossehaus ab«, entschied Oma Hulda und hob die letzte Tasche aus dem Wagen. »Flott, flott, Kameraden, keine Müdigkeit vorschützen. Es kann sich nur um Stunden handeln.«
4
E