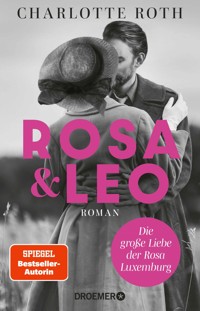9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der große biografische Roman über eine der beliebtesten deutschen Schauspielerinnen der 30er Jahre. Die Geschichte eines tragischen Frauenschicksals von der Autorin des Bestsellers »Als wir unsterblich waren« Charlotte Roth. Berlin 1931: Sie ist der Shooting Star, die Sensation des jungen deutschen Tonfilms. "Ich bin ja heut so glücklich" singt sie und scheint es ernst zu meinen. Renate Müller, der Münchner Journalistentochter, die mit achtzehn nach Berlin kam, verfällt die Filmwelt quasi über Nacht, obwohl sie so gar nicht dem gängigen Leinwandideal entspricht und weder das süße Püppchen noch den männermordenden Vamp verkörpert. Sie ist gefragt, begehrt, selbst Hollywood ruft nach ihr. Renate könnte so glücklich sein, wie es ihr berühmtes Lied verspricht, doch ihre große Liebe hat sie einem Juden geschenkt und gerät damit ins Visier der braunen Machthaber … Berührend, dramatisch und auf der wahren Geschichte der Schauspielerin Renate Müller beruhend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 670
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Charlotte Roth
Ich bin ja heut so glücklich
Roman nach einem wahren Schicksal
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Berlin 1931. Sie ist der Shootingstar, die Sensation des jungen deutschen Tonfilms. »Ich bin ja heut so glücklich«, singt sie und scheint es ernst zu meinen. Renate Müller, der Münchner Journalistentochter, die mit achtzehn nach Berlin kam, verfällt die Filmwelt quasi über Nacht, obwohl sie so gar nicht dem gängigen Leinwandideal entspricht und weder das süße Püppchen noch den männermordenden Vamp verkörpert. Sie ist gefragt, begehrt, selbst Hollywood ruft nach ihr. Renate könnte so glücklich sein, wie es ihr berühmtes Lied verspricht, doch der Mann, den sie liebt, ist Jude, und damit gerät sie ins Visier der braunen Machthaber …
Inhaltsübersicht
Widmung
Eine Bitte vorweg
Motto
Blei gießen
Gold trinken
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Silber streifen
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Eisen schmieden
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
Zum Schluss
Glossar
Quellennachweise
Leseprobe »Die Liebe der Mascha Kaléko«
Für meine »Kleine-Omi«,
in Liebe.
Mein Pferdchen sollte ich für dich einmal nicken lassen.
Bitte schau mal – mein Büchlein nickt für dich auch.
Eine Bitte vorweg
Dieser Roman ist aus dem Wunsch heraus entstanden, einer bemerkenswerten Frau ein kleines Denkmal zu zimmern. Aus Respekt vor ihr und den lebenden Vorbildern meiner Romanfiguren, die ein Recht auf Schutz haben, habe ich Namen, Wohnorte und Charakterzüge verändert. Zusammenhänge, Wendungen und Details habe ich aus Respekt vor meinen Leser*innen verändert, die ein Recht auf eine stringent erzählte Geschichte haben.
So habe ich – während alle anderen Filme der tatsächlichen Filmografie Renate Müllers entstammen – die Filme Selkie und Weil noch das Lämpchen glüht aus dramaturgischen Gründen erfunden. Sie sind an zeitgleich verwirklichte Filme und die Strömungen des jeweiligen Filmjahrs angelehnt (und ich habe einen davon so lebhaft vor Augen gesehen, dass ich mir wünschte, er wäre gedreht worden). Der zweiteilige Fritz-Lang-Film Die Nibelungen wurde bereits 1924, nicht wie von mir behauptet 1926, uraufgeführt. Auch die erste Begegnung zwischen Renate Müller und Sybille Schmitz oder die zwischen Sybille Schmitz und Harald Petersson ist nicht so verbürgt, wie ich sie geschildert habe.
Ich bitte daher, diesen Roman nicht als Biografie Renate Müllers misszuverstehen, sondern ihn als eine Hommage zu lesen, als ein Lied, das ich für sie gedichtet habe, eine Geschichte, die ich für sie erzähle. Zwar hoffe ich, dass sie sich darin erkannt hätte – aber so, als betrachte man ein von liebevoller Hand gemaltes Porträt, nicht als schaue man ein Foto an.
Vielen Dank.
Charlotte Roth, April 2021
»Hat die ganze Welt Geburtstag heut’,
Was ist denn heut’ bloß los?
Weil ich lache, lachen alle Leut’,
Was machen die für dumme Sachen?
Alles Sorgen bin ich einmal los,
Als ob es so sein müsst’.
Und mir ist, als ob mit einem Nu
Mein Herz im Himmel ist.
Ich bin ja heut’ so glücklich, so glücklich, so glücklich.
Ich fühl’ mich augenblicklich
So glücklich wie noch nie.
Ich könnt’ vor Glück zerspringen, zerspringen, zerspringen
Und möchte immer singen
Die eine Melodie.
Tra la la la. Tra la la la. Kinder, ich bin ja so froh.
Tra la la la. Tra la la la. Wäre es doch immer so.«
Robert Gilbert und Paul Abraham:
»Ich bin ja heut’ so glücklich«
aus dem Film Die Privatsekretärin,
1931
Blei gießen
Emmering bei MünchenSilvester 1918
»Weil ich lache, lachen alle Leut’,
Was machen die für dumme Sachen?«
Als der Jubel sich legte, dämpfte Johann, der Hausdiener, die Lichter. Über den Raum senkte sich Schweigen, nur ein paar sterbende Kerzenflammen flackerten im Dunkeln. Die bedeutendste Stunde stand bevor. Die Stunde der Zukunft.
Renate spürte, wie jeder Muskel in ihrem Körper sich spannte. Dies war der Augenblick, auf den sie den ganzen Abend über gewartet hatte. Gleich darauf ließ eine erregte Stimme sie zusammenfahren.
»Lassen Sie mich das doch machen, Frau Müller, ich bitt’ Sie!« Werner, der Nachbarssohn, sprang am Tisch hoch wie ein kleiner Junge und versuchte, Renates Mutter den Löffel aus der Hand zu reißen. »Die Zukunft können Sie mir ruhig anvertrauen. Ich bin doch jetzt kein Kind mehr.«
Renates Mutter hieß Mariquita. Sie war in Südamerika zur Welt gekommen, und ein schlichtes Klara, Anna oder Margarete hätte für sie nicht genügt. Als Volksschülerin hatte Renate sich gewünscht, ihre Mutter würde so heißen wie die Mütter von anderen Kindern und ihre Schwester Gabriele und sie selbst hätten Namen wie Gertrud, Maria oder Else. In Renates Volksschulklasse hatte es vier Gertruds, drei Marias und fünf Elses gegeben, aber weder eine zweite Renate noch eine Gabriele. Die Mitschüler hatten sich über ihren Namen lustig gemacht und »Renate-Granate« hinter ihr hergerufen. Renate war rundlich. Granatenförmig. Ihr einziges Talent schien darin zu bestehen, andere zum Lachen zu bringen. Sie musste selbst dauernd lachen, und sooft sie damit anfing, lachten alle mit.
In manchen Nächten hatte sie sich ausgemalt, morgens früh ins Klassenzimmer zu spazieren, statt zu lachen den Bauch einzuziehen und zu erklären, sie hieße nicht länger Renate, sondern Lotte-Luise.
Inzwischen aber war sie schon zwölf, ging in München auf das Lyzeum und wurde um ihren exotischen Namen beneidet. »Renate, die Wiedergeborene«, nannte sie der Lateinlehrer, und Renate war jetzt froh, dass sie damals nicht hatte tauschen können, sondern vor dem Allerweltsnamen Müller wenigstens ein fesches Renate stand. Alles andere an ihr war so entsetzlich langweilig: Pausbacken, Stupsnase, pummelige Hüften – wer sie zu Gesicht bekam, sah sie kaum richtig an und hatte sie gleich darauf schon wieder vergessen. Das mit dem Lachen war allerdings ein wenig besser geworden, weil sie sich Mühe gab, sich zu beherrschen.
Werner, der noch immer neben ihrer Mutter auf und ab hüpfte, lachte selten. Er hieß mit vollem Namen Werner Josef Lohse, und sein Vater gehörte zu den Freunden von Renates Vater. Wenn im Hause Müller Feste gefeiert wurden, waren die drei Lohses grundsätzlich mit von der Partie. »Dem Himmel sei Dank«, sagte Renates Vater jedes Mal, wenn Werner, seinen Eltern voran, zur Tür hereinkam. »Endlich ein männliches Wesen. Ich dachte schon, mein Schöpfer will mich inmitten der geballten Weiblichkeit verkümmern lassen.«
Der Witz lag nahe, auch wenn ihm mittlerweile ein Bart wuchs: Renates Vater hatte keinen Sohn, sondern zwei Töchter. Er hatte auch weder Vater noch Schwiegervater, stattdessen eine Schwiegermutter, eine Schwiegergroßmutter, zwei frisch verwitwete Schwestern, drei Nichten und eine Schwägerin, die bei jedwedem Anlass vollzählig zur Tür hereinspazierten.
Ganz so geballt, wie Renates Vater es darstellte, war die Weiblichkeit trotzdem nie gewesen. Hier in Emmering, in der Künstlerkolonie vor den Toren Münchens, lebten sie alle wie in einer Familie, und zu den Festen waren männliche Freunde ebenso ins Haus geschneit wie weibliche Verwandte. Bis der Krieg gekommen war. Die Zeit der Frauen und Kinder. Jetzt aber war es damit vorbei. Das neue Jahr würde im Frieden beginnen, und unter die Müller-Frauen, die sich mit Vorliebe in der großen Küche einfanden, um beim Abwasch zu singen, zu tanzen und zu schwatzen, mischten sich nun wieder Männer.
Die, die noch lebten. Die nach Hause zurückgekehrt waren.
Werner dagegen war auch in den Kriegsjahren hier gewesen. Er war schließlich erst fünfzehn und noch kein Mann, sosehr er Renate auch damit in den Ohren lag, dass er doch eigentlich schon als solcher betrachtet werden müsste. »Deutschlands große Stunde verpass ich, nur wegen der paar Jahre«, hatte er ihr vorgejammert. An die Front hatte er gehen wollen, sich freiwillig melden, »für mein Vaterland meine männliche Pflicht tun«.
Renate bewies er damit erst recht, dass er hinter den Ohren nicht nur feucht, sondern pudelnass war. Renates Vater war Journalist, war vom Kulturreferenten und Theaterkritiker zum Kriegsberichterstatter geworden. Was er in seiner Zeitung nicht schreiben durfte, brach aus ihm heraus, sobald er auf Urlaub heimkam: Schützengräben, in denen Soldaten hüfthoch durch Schlamm wateten, Abiturienten, die im Laufen von Bomben zerrissen wurden, Verwundete, die in Bombenkratern ertranken. Wie konnte man sich so etwas wünschen und dann noch von großer Stunde und Mannespflicht schwafeln? Renate nahm es Werner nicht übel. Sie wusste schließlich, dass Jungen länger zum Erwachsenwerden brauchten als Mädchen, aber ernst nehmen konnte sie ihn mit solchem Unfug nicht.
Sie mochte Werner gern. Ihre Freundinnen mochten ihn allerdings nicht und deren Mütter noch weniger. Sie nannten ihn einen Flegel, den jemand Manieren hätte lehren müssen, einen Taugenichts, mit dem es übel enden würde. »Aber du magst ihn natürlich – du magst ja jeden«, hatte Hetty, Renates Banknachbarin im Lyzeum, gelästert, und ganz unrecht hatte sie damit nicht.
Renate sah sich in der großen Wohnstube um, in der die Freunde ihrer Familie versammelt waren, und hätte nicht einen benennen können, gegen den sie etwas hatte. Sie mochte Menschen, und die Menschen mochten sie, zumindest seit die Jahre der Renate-Granate-Hänseleien vorbei waren. Sie war vielleicht niemandem die Liebste und Wichtigste, aber es störte sich auch keiner an ihr oder schloss sie aus.
Manchmal wünschte sie sich aber genau das: im Herzen eines Menschen, der nicht ihr Vater, ihre Mutter oder ihre Schwester war, einen besonderen Raum einzunehmen. Da das aber nicht möglich schien, war alles gut, so wie es war. Sie hatte Menschen um sich, die ihr wohlgesonnen waren, hatte in ihrer Welt ihren Platz und fühlte sich geborgen.
Für Werner war dieser Wunsch, für jemanden das Nonplusultra zu sein, aber offenbar stärker und unbezähmbar. Erst heute Vormittag hatte er Renate wieder gefragt, ob sie ihn mochte, und als sie ihm ihr übliches: »Aber freilich, du Dummkopf«, zur Antwort gab, hatte er sich damit nicht abspeisen lassen.
»Nicht so, wie du all die anderen magst«, hatte er beharrt. »Das ist nichts wert. Was jeder haben kann, das will ich nicht.«
»Es kann ja nicht jeder haben«, beschied ihn Renate. »Bestimmt gibt’s ganz arme, traurige Geschöpfe auf der Welt, die mag kein Mensch.«
»Die sind mir egal«, sagte Werner. »Ich rede nicht von irgendeinem Hinz und Kunz, sondern von mir.« Hübsch hatte er ausgesehen, mit der schwarzen Tolle in der Stirn und der blitzenden Empörung in den Augen. Aber auch mächtig verbohrt. Renate verspürte eine unbändige Lust, zu lachen, doch sie wusste, sie hätte ihn damit verletzt.
»Du redest doch immer von dir«, erwiderte sie schließlich.
»Weil es sonst keiner tut«, kam es bitter zurück. »Also sag’s mir: Magst du mich wirklich? Magst du mich lieber als die verwöhnten Bonzensöhnchen in den Lodenmänteln, die euch die Schultaschen nach Hause tragen?«
Das war eines von Werners Problemen: Helmut Lohse, sein Vater, war als Künstler auf keinen grünen Zweig gekommen und unterrichtete nun als Privatlehrer. Er hatte sein Auskommen, aber er war nicht reich und wohl aus diesem Grund ständig ein wenig griesgrämig. Auch Renates Vater galt nicht als reich, obwohl es Renate so vorkam. Er besaß hier draußen in Emmering dieses schöne Haus mit einem noch schöneren Garten, der bis hinunter ans Ufer des Flusses Amper reichte, ein Badesteg wartete dort auf den Sommer, und im Schilf um den Steg lag ihr Boot. Für Renate war das Reichtum genug. Sie hatten alles, was sie brauchten, und mehr: einen selbst in Kriegsjahren reichlich gedeckten Tisch, eine Kalesche für Stadtfahrten, die der getreue alte Oscar zog, und ihre unbezahlbare »Adaate«, die zum Hausmädchen avancierte Kinderfrau, deren Taufnamen »Agathe« Gabi und Rena einst verballhornt hatten und die nun niemand mehr anders rief.
Werner aber meinte mit Reichtum etwas anderes, das war Renate bewusst. »Also los, jetzt sag schon«, hatte er sie aufgefordert. »Magst du mich lieber als die anderen?«
Renate hatte kurz überlegt, dann hatte sie genickt. Natürlich mochte sie ihn nicht lieber als ihre Eltern, ihre Schwester, Großmutti, Uri und die lustige Schar ihrer Tanten und Cousinen, aber an die hatte Werner sicher auch nicht gedacht. Und ihre Freundinnen? Die Söhne der anderen Nachbarn? Gar so genau brauchte sie es nicht zu nehmen, hatte sie befunden. Ihr Vater hatte ihr einmal, an ihrem Geburtstag, erklärt, das Wichtigste, das er ihr auf dem Weg in ihr Leben mitgeben wolle, sei der Glaube an sich selbst. Daran mangelte es Werner. Warum sollte sie ihm also nicht ein bisschen Aufschwung verleihen?
»Nicht nur nicken«, insistierte Werner. »Sprich’s aus.«
»Ja, ich mag dich am liebsten«, sagte Renate und sah, wie in seine Augen ein Leuchten trat.
»Du bist meine Beste, kleines Renatchen. Und die bleibst du auch. Dass ich auf dich warten muss, weil du noch so klein bist, macht mir nichts aus.«
Renate hatte sich gefreut, weil es schön war, anderen eine Freude zu bereiten. »Denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eig’ne Herz zurück«, hatte ihr einst ausgerechnet Werner ins Poesiealbum geschrieben. Und zum Dank hatte er ihr dann auch noch versprochen, heute Abend, wenn das Tanzverbot aus dem Krieg aufgehoben wurde, mit ihr zu tanzen. Renate hatte schon als kleines Mädchen für ihr Leben gern getanzt und konnte es kaum erwarten, es endlich wieder zu dürfen. Das Tanzen war dann auch schön gewesen, wenngleich sie alle – bis auf Vater und Mutter – ein wenig wackelig und aus der Übung waren. Es hatte reichlich zu essen gegeben, obwohl die Süßspeise nach Steckrüben schmeckte, und gerade eben, um Mitternacht, hatte Werner ein Glas Sekt ergattert und Renate einen Schluck probieren lassen, der verheißungsvoll im Magen kribbelte.
Alles in allem hatte sie also keineswegs bereut, seinem Glauben an sich selbst ein bisschen aufgeholfen zu haben. Jetzt aber, wo er wie ein Gummiball neben ihrer Mutter auf und ab hüpfte und versuchte, sich den Löffel fürs Bleigießen unter den Nagel zu reißen, hätte sie ihn auf den Mond schießen wollen.
Was fiel dem Kerl denn ein? Bleigießen an Silvester war eine geradezu heilige Angelegenheit, und die ganze Feier hindurch hatte Renate sich darauf gefreut. Hinterher würden sie und Gabriele ins Bett geschickt werden, die Gäste würden sich langsam verabschieden, und der ganze Zauber wäre vorbei. Zuvor aber würde das Bleigießen verraten, was die Zukunft für jeden von ihnen bereithielt, und das war in diesem Jahr wichtiger denn je.
Zum einen war es das erste Bleigießen in Friedenszeiten, das erste nach vier Jahren, das Vater und Mutter wieder gemeinsam durchführen würden, und zum Zweiten war man mit zwölf – oder sogar fast dreizehn – ja wohl alt genug, um eine Zukunft zu haben.
Eine Zukunft für Erwachsene, nicht für Kinder wie in den Vorkriegsjahren: »Sieh an, ein Schuh auf Rädern – da gibt’s zum Geburtstag wohl Rollschuhe mit Kugellager«, hatte der Vater ihr einst beispielsweise prophezeit, ohne das Buch der Zukunft zu Rate zu ziehen, oder: »Eindeutig eine Badekabine – das kann ja nur eine Sommerfrische an der See bedeuten«.
All das würde nun, da der Krieg vorbei war, ohnehin wiederkehren, doch es würde nicht mehr den Dreh- und Angelpunkt von Renates Dasein darstellen. Mit diesem Jahr würde das richtige Leben beginnen, und in dem kleinen Klumpen Blei lag sein Geheimnis verborgen.
Je weiter der Silvesterabend voranschritt, je tiefer die Kerzen in den Messingleuchtern des Vaters herunterbrannten und dabei auf den Simsen ihr Wachs vergossen, je näher Mitternacht rückte, desto mehr wuchs Renates Erregung. Endlich war das quirlige Gemurmel verebbt, und Johann, der betagte Hausdiener, hatte die Gasbeleuchtung heruntergedreht, sodass nur noch die Flammen der Kerzenstummel flackerten und das Dunkel erhellten. Einer der jüngeren Gäste schaltete das Grammofon aus, das heitere Tanzmusik gespielt hatte. Seite an Seite waren der Vater und die Mutter vor den langen Tisch getreten, dessen Eichenholzplatte von unzähligen geselligen Zusammenkünften abgeschabt war. Die Mutter hatte die einzelne Kerze und die Schüssel mit dem geeisten Wasser auf den Tisch gestellt, während der Vater zu ihrer Linken das schwere, in Leder gebundene Buch bereithielt.
In jenem Buch waren die Deutungen verzeichnet. Nicht die Rollschuhe und Sommerfrischen natürlich, sondern die Schlüssel zu den wahren Geheimnissen. Renates Vater hatte seine Töchter immer angehalten, sich an den Bänden in seiner Bibliothek nach Herzenslust zu bedienen, aber das Buch, das die Zukunft verhieß, stand auf dem obersten Bord und war für jeden anderen als ihn tabu.
Renate hatte Mühe, still zu stehen und abzuwarten. Genauso war es gewesen, so hatte sie es aus ihren Kinderjahren vor dem Krieg in Erinnerung.
Gleich würde die Mutter einen Bleiklumpen auf den Löffel legen, dabei den Namen des Anwesenden verkünden, dessen Zukunft gedeutet werden sollte, und dann das Metall über der Kerzenflamme erhitzen, bis der Boden des Löffelkopfs schwarz und die Mulde mit silbrig glitzernder Flüssigkeit gefüllt war. Diese Flüssigkeit würde sie alsdann mit einer blitzschnellen Drehung aus dem Handgelenk in die Schüssel mit dem Eiswasser schleudern, was fast so aussah, als wirbele der Staub von zerstobenen Sternen durch die Luft. Im Wasser würde der flüssige Sternenstaub zu einer Form erstarren, die der Vater schließlich mit einem zweiten Löffel herausfischte.
Der ganze Raum würde in gespanntem Schweigen verharren, während der Vater die erstarrte Form aus Blei von allen Seiten betrachtete, um dann in dem geheimen Buch nachzuschlagen, was das Symbol für die Zukunft des Betreffenden verhieß. Renate hatte nicht einmal gewagt, darüber nachzudenken, was sie sich wünschte. Wie so oft kam es ihr vor, als wäre ihr Kopf zu klein für die Größe ihrer Träume. Sie würde sich überraschen lassen. Nur eines wusste sie: Es sollte diesmal keine Kleinigkeit sein, sondern etwas Unerhörtes, Sensationelles, das die anderen aufmerken ließ.
»Sieh an, unsere Rena«, würden sie untereinander tuscheln. »Wer hätte das von ihr gedacht?«
»Eher hätte man so etwas ja von der Gabi erwartet – Rena war doch immer so patent und bodenständig.«
Ihr Vater aber würde das große Buch niederlegen, vor sie hintreten und ihr ins Gesicht sehen. »Es ist schon ganz in Ordnung, dass du kein Junge geworden bist«, würde er sagen. »Deshalb habe ich dich Latein lernen lassen – ich habe immer gewusst, dass etwas Besonderes in dir steckt.«
Sie hatte sich so sehr darauf gefreut, und jetzt musste Werner mit seinem ewigen Drang, sich in den Vordergrund zu spielen, alles verderben. Er hätte den Löffel um ein Haar erbeutet, aber ihre Mutter zog ihn gerade noch weg und gab dem Störenfried einen Klaps auf die Hand. »Jetzt ist es genug, Werner«, sagte sie unwilliger, als Renate sie je mit einem Kind hatte sprechen hören. »Blei ist kein Spielzeug. Wenn du dabei einen Tropfen verspritzt und jemand ihn abbekommt, trägt er eine Narbe fürs Leben davon.«
»Aber ich bin doch ganz vorsichtig, Frau Müller!« Werner mit seiner albernen Hüpferei hörte nicht auf zu betteln. »Ich bin keines von den unreifen Bürschchen, ich trage Ernst in mir und weiß, wie man so etwas anpackt.«
»Du hast gehört, was ich gesagt habe«, wies ihn die Mutter nochmals zurecht und sah sich Hilfe suchend nach seinen Eltern um. Die aber hatten sich in der Menge verdrückt. Sie schämten sich für Werners Betragen, und dafür tat er Renate leid.
»Jessas Maria, jetzt lass ihn halt bei den Kindern mitmischen«, schaltete ihr Vater sich ein. »Du gießt das Blei, er sagt seine Sprüchlein auf, und hinterher hat die liebe Seele Ruh’. Umso schneller können wir Erwachsenen in Frieden weiterfeiern.«
Renates Herz stockte. Meinte der Vater das etwa ernst, zählte er sie ebenso zu den Kindern wie Gabi und die Kleineren?
»Von mir aus.« Ihre Mutter fasste Werner ins Auge. »Für euch Kinder die Klumpen deuten darfst du, aber von meinem Bleilöffel lässt du die Finger, verstanden?«
»Aber sicher doch, Frau Müller. Sie werden sehen, Sie können mir vertrauen.« Werner nickte heftig und hörte mit dem Hüpfen auf.
Renates Mutter seufzte. »Mit wem willst du anfangen?«
»Mit Renate natürlich!«, rief Werner. »Mit der Tochter des Hauses.« Auf dem Absatz schwang er herum und zwinkerte Renate zu.
Die sah ihren Vater das Buch zur Seite legen und spürte all ihre Hoffnungen zerplatzten.
»Für Renate also«, sagte ihre Mutter, hielt den Löffel allzu flüchtig über die Flamme und schleuderte den erst halb geschmolzenen Klumpen in die Wasserschüssel.
Werner drehte sich wieder zum Tisch, schnappte sich den zweiten Löffel und fischte mit übertriebener Gestik das erstarrte Gebilde aus dem Wasser. Er hatte kaum einen Blick darauf geworfen, als er bereits verkündete: »Nicht zu glauben! Das ist eindeutig ein Brautpaar! Und wer sind die zwei Glücklichen, die da in nicht allzu ferner Zukunft zum Altar schreiten werden?« Er kniff die Augen zusammen und tat so, als würde er das erstarrte Stück Blei genauestens studieren. »Sieh einer an! Deine Stupsnase, Renatchen, und meine Denkerstirn. Die beiden hier sind eindeutig du und ich.«
Renate stand da, als wäre sie selbst wie das Blei in kaltem Wasser erstarrt. Was ihr an Kraft blieb, brauchte sie, um gegen die Tränen anzukämpfen. Werner hatte alles verdorben. Alles, alles, alles.
»Was sagst du dazu?« Strahlend wandte er sich ihr wieder zu und hielt den Löffel mit dem Klumpen wie eine Trophäe. »Ich weiß, meine kleine Braut ist den Kinderschuhen noch nicht entwachsen, aber dass wir füreinander bestimmt sind, hat das Blei ohne jeden Zweifel besiegelt.«
Es gab ein bisschen dünnes Gelächter, doch die meisten Gäste hatten das Interesse verloren und sich anderen Dingen zugewandt.
»Bist du fertig?«, fragte Renates Mutter. »Können wir dann mit Gabi weitermachen?«
»Ich will nicht!«, rief Gabi, Renates Schwester, die zwei Jahre jünger war und noch mit dem Fuß aufstampfte. »Am Ende muss ich auch den ungezogenen Werner heiraten, und das tue ich nie und nimmer!«
Ein kleiner Tumult entstand. Werner rief irgendetwas Empörtes, Gabriele beharrte weiter darauf, sie werde sich auf keinen Fall von ihm die Zukunft deuten lassen, und Renates Vater bemühte sich mit ein paar ruhigen Worten, die Streiterei zu schlichten. Mehrere andere mischten sich ein, Tante Anni schlug vor, »das Kleingemüse ins Bett zu stecken und zum gemütlichen Teil überzugehen«, aber keiner von ihnen schien etwas zu bewirken.
Da trat ein Mann, den Renate nicht kannte, dazwischen und bemächtigte sich des Löffels, ehe Werner begriff, wie ihm geschah.
»Einen Augenblick bitte.«
»Was fällt Ihnen ein?«, rief Werner und versuchte, den Löffel wieder an sich zu bringen. Der andere aber schob ihn in schönster Seelenruhe zurück. Er überragte Werner um bald einen Kopf, war jedoch genauso schlank und schlaksig wie dieser, und jetzt erkannte Renate, dass er doch kein Mann, sondern auch noch ein Junge war, der höchstens ein oder zwei Jahre älter sein konnte als Werner.
»Sie bekommen das gute Stück ja gleich wieder«, sagte er noch immer vollkommen ruhig. »Ich war nur fasziniert von der Bleiformation, in der man komplette Gesichtszüge und bereits einen halben Brautzug samt Mitgift und Erstausstattung erkennen kann, und wollte mir das mit eigenen Augen ansehen.«
Das Gelächter, das daraufhin ertönte, war beileibe nicht dünn, und selbst Renate, der doch so elend zumute war, musste mitlachen.
»Herr Müller hat mir die Deutung der Zukunft übertragen, nicht Ihnen«, begehrte Werner auf und stürzte sich mit wie zum Schlag erhobener Hand auf den Fremden. Der trat lediglich zur Seite, sodass Werner ins Leere torkelte wie einer, der zu viel getrunken hatte.
»Ihre Deutungshoheit fechte ich natürlich nicht an«, sagte der Fremde, dessen dichtes, dunkelblondes Haar nicht pomadiert und ein gutes Stück zu lang war. »Fräulein Müller sieht allerdings aus, als würde sie es nur zu gern tun. Was ich ihr nachfühlen kann, wenn ich ehrlich bin.«
»Und warum, wenn ich fragen darf?« Werner baute sich vor ihm auf und stemmte die Hände in die Hüften. »Sind Sie etwa der Ansicht, Renate Müller wäre mit Ihnen besser dran?«
»Ich bin siebzehn«, sagte der blonde Fremde souverän. »Heute Nacht beginnt ein neues Jahr und morgen eine neue Welt. Eine Zeit, um über alles erdenkliche andere eher nachzusinnen als übers Heiraten, finden Sie nicht auch?«
Werner war sprachlos. Er schnappte nach Luft wie ein Fisch auf dem Trockenen.
Der blonde Fremde hingegen beugte sich noch immer mit der Nonchalance eines Erwachsenen über den Bleiklumpen. »Ich sehe so vieles darin, ich könnte das gar nicht als ein einziges Ereignis deuten«, sagte er, nahm das Stück Blei in die Hand und drehte es dicht vor seinen Augen. »Wenn ich es so halte, könnte es eine Tänzerin sein, wenn ich es aber so herum drehe, überhaupt keine Menschenfigur, sondern eine Kamera. Bedeutet das Kino? So erfolgreich, wie die Messter-Wochenschau im Krieg gewesen ist, werden die nun ja wohl wie Pilze aus dem Boden schießen.«
»Wollen Sie Fräulein Müller einreden, sie ginge zum Film?«, platzte Werner heraus, als wäre das die absurdeste Vorstellung der Welt.
»Warum nicht?«, fragte der Blonde gelassen zurück. »Ich halte das für gar keine üble Idee. Von dieser Seite betrachtet sieht der Bleiklumpen allerdings mehr aus wie ein Schiff und von der anderen wie eine Schreibmaschine. Vielleicht geht Fräulein Müller also nicht zum Film, sondern fährt am Ende zur See? Oder sie lernt Tippen und wird Sekretärin. Wenn ich dieses Bleiexponat noch eine Weile lang hin und her drehe, fallen mir sicher ein Dutzend weitere Deutungsmöglichkeiten ein, und ist das nicht die allerbeste Deutung von allen? Dass Fräulein Müller eine Zukunft voller Möglichkeiten vor sich hat? Warum sollte sie sich die mit einer schnellen Heirat abschneiden?«
»Weil …«, stammelte Werner und schnappte zwischen den Worten wie ein Karpfen nach Luft, »weil …«
Er war so hilflos. Und der andere ihm so haushoch überlegen.
Renate ertrug so etwas nicht. Schon als Kind hatte sie vor jedem Käfer, der auf dem Rücken lag und mit den Beinen zappelte, in die Hocke gehen und ihn umdrehen müssen. Was der blonde Fremde aufgezählt hatte, hatte unwiderstehlich geklungen, und der Traum vom Kino war so schön, dass sie ihn selbst noch gar nicht zu träumen gewagt hatte. Aber der Fremde war hochmütig, und das war gar nicht schön. Er tat Werner mit Absicht weh.
Und Werner war nicht nur ein Käfer. Werner war ihr Freund.
»Ist mir egal, ich will das alles nicht!«, rief Renate. »Ich heirate Werner. Sobald wir beide großjährig sind.«
Werners schnappende Atemzüge stockten. Er wandte ihr das Gesicht zu, und einen Augenblick lang war es, als wären sie beide im Licht der sterbenden Flammen allein.
»Wirklich, Renatchen? Du hältst zu mir, du hängst nicht dein Fähnchen nach dem Wind wie alle anderen?«
»I wo«, sagte Renate, der das Ganze nun schon wieder zu ernst und zu dramatisch wurde. »Ich hab gar keine Lust, tippen zu lernen. Ich heirate lieber.«
Der blonde Fremde hob die Hände. »Oh, aber gern doch. Ich wollte niemandem seine Vorlieben verleiden. Chacun à son goût.«
»Chacun was?« Werner verstand kein Französisch. Die Schule mit all ihren Vorschriften und Zwängen war ihm verhasst.
»Vergessen Sie’s.« Der Blonde deutete eine Verbeugung an. »Und einen schönen Abend noch.«
»Leuten wie Ihnen werd ich’s noch zeigen«, presste Werner zwischen den Zähnen hervor. »Man muss nicht mit dem silbernen Löffel im Mund geboren sein wie ihr Bankierssöhnchen, um etwas aus sich zu machen. Ich weiß, was in mir steckt, ich brauche nur die passende Gelegenheit, und die Renate wird einmal froh sein, dass sie sich für mich entschieden hat.«
»Na schön«, unterbrach die Mutter, die ihren Löffel längst beiseitegelegt hatte. »Aber jetzt ist es genug, ja? Ich denke, wir belassen es in diesem Jahr dabei und nehmen die Zukunft, wie sie eben kommt. Karl-Eugen hat diesbezüglich nämlich noch eine Ankündigung zu machen, die euch vermutlich interessieren wird.«
Karl-Eugen war der Name des Vaters. Der räusperte sich.
Werner drängelte sich zu Renate durch und redete wie ein Wasserfall auf sie ein, übers ganze Gesicht strahlend: »Dass du das für mich getan hast, Renatchen, das vergelt ich dir. Du wirst’s nicht bereuen, darauf geb ich dir hoch und heilig mein Wort.«
Denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eig’ne Herz zurück, beschwor Renate sich stumm. Aber das Herz stellte sich stur und wollte die Freude nicht einlassen. Vermutlich hatte sich die Enttäuschung allzu sehr darin ausgebreitet. Auf dem Sims vor dem hohen Fenster erloschen zwei Kerzenflammen gleichzeitig.
Der Vater räusperte sich von Neuem, diesmal lauter, und Werner hörte zu schwafeln auf.
»Liebe Freunde«, sagte der Vater. »Liebe Familie. Es ist schön, euch alle wieder hier beieinanderzuhaben, und Mariquita und ich hoffen, dass wir unter unserem Dach immer wieder zusammenkommen werden, um zu feiern, denn wo immer wir zusammen sind, haben wir es gut. Dass es das letzte Fest unter diesem Dach sein wird, steht allerdings fest. Mein Weibsvolk und ich werden zum nächsten Ersten unsere Sachen packen und diesem heimeligen Idyll den Rücken kehren. Die Münchner Neuesten Nachrichten haben mir die Position des Chefredakteurs angeboten, und ich habe nicht gezögert, anzunehmen.«
»Ihr geht nach München?«, rief Helmut Lohse. »Aber das könnt ihr doch nicht machen, was wäre denn Emmering ohne euch?«
»Es wird schon nicht untergehen«, erwiderte der Vater, der sich genau wie der fremde blonde Junge nicht aus der Ruhe bringen ließ. »Aber in München schlägt jetzt der Puls der Zeit, Helmut, das ist der Ort, wo man als Zeitungsschreiber hinmuss. Und meine Mädchen haben es dann auch einfacher. Der lange Schulweg jeden Morgen ist keine Kleinigkeit.«
Werner stand direkt vor Renate, sodass sie gar nicht vermeiden konnte, ihm ins Gesicht zu sehen. Die Freude darauf erstarb mit jedem Wort, das der Vater aussprach. Sie selbst hingegen schämte sich, weil ihre schon erloschene Hoffnung auf einmal wieder aufflackerte.
Um das Haus und den Garten, um den Steg und das Boot würde es ihr leidtun und noch mehr natürlich um Werner und all ihre anderen Freunde. Noch während sie jedoch darüber nachdachte, verblasste all das schon und wurde Vergangenheit. Sie würden nach München gehen – in die große Stadt! Was würde dort nicht alles möglich sein?
Ein ganz leises, vielleicht gar nicht hörbares Geräusch ließ sie sich umwenden, so unhöflich das Werner gegenüber auch war. In der Tür zum Korridor sah sie den blonden Fremden verschwinden. Er drehte sich um und schenkte ihr flüchtig einen lächelnden Blick.
Gold trinken
Freie Stadt DanzigZwei Wochen vor Silvester 1923
»Hat die ganze Welt Geburtstag heut’,
Was ist denn heut’ bloß los?«
1
Renate
Müller, Renate. Aufstehen«, Die Stimme des Lateinlehrers schnarrte. In der erhobenen Rechten hielt er Renates Abschlussarbeit.
Mit Gliedern, die ihr steif wie Holzlatten vorkamen, schob Renate ihren Stuhl zurück, stützte sich am Pult ab und stand auf. Ihr Kopf fühlte sich an wie ein Ballon in knallroter Farbe, der noch schwoll. Toni, ihre Banknachbarin, hatte ihre Arbeit schon erhalten, ein solides »Befriedigend« stand darauf, auf das sie den Blick gesenkt hielt wie ein Priester auf das Evangelium. Renate war Neid fremd. Sie wusste, dass keine der Freundinnen ein so schönes, sorgenfreies Leben hatte, wie sie es mit ihrem Vater, ihrer Mutter, Gabi und Adaate führte, aber für diesen einen Augenblick hätte sie nur allzu gern mit Toni getauscht.
Der Lateinlehrer – Dr. von Knoop – hatte sie auf dem Kieker. Renate konnte es ihm nicht verdenken. Sie hätte jederzeit freimütig zugegeben, dass sie in Latein eine Niete war. Sooft Dr. von Knoop die Funktionen des Ablativus absolutus und des Participium necessitatis auch erklärte, Renate verstand nur Bahnhof, und der lag in Danzig am Hohen Tor.
In München, am Anfang ihrer Oberschulzeit, hatte Latein ihr nichts ausgemacht. Im Gegenteil. Zwar hatte sie bei all den Casus und Genera und Modi und so weiter schon damals nicht viel mehr als Bahnhof verstanden, aber der Lateinlehrer war ein freundlicher Mann mit einem Bart wie Rübezahl gewesen, und er hatte ihren Namen gemocht.
Renate, die Wiedergeborene.
»Seien wir ehrlich, liebe wiedergeborene Müllerin«, hatte er zu ihr gesagt, »das Schwitzen über Vokabellisten und Konjugationstabellen ist für dich nicht erfunden worden. Aber warum auch? Gott sei Dank sind wir alle mit verschiedenen Gaben gesegnet, und für ein Mädchen gibt es ja wahrhaft reichlich Talente, die höher im Kurs stehen.«
Tatsächlich hatte unter Renates Emmeringer Freundinnen kaum eine Latein gelernt, auch ihre Schwester Gabi wurde an einer Oberschule angemeldet, die mehr Wert auf die traditionellen Fertigkeiten für Töchter aus dem Bürgertum – von Handarbeiten bis französische Konversation – legte. Renate hätte darum bitten können, auch auf jene Schule wechseln zu dürfen, aber die Enttäuschung wollte sie ihrem Vater nicht antun.
Renate liebte ihren Vater. Etwas war zwischen ihnen, das sich schwer benennen ließ und das keine der Freundinnen mit ihrem Vater teilte. Sie wusste, der Vater hatte sich unbändig auf sein erstes Kind gefreut. »Er war aufgeregter als ich«, hatte die Mutter erzählt. »Eigentlich hätte er im Theater sitzen und eine Kritik zu Hauptmanns Florian Geyer schreiben müssen, aber er rannte schon in der Pause nach Hause. Großmutti, Uri und seine Schwestern mussten ihn mit vereinten Kräften daran hindern, unser Schlafzimmer zu stürmen, wo sein Sohn zur Welt kommen sollte.«
Sooft Renate diese Geschichte hörte, tat ihr das Herz weh um den Vater, weil der so sehr ersehnte Sohn am Ende ein Mädchen gewesen war. Sie wusste, dass er sie liebte, er zeigte es ihr auf jede erdenkliche Weise und hatte ihr und Gabi wiederholt versichert, dass er mit seinen beiden Töchtern rundum zufrieden war: »Ich habe zwei wohlgeratene Mädchen und die wundervollste Frau der Welt, worüber sollte ich mich also beklagen? Letzten Endes bin ich ganz froh, dass das mit dem Sohn nichts geworden ist. Heranwachsende Söhne halten ihre Väter für vergreiste Dummköpfe, die nicht schnell genug ihren Platz räumen. Töchter dagegen belassen ihre Väter auch mit siebzehn noch in dem Glauben, sie wären unfehlbar, könnten zaubern und kämen gleich nach dem lieben Gott.«
Sie hatten alle gelacht, und die dunkellockige Mutter, die nicht älter, sondern immer nur noch schöner und eleganter zu werden schien, küsste den Vater und sagte: »Nur bis der erste junge Mann auftaucht, Karl. Danach saust du von deinem Götterolymp geschwind wie ein Paternosteraufzug in die Tiefe.«
Natürlich hatten Renate und Gabriele das bestritten, hatten dem Vater die Arme um den Hals geworfen, sodass sie schließlich zu dritt um ihn hingen, und geschworen, er werde immer »der liebste und beste Vati aller Zeiten bleiben« und zaubern könne er natürlich sowieso.
Sie waren glücklich zusammen. Der Vater und die Mutter waren glücklicher als alle Liebespaare, die Renate kannte, und dabei waren sie überhaupt kein Liebespaar mehr, sondern seit zwanzig Jahren ordentlich verheiratet. Sie waren nicht glücklich wie Menschen im Leben, sondern glücklich wie Menschen im Kino, und ihre Kinder – Renate und Gabi – krönten dieses ganze Glück noch obendrein.
Dennoch wünschten Väter sich Söhne.
Renate wusste das. Sie wusste, dass ihr Vater sich einen Sohn gewünscht hatte und dass er sich die Zukunft dieses Sohnes bereits bis ins Kleinste ausgemalt hatte: klassische Schulbildung, beste Möglichkeiten, berufliche Höhenflüge, nur der Himmel als Grenze. Anstelle dieses Sohnes war sie auf die Welt gekommen, also würde sie ihm, so gut sie es eben vermochte, diesen Sohn ersetzen. Auf die höhere Schule gehen. Später ein Studium und einen Beruf anstreben, wie er sonst Söhnen vorbehalten war. Ärztin oder Anwältin musste sie werden oder am besten Journalistin wie der Vater.
Er war ihr Vorbild, ihm wollte sie nacheifern, und Latein war dazu unumgänglich.
Es war der erste Schritt, der Vater platzte vor Stolz, prahlte bei sämtlichen Freunden und Kollegen mit seiner Tochter: »Den Sohn, der mit meiner Rena mithalten kann, muss mir erst mal einer zeigen.«
Und was tat sie? Fürchtete sich vor jeder Lateinstunde und hoffte, eine ansteckende Krankheit möge sie im letzten Augenblick befallen, damit sie nicht zur Schule musste.
In München war es noch gegangen, bei Dr. Fresinger mit dem Rübezahlbart hätte sie sich irgendwie schon durchgemogelt, aber hier, an der Ferner’schen Höheren Töchter- und Mädchenschule von Danzig, war jede Stunde eine Tortur. Sie war zu dumm. Nicht mit anderen Gaben gesegnet, sondern schlichtweg dumm, und Dr. von Knoop stellte sie dafür vor der ganzen Klasse bloß.
»Müller, Renate. Na, was glauben Sie denn, was für eine Note Sie hier fabriziert haben?«
Einen Augenblick lang hoffte sie, jemand werde sie retten. Ihr Blick schweifte noch einmal zu Toni. Könnte sie sich nicht mit irgendetwas zu Wort melden, eine sinnlose Frage stellen oder zur Not mit ihrem Stuhl umkippen? Ich würde es jedenfalls für dich tun, beschwor Renate sie stumm. Toni aber fuhr fort, wie gebannt auf ihre eigene Arbeit zu starren. In der Stille, die im Klassenraum herrschte, glaubte Renate, ihr Blut rauschen zu hören.
»Wir warten, Fräulein Müller«, schnarrte von Knoop.
Durch das Rauschen drang ein spitzes Kichern.
»Ich … ich weiß nicht«, stammelte Renate.
»Sie wissen es nicht?«, brauste von Knoop auf. »Sie haben nicht genug Verstand, um der einfachsten Erklärung zu folgen, sammeln Bildchen von dümmlichen Filmsternchen, statt sich der ernsthaften Bildung Ihres Geistes zu widmen, und obendrein sind Sie auch noch zu faul, um sich ein bisschen anzustrengen. Und da wollen Sie nicht wissen, was Sie mir in Ihrer sogenannten Abschlussarbeit zugemutet haben?«
Renate hielt den Atem an und kämpfte gegen den Drang, die Augen zuzukneifen.
»Ungenügend!«, schrie Dr. von Knoop und schleuderte den Stapel beschriebenen Papiers vor Renate auf das Pult. Die uralte Holzplatte hüpfte. Renate konnte nicht anders. Wie von selbst pressten sich ihre Hände auf die Ohren. Dr. von Knoop packte ihre Gelenke und riss sie hart nach unten. Seine Handflächen waren schweißfeucht, der Geruch, den er ausströmte, hatte etwas Käsiges und verursachte Renate Übelkeit.
»Die Ohren zuhalten will sie sich.« Dr. von Knoop kniff die Augen zu Schlitzen zusammen. »Die Wahrheit ausschließen, als würde sie dadurch verschwinden. Das kommt davon, wenn man zu viel ins Kino geht. Ich begreife nur nicht, was ein Dienstmädchen, das davon träumt, Prinzessin zu werden, auf meiner Schule zu suchen hat.«
Renate war kein Dienstmädchen. Sie träumte nicht davon, Prinzessin zu werden, und die Schule gehörte nicht Dr. von Knoop. Ins Kino ging sie nur selten, denn eine Eintrittskarte kostete fünf Groschen, Dittchen genannt, in der neuen Währung, selbst wenn man nicht in die eleganten Flamingo-Lichtspiele in der Junkergasse ging. Ein halber Danziger Gulden. Woher hätte Renate den nehmen sollen? Und einen Kavalier, der sie hätte einladen können, hatte sie noch weniger.
Dass sie vom Kino träumte, war allerdings wahr. Sie wusste nichts Schöneres, als in einer der Reihen vor der riesigen Leinwand zu sitzen, wenn die Lichter ausgingen, die Welt draußen verblich und die weiße Wand zum Leben erwachte. Im Flamingo sollten sie sogar ein eigenes Orchester haben, das aufspielte, sobald die Bilder zu tanzen begannen. Ein bisschen wie in Berlin, wo der große Filmpalast der UFA fast zweitausend Menschen Platz bot.
Renate hatte nichts gegen ihr Leben einzuwenden. Es war ein nettes, freundliches Leben, wenn nicht gerade Lateinstunde war, und es gab keinen Grund, sich daraus fortzuträumen. Auf der Leinwand aber erstand ein zweites oder drittes und viertes Leben, und diese neuen Leben steckten voller Geheimnisse und Zauber. In ihnen war alles möglich, jeder Augenblick wartete mit Überraschungen auf, und das Gewöhnliche, zuweilen ein wenig Langweilige fand nicht statt.
Ihr eigenes Leben und das Leben im Kino, das war überhaupt kein Vergleich. Als ginge man zu Fuß oder führe mit der Straßenbahn, und auf einmal breite man die Arme aus und könne fliegen.
Das war kindisch. Hätte Dr. von Knoop ihre Gedanken gelesen, hätte er sich gewiss darüber ereifert, dass ein derart albernes, unreifes Geschöpf die kostbare Schule besuchte, an der er unterrichtete.
Hinter ihr ertönte das Kichern jetzt mehrstimmig. Ihr war noch immer übel, ja geradezu benommen von dem Käsegeruch, und von Knoop machte keine Anstalten, auch nur einen halben Schritt zurückzuweichen. Offenbar erwartete er, dass sie noch etwas sagte.
Aber was?
Sollte sie ihn händeringend um Verzeihung bitten, weil sie zu dumm für Latein war, Kino liebte und kindische Gedanken hegte?
Fieberhaft suchte Renate nach Worten, bis die Schulklingel sie erlöste.
»Durchgefallen sind Sie«, bellte ihr Peiniger, ehe er mit sichtlichem Widerstreben von ihr ablassen musste. »Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass Frauen für akademische Laufbahnen die geistigen Fähigkeiten fehlen, dann findet er sich in Ihnen.«
Und warum unterrichten Sie dann an einem Mädchen-Lyzeum?, hätte Renate ihn gerne gefragt. Eigentlich gab es keinen Grund, sich von diesem Mann, der offenbar seinen Beruf verfehlt hatte, einschüchtern zu lassen. Er war einer, der in seinem Leben nicht glücklich war. »Ein glücklicher Mensch hat es nicht nötig, einen anderen unglücklich zu machen«, hatte die Mutter ihnen oft genug erklärt und war ja selbst das beste Beispiel dafür: Mariquita Müller war eine glückliche Frau und tat keiner Menschenseele etwas Böses. »Wenn jemand dich grundlos angreift, ist er mit größter Wahrscheinlichkeit ärmer dran als du.«
Renate leuchtete das ein. Für gewöhnlich fiel es ihr nicht schwer, über derart durchsichtige Attacken hinwegzusehen, denn sie besaß ja so viel. Ihr Leben war voller Wärme, und Dr. von Knoop sah aus, als sei ihm immer kalt. Dennoch gelang es ihr nicht, seine Tiraden zu ignorieren. Das lag zum einen daran, dass er sie bloßstellte, sie vor anderen lächerlich machte, und nichts fand sie schwerer erträglich als das. Es war das Gefühl, im Nachthemd auf einer belebten Straße zu stehen oder durch eine Gasse von Kindern laufen zu müssen, die »Renate-Granate« kreischten und vor Lachen wieherten.
Zum anderen lag es daran, dass Knoop ihr mit seinen Beschimpfungen unter die Nase rieb, wie sehr sie ihren Vater enttäuschte.
Sie war kein Sohn.
Sie würde nie einer sein.
Bewusst langsam packte Renate ihre Sachen, während die übrigen Mädchen den muffigen Klassenraum nicht schnell genug verlassen konnten. Schließlich konnte man, wenn man sich beeilte, den Jungen vom nahen Conradinum begegnen, die um dieselbe Zeit nach Hause entlassen wurden. Für gewöhnlich gehörte auch Renate zu den Ersten, die ins Freie stürmten, nicht weil ihr sonderlich viel an den Jungen vom Conradinum lag, sondern weil sie sich in dem roten Backsteingebäude wie gefangen fühlte. Heute aber wollte sie erst gehen, wenn alle anderen fort waren und nicht länger die Gefahr bestand, jemandem über den Weg zu laufen.
Toni, der sonst so viel daran lag, mit Renate das kurze Stück Heimweg, das sie teilten, gemeinsam zu gehen und noch ein wenig zu ratschen, war gleich nach dem Klingeln aus dem Raum geeilt. Renate verstand sie: Sie schämte sich und wollte Fragen ausweichen. Weh tat es trotzdem. Selbst wenn Toni im Grunde nichts vorzuwerfen war, kam Renate sich verraten vor. Hätte die andere wirklich nichts tun können, um ihr beizustehen? Hätte sie selbst nicht alles versucht, zur Not sogar Dr. von Knoop ins Gesicht geschrien, was sie von ihm hielt?
Wenn man schlecht behandelt wurde und die eigenen Freunde dazu schwiegen, tat das mehr weh als die Misshandlung selbst.
Bald vier Jahre lang, seit Renate mit ihrer Familie nach Danzig gezogen war, hatten sie und Toni einträchtig eine Bank geteilt, hatte eine von der anderen abgeschrieben, und in den Pausen hatten sie über Gott, die Welt und Tonis Verehrer geplaudert. Jetzt aber fiel Renate mit einem Mal auf, dass sie mit der umschwärmten Rothaarigen kaum etwas verband.
Hatten sie je miteinander über das gesprochen, was sie im Innersten beschäftigte? Renate besaß ein Bild der glutäugigen Pola Negri und träumte davon, eines Tages aufzuwachen und so schlank und dunkelschön wie sie zu sein. Hätte sie je gewagt, Toni davon zu erzählen? Davon, dass sie sich in ihren Träumen auf der Leinwand sah, ein Star wie die Hauptdarstellerin aus Carmen und Salome, die Blume des Morgenlandes, dass sie aber gleich darauf glaubte, den ganzen Kinosaal schallend lachen zu hören, weil da oben keine unwiderstehliche Pola stand, sondern nur eine dickliche, stupsnasige Renate?
Ebenso wenig erzählte sie Toni davon, dass sie gern Gedichte las und manchmal sogar selbst welche schrieb, dass sie heimlich vor dem Spiegel übte, wie eine Opernsopranistin zu singen und in der Waldoper oder im Stadttheater aufzutreten.
Vielleicht war das kein guter Gradmesser für Freundschaft. Schließlich erzählte sie auch keinem anderen davon, weder Gabi noch ihren Eltern oder einem der anderen Mädchen, mit denen sie im Winter an der Aschbrücke zum Eislaufen ging und im Sommer an den Strand von Zoppot zum Baden fuhr. Höchstens Werner. Aber der zählte nicht, weil er selbst so verrückte Träume hatte. Außerdem war es etwas anderes, ob man jemandem in tiefer Nacht, bei flackerndem Kerzenschein und ein bisschen Weltschmerz einen Brief schrieb oder ob man ihm leibhaftig gegenüberstand.
Zuweilen kam ihr Werner vor wie ihr Tagebuch: Man schrieb etwas hinein und las es nie wieder. Es war ein solches Vergnügen, einen Brief abzufassen, aber das, was man dem Papier anvertraute, gehörte nicht ganz in die Wirklichkeit.
Jener Wirklichkeit – zumindest der, die hier im Klassenzimmer stattfand – wäre Renate in diesem Augenblick nur zu gern entkommen, aber diese Möglichkeit gab es nicht. Sie musste bis zum bitteren Ende ausharren und jeden hämischen Blick, jedes Gekicher ihrer Mitschülerinnen ertragen, ehe sie dem verhassten Raum entfliehen durfte.
Und wenn es endlich so weit war, wartete das Schlimmste auf sie: Sie würde ihrem Vater sagen müssen, dass sie eine Versagerin war.
2
Werner
Der Raum glich bis ins Detail den Bildern, die Werner im Kopf hatte, wenn er sich sein zukünftiges Arbeitszimmer vorstellte. Ein Arbeitszimmer, in dem er sich in seinem Element gefühlt hätte, in dem er aus sich hätte herausholen können, was in ihm steckte und was einfach niemand erkennen wollte. Das quadratische Erkerzimmer war in dunklen, gedeckten Tönen gehalten, die Souveränität und Macht ausstrahlten, und mit Möbelstücken eingerichtet, die zwanglos, beinahe wie zufällig angeordnet waren und gerade dadurch unterstrichen, dass jedes einzelne von ihnen echt war.
Lediglich der Schreibtisch hätte für Werners Geschmack größer sein dürfen. Ein wuchtiger Schreibtisch schüchterte das Gegenüber ein, was bei Verhandlungen jeglicher Art von Vorteil sein konnte. Umso stärker würde anschließend die Wirkung sein, wenn er, Werner, den Verhandlungspartner mit seiner jovialen, freundschaftlichen Art überraschte. Das Zusammenspiel beider Elemente war unschlagbar: Während die Behandlung des Unterlegenen auf Augenhöhe Vertrauen schaffte, machte die Größe des Schreibtischs deutlich, dass dieser es mit einem mächtigen Mann zu tun hatte, mit dem im Zweifelsfall nicht zu spaßen war.
Werner gelang es spielend, solche Zusammenhänge zu durchschauen. Er hätte ganze Klassenräume voller Lehrlinge darin unterrichten können, und es war unbegreiflich, dass kein Arbeitgeber dieses Talent erkannte und Nutzen daraus zog.
Dumm war er beileibe nicht. Wer das behauptete, war es selbst. Kommerzienrat Deutsch bot dafür das beste Beispiel. Der Mann gehörte zu jener Klasse, die annahm, nur weil sie reich geboren war, sei der gesamte Rest der Menschheit ihr unterlegen. Er saß auf seinem hohen Ross, sah Fehler grundsätzlich nur bei anderen Leuten und erkannte nicht, welchen Anteil er selbst daran hatte. Wenn etwa ein Angestellter seine Aufgaben nachlässig und ohne Fleiß erledigte, machte er ihn zur Schnecke. Auf die Idee, er könne den Mann an falscher Stelle eingesetzt und nicht genügend gefördert haben, kam er im Leben nicht.
Renate, sein geliebtes Renatchen, die erst siebzehn Jahre alt und doch so viel aufgeweckter und lernfähiger war als all die aufgeblasenen studierten Herrschaften, hatte diese Zusammenhänge im Handumdrehen erkannt:
»Du bist weder dumm noch faul, Werner«, hatte sie ihm geschrieben, denn seit ihre Eltern sie nach Danzig verschleppt hatten, war ihnen ja nur mehr das Briefeschreiben geblieben. »Du hast einfach noch nicht den Platz gefunden, an den du gehörst und auf dem du dich entfalten kannst.«
Ihre Briefe waren Balsam für ihn. Jeder einzelne. Er schrieb täglich an sie, gab sein karges Einkommen für das Porto aus, aber irgendwann hatte er einsehen müssen, dass Briefe nicht länger genügten. Er brauchte Renate um sich, brauchte ihre Ermutigung von Angesicht zu Angesicht. So wie er nie ihre Schwachpunkte – die pummelige Figur, die unvollkommenen Züge – gesehen hatte, sondern einzig und allein den Prachtkerl von einem Mädchen, der sie immer gewesen war, sah auch sie in ihm den begabten jungen Mann, nicht den Versager, als den andere ihn von klein auf abgestempelt hatten. Dass ihm ihre Art der bedingungslosen Zuneigung in den vergangenen drei Jahren verwehrt geblieben war, hatte zu seiner beruflichen Misere nicht unerheblich beigetragen.
Aber damit war es jetzt ja vorbei. Karl-Eugen Müller war ein völlig anderes Kaliber als Kommerzienrat Deutsch. Renates Vater hatte immer an ihn geglaubt und war ihm auf Augenhöhe begegnet, ja, Werner hatte sogar zu spüren gemeint, dass er in ihm ein wenig den Sohn sah, den er gerne gehabt hätte. Und wenn es nun ausgerechnet durch Vater Müller geschah, dass er die ersehnte Chance bekam, wäre auch seine geliebte Renate ständig um ihn, und sie könnten anfangen, an Heirat und einen eigenen Hausstand zu denken.
Sein Vater würde ihm diesbezüglich keine Steine in den Weg legen. Er half ihm nicht, hatte ihm noch an keinem Tiefpunkt seines Lebens geholfen, aber er versuchte auch nicht, ihn an etwas zu hindern. Dazu war er zu schwach.
Ein Arbeitszimmer besaß er überhaupt nicht, sondern hielt seinen läppischen Unterricht in der Stube der engen Wohnung ab. Werner und seine Mutter hatten sich derweil in die Küche zwängen müssen, in die durch dünne Wände der Lärm drang und wo Konzentration unmöglich war. Eng waren in dieser Wohnung nicht nur die Räume. Das ganze Denken war so beschränkt und kleingeistig, dass Werner Platzangst verspürte, und die Ziele, die seine Eltern sich setzten, blieben immer bescheiden. Träume von Größe, hochfliegende Hoffnungen schienen die beiden nicht zu kennen.
Auch nicht für ihren einzigen Sohn. Brav zur Schule hatte er gehen und seinen Abschluss machen sollen. Dass er nach Höherem strebte, ging ihnen nicht in den Kopf.
Ganz anders sah es bei Karl-Eugen Müller aus, der einem Sohn sicher gern den Weg in eine strahlende Zukunft geebnet hätte. Karl-Eugen Müller war nicht schwach, auch wenn der Schreibtisch, hinter dem er saß, in seiner Zierlichkeit fast feminin wirkte. Immerhin war es ein geschmackvolles Möbelstück aus hellem Mahagoni, niederdeutsches Biedermeier, vermutete Werner. Und dann all die herrlichen Messingleuchter, die Renates Vater sammelte! Schon als Kind, als die Müllers noch in Emmering gewohnt hatten und Werner zum Feiern in ihr Haus gekommen war, hatte er jeden einzelnen bewundert.
Ein Paar, dessen Stiele wie gedrehte Blütenblätter in die Höhe wuchsen, hatte es ihm schon vor Jahren angetan. Damals hatten die beiden edlen Stücke auf dem Sims des großen Fensters gestanden, und hier standen sie wiederum paarweise auf einem schmalen, bildhübschen Sideboard.
»Werner.« Karl-Eugen Müller erhob sich und streckte ihm über den Schreibtisch hinweg die Hand entgegen. »Das ist ja eine nette Überraschung. Bist du auf Besuch in unserem schönen Danzig? Sind deine Eltern auch hier? Wenn ich dich so ansehe, sollte ich dich wohl nicht länger duzen. Du bist ja ein richtiger Mann geworden.«
»Aber ich bitte Sie, unsere Familien sind doch befreundet – natürlich bleiben wir beim vertrauten Du.« Werner schlug ein und spürte den festen, männlichen Händedruck. Im Laufe des Gesprächs würde der Ältere ihm sicherlich anbieten, ihn ebenfalls zu duzen. »Ich bin allerdings allein hier und auch nicht nur auf Besuch. Vielmehr stehe ich im Begriff, mir in dieser herrlichen alten Hansestadt beruflich etwas aufzubauen. Auf Dauer, meine ich. Ich sehe meine Zukunft hier.«
Er klang wie ein Stotterer, bei Weitem nicht selbstbewusst genug. Dabei wollte er Karl-Eugen Müller doch von Mann zu Mann gegenübertreten, als einer, der etwas zu bieten hatte, der wusste, was er wert war.
»Du bist beruflich in Danzig? Und du willst hierbleiben?« Karl-Eugen Müller zog seine Hand zurück. »Aber hat nicht Helmut erzählt, du gehst jetzt bei Leo Deutsch im Münchner Stammhaus in der Lehre? Unser letzter Briefwechsel liegt schon eine Weile zurück, doch ich bin recht sicher, mich zu erinnern …«
»Ja, das ist richtig«, beeilte sich Werner zu versichern. »Ich dachte, eine gewisse Zeit in einer großen Privatbank, um Erfahrungen zu sammeln und gewisse Erkenntnisse zu erlangen, könnte für meinen künftigen Weg nicht schaden. Und da Kommerzienrat Deutsch sichtlich daran gelegen war, mich für sein Unternehmen zu gewinnen, habe ich dort unterzeichnet. Allerdings wurde sehr schnell klar, dass Herr Deutsch nicht gewillt war, mir ein Weiterkommen zu ermöglichen, wie er es mir mündlich zugesichert hatte. Es tut mir leid, es so deutlich zu sagen, da ich weiß, Sie sind mit Herrn Deutsch freundschaftlich verbunden, aber ich musste leider erkennen, dass ihm lediglich an einer billigen Arbeitskraft gelegen war, die er nach Belieben ausnutzen konnte.«
»Ich bin sicher, dass du dich da täuschst, Werner.« Renates Vater nahm wieder hinter dem Schreibtisch Platz und wies vage auf eine Gruppe von zwei Sesseln, um Werner ebenfalls zum Sitzen aufzufordern. »Zwar bin ich keineswegs mit Herrn Deutsch befreundet, sondern habe lediglich meine Konten bei seiner Bank, aber ich habe ihn immer als einen Mann erlebt, der zu seinem Wort steht und mit dem man reden kann. Lehrjahre sind nun einmal keine Herrenjahre.« Er lächelte. »Das waren sie für keinen von uns. Aber man überlebt sie und lernt auch ziemlich schnell, dass es Schlimmeres gibt.«
»Oh, ich habe nicht das Geringste gegen harte Arbeit einzuwenden.« Werner hob die Hosenbeine an den Knien an, ehe er sich setzte, um die Passform nicht zu ruinieren. Es würde dauern, bis er sich neu einkleiden konnte, also musste dieser Anzug, so schäbig er war, noch eine Weile herhalten. »Im Gegenteil. Ich brenne ja darauf, endlich richtig gefordert zu werden und zeigen zu dürfen, was ich kann. Bei der Privatbank Deutsch war das aber leider nicht der Fall. Wenn ich ehrlich bin, fürchte ich sogar, dass das Unternehmen seine besten Tage hinter sich hat. Die Anzeichen, die ich nicht umhinkam, wahrzunehmen, sprechen wahrlich nicht für ein prosperierendes Bankhaus.«
»Der Eindruck mag entstehen, weil Deutsch genau wie die anderen Banken gerade die verheerendste Inflation der Geschichte überlebt hat«, erwiderte Müller. »Aber ich kann dich beruhigen: Die Wirtschaft wird sich jetzt, wo sie sich auf die Rentenmark stützen kann, erholen, Deutschs Bank ist solide aufgestellt, und der Sohn, der in die Firma eintreten wird, sobald er sein Studium abgeschlossen hat, scheint ein kluger Kopf.«
»Pah.« Werner schnaubte. Der Sohn von Kommerzienrat Deutsch war ein Schnösel, und wie dieser auf der Silvesterfeier vor fünf Jahren versucht hatte, ihn bloßzustellen, hatte sich unauslöschlich in sein Gedächtnis eingegraben. Während seiner Anstellung in der Bank hatte er jede Begegnung mit dem Kerl vermieden, aus Angst, sich andernfalls zu vergessen. »Wenn es einem so leicht gemacht wird, man sorglos studieren kann und anschließend Vatis Bank übernimmt, ist es kein Kunststück, sich als kluger Kopf zu präsentieren«, sagte er.
»Dein Vater hätte dir auch gern ein Studium ermöglicht«, sagte Karl-Eugen Müller. »Ich denke, das weißt du.«
»Die Voraussetzungen sind doch völlig andere«, fuhr Werner auf. »Bei meinen Eltern ist Schmalhans Küchenmeister, solange ich zurückdenken kann. Mein Vater verdient kaum mehr als ein Almosen – wie hätte ich ihm da noch länger auf der Tasche liegen können?«
»Er hätte sich gefreut, wenn du die Schule abgeschlossen und dich für den höheren Bildungsweg entschieden hättest«, gab Müller unerbittlich zurück. »Darin sind alle Eltern gleich. Sie wollen das Beste für ihre Kinder. Und auch wenn dein Vater kein Bankier ist, verdient er beileibe mehr als nur Almosen. Er würde dir auch jetzt noch unter die Arme greifen, wenn du dich entschließen würdest, es mit der Schule noch einmal zu versuchen. Du bist erst zwanzig, Werner. Dein Zug ist doch noch nicht abgefahren.«
»Ich bin erwachsen«, erwiderte Werner schärfer als beabsichtigt. »Und Sie können mir glauben, ich habe mir sehr gewissenhaft überlegt, was möglich ist und was nicht. Diese Mühe musste sich der Sohn des Kommerzienrats nie machen, er wird sie sich auch nie machen müssen, nur darauf wollte ich hinaus.«
»Die Großmutter meiner Frau pflegt zu sagen: Unter jedem Dach wohnt ein Ach«, erwiderte Müller in jenem ruhigen, überlegenen Ton, den Werner hasste, weil er denen vorbehalten war, die in gemachten Nestern saßen. »Ehe du Georg Deutsch allzu sehr beneidest, solltest du dich an dem freuen, was du hast: ein anständiges Elternhaus, gesunde Glieder, deine Jugend und einen Kopf, der sich zum Denken gebrauchen lässt. Wenn du es dir jetzt nicht verpatzt, hast du noch alles vor dir. Die Deutschs hingegen mögen finanziell gut gestellt sein, aber die persönliche Tragödie, die ihnen auferlegt ist, wünsche ich keinem Menschen.«
Werner nickte unwillig. Er hatte Gemunkel darüber gehört. Auch Tragödien waren allerdings leichter zu bewältigen, wenn man sie in einer Villa in Grünwald durchlebte und abends zum Trost in Champagner baden konnte. Außerdem war er nicht hergekommen, um über die Leiden der Familie Deutsch, sondern um über seine Zukunft zu sprechen. Um sich zu sammeln, ließ er den Blick über die zwei Messingleuchter mit den Blütenblättern schweifen. »Ich beneide weder Georg Deutsch noch sonst jemanden, sondern will mir aus eigener Kraft etwas aufbauen«, sagte er schließlich. »Aus ebendiesem Grund bin ich von der Bank und aus München fortgegangen. Dort wurden mir doch nur immer wieder Steine in den Weg gelegt. Was ich brauche, ist ein neuer, frischer Anfang.«
»Wenn du zu diesem Schluss gekommen bist, dann ist es sicher das Richtige«, sagte Müller. »Danzig mag seine Probleme haben, zumal mit der Abtrennung von Deutschland ja nicht jeder einverstanden war, aber es ist und bleibt eine lebendige Stadt von einzigartiger Schönheit.«
Werner hatte die fast poetische Art, in der Renates Vater sich ausdrückte, immer gemocht. »Ja, es ist eine herrliche Stadt mit einem so reichen historischen Erbe«, stimmte er zu. »Und natürlich hätte es unbedingt zu Deutschland gehört. Man möchte in all diese Bürgerhäuser mit ihren bemalten Fassaden hineinspähen dürfen, um die Schätze zu entdecken, die sie bergen. So wie auch hier bei Ihnen – Ihr Sideboard ist niederdeutsches Biedermeier, nicht wahr? Die beiden Leuchter passen hervorragend dazu, auch wenn ich annehme, dass sie älter sind. Barock, wenn ich nicht irre?«
»In der Tat.« In Karl-Eugen Müllers Stimme schwang Anerkennung. »Das ist mir schon damals in München aufgefallen: Du hast nicht nur ein echtes Interesse an Antiquitäten, sondern auch einen erstaunlich guten Blick.«
»Vielen Dank.« Werner spürte, wie seine Wangen glühten. Weder sein eigener Vater noch sonst ein Mensch hatte je auch nur bemerkt, wie sehr ihn die Schätze der Vergangenheit faszinierten. Er war ein Mann der Zukunft, daran bestand kein Zweifel, aber eine Zukunft von Wert und Bestand musste auf dem Erbe einer Kultur begründet sein und sich auf deren Reichtum besinnen. »Es muss einfach wunderbar sein, von so herrlichen Dingen umgeben leben zu können«, sagte er. »Ich wäre ein ganz anderer Mensch, wenn ich diese Möglichkeit hätte, könnte ganz anders denken und arbeiten. Leider habe ich für den Augenblick mit einem kaum zumutbaren Zimmer hinter der Telegrafenkaserne vorliebnehmen müssen. In der Polenhof-Siedlung. Falls Sie von einer angemesseneren Unterkunft hören und es mich wissen lassen, wäre ich Ihnen sehr zu Dank verpflichtet.«
»Ein Kollege von mir wohnt in der Polenhof-Siedlung«, sagte Müller, als wäre er in Gedanken auf einmal weit weg. »Jaroslaw Powazki, ein höchst patenter, angenehmer Kerl. Vielleicht kann er dir einen Rat geben. Soweit ich weiß, fühlt er sich mit seiner Familie in der Siedlung sehr wohl.«
»Ein Kollege von Ihnen ist Pole?«, fragte Werner ungläubig. »Die Danziger Zeitung stellt Mitarbeiter ein, die zur polnischen Bevölkerung gehören?«
»Ja, warum denn nicht?«, gab Müller zurück. »Wir stellen den ein, der sich als der beste Kandidat für das jeweilige Ressort erweist. Und der Kollege Powazki, der für den Sport schreibt, ist auf seinem Feld einfach unschlagbar. Überdies ist er fließend zweisprachig, im Polnischen wie im Deutschen, was mich beständig aufs Neue mit Bewunderung erfüllt, und beherrscht darüber hinaus Englisch und Französisch besser als die gesamte Redaktion. Er ist ein ausgezeichneter Journalist, einerlei welchem Volk er entstammt.«
Er hielt inne und fasste Werner so fest ins Auge, dass dieser nicht ausweichen konnte. »Du hast dir doch kein dummes Zeug von Rassisten ins Hirn blasen lassen, nicht wahr, Werner? Ich weiß, diese Leute wittern gerade Morgenluft, weil die Inflation so viel Not verursacht hat und Not den Menschen für solchen Irrsinn empfänglich macht. Der Putsch, an dem der ewiggestrige Ludendorff sich mit diesem Hitler versucht hat, ist ja das jüngste Beispiel dafür. Aber der Versuch ist im Sande verlaufen, weil derlei Gedankengut in unserer Demokratie keinen Platz hat. Und unter euch, den Kindern aus Emmering, die schon in Freiheit aufgewachsen sind, als halb Deutschland nicht einmal wusste, was das Wort bedeutet, kann es erst recht keinen Platz haben. Wenn es dir nicht gut geht, Werner, wenn du derzeit eine Misere durchlebst – mach nicht Menschen dafür verantwortlich, die weit weniger dafür können als du selbst und vermutlich härter zu kämpfen haben.«
Werner wollte protestieren, doch für kurze Zeit schwieg er erschrocken. Ja, es war ihm in der Tat falsch erschienen, dass in der Siedlung hinter der Telegrafenkaserne Polen ganze Häuser bewohnten und finanziell sichtlich gut gestellt waren, während er selbst kaum die Miete für eine schmuddelige Kammer aufbrachte. Ja, er war über die unverschämte Attitüde seiner polnischen Vermieterin empört gewesen, und es kam ihm ungerecht vor, dass ein polnischer Redakteur in einem deutschen Zeitungsverlag jemandem den Arbeitsplatz wegnahm. Immerhin befanden sie sich in einer deutschen Stadt, ganz egal, was der Völkerbund 1920