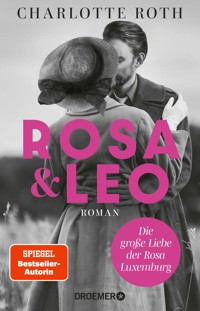9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein aufwühlender Roman über den Mauerbau, das Leben in der jungen DDR und über zerrissene Familien und Freundschaften von der Bestseller-Autorin Charlotte Roth Berlin nach dem 2. Weltkrieg: Von ihrem geliebten Vater Volker, einem Lehrer, hat Susanne gelernt, an den Sozialismus zu glauben. Ohne je das Vertrauen in die Menschheit zu verlieren, hat er gegen das Naziregime gekämpft – und wurde vor den Augen seiner sechzehnjährigen Tochter kurz vor Kriegsende erschossen. Nie hat Susanne dieses Erlebnis vergessen, das sie für ihr Leben geprägt hat.. Um das Vermächtnis des Vaters zu erfüllen, widmet sich Susanne von ganzem Herzen dem Aufbau eines besseren Deutschland. Erst als sie den lebenslustigen Koch Kelmi kennen- und liebenlernt, beginnt sie allmählich zu begreifen, was um sie herum passiert. Zu tief jedoch ist der Glaube an den Sozialismus im Osten Deutschlands in ihr verwurzelt, zu stark das Band, das sie mit dem toten Vater verbindet. Dann kommt der 13. August, und plötzlich verstellt die Mauer Susanne jegliche Möglichkeit einer Alternative … »Eine berührende Liebesgeschichte und eine erschütternde Familientragödie, spannend geschrieben.« Mechtild Borrmann, Autorin des SPIEGEL-Bestsellers Trümmerkind
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 724
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Charlotte Roth
Wir sehen uns unter den Linden
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein aufwühlender Roman über den Mauerbau, das Leben in der jungen DDR und über zerrissene Familien und Freundschaften von der Bestseller-Autorin Charlotte Roth
Berlin nach dem 2. Weltkrieg.
Von ihrem geliebten Vater Volker, einem Lehrer, hat Susanne gelernt, an den Sozialismus zu glauben. Ohne je das Vertrauen in die Menschheit zu verlieren, hat er gegen das Naziregime gekämpft – und wurde vor den Augen seiner sechzehnjährigen Tochter kurz vor Kriegsende erschossen. Nie hat Susanne dieses Erlebnis vergessen, das sie für ihr Leben geprägt hat. Um das Vermächtnis des Vaters zu erfüllen, widmet sich Susanne von ganzem Herzen dem Aufbau eines besseren Deutschland.
Erst als sie den lebenslustigen Koch Kelmi kennen- und liebenlernt, beginnt sie allmählich zu begreifen, was um sie herum passiert. Zu tief jedoch ist der Glaube an den Sozialismus im Osten Deutschlands in ihr verwurzelt, zu stark das Band, das sie mit dem toten Vater verbindet.
Dann kommt der 13. August, und plötzlich verstellt die Mauer Susanne jegliche Möglichkeit einer Alternative …
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto 1
Motto 2
1945. Kapitel
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Zweiter Teil
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Dritter Teil
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Vierter Teil
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
Fünfter Teil
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
Sechster Teil
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
Siebenter Teil
39. Kapitel
40. Kapitel
Achter Teil
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
Nachsatz
Glossar
Für unsere Freunde
Sue, Kelly und Beatrice
Dieser Roman spielt in Berlin.
Nur in Berlin.
Und doch in drei Städten.
In der Swing tanzenden, um ihre Freiheit kämpfenden Metropole der Weimarer Republik.
In der weltweit verhassten Machtzentrale des Naziterrors.
Und in einer geteilten Stadt.
»Untern Linden, untern Linden
geh’n spazier’n die Mägdelein.
Wenn du Lust hast anzubinden,
Dann spaziere hinterdrein.
Fängst du an bei Café Bauer,
Sagt sie dir noch: ›Ich bedauer‹,
Doch dann am Pariser Platz
Schwupp, da ist sie schon dein Schatz.
Untern Linden promenier ich
Immer gern vorbei,
ach ist die Passage schwierig
Und die Schubserei.
Auf ’ner Kilometerlänge
Siehst du nichts als Menschenmenge
Und inmitten
Hält beritten
Stolz die Polizei.
Menschen siehst du dorten
Aus den fernsten Orten.
Hamburg, Köln und auch von Wien,
Mal auch einen aus Berlin.
Doch das Allernett’ste,
Süßeste, Kokett’ste
In dem Rahmen
Sind die Damen,
Die vorüberzieh’n.«
Heiß geliebter Berliner Schlager seit 1913.
Text von Rudolf Bernauer, geflohen aus dem Dritten Reich, zwanzig Jahre später.
1945
Die Wohnung in der Adalbertstraße, zwei Stuben und Küche im obersten Stock, war ihre Höhle. Als kleines Kind – vier Jahre war sie damals gewesen – hatte Suse sich vorgestellt, sie und ihre Eltern wären drei Bären aus einer Geschichte, die ihre Mutter ihr vorgelesen hatte. Die drei Bären hatten auf drei Stühlen um den Küchentisch gesessen und beim Suppelöffeln Abzählreime aufgesagt, wie der Vater, die Mutter und Suse es taten, sie hatten in drei Betten nebeneinander geschlafen und sich im Dunkeln Geschichten erzählt. Im Sommer waren sie zum Picknicken in den Wald gewandert, hatten aus Astlöchern Honig und aus Buschwerk Waldmeister gesammelt, und im Winter hatten sie sich mit ihrem Mensch-ärgere-dich-nicht-Brett an den Kachelofen gesetzt, in dessen Rauchabzug Bratäpfeln krachend die Schale platzte.
Und sie waren glücklich gewesen, die drei Bären in ihrer Höhle, so glücklich, wie drei Bären – ein großer mit Brille, ein mittlerer im rosa Kleid und ein kleiner, der an ihren Händen hüpfte – überhaupt nur sein können, bis das böse Goldlöckchen gekommen war und das ganze Glück kaputt gemacht hatte.
Das böse Goldlöckchen hatte gelbe Haare wie das Mädchen auf den Plakaten im Glaskasten. Als Kind hatte Suse vor diesem gelbhaarigen Bösen solche Angst gehabt, dass sie in Tränen ausgebrochen war und sich die Ohren zugehalten hatte.
»Nun komm schon«, hatte die Mutter sie gedrängt. »Du wirst doch wohl wissen wollen, wie es ausgeht.«
Aber gerade das hatte Suse ganz und gar nicht gewollt.
Ihre Mutter hatte darüber gelacht. Sie lachte damals immer, war fröhlich, redete auf den Vater ein, er solle das Leben nicht so schwer nehmen. »Was bist du nur für ein komisches Liebchen«, sagte sie zu Suse. »Ich hätte mich als Kind vor den Bären gefürchtet, aber doch nicht vor dem niedlichen Goldlöckchen.«
An den Bären war nichts zum Fürchten, fand Suse. Die lebten friedlich ihr Leben und taten niemandem etwas zuleide.
Das Bilderbuch, eine prächtige Ausgabe, die von Kiepert am Knie stammte, hatte Großmutter Konya zu Suses Geburtstag geschickt, und ihre Mutter wünschte sich, dass Suse es gern mochte. Aber Suse mochte es nicht gern. Wild entschlossen hatte sie nach ihrem dicksten Buntstift gegriffen und versucht, das Goldlöckchen, das den Stuhl des Bärenkindes zerbrach, seine Schüssel mit Haferbrei leer aß und sich in sein Bett legte, zu übermalen.
Ihre Mutter hatte ihr das Buch weggerissen. »Was ist denn mit dir los? Die Großmutter hat es gut gemeint, sie wollte dir eine Freude machen, und du verdirbst die schönen Bilder.«
Suse hatte nicht aufhören können zu weinen. Sie wusste das noch, obwohl es zwölf Jahre her war. Das Bärenkind, das nichts ahnend in sein Zuhause kam und seinen Stuhl zerbrochen, seinen Teller leer und sein Bett besetzt fand, hatte ihr entsetzlich leidgetan, und die Angst, auch in ihre Wohnung in der Adalbertstraße könne sich eine böse Zerstörerin einschleichen, hatte sie wie eine Welle überrollt.
Ihr Vater hatte sie verstanden. Er verstand sie immer – oder besser, er hatte es immer getan, solange sie ein Kind gewesen war. Er hatte den Arm um sie gelegt und ihr versichert: »In unsere Wohnung kommt kein Goldlöckchen. Wir haben ja ein Schloss an der Tür und lassen nur Leute herein, die wir bei uns haben wollen. Tante Hillchen. Eugen und Sido. Niemanden, der uns Böses will.«
Jetzt war Suse kein Kind mehr. Sie wurde in diesem Jahr sechzehn, ging aufs Gymnasium, konzentrierte sich auf die Schule, solange es Lehrer gab und Räume, die für den Unterricht benutzt werden konnten. Den Westflügel mit der Aula hatte eine Brandbombe in einen hohlen Riesenzahn verwandelt, und in ihrer Klasse, in der einst dreiundzwanzig Jungen und sieben Mädchen gesessen hatten, waren sie nur noch zu sechst. Man bekam kaum Schreibpapier und für einen Bleistift, der bis auf den letzten Stummel angespitzt war, keinen Ersatz. Auf der Landkarte mit den Fähnchen wurden am Morgen Lügen eingetragen, und wohin Herr Kurth, der Erdkundelehrer, verschwunden war, durfte niemand fragen.
»Geh trotzdem hin«, sagte der Vater. »Versuch an jedem Tag, an dem sie dich lassen, etwas zu lernen. Schule ist das Wichtigste, Suse. Vergiss das nicht.« Ihr Vater war Lehrer. Er war Lehrer gewesen, bis sie ihn nicht mehr gelassen hatten, und im Innern war er es wohl noch immer.
Ein Lehrer ohne Schüler.
Suse hatte wahrhaftig andere Sorgen als halb vergessene Kindergeschichten, und das Buch mit dem Goldlöckchen, das sie einst in solchen Schrecken versetzt hatte, war längst in einer Kiste auf dem Hängeboden und dann anderswohin verschwunden. Dennoch packte sie jeden Tag auf dem Heimweg die alte Angst.
Es war kalt und wurde schon dunkel, Wind, der ihr entgegenpfiff, biss sich in ihren Wangen fest. Dennoch lief ihr der Schweiß unter dem Mantel, den Tante Hille ihr zurechtgenäht hatte und der nicht mehr richtig warm hielt. Sie lief die lange Friedrichstraße hinunter, und mit jedem Schritt, den sie ihrem Zuhause näher kam, schwoll die Angst. Immer größer und schwerer hing sie Suse vom Rücken, wollte sie zurückhalten, vor dem Schrecken bewahren, der in ihrer Wohnung auf sie wartete. Dennoch lief Suse weiter, schneller und schneller, wie in der Hoffnung, es ließe sich noch etwas verhindern. Wir haben ein Schloss an der Tür, versuchte sie sich zu beruhigen, wir lassen keinen, der uns Böses will, herein.
Wie von selbst bekamen ihre Gedanken einen Rhythmus, formten sich zu Abzählreimen wie die, die sie früher beim Essen aufgesagt und über die sie sich und die Mutter vor Lachen ausgeschüttet hatten:
Keiner, der
Böses will,
Darf zu uns
Herein.
Mit der Mutter zu lachen war schön. Es war wie ein Aufatmen, weil wieder einmal nichts passiert war und auch nichts passieren würde, weil Suses Hirn –»das hast du von deinem Vater, ihr seid meine zwei Schwarzseher« – alles überzeichnete, weil, falls es an der Tür schellte, niemand als Eugen oder Tante Hille davorstehen würde. Nur kam Eugen nicht mehr oft, und Tante Hille hatte einen Schlüssel. Suse sprang von einem Hügel aus Schneematsch in den nächsten, und mit dem Platschen ihrer Sohlen hallten die Silben des Abzählreims:
Keiner, der
Böses will,
Darf zu uns
Herein.
Es würde Bratkartoffeln geben. Spätestens wenn sie den Absatz im dritten Stock erreichte, würden Schwaden des Duftes ihr entgegenquellen. Die Mutter war eine lausige Köchin. »Ich kann Stullen schmieren, alles andere macht meine Schwägerin«, pflegte sie zu sagen, aber ihr, nicht Tante Hille, gelang es noch immer, Kartoffeln, Eier und irgendeine Art von Fett aufzutreiben. Seit sie alle ständig Hunger hatten, schmeckten ihre Bratkartoffeln köstlich. Suse würde an der Tür der Wernickes vorbeiflitzen, und wenn Frau Wernicke den Kopf in den Spalt steckte und irgendetwas keifte, würde sie so tun, als hätte sie nichts bemerkt.
Suse fiel ins Rennen. Endlich erreichte sie die Straßenecke, Patzenhofers Destille, wo sie früher mit den Eltern eingekehrt war, wenn sie von einem Ausflug heimgekommen waren. »Jemand Lust auf dicke Bockwurst mit Erbsen?«, hatte die Mutter gefragt. »Wochenende mit euch ist zu schön, um es am Herd zu vergeuden.« Sie hatten sich über die dampfenden Teller hergemacht und sich wie Könige gefühlt, hatten beim Essen ein Spiel gespielt, das Ich packe meinen Koffer hieß, und sich die Reisen ausgemalt, die sie eines Tages wieder machen wollten, an die Ostsee und anderswohin.
»Ich packe in meinen Koffer Suses blaues Badekostüm.«
»Das ist zu klein.«
»Dann eben ein neues. Und einen großen Spaten für die Sandburg.«
Später hatte Suse sich bei Patzenhofer manchmal Fassbrause holen dürfen, für die Eugen ihr einen Groschen in die Hand gedrückt hatte: »Sei ein Schatz, Kleinmensch, geh und kauf dir an der Ecke Brause. Dein Vater und ich haben zu reden, da können wir kein Fräulein Naseweis, das lange Ohren macht, brauchen.«
Suse hatte die Emaillekanne aus der Küche geholt und war losgelaufen. Sooft Eugen mit ihm zu reden hatte, legte sich die Stirn des Vaters in Falten, und sie wollte es ihm nicht noch schwerer machen. Irgendwann hatten sich die Falten in seiner Stirn nicht mehr geglättet, und wenn Eugen jetzt überhaupt noch kam, sagte er Dinge wie: »Mit dir darüber zu reden war doch müßig« oder »Der, der weiß, wann es zu spät war, bin ja wohl ich.« Die Mühe, Suse einen Groschen für Patzenhofer zuzustecken, machte er sich längst nicht mehr, und dass es dort noch Fassbrause gab, bezweifelte Suse. Es gab ja nirgends mehr etwas. Zumindest aber war Patzenhofer nicht ausgebombt.
Die Adalbertstraße mit ihren vom Schneeregen geschwärzten vierstöckigen Häusern war eine der wenigen, die noch aussah wie vor dem Krieg. Als hätte der Krieg um sie einen Bogen gemacht. »Das bleibt bis zum Schluss so«, sagte Suses Mutter, wenn sie hinter den verdunkelten Fenstern unter dem Küchentisch kauerten und sich aneinander festhielten, während die Dielen bebten und die Scheiben in den Rahmen rasselten. »Es lässt uns aus. Wir sind noch da, wenn der Spuk vorbei ist.«
Suse ballte im Laufen die Fäuste. Es würde so kommen, und es würde nicht mehr lange dauern. Man durfte das nicht sagen, aber jeder wusste es. Die Angst vor dem Ende war überall spürbar, in vielsagenden Blicken, im Murmeln mit gesenkten Köpfen, im jäh verstummenden Geflüster. Aber Suse und ihre Eltern gehörten nicht zu denen, die vor dem Ende Angst hatten. »Wir müssen nur durchhalten«, sagte der Vater. »Wenn es vorbei ist, wird alles gut. Dann bauen wir uns ein neues Land auf, eines, in dem sich alle Menschen an dem einen Leben, das sie haben, freuen können.«
Er hatte das schon vor bald vier Jahren gesagt, als der Krieg gegen die Sowjetunion begonnen hatte, und die Mutter hatte lachend erwidert: »Sich am Leben freuen – Und so etwas kann mein Teufel-an-die-Wand-Maler?«
Der Vater hatte gelächelt und die Arme um die Mutter gelegt. »Ich kann es, seit ich an einem Frühlingsmorgen Unter den Linden dich getroffen habe.«
»Du hast mich nicht getroffen.« Die Mutter hatte ihn geboxt und sich in seine Arme geschmiegt. »Du Blindschleiche bist frontal in mich hineingestolpert.«
Es tat Suse gut, sich daran zu erinnern, auch wenn solche Momente zwischen dem Vater und der Mutter selten geworden waren. Es gab sie noch. Bärenglücksmomente zwischen ihnen allen dreien. Nichts würde passieren, das ihnen etwas anhaben konnte, all das Schlimme, Bedrohliche würde bald ein Ende haben.
»Und dann«, hatte der Vater gesagt, »dann liegt es an uns, dass etwas wie das hier nicht wieder geschieht. Bildung müssen wir den Leuten geben. Wenn sie Zugang zu Bildung haben, haben sie Zugang zur Wahrheit. Sie sind in der Lage, die Lügen von Rattenfängern zu durchschauen, und werden nie mehr einem in die Falle gehen.«
Zu den Silben des Abzählreims rannte Suse die Straße hinunter.
Keiner, der
Böses will,
Darf zu uns
Herein.
Sie erreichte die Tür. Eine große, hölzerne Flügeltür, deren rechter Flügel sonst geschlossen war, weil keine Fuhrwerke mehr durch den Gang kutschieren mussten, um Geschäfte und Werkstätten im Hinterhof zu beliefern. Die Papierhandlung war verrammelt worden, der Inhaber im Krieg erfroren. Stalingrad. Wenn der Vater das aussprach, klang es ein bisschen, wie wenn der Geschichtslehrer, der die verlogenen Fähnchen in die Landkarte pinnte, von der geheimen Wunderwaffe sprach.
Heute stand der rechte Türflügel offen. Beide Flügel. Etwas war anders als sonst, das bemerkte Suse, noch ehe sie das Haus betrat. Es roch nicht nach Bratkartoffeln. Aber das tat es vor dem Absatz im dritten Stock ja nie.
Durch den Flur, in dem jedem Schritt ein Echo antwortete, eilte sie zur Treppe. Aus Gewohnheit drückte sie auf den Lichtschalter, obwohl die durchgebrannte Birne seit bestimmt einem halben Jahr nicht ersetzt worden war. Dass die Wohnungstüren einen Spalt breit offen standen, sah sie dennoch, und trotz des schwindenden Lichts war sie sicher: Nicht nur Greeve, der Blockwart, auf der rechten Seite, sondern auch Omi Lischka auf der linken, deren Enkel Otti wie ein großer Bruder mit Suse gespielt hatte, presste das Gesicht zwischen Tür und Rahmen und spähte durch die Ritze.
Sie eilte die Treppe hinauf. Würdigte die Türspalten, in denen je ein Auge blitzte, keines Blickes. Während sie die Stufen erklomm, dabei zwei auf einmal nahm, glaubte sie, in ihrem Rücken Gekicher zu hören.
Im zweiten Stock würde es nicht so schlimm sein. Frau Schmidtke, deren Mann im zweiten Kriegsjahr gefallen war, hatte mit vier Kindern und zwei ausgebombten Schwestern zu viel zu tun, um sich um andere zu scheren, und rechts wohnten die Dombröses, die niemandem übelwollten. Lutz Dombröse hatte im Krieg – nicht in diesem, sondern im letzten – einen Lungenflügel und ein Bein verloren, er betrieb von daheim einen Handel mit Briefmarken, und seine Frau Lotte war Schaffnerin bei der Straßenbahn. Wenn sie Schicht hatte, führte Suse ihr Fritsche, den Dackel, aus oder holte ihrem Mann die Zeitung. Zum Dank brachte Lotte Dombröse ihnen manchmal eine Stiege Birnen aus dem Schrebergarten mit. »Die isst dein Vater doch so gern, Susannchen.«
Die Dombröses gehörten nicht zu den Leuten, die gafften, wenn anderen Unglück geschah. Im Haus ging Gemunkel um, Lutz sei Sozialdemokrat gewesen, habe in pazifistischen Kreisen verkehrt. Auch war er es gewesen, der sich nach dem Vorfall im Keller bei Blockwart Greeve für den Vater eingesetzt hatte, obwohl der ihn selbst auf dem Kieker hatte.
Suse lief über den Absatz und wollte schon auf die nächste Stufe steigen, als rechts die Tür aufsprang. Lotte Dombröses Hand schoss heraus und packte sie am Arm. »Komm rein, schnell«, zischte die Frau ihr zu, während sie sie in den dunklen Flur ihrer Wohnung zerrte. Es roch nach dieser Seife, die nur alte Leute benutzten, und nach einem der Gerichte, die alte Leute sich kochten. Suse setzte zum Protest an, aber Lotte Dombröse presste ihr eine Hand auf den Mund. »Sei doch still«, flüsterte sie. »Die sind bei euch oben. Da kannst du jetzt nicht rauf.«
Suses Herz wurde hart wie eine Faust und begann, in dumpfen Schlägen gegen ihre Brust zu hämmern. Vor ihrem geistigen Auge zogen die Bilder aus dem Buch auf – der zerbrochene Stuhl am Boden, das Gesicht des kleinen Bären, der mit seiner Kiepe heimkommt und seine Höhle zerstört findet.
»Komm schon. Musst dich verstecken.« Lotte Dombröses zu Löckchen gedrehtes Haar war zerzaust und ihr Gesicht wachsbleich. Sie zog Suse in Richtung Stube. Auf dem grünlichen, abgewetzten Sessel saß ihr Mann mit einer Decke über den Knien. Über dem einen Knie und dem leeren Hosenbein. Der Volksempfänger war eingeschaltet, spielte irgendeine plänkelnde Musik. »Da runter.« Lotte schnaufte, wies auf das Sofa. »Bleib liegen, bis sie weg sind. Rühr dich nicht.«
Suse stand wie gebannt, starrte auf den fadenscheinigen Stoff des Polsters, an dem Hundehaare klebten. Wo war Fritsche, der Dackel?
»Wenn sie kommen, setz ich mich da hin und verdeck dich«, flüsterte Lotte Dombröse. »Niemand kriegt dich zu sehen. Wir passen auf dich auf.«
Suse hörte den Hund aus der Küche winseln. Vielleicht war es dieses Geräusch, das sie aus ihrer Trance schreckte. Da oben in der Wohnung waren keine Bären aus Kindergeschichten, sondern ihre Eltern. »Ich muss nach Hause.« Sie riss sich los und rannte aus dem Zimmer, hörte Lotte schreien und ihren Mann mit heiserer Stimme rufen: »Großer Gott, doch nicht das arme Kind!«
Ohne sich umzudrehen, rannte sie durch den Flur, sah an der Wand ein Bild, das ein Trugbild sein musste, und stieß vor Schrecken den Schirmständer um. Gleich darauf vergaß sie es wieder und stürmte aus der Tür.
Nachbarn von oben und unten waren im Treppenhaus zusammengelaufen, hatten sich aus der Deckung gewagt und glotzten offen, ohne Scham. Ihre Gesichter wischten vorbei, die meisten bekannt, manche fremd. Wer in Berlin noch intakte Räume bewohnte, nahm ausgebombte Verwandte auf. Im Haus schienen doppelt so viele Leute zu wohnen wie vor Ausbruch des Krieges, aber wenn man nicht in den Luftschutzkeller ging, wenn man sich für sich hielt, bekam man wenig davon mit.
Anfangs, als feststand, dass er sich im Keller nicht mehr blicken lassen durfte, hatte der Vater Suse und die Mutter gedrängt, ohne ihn zu gehen: »Das kann ich nicht erlauben, Ilo, ihr dürft nicht meinetwegen euer Leben gefährden.«
Suse und die Mutter hatten ihm nicht zugehört, sondern Decken, Kissen, Bücher und Spielkarten unter den Küchentisch getragen, um sich für die Dauer des Alarms dort einzurichten. In der Sirene, der Zeitschrift, die der Reichsluftschutzbund verteilte, hatte gestanden: »Wenn Sie im Fall von Feindbeschuss Ihre Wohnung nicht rechtzeitig verlassen können, suchen Sie Schutz unter Treppen oder Möbelstücken.«
Einmal, als der Vater verzweifelt begonnen hatte, an der Mutter zu zerren, hatte diese sich ruhig umgedreht und zu ihm gesagt: »Lass den Unsinn, Volker. Entweder wir schaffen es alle, oder wir schaffen es nicht. In einer Welt, in der du nicht mehr bist, will ich auch nicht mehr sein, und unsere Suse wollen wir in solcher Welt ja wohl kaum zurücklassen.«
Danach hatte der Vater nichts mehr gesagt, und der Platz unter dem Küchentisch war ihr Luftschutzraum geworden. Die Hausgemeinschaft, in der Suse aufgewachsen war, hatte sich geteilt in Wir und die Anderen. Die Anderen – angeführt von Ilse Wernicke, die den Mann bei der SS und das Gehör in jedem Winkel hatte – standen jetzt da wie ein Pulk, durch den sich Suse ihren Weg bahnen musste. Sie wichen ihr nicht aus, machten ihr keinen Platz, sondern bewegten sich erst, als Suse sie mit den Ellbogen beiseitestieß. Der Blick von Frau Schmidtke traf sie, geradezu lechzend. Standen sie alle auf der anderen Seite, gab es außer den Dombröses niemanden mehr, dem sie trauen durften? Sie rannte die Stufen hinauf. Von den Gaffern kam keiner mit, nur die Blicke glaubte sie zu spüren, die sich in ihren Rücken bohrten.
Am Fuß der letzten Treppe sah sie die Tür ihrer Wohnung, die weit offen stand, und die Männer in schwarzen Mänteln, die davor warteten. Keine Hausbewohner, keine Ausgebombten.
Gestapo.
Woran man sie erkannte, hatte Suse niemand erklärt, doch es gab keinen Zweifel.
»Die sind zu anderen gekommen, die kommen irgendwann auch zu dir«, hatte Eugen gesagt, damals, als er Suse noch Groschen für Fassbrause gegeben hatte, damit sie keine langen Ohren machte. Suse war mit der Emaillekanne losgezogen, aber das, was aus dem Zimmer hallte, ließ sich auch mit kurzen Ohren nicht überhören.
»Glaubst du, dich verschonen die?«, hatte Eugen geschrien. »Weil du so nett mit deiner rosa Brille aus dem Wolkenkuckucksheim schaust?«
»Ich bin nur ein Lehrer«, hatte der Vater erwidert, obwohl er längst nicht mehr gelehrt, sondern auf dem Tisch in der Stube Lampenschirme geklebt hatte. »Warum sollten sie sich für einen kleinen Lehrer die Mühe machen?«
»Sag mal, bist du so blöd, oder tust du nur so?«, hatte Eugen gebrüllt. »Du verdammter Traumtänzer, denk wenigstens an Ilo und an das Kind, das du ihr unbedingt machen musstest!«
»Ich denke immer an die beiden. Ich habe Ilo mein Wort gegeben, dass ich die Familie nicht in Gefahr bringe.«
Suse hatte weiter nichts hören wollen und war zu Patzenhofer gelaufen. Sie wäre auch jetzt gern fortgelaufen, aber diese Möglichkeit gab es nicht. Ihre Schritte wurden schwer und steif, doch sie musste weitergehen. Auf die Männer zu, in ihre geschändete Höhle, zu dem zerbrochenen Stuhl, dem zerwühlten Bett und dem leeren Teller.
Einer von ihnen stand im Hausflur, ein Zweiter lehnte im Türrahmen und war nur zur Hälfte sichtbar. Sie waren nicht die Einzigen, dessen war Suse sich sicher. Stufe um Stufe näherte sie sich, und die Männer rührten sich nicht. Auch nicht, als sie den Absatz erreichte. Dem, der draußen stand, war sie schon so nah, dass ihr sein Geruch in die Nase stieg. Duft nach Leder und etwas Käsiges, das von der Haut stammte. Sie hätte nicht sagen können, ob er jung oder alt war, blond oder dunkel, ob er eine Brille oder einen Schnurrbart trug. Nur den Mantel sah sie. Schwarz, bis zur Wade. Sie wollte an ihm vorbei.
»Halt.« Der Arm schnellte wie eine Schranke vor Suse in die Höhe.
»Ich muss da rein.« Ihre Stimme klang fremd. »Ich bin Susanne Engel. Ich wohne hier.«
Der Mann nahm den Arm nicht weg. Der andere drehte den Kopf nach ihm. »Schwierigkeiten?«
»Ach, was.« Der Mann, der sie aufhielt, sprach, als schliefe er im Stehen ein.
Der andere sagte noch etwas, das Suse nicht verstand. Diese zwei hatten keine Bedeutung, sie standen nur Wache oder führten irgendein Protokoll. Es war wie bei den drei Bären: Die wirklichen Zerstörer waren tief in die Höhle eingedrungen, in die Küche, wo sich das Leben abspielte. In der Stube nahmen die Kisten mit den Arbeitsmaterialien des Vaters sämtlichen Platz ein, aber in der Küche standen die drei Betten der Familie Seite an Seite. Am Tisch reihten sich drei Stühle, und am Herd verteilte die Mutter Bratkartoffeln auf drei Teller.
Die Küche lag am Ende des Korridors, und in ihr Fenster fiel Licht, bis die Sonne verschwand. Das war schön, wenn man noch lesen wollte und keine Lampe eingeschaltet werden durfte. Von ihrem Platz aus konnte Suse hineinsehen, bis zum Herd, auf dem in der Pfanne etwas verkochte. In einer Säule, die oben zur Wolke zerfloss, stieg Qualm auf. Davor stand Tante Hille, der Verschwendung ein Graus war, und rührte keine Hand, um das Essen in der Pfanne zu retten.
Wie Suse befürchtet hatte, waren die Männer in die Höhle eingedrungen. Zwei standen im Korridor und hielten sich an der Wand. Der Dritte dagegen hatte sich im Eingang der Küche aufgebaut, vielleicht vier Schritte von Tante Hille entfernt. Wo sich ihre Eltern befanden, konnte Suse nicht sehen. Sicher saß ihr Vater mit Büchern und Schreibzeug am Tisch, und ihre Mutter stand oder lief herum, weil sie – wie Tante Hille sagte – Hummeln im Hintern hatte. Aber solange von ihnen nichts zu hören war, bestand Hoffnung, dass sie ausgegangen waren. Der Vater ging nie aus. Aber die Mutter besuchte manchmal Großmutter Konya oder traf sich mit ihr und ihrer Schwester in der Stadt. Vielleicht hatte sie dieses Mal den Vater mitgenommen, nur dieses eine, einzige Mal. Sie waren nicht hier. Nur die harmlose Tante Hille war hier, die sich an Vorschriften hielt und keinen Menschen störte.
Suses Gedanken klangen wie ein Gebet. Aus dem Teil der Küche, den sie nicht überblicken konnte, kam kein Geräusch, also war nicht auszuschließen, dass der Vater mit der Mutter gegangen war. Warum denn nicht? Vielleicht machten sie einen Spaziergang. Von hier bis Unter den Linden war es nicht mehr als eine halbe Stunde zu Fuß. Früher waren sie da oft hingegangen, im Café Kranzler einen Mokka trinken, wenn Hille auf Suse aufpasste, die Mutter eine Prinzessin in ihrem rosa Kleid und selbst der Vater flott, mit Stock und Hut – »Mach’s dir hübsch mit Tante Hillchen, Liebchen, bis zum Abendbrot sind wir wieder bei dir«.
Früher, früher, früher.
Das alles war so lange her, es war schon nicht mehr wahr. Das Kranzler war ausgebombt, und Unter den Linden waren die Eltern nicht mehr gewesen, seit die Sache mit Sido passiert war. Der Vater würde hier sein. Er war immer hier. Machte mit zerkautem Bleistift Notizen in seine Kladde, schlug in Büchern nach, ging nirgendwohin.
Der Qualm von den verbrennenden Kartoffeln quoll in Schwaden in den Korridor. Tante Hille drehte sich um und wollte die Pfanne vom Herd nehmen, doch der Gestapo-Mann herrschte sie an: »Stehen bleiben. Probier das noch mal, und es knallt.«
Tante Hille erstarrte, zog die Schultern hoch, machte sich klein.
Erst jetzt sah Suse, dass der Mann ein Stück Papier in der Hand hielt, einen abgerissenen Zettel, den er zwischen zwei Fingern baumeln ließ. »Was das ist, wollen wir wissen. Woher das kommt.«
Etwas regte sich im unsichtbaren Teil des Raumes, zu erkennen nur an dem Schatten, der über die Rauten der Bodenfliesen huschte. Tante Hille duckte den Kopf noch tiefer zwischen die Schultern. Ihre Lippen bewegten sich. »Nein, nein«, glaubte Suse zu hören. »Nein, nein, nein.«
Wieder zuckte der Schatten.
Die arme Tante Hille, die doch immer nur kam, um zu helfen, gab ein Wimmern von sich. Instinktiv wollte Suse zu ihr laufen, doch der Mann, der sie aufgehalten hatte, versetzte ihr einen Stoß, der sie zurücktaumeln ließ. Schmerz und Überrumpelung raubten ihr den Atem. Sie presste die Hände auf die Brüste, konnte nicht fassen, dass jemand ihr mit Absicht wehgetan hatte. Als sie ansetzte, um noch einmal zu versuchen, in die Wohnung zu gelangen, gerieten ihr die Schritte verzagt. Der Mann hob wieder den Arm, und sie blieb stehen wie von selbst.
Von Neuem sah sie durch den schmalen, lichtlosen Korridor bis in die Küche, wo jemand die Lampe eingeschaltet hatte. Tante Hille stand noch immer mit dem Rücken zum Herd. Etwas hinter ihr knackte. Vermutlich war mittlerweile alles Bratgut verkohlt, und die Glut fraß sich durch die Reste, um gleich darauf Flammen zu schlagen.
Der Gestapo-Mann wedelte noch einmal mit dem Zettel, dann öffnete er die Finger, sodass das Papier zu Boden segelte. Seltsam langsam, als hätte jemand die Zeit angedickt, damit sie nicht so schnell floss. In Tante Hilles Rücken knackte es noch einmal, und eine orangerote Lohe schoss durch den Qualm empor. Tante Hille drehte sich um, griff nach der Pfanne, wie sie es Hunderte von Malen getan hatte, und zog sie vom Gas.
Die Hand des Mannes fuhr in die Manteltasche und fischte etwas heraus. Im Licht der Flamme blitzte der Lauf der Pistole, der auf Tante Hilles Brust gerichtet war. Die fuhr herum, sah die Waffe und schlug die Hände vor den Mund. Vielleicht schrie jemand. Vielleicht war es Suse selbst.
»Ich habe das geschrieben!« Über die Bodendielen waberte im flackernden Licht ein Schatten, und die Stimme ihres Vaters klang wie aus Metall. »Das Blatt stammt von mir, und ich hab’s auch verteilt. Nur ich. Lassen Sie meine Familie aus dem Spiel.«
Der Schatten schoss ins Sichtfeld, und der Körper des Vaters folgte wie ein dunkler Blitz. Er packte Tante Hille von vorn, umfasste mit beiden Händen ihre Schultern und wollte sie zur Seite reißen, doch im selben Augenblick krachte der Schuss.
Suse sah sie fallen. Ganz langsam, als hätte jemand die Zeit angedickt, glitten sie am Herd hinunter. Tante Hilles schneeweißes Gesicht starrte Suse an, bis ihr Hinterkopf auf die Fliesen prallte und der Leib des Vaters sie unter sich begrub. Auch das Blut floss langsam. Es sickerte dem Vater über den Rücken, durchtränkte den Stoff seiner Hausjacke, und nur ein dünnes Rinnsal tropfte auf den Boden.
Wieder schrie jemand. Suse konnte es nicht sein, denn aus ihrer Kehle kam kein Laut. Stattdessen setzte in ihrem Kopf eine Melodie ein, das Pling-Pling einer Spieluhr, die sie am Tag ihrer Einschulung hier, in der Küche, auf den Boden geschleudert hatte.
»Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh?
Das sind die lieben Gänschen, die hab’n keine Schuh.«
»Die brauch ich nicht mehr. Ich bin jetzt ein großes Mädchen.«
»Und ob du das bist. Ein Schulmädchen. Wollen wir Gerti Sing-Gans in die Kiste auf den Hängeboden legen? Dann weißt du, wo sie ist, falls sie doch noch einmal für dich singen soll.«
»Die ist für Babys. Die soll nicht mehr für mich singen.«
»Dann vielleicht für mich, mein Schatz. Vielleicht einmal, wenn du auf deiner eigenen Straße unterwegs bist, für mich.«
Mit aller Kraft wünschte sich Suse, der Vater möge sich umdrehen, damit ihr Blick seinem Blick noch etwas sagen konnte. Aber er drehte sich nicht um. Durch das Zirpen der Kindermelodie drangen die Schreie der Mutter. Über die Fliesen, auf denen das Blut nur eine dünne Spur zog, rutschte sie auf Tante Hille und den Vater zu und warf sich über sie. Die graue Hausjacke, die an den Ellbogen dünn gescheuert war, hatte der Vater getragen, solange Suse denken konnte.
Erster Teil
April 1928
»Dass ich dich lieb hab,
Wird es zu lesen sein,
In Blätter gestanzt,
Ins Meer gepflanzt,
In den Wind geschrieben?«
Inge Müller
1
Der Vorhang war nachtblau und von vorn betrachtet übersät mit goldenen, wie frisch am Himmel aufgezogenen Sternen. Von hinten, von der Bühne aus gesehen, ließ sich jedoch erkennen, wie die Goldfäden der Sterne vernäht worden waren, und damit verpuffte der himmlische Effekt.
Das ist es, was mit mir nicht stimmt, dachte Ilo. Mir fällt immer auf, wie die Dinge von hinten aussehen, und prompt ist der Hokuspokus verpufft. Als Kind war sie mit Maman und Marika in einer magischen Nummer im Chat Noir aufgetreten. Ohne Absicht war sie vor den Tisch getreten, auf dem der Zylinder des Magiers stand, hatte an einer Lade im Boden des Hutes gerüttelt, und herausgesprungen war das weiße Kaninchen.
»Dieses Kind ist eine wandelnde Entzauberung«, hatte Maman gestöhnt, und das traf vermutlich den Nagel auf den Kopf. Von den Goldsternen des Wintergartens, die auch an der blauen Glaskuppel wie am nächtlichen Firmament prangten, schwärmte das Tageblatt wie die Volks-Zeitung. Auf der Terrasse, wo Speisen serviert wurden und der billigste Platz sechs Mark kostete, drängten sich die Besucher, und selbst die Stehplätze im Entree waren morgens wie abends ausverkauft. Die Berliner liebten das Theater unter dem Sternenhimmel, es gehörte zu den gefeierten Bühnen Europas, und Schauspieler, Sänger, Tänzer, Artisten, kurz Gaukler jeder Couleur rissen sich darum, hier aufzutreten. Gewiss war Ilo die Einzige, die sich vor ihrer ersten Vorstellung gewundert hatte, warum man eine gläserne Kuppel, die Sternenlicht in den Saal hätte strömen lassen, mit Platten vernagelte, um künstliche Sterne aus Glühbirnen an die Decke zu hängen.
Daran gab es ja nichts zu wundern. Echte Sterne waren einfach unzuverlässig, und zur Matinee konnte man sie gleich ganz vergessen.
Der Vorhang hob sich wieder, und der Lichtstrahl des Schwenk-Scheinwerfers traf Ilos Gesicht. Wie auf ein Zeichen nahm sie den Rock ihres Kleides links und rechts beim Saum und vollführte mit zierlich gekreuzten Fesseln einen Knicks. Der Applaus toste in Wellen, wurde leiser, als der Vorhang sich senkte, ebbte aber nicht ab. Wenn das Publikum ein weiteres Heben forderte, würde Ilo nicht drum herumkommen, ihnen eine Zugabe zu bieten. Hinter der blauen Wand riefen Leute zu rhythmischem Klatschen ihren Namen: »Ilo Konya, Ilo Konya!«
»Du bist ein Glückskind, weißt du das?« Sidonie, ihre Freundin, die im Hintergrund mit drei aprikosenfarbenen Zwergpudeln auftrat, obwohl sie Hunde nicht ausstehen konnte, schnitt eine Grimasse. »Mit dem Silberlöffel im Mund geboren bist du, nach dir schreien sie sich die Hälse rau, während sie sich von unsereiner nicht mal den Namen merken.«
»Das stimmt doch nicht«, sagte Ilo, wusste aber, dass es doch stimmte. Ihr war in den Schoß gefallen, wofür Mädchen wie Sidonie kämpften. Ihre Mutter entstammte einer eingefleischten Theaterfamilie und war selbst ein gefeierter Revuestar, ihr Vater ein Fabrikant von Schiffsturbinen, der für die Welt der Bühne schwärmte. Sie hatte mit vier ihre erste Tanzstunde erhalten, war mit fünf zum ersten Mal aufgetreten und hatte mit sieben, kurz vor Ausbruch des Krieges, an Maria Moissis Schauspielschule eine Ausbildung begonnen. Jetzt – mit zweiundzwanzig – bestritt sie die Zugnummer der Matinee im Wintergarten, und am Abend trat sie mit Mutter und Schwester in Hollaenders Kabarett-Revue im Großen Schauspielhaus auf.
Die drei Konyas. Sie waren angesagt, beliebt, konnten sich vor Engagements nicht retten.
Die Wohnung, die die Familie im feinsten Teil Charlottenburgs bewohnte, erstreckte sich über zwei Stockwerke und die Bodenkammern fürs Personal. Bald wöchentlich fuhr Maman mit beiden Töchtern zum Hausvogteiplatz, um sie bei den Meistern der Haute Couture rundherum einzukleiden. Sie hatten keine Sorgen, hatten sogar die Inflation überstanden, ohne auf Trinkschokolade, Champagner, Südfrüchte und Leberpastete zu verzichten, während andere ihren Wochenverdienst auf Karren durch die Stadt gezogen und gegen ein Brot getauscht hatten. Eugen, der Agent, der alle Konya-Frauen betreute und mit ihnen als Conférencier auftrat, arrangierte derzeit für Ilo ihren ersten Film.
Und wenn ich müde bin?, durchfuhr es Ilo.
Wie Mamans Antwort darauf ausgefallen wäre, hätte sie auswendig vorbeten können: »Du bist zu jung, um müde zu sein. In deinem Alter hat man Energie genug, um Bäume auszureißen.«
Ilo mochte Bäume gern. Wenn sie die schmächtigen umzäunten Linden auf Berlins Prachtboulevard sah, wünschte sie sich ein Blechkännchen Wasser, um sie zu gießen.
Der Applaus schwoll wieder an, und die Bühnenarbeiter schickten sich an, die Sternennacht des Vorhangs noch einmal in die Höhe zu kurbeln. Willi Brandeis, der im Orchestergraben das Ensemble dirigierte, tauchte unter dem Saum am Bühnenrand auf. »Was willst du singen, Püppchen? Märchen aus der Puszta?«
Ilo nickte. Ihr war das eine so recht wie das andere, sie probte täglich und war auf alle Stücke aus ihrem Repertoire mustergültig vorbereitet. »Talent ist etwas, auf das die Schwätzer von der Presse fliegen«, behauptete Maman. »Dass Erfolg in unserem Beruf zu neunzig Prozent auf Schweiß und knochenharter Arbeit beruht, das macht sich nicht gut auf deren Hochglanzseiten.«
Mit kaum hörbarem Rauschen glitt der Vorhang in die Höhe, und Ilo stellte sich in Positur. Sie legte den Kopf leicht schräg und senkte die Lider, wie es Maria Moissi zufolge einer ungarischen Schönheit zukam, die von ihrer fernen Heimat träumte. Das Lied war ursprünglich für Ilos Schwester Marika geschrieben worden, die über kräftigere Farben und üppigere Formen verfügte, wie sie in den Köpfen der Leute zu einer Ungarin gehörten. Da sie damit jedoch erfolglos geblieben war und Eugen die lasziv-sentimentale Weise zu schade zum Wegschmeißen fand, hatte er sie kurzerhand Ilo vererbt.
Die stand blass, blond und rosa vor dem Orchestergraben und begann zu singen, sobald der letzte zerschmelzende Ton des Geigenvorspiels verklungen war. Wie die Versammelten den Atem anhielten, konnte sie förmlich hören. Am Abend kamen alle möglichen Leute ins Varieté – Touristen, Nachtschwärmer, Geschäftsleute auf der Durchreise und junge Männer auf Brautschau. In der Matinee aber saßen ihre hartgesottenen Verehrer, die, die sich eigens frei nahmen oder von weit her anreisten, um sie zu sehen.
»Bei der jüngsten Konya ballt sich das ungarische Erbe allein in der Stimme«, schrieben die paar Kritiker, die die leichte Muse nicht als unter ihrer Würde erachteten. »Dem zarten Persönchen traut man die Puszta nicht zu, doch in der Kehle brodelt pure Paprika.«
Was Unsinn war. Wie so vieles. Das beschworene ungarische Erbe der Konya-Geschwister stammte vom Vater, dem Schiffsturbinen-Fabrikanten, dessen Wurzeln ins kaiserlich-königliche Budapest reichten. Von ihm hatte Ilo den zarten Bau und das helle Haar. Ihre Mutter hingegen, von der die brachiale, in Ilos fragilem Körper so verblüffende Stimmgewalt stammte, war ein waschechtes Berliner Theaterkind. Im Quintett mit ihren Cousinen war sie allabendlich im Apollo-Theater aufgetreten, bis das Kino dem Apollo und dann der Krieg der ganzen Epoche die Luft abgedrückt hatte. Kein Tropfen Blut in ihren Adern war ungarisch, aber die Leute brauchten nur schwarzes Haar und glutvolle Augen zu sehen, schon hatten sie sich ihren Reim gemacht.
»In der großen Stadt
Bewundern sie meine Schönheit
Und lassen mich kalt.
Doch in der Ferne, in der Weite der Puszta,
Wartet einer, den ich nie vergesse.«
Ilo sang das Lied zu Ende, vollführte ihren artigen Knicks und sandte unartige Blicke ins Publikum. Wie das funktionierte, hatte Maria Moissi, Berlins begehrteste Schauspiellehrerin, ihr beigebracht, und Maman hatte es unterfüttert: »Das ist es, was Männer wollen, Schätzelchen. Und es sind Männer, die das Geld in den Westentaschen haben, die Eintrittskarten kaufen, die Champagner bestellen. Was es zu bedeuten hat, brauchst du kleine Unschuld vom Lande nicht zu wissen, solange du weißt, wie man es macht.«
Ilo war nicht vom Lande, und dass man in Berlin am Theater aufwachsen und eine Unschuld bleiben konnte, bezweifelte sie. Wenn ein Spielleiter zu ihr sagte: »Schau mal ein bisschen dreckiger drein«, dann wusste sie, dass das Dreinschauen nicht nur mit den Augen, sondern ebenso mit den Beinen stattzufinden hatte, dass eins aus dem Schlitz im Kleid gestreckt werden musste, während die Wimpern plinkerten. Aber vielleicht hatte die Mutter ja doch recht, und Ilo hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Sie hätte zum Beispiel nicht zu sagen vermocht, was Männer an ausgestreckten Mädchenbeinen in Netzstrümpfen so aufregend fanden. Von künstlichen Wimpern, die beim Augenschließen ein Geräusch zu machen schienen, ganz zu schweigen.
Sie wusste auch nicht, wo und wie die Puszta war, ob es dort hübsch war oder grässlich, und wie es sich anfühlte, einen Mann zu kennen, den man nie vergaß. Es war nicht ihre Aufgabe, das zu wissen, sondern nur, den Zuschauern das Gefühl zu geben, es wisse niemand so tief, so schmerzlich und allumfassend wie sie.
Der Applaus prasselte auf Ilo nieder wie ein Regenguss. Draußen aber war Sonne, ein Frühlingsmorgen, und auf einmal verspürte sie einen wilden Drang, der künstlichen Nacht zu entkommen und in die Helligkeit des Tages zu fliehen. Sie drehte sich um, noch ehe der Saum des Vorhangs den Boden erreichte, und rannte über die Bühne davon.
Sidonie klebte sich an ihre Fersen. »He, he, was hast du’s denn so eilig, du weißt doch noch gar nicht, ob du fertig bist.«
»Ach, sei’s drum. Es wird schon keiner dran sterben, wenn ich’s ausnahmsweise bei der einen Zugabe belasse.«
»Was ist denn los mit dir?« Vor der Tür der Garderobe, die sie sich teilten, blieben die beiden stehen.
»Nichts.«
»Erzähl keinen Quatsch.« Sidonie sperrte die Tür auf, ohne Ilo aus den Augen zu lassen. »Ich habe heute schon mindestens drei Witze gerissen, über die du nicht gelacht hast, und das kommt mir spanisch vor, das bist nicht du.«
Ilo gab sich geschlagen. Sidonie war ihre Freundin seit den Tagen bei Maria Moissi. Sie hatten dieselben Erfahrungen, auch solche, die sich nicht in Worte fassen ließen, und wenn jemand Ilo kannte, dann Sido. Sie selbst war sich ein Rätsel, und manchmal fragte sie sich, ob es überhaupt etwas an ihr zu kennen gab.
»Ich weiß es doch auch nicht«, sagte sie. »Mir geht heute alles auf die Nerven, ich kann diesen blöden Vorhang und die grinsenden Gesichter dahinter nicht mehr sehen.«
»Deine Probleme möcht ich haben.« Sido winkte die Garderobefrau, die herbeigeeilt kam, um Ilo zu helfen, zurück. »Ist schon gut, Selma, wir wursteln uns heute mal allein durch.« Dann schob sie Ilo in die Garderobe, folgte und verriegelte hinter ihnen die Tür. »Du bist ziemlich undankbar. Aber das weißt du selber, richtig?«
Ilo nickte. Ihr Blick wanderte durch den Raum. Vorhin, als sie die Garderobe verlassen hatte, hatte auf ihrem Schminktisch ein einziges Durcheinander geherrscht. Jetzt lag alles wohlgeordnet, jeder Augenbrauenstift an seinem Platz und Ilos private Habe – ein vormals zerknülltes Taschentuch, ein Etui mit Visitenkarten und ein Textbuch – säuberlich gestapelt in einem Korb. Sogar das Fenster war geöffnet worden, um den tranigen Geruch der Schminke zu vertreiben. Um diese Dinge kümmerte sich Selma, auf deren Einstellung Eugen eigens deshalb bestanden hatte. »Ich will, dass du dich auf deine Laufbahn konzentrierst«, hatte er zu Ilo gesagt. »Alles andere wird für dich erledigt, das lass meine Sorge sein.«
Ilo ließ sich auf den Stuhl vor dem Schminktisch fallen. Aus dem Spiegel sahen ihr blassblaue Augen entgegen, die ihr riesig vorkamen und nicht ihr gehören konnten. Kein normaler Mensch hatte derart gigantische Augen und keine blasse, blonde Berlinerin so schwarze Wimpern. Ihre Maskenbildnerin Mine, die ebenfalls Eugen aufgetrieben hatte, hätte aus einer afrikanischen Greisin einen jungfrischen Eskimo machen können.
Wenn mir mein von Mine geschminktes Gesicht verloren gehen und es im Fundbüro abgegeben werden würde, würde ich es nicht finden, durchfuhr es Ilo. Es würde dort liegen bleiben, und niemand würde es als das seine erkennen und mit nach Hause nehmen. »Ich glaube, bei mir tickt es heute wirklich nicht richtig«, sagte sie zu Sido.
»Das tut es allerdings nicht«, erwiderte diese und schenkte ihnen aus einer Kristallkaraffe Wasser, Eis und Zitronenschnitze in zwei Gläser. »Wenn du nicht aus unerfindlichen Gründen meine spezielle Freundin wärst, könnte ich es ziemlich schwer erträglich finden, mir dein Gejammer anzuhören. Du wirst ein Star, Ilo. Oder nein, du bist schon einer, du bist eine von diesen Knospen, die gar nicht mehr zu platzen bräuchten. Du hast alles, wovon ich träume und was ich nicht bekommen kann.«
»Natürlich kannst du es bekommen«, sagte Ilo, wollte nett sein und kam sich verlogen vor. »In der Eleganten Welt hat gestanden, du bist hübscher als ich.«
»Aha.« Sido setzte sich an ihren Schminktisch und begann, sich das dichte, kinnkurz geschnittene Haar auszubürsten. »Deshalb muss ich mit kläffenden Flohteppichen Ringelreihen spielen, während sich nach dir die halbe Stadt verschmachtet, sobald du den Mund aufmachst und deine Schnulze trällerst. Wen kratzt es da noch, was in der Eleganten Welt steht? Und seit wann liest du eigentlich die Elegante Welt, seit wann liest du überhaupt eine Zeitung?«
»Ich hab’s nicht gelesen«, gestand Ilo. »Meine Mutter hat es vor ein paar Tagen beim Frühstück entdeckt und sich schrecklich darüber aufgeregt. Ich dachte, sie reißt Eugen den Kopf ab.«
»Und Eugen?« Sidos Stimme bekam etwas Lauerndes.
Ilo zuckte die Schultern. »Hat sich nicht viel daraus gemacht. Du kennst ihn doch.«
»Allerdings, das tue ich, und deshalb brauchst du dir für mich nichts aus den Fingern zu saugen. Also, was hat Eugen gesagt? Dass er den Fritzen von der Eleganten Welt eigens instruiert hat, dieses Zeug zu schreiben, weil im glorreichen zehnten Jahr der Republik nach Mädchen, die hübsch sind, kein Hahn mehr kräht?«
Das traf beinahe wortwörtlich zu. Sido kannte nicht nur Ilo, sie kannte auch Eugen, der für Ilo ein Buch mit sieben Siegeln war. Sie verstand sich auf Menschen, war nicht nur hübscher, sondern auch klüger als Ilo und hätte das verdient, was Ilo besaß. Nur war ihre Mutter eben kein gefeierter Revuestar, sondern eine vermögenslose Hausfrau, die ihrer Tochter ein glamouröseres Leben gegönnt hatte, und ihr Vater war kein Fabrikant von Schiffsschrauben, sondern Kassierer in einer Bank gewesen, ehe er sich in den Krieg gemeldet hatte und vor Ypern gefallen war. Ihre Mutter hatte in einem Kinderheim Wäsche gewaschen und sich die Butter vom Brot gekratzt, um ihrer Tochter den Unterricht bei Maria Moissi zu bezahlen. Ein Jahr nach Kriegsende war sie mit den Zahlungen jedoch so weit ins Hintertreffen geraten, dass die Moissi Sidonie vor die Tür gesetzt hatte.
»Wirf das Handtuch, Mädchen. Weiter als bis zur Komischen Alten bringst du’s ohnehin nicht, und für die hast du nicht das richtige Gesicht.«
Die meisten hätten das Handtuch geworfen. Sidonie Teitelbaum warf keines, sondern biss sich durch. Sie war vierzehn gewesen, kaum zwei Jahre älter als Ilo, aber sie hatte ihr Leben wie eine Erwachsene angepackt. Hatte sich bei einer der unzähligen Kleinkunstbühnen ein Engagement besorgt, der Mutter unter die Arme gegriffen und sich in dem bisschen Zeit, die ihr blieb, beigebracht, was immer ihr von Nutzen schien, vom Bauchreden bis zur Hundedressur. Wenn an dem, was Ilos Mutter redete, etwas Wahres war, wenn Erfolg auf Schweiß und harter Arbeit beruhte, hätte Sido auf dem Gipfel stehen müssen.
Aber auf dem stand sie nicht. Statt ihrer erklomm Ilo den Gipfel, die nicht einmal sicher war, ob sie sich etwas daraus machte. Dass die arme Sido den Sprung an die großen Häuser schließlich geschafft hatte, verdankte sie der Tatsache, dass Eugen fand, sie bilde zu Ilo einen nützlichen Kontrast. »Wer vorn Erregung bieten will, braucht im Hintergrund Ruhe, etwas Angenehmes für die Augen, das weder ablenkt noch stört.«
Sido band sich ihr knisterndes, glänzendes Haar aus dem Gesicht, zog einen Tiegel mit Fett heran und langte hinein, um sich abzuschminken. Ilo sah ihr zu, erfasste ihr beinahe klassisches Profil mit der kleinen, geraden Nase, die runden Schultern, den harmonischen, einladend weiblichen Körper, den Sido mit täglichem Turnen geschmeidig hielt. Ob die Zeitungsleute nun von Eugen instruiert waren oder nicht, sie hatten recht, Sidonie war hübsch, sie war rundherum entzückend, und es war kein bisschen fair, dass Frauen wie sie über Nacht nicht länger en vogue waren.
»Das ist nicht über Nacht passiert«, hatte Eugen widersprochen. »Schon nach dem Krieg hat keiner mehr die braven Töchterchen mit ihren überfütterten Mutterschößen sehen wollen.« Nach dem Krieg war Eugen achtzehn gewesen, aber Ilo bezweifelte nicht, dass er bereits damals alles gewusst hatte, was sich zu wissen lohnte. »Und nach der Inflation erst recht nicht. Die Frau der Endzwanziger ist mager und morbide, sie ist der Sex, der vom Tod weiß und daran zugrunde geht. Sie sieht aus wie ein Mann und schlägt sich wie einer, aber dass sie, wenn die Lichter ausgehen, keiner ist, macht sie unwiderstehlich.«
»Es tut mir leid«, murmelte Ilo.
»Muss es nicht«, erwiderte Sido und setzte ihrem linken Auge brutal mit einem fettgetränkten Wattebausch zu. Bläuliche Farbe troff ihre Wange hinunter, als hätte sie sich die Tränen gefärbt. »Auch wenn es mir manchmal schwerfällt, es zu glauben – es ist nicht deine Schuld.«
An der Tür klopfte es.
»Nein, danke, Selma, wir kommen zurecht«, rief Ilo.
Durch das Holz der Tür war ein Gemurmel zu hören, dann klopfte es erneut, diesmal schärfer.
»Das ist nicht Selma, sondern Eugen«, sagte Sido, rieb sich mit wütender Hast die Wange sauber und warf den Wattebausch auf den Tisch.
Ilo stand auf und ging zur Tür, doch statt sie zu öffnen, prüfte sie, dass der Riegel vorgeschoben war. Dabei bestand daran kein Zweifel. Wäre die Tür nicht verriegelt gewesen, hätte Eugen nicht gezögert, sie zu öffnen.
»Bist du da drinnen eingeschlafen, Ilona? Ich würde so langsam gern fahren, mir hängt der Magen in den Kniekehlen.«
»Fahr ohne mich«, sagte Ilo.
»Und was sollen bitte die Sperenzchen? Wir haben dafür keine Zeit, deine Mutter erwartet uns in diesem neuen Palast der Gigantomanie, wo sie um jeden Preis ein Restaurant ausprobieren möchte, das ihr bei ihrem Coiffeur als entzüüückend angepriesen worden ist.«
Er sprach das »ü« spitz aus und zog es in die Länge. Warum Ilo beim Ausprobieren des entzückenden Restaurants zwingend dabei sein musste, erklärte er nicht. Er erklärte so etwas nie, und niemand fragte danach. Ilo schon gar nicht.
»Ich komme nach«, sagte sie. »Zu Fuß. Sind ja nur ein paar Schritte.«
»Das halte ich für keine gute Idee. Vor der Tür lauern die Geier, und du hast keine Ahnung, mit wem du sprechen darfst und mit wem nicht.«
»Dann spreche ich eben mit gar keinem. Ich bitte dich, Eugen. Mir rauscht der Kopf, ich brauche ein bisschen frische Luft.«
»Kopfschmerzen?« Eugens Tonfall schlug um. »Du brütest doch wohl nichts aus, wir haben am Montag den Termin bei der UFA.«
»Nein, keine Sorge«, versicherte Ilo hastig. »Mit mir ist alles in Ordnung, ich will mir nur ein bisschen die Beine vertreten.«
»Wirklich?«
Ilo nickte, was Eugen nicht sehen konnte.
»Dann geh in drei Teufels Namen zu Fuß«, sagte er. »Aber beeil dich, nicht, dass deine Mutter mir die Hölle heiß macht und ich dich am Ende suchen muss.«
»Bestimmt nicht«, versprach Ilo. Ihre Mutter würde Eugen nicht die Hölle heiß machen – allen Menschen, die in der Stadt herumliefen, vom Briefträger bis zur Kostümbildnerin, aber nie im Leben Eugen.
»Wir sehen uns dann gleich in diesem Haus Vaterland. Das Restaurant heißt Csárdás.«
»Ja, danke. Bis gleich.«
»Wir bestellen schon die Entrees.«
»Für mich nur etwas Leichtes bitte. Suppe und Kompott genügt.«
Er brummte noch etwas darüber, dass sie vernünftig zu essen und ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten hatte, und würde Ilo ganz bestimmt nicht nur Suppe und Kompott bestellen, aber immerhin ging er. Es war nicht so, dass Ilo nicht mit ihm zusammen sein wollte. Sie war so gut wie immer mit ihm zusammen, und daran gab es nichts auszusetzen, nur verspürte sie heute aus heiterem Himmel diesen Wunsch, allein zu sein.
Aus dem Spiegel starrten sie noch immer die grotesk vergrößerten Augen an. »Vielleicht beneide ich dich ja genauso wie du mich«, entfuhr es ihr.
»Du mich?« Sido drehte sich nicht nach ihr um, sondern betrachtete ebenfalls ihr Spiegelbild.
»Du träumst von dem, was ich habe«, sagte Ilo. »Aber mir fällt nicht einmal etwas ein, von dem ich träumen könnte.«
»Ist das dein Ernst?« Jetzt drehte Sido sich doch um, und Ilo tat es ihr nach, und ihre Blicke trafen sich.
Ilo nickte. »Du solltest der Star der Revue sein, nicht ich. Du liebst das alles hier, während ich mir nicht einmal sicher bin, ob ich es mag.«
Sido sah sich in der Garderobe um, ließ den Blick über die Fotografien an den Wänden schweifen, die Publikumslieblinge des Wintergartens zeigten, und starrte dann wieder auf die Schminkutensilien vor ihr auf dem Tisch.
»Ja«, sagte sie endlich, »ich liebe das alles. Schon wenn ich ins Theater komme und dieser Duft nach Schweiß und Staub und Farbe mir entgegenschlägt, geht mir das Herz wie ein Pumpenschwengel, wenn ich dieses Geraschel aus den Kulissen höre, das Gewisper aus dem Souffleurkasten, das Schrammeln aus dem Graben, wo das Orchester seine Instrumente stimmt. Ich liebe die Aufregung, wenn der Vorhang sich hebt, die selbst nach Jahren nicht vergeht. Im Scheinwerferlicht glänzt selbst der Staub, und jedes Mal wartet eine neue Chance, jedes Mal bricht dieser Gedanke sich Bahn: Werde ich heute über mich hinauswachsen? Werde ich heute eine Sekunde lang nicht mehr die langweilige Sido aus Schlorendorf sein, sondern eine Zauberin, eine Heldin – werde ich eine Sekunde lang etwas tun, das mich zu den Sternen erhebt?«
»Ach, Sido!« Ilo stand auf, trat hinter die Freundin und hängte ihr die Arme um den Hals. »Ich wünschte wirklich, das alles, was ich habe, hättest du. Wenn du davon sprichst, komme ich mir furchtbar schäbig vor, weil ich es nicht zu schätzen weiß.«
Leise lachte Sido auf, schob einen Ärmel von Ilos rosa Kleid über den Ellbogen hoch und kitzelte sie in der Armbeuge. »You’re my special girlfriend.« Das war aus einem Lied, das sie zusammen gesungen hatten, bis Eugen befunden hatte, Ilo solle es alleine singen und Sido nur noch im Hintergrund mit Pudeln hampeln. Sie sagten es sich trotzdem noch oft: Du bist meine besondere Freundin.
»Manchmal frage ich mich das auch«, fuhr Sido fort und kitzelte Ilo. »Warum bekommt nicht der ein Geschenk, der es sich am meisten wünscht, warum wird das Schönste, das uns das Leben zu bieten hat, wahllos verstreut, egal, ob der, in dessen Schoß es landet, es überhaupt brauchen kann? Und dabei denke ich nicht einmal an deine Laufbahn am Theater, weil ich auf die verzichten kann, selbst wenn es mich ab und zu wurmt. Der Griff nach den Sternen ist eben für mich nicht gemacht, die Moissi hatte schon recht, mehr als die Komische Alte steckt nicht in mir. Und solange man mich die spielen lässt und mir meinen Appel und mein Ei dafür zahlt, bin ich im Grunde recht glücklich damit.«
Und genau darum beneide ich dich, stellte Ilo fest. Sie selbst war nicht unglücklich. Warum auch? Sie wurde umsorgt, gehätschelt, umschwärmt, Menschen wie Selma waren eigens abgestellt, um ihr jeden Wunsch von den Augen abzulesen, und vor dem Bühnenausgang wartete eine Traube aus Männern, die sich darum rissen, dasselbe zu tun. Am Theater sagte man ihr eine glorreiche Zukunft voraus, und über das, was die Leinwand für sie in petto hielt, kursierten wilde Spekulationen. Die Tage des Stummfilms waren gezählt, und wenn sich der brandneue Ton erst überall durchgesetzt hatte, mochte ihre Stimme einen Siegeszug um die Welt antreten.
So sagte es Eugen.
So sagten es ihr Gesanglehrer, ihr Abendspielleiter und manchmal, wenn sie gut aufgelegt war, sogar ihre Mutter. Sie war gar nicht so selten gut aufgelegt mit Ilo, es war Marika, an der sie ständig etwas herumzunörgeln hatte.
»Und womit bist du nicht glücklich?«, fragte sie Sido. »Was ist das Schönste, das dir das Leben zu bieten hat und das in meinen Schoß nicht hätte fallen sollen?«
»Das weißt du doch.«
Ja, Ilo fürchtete, es zu wissen, und doch wollte sie es Sido sagen hören, weil es sonst so schwer zu glauben war.
»Eugen«, sagte Sido. »Dass der Kerl, für den ich die ewige Seligkeit hinschenken würde, meine beste Freundin liebt, ist nicht so leicht zu schlucken.«
»Gibt’s die denn, die ewige Seligkeit?«
»Keine Ahnung. Ich würde auch die unewige hinschenken.«
»Und Eugen liebt mich nicht. Eugen liebt niemanden.«
»In der Illustrierten steht, eure Verlobung stünde unmittelbar bevor.«
»Ja, das steht da. Eugen fand, es wäre an der Zeit …«
»Ihn zu heiraten?«
»Nein, mich privat ein bisschen interessanter zu machen, Klatsch und Tratsch ins Spiel zu bringen, Gerüchte zu streuen.«
»Das heißt, ihr heiratet gar nicht?«
Ilo zuckte zusammen und musste lachen, obwohl sie nichts komisch fand. »Gott bewahre. Nein. Eugen meint, eine Heirat wäre der Todesstoß für meine Karriere. Gerede soll’s geben. Aber bloß keinen Nagel mit Kopf.«
»Und du bist damit zufrieden?«
Ilo zuckte die Schultern. »Was verstehe ich denn davon? Eugen wird dafür bezahlt, dass er mich berät, also halte ich mich an seinen Rat.«
»Das meinte ich nicht«, sagte Sido.
»Was dann?«
»Wenn ich Eugen heiraten könnte, wäre mir ziemlich egal, ob das der Todesstoß für meine Karriere wäre. Ich würde ihn heiraten und wäre vermutlich eine ganze Weile lang nicht mehr als ein schmachtendes kleines Frauchen, das an nichts anderes denkt als ihren Mann und vor lauter Glück nicht zu ertragen ist. Aber ich habe ja auch keine Karriere, die der Rede wert wäre, und werde irgendwann einen Mann brauchen, der mich versorgt. Du hingegen könntest problemlos einen Mann versorgen, aber auf dein Geld hat Eugen es nicht abgesehen. Er mag mit leeren Taschen geboren sein, aber er ist ja auf dem besten Weg, das zu ändern.«
Abrupt stand Ilo auf. Plötzlich war sie sicher, nicht länger zu ertragen, wie Sido von Eugen sprach. Außerdem schmolz ihre Zeit wie eine Kugel Vanilleeis in der Waffel, ihr mühsam erkämpftes bisschen Zeit in der Frühlingssonne. »Ich muss gehen«, sagte sie zu Sido. »Die anderen warten mit dem Essen auf mich, und meine Mutter bekommt schlechte Laune, wenn man sie warten lässt.«
Sido sagte nichts.
Unschlüssig trat Ilo von einem Fuß auf den andern, suchte auf dem Tisch nach ihrer Tasche, um festzustellen, dass sie sie schon unter dem Arm trug. »Ich sollte dich fragen, ob du nicht mitkommen willst, aber …«
»Aber du hast keine Lust dazu«, fiel ihr Sido ins Wort. »Ist schon gut, zieh los und genieße, was immer du dir in den Kopf gesetzt hast. Um die gute alte Sidonie mach dir keine Sorgen. Die versteht das. Dazu ist sie doch da.«
2
Vor dem Bühnenausgang lauerte eine Traube aus Verehrern und Zeitungsreportern und versperrte Ilo den Weg.
»Ich begleite Sie, Fräulein Konya.«
»Lassen Sie mich ein Taxi für Sie rufen.«
»Was halten Sie von Mittagessen im Adlon? Der neue Fischkoch dort ist ein Meister, dem gelingen die Seezungen so zart, dass sie mich an die Fesseln Ihrer Füßchen denken machen.«
Ilo gab sich alle Mühe, ihr schüchternes Mädchenlächeln aufzusetzen, bedauernd Worte der Ablehnung zu hauchen und sich dabei ihren Weg zu bahnen. Zwar gelang es ihr, sich an den Männern, von denen mehrere mit blitzgewitternden Kameras auf sie zielten, vorbeizuschieben, aber abschütteln ließ sich die Meute nicht. Sie folgte ihr wie ein Kometenschweif und bombardierte sie ohne Pause mit immer gleichem Gesäusel:
»Sie sehen heute entzückend aus, Fräulein Konya.«
»Sie sehen immer entzückend aus.«
»Sie werden entzückend aussehen, solange Sie leben, und ich werde sterben, wenn Sie morgen nicht mit mir ausgehen.«
Ilo hastete die Friedrichstraße hinunter, schlug Haken und Bögen, um dem entgegenkommenden Strom von Passanten auszuweichen. Das Heer ihrer Verfolger wurde sie damit nicht los. Es klebte an ihren Fersen wie ein Bündel Schatten, vollzog jede ihrer Bewegungen mit und verfiel keinen Atemzug lang in Schweigen. Vom Summen und Singen der Straße, auf das sie sich gefreut hatte, bekam sie nichts mit. Sie sah das Gewirr, die Energie, mit der alles in der großen Stadt vorwärts strebte, die hastenden Leute, die sich schlängelnden Radfahrer, die Automobile, Busse und Straßenbahnen, aber sie hörte sie nicht, weil die Wortsalven, die die Männer von hinten auf sie abfeuerten, alles übertönten.
Als sie in den Prachtboulevard Unter den Linden einbog, überkam sie eine Traurigkeit, wie sie sie nie gekannt hatte. In Friedrich Hollaenders Kabarett-Revue Bei uns um die Gedächtniskirche rum spielte sie die mit Spreewasser getaufte Berliner Göre, besang Charme und Chuzpe der Hauptstadt und hatte in Wahrheit doch von Berlin so wenig Ahnung wie von der Weite der Puszta und unvergesslichen Männern. Sie war nie am Wannsee baden gegangen, hatte sich nie ans Schaufenster eines Kaffeehauses gesetzt, um Zeit zu vertrödeln und Passanten zuzuschauen, war nie durch das Gewimmel der Straßen geschlendert, ohne ein Ziel zu haben, einen Termin, der schon drängte.
Allabendlich sang sie in schwärmerischen Tönen:
»Berlin, du bist meen Liebeslied,
Mal Dur und ooch mal Moll«
Doch in Wahrheit kannte sie Berlins Lied überhaupt nicht, hatte nie gehört, wie die Stadt es vor sich hin summte, geschweige denn dazu getanzt. Auf der Straßenterrasse vor dem Café Kranzler saßen Leute in der Sonne, genossen Getränke und Tortenstücke, ließen den lieben Gott einen guten Mann sein. Im Vorbeilaufen sah Ilo eine Frau, die in ihrem Alter sein musste, jedoch vor ihrer Kaffeetasse, allein an ihrem Tisch, so viel älter, reifer und lebendiger wirkte.