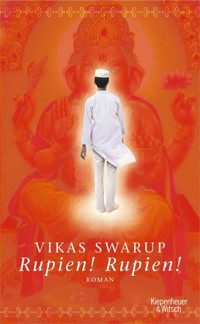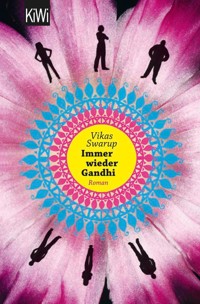9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von der Verkäuferin zur Leiterin eines Imperiums – die mitreißende Geschichte eines märchenhaften Aufstiegs Sappna kann nicht glauben, was ihr der Fremde im Tempel anbietet: Sie soll die Leitung seines Imperiums übernehmen, allerdings muss sie sich vorher sieben Prüfungen unterziehen. Sappna lehnt ab, doch dann zwingen sie die Umstände dazu, auf dieses seltsame Angebot einzugehen …Warum ausgerechnet sie? Sappna, die als Verkäuferin in einem Elektroladen arbeitet, ist irritiert, als Acharya, einer der reichsten Männer Indiens, ihr anbietet, die Leitung seines Milliarden Dollar schweren Imperiums zu übernehmen. Vorher muss sie allerdings sieben Tests bestehen, mit denen er ihre Integrität prüfen will.Sappna glaubt an eine Falle und schlägt das Angebot entrüstet aus, bis die Umstände sie dazu zwingen, ihre Meinung zu ändern. Doch wann sollen die angekündigten Prüfungen endlich beginnen?Sappna will wissen, woran sie ist, nicht ahnend, dass ihr Gönner sie ständig beobachtet – das Leben hält nun mal die besten Prüfungen bereit. Aber kann man Acharya wirklich vertrauen? Oder spielt er ein ganz anderes Spiel?Im Leben bekommt man nicht das, was man verdient, sondern das, was man verhandelt – und Sappna ist fest entschlossen, es allen zu zeigen.Ein zauberhafter Roman vom Autor des oscarprämierten Films »Slumdog Millionaire«, voller unerwarteter Wendungen, der rasante Unterhaltung verspricht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Vikas Swarup
Die wundersame Beförderung
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Vikas Swarup
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Vikas Swarup
Vikas Swarup, geboren in Allahabad (Indien) studierte Geschichte, Philosophie und Psychologie. Wurde 1986 in den diplomatischen Dienst bestellt und war als Botschafter seines Landes Indien in der Türkei, den USA, Äthiopien, GB und Südafrika tätig. Seit 2009 ist er Generalkonsul in Osaka-Kobe, Japan. Sein erster Roman »Rupien, Rupien« wurde ein Bestseller, sein zweiter Roman »Immer wieder Ghandi« wird gerade verfilmt, und auch die Filmrechte an diesem Roman wurden bereits verkauft.
Bernhard Robben, geboren 1955, lebt in Brunne/Brandenburg und übersetzt aus dem Englischen, u. a. Salman Rushdie, Peter Carey, Ian McEwan, Patricia Highsmith und Philip Roth. 2003 wurde er mit dem Übersetzerpreis der Stiftung Kunst und Kultur des Landes NRW ausgezeichnet, 2013 mit dem Ledig-Rowohlt-Preis für sein Lebenswerk geehrt.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Warum ausgerechnet sie? Sappna, die als Verkäuferin in einem Elektroladen arbeitet, ist irritiert, als Acharya, einer der reichsten Männer Indiens, ihr anbietet, die Leitung seines Milliarden Dollar schweren Imperiums zu übernehmen. Vorher muss sie allerdings sieben Tests bestehen, mit denen er ihre Integrität prüfen will. Sappna glaubt an eine Falle und schlägt das Angebot entrüstet aus, bis die Umstände sie dazu zwingen, ihre Meinung zu ändern. Doch wann sollen die angekündigten Prüfungen endlich beginnen? Sappna will wissen, woran sie ist, nicht ahnend, dass ihr Gönner sie ständig beobachtet – das Leben hält nun mal die besten Prüfungen bereit. Aber kann man Acharya wirklich vertrauen? Oder spielt er ein ganz anderes Spiel?
Im Leben bekommt man nicht das, was man verdient, sondern das, was man verhandelt – und Sappna ist fest entschlossen, es allen zu zeigen.
Ein zauberhafter Roman vom Autor des oscarprämierten Films »Slumdog Millionaire«, voller unerwarteter Wendepunkte, der rasante Unterhaltung verspricht.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: The Accidental Apprentice
Copyright © Vikas Swarup 2013
All rights reserved
Aus dem Englischen von Bernhard Robben
© 2014, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
eBook © 2014, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © Rudolf Linn, Köln
ISBN978-3-462-30835-8
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Prolog
Die erste Prüfung
Die zweite Prüfung
Die dritte Prüfung
Die vierte Prüfung
Die fünfte Prüfung
Die sechste Prüfung
Die siebte Prüfung
Epilog
Danksagung
für Aditya und Varun, die meine ersten Geschichten hörten
Prolog
Im Leben bekommt man nie, was man verdient, nur das, was man für sich heraushandelt.
Das war die erste Lektion, die er mir beibrachte.
Während der letzten drei Tage habe ich diese Weisheit in die Praxis umgesetzt und pausenlos mit meinen Anwälten und Verfolgern in dem verzweifelten Versuch verhandelt, die Todesstrafe abzuwenden, von der alle glauben, ich hätte sie verdient.
Wie die Geier sammeln sich vor dem Gefängnis die Presseleute. Ihre Nachrichtenkanäle können von mir gar nicht genug bekommen. Sie präsentieren meinen Fall als abschreckendes Beispiel dafür, was passiert, wenn Raffgier auf Naivität prallt und so jenes bluttriefende Unglück verursacht, das bei uns Mord ersten Grades heißt. Immer wieder wird das kurz nach meiner Verhaftung aufgenommene Verbrecherfoto der Polizei gezeigt. Sunlight TV hat sogar ein grobkörniges Klassenfoto ausgegraben, auf dem ich in der ersten Reihe kerzengerade vor Mrs Saunders sitze, meiner Lehrerin in der Achten in meiner Schule in Nainital. Im Moment ist Nainital für mich wie eine andere Welt, ein Nimmerland saftig grüner Berge und silbriger Seen, wo mir mein jugendlicher Optimismus vor langer, langer Zeit einmal vorgaukelte, dass die Zukunft grenzenlos und der Geist des Menschen unbezwingbar sei.
Ich möchte hoffen, träumen, glauben können, aber stets aufs Neue erdrückt mich die kalte Last der Realität. Mir ist, als durchlebte ich einen Albtraum, gefangen in einem tiefen, dunklen Brunnen endloser Verzweiflung, aus dem es kein Entkommen gibt.
In der schwülheißen, fensterlosen Zelle wandern meine Gedanken zu jenem schicksalshaften Tag, an dem alles begann. Es ist zwar schon sechs Monate her, aber ich kann mich so deutlich an jedes Detail erinnern, als wäre es erst gestern gewesen. Vor meinem inneren Auge sehe ich mich an einem kalten, grauen Nachmittag zum Hanuman-Tempel am Connaught Place gehe.
Es ist Freitag, der zehnte Dezember, und auf der Baba Kharak Singh Marg herrscht der übliche Verkehr, ein Chaos aus Hitze und Lärm. Rumpelnde Laster, hupende Autos, jaulende Vespas und knatternde Motorrikschas verstopfen die Straße. Der Himmel ist wolkenlos, doch bleibt die Sonne unsichtbar in dem giftigen Smogcocktail, der sich wie jeden Winter über der Stadt zusammenbraut.
Nach der Arbeit habe ich mich wie immer umgezogen und trage statt meiner Uniform nun eine graue Strickjacke über einem züchtigen himmelblauen Salwar Kamiz. So mache ich das jeden Freitag: Während der Mittagspause schlüpfe ich aus dem Verkaufsraum und laufe die kurze Strecke über den Marktplatz zum alten, dem Affengott geweihten Tempel.
Die meisten Leute gehen in einen Tempel, um zu beten; ich gehe hin, um zu büßen. Alkas Tod bedrückt mich noch immer, und ein Teil von mir ist weiterhin davon überzeugt, dass ich schuld an dem bin, was geschah. Seit dieser schrecklichen Tragödie sind die höheren Mächte meine einzige Zuflucht. Zudem verbindet mich mit der Göttin Durga, der im Hanuman Mandir ebenfalls ein Schrein geweiht ist, eine ganz besondere Beziehung.
Lauren Lockwood, meine amerikanische Freundin, findet es immer wieder faszinierend, dass wir über dreihundertdreißig Millionen Götter haben. »Wahnsinn, ihr Hindus geht wirklich auf Nummer sicher«, sagt sie, was vielleicht ein wenig übertrieben klingt, aber es stimmt schon, dass in jedem Tempel, der seinen Namen verdient, Schreine für mindestens ein halbes Dutzend Götter stehen.
Alle diese Gottheiten verfügen über besondere Kräfte. Göttin Durga ist die Unbesiegbare, die von äußerstem Kummer erlösen kann. Sie half mir, als mir mein Leben nach Alkas Tod nur noch wie ein dunkler Tunnel aus Leid, Schmerz und Schuldgefühlen vorkam. Und sie steht mir bei, wann immer ich sie brauche.
Für einen Freitagnachmittag ist der Tempel ungewöhnlich voll, und ich gerate in den schier endlosen Strom von Gläubigen, die zum innersten Heiligtum drängen. Der Marmorboden unter meinen nackten Füßen fühlt sich kühl an, und die Luft ist schwer vom betäubenden Geruch nach Schweiß, Sandelholz, Blumen und Weihrauch.
Ich reihe mich in die deutlich kürzere Frauenschlange ein und brauche kaum zehn Minuten für mein Gebet zu Durga Ma.
Nach meinem darshan will ich die Stufen hinuntergehen, als mir jemand eine Hand auf die Schulter legt. Ich wirble herum und sehe einen Mann, der mich prüfend anblickt.
Wenn ein erwachsener unbekannter Mann in Delhi eine junge Frau anfasst, greift sie besser instinktiv nach der Dose Pfefferspray, die sie für solche Fälle parat haben sollte. Doch der Fremde, der mich anstarrt, ist kein Obdachloser und kein Tagedieb, sondern ein älterer Herr im cremeweißen Kurta-Seidenpyjama mit einem lässig über die Schulter geschwungenen weißen Pashmina-Schal. Ein Mann von großer Statur, hellhäutig, mit Adlernase und einem harten, entschlossenen Mund; das volle schneeweiße Haar trägt er nach hinten gekämmt. Auf der Stirn prangt ein zinnoberrotes Tika, und die Hände strotzen vor diamant- wie smaragdbesetzten Ringen. Doch was mich am meisten verunsichert, sind die durchdringend blickenden braunen Augen. Sie mustern mich mit einer Unverblümtheit, die ich beinahe furchteinflößend finde. Dies ist ein Mann, der es gewohnt ist, jede Situation zu beherrschen.
»Könnte ich Sie bitte sprechen?«, fragt er ein wenig reserviert.
»Was wollen Sie?«, erwidere ich knapp, aus Respekt vor seinem Alter allerdings weniger ruppig, als ich sonst vermutlich reagiert hätte.
»Ich heiße Vinay Mohan Acharya«, erklärt er gelassen. »Mir gehört das Acharya Business Consortium. Haben Sie schon von der ABC-Group gehört?«
Ich nicke instinktiv. Die ABC-Group ist weithin als eines der größten Konglomerate Indiens bekannt, das von Zahnpasta bis Turbinen nahezu alles herstellt.
»Ich möchte Ihnen etwas vorschlagen«, fährt er fort, »etwas, das Ihr Leben für immer verändern könnte. Geben Sie mir zehn Minuten, um mich genauer zu erklären?«
Von lästigen Versicherungsfritzen und Waschmittelverkäufern habe ich solche Sätze schon oft gehört. Und sie lassen mich immer extrem vorsichtig werden. »Ich habe keine zehn Minuten«, erwidere ich. »Ich muss zurück zur Arbeit.«
»Hören Sie mich nur kurz an«, beharrt er.
»Worum geht’s denn? Jetzt sagen Sie schon.«
»Ich möchte Ihnen die Chance geben, Geschäftsführerin der ABC-Group zu werden und ein zehn Milliarden schweres Geschäftsimperium zu leiten.«
Jetzt weiß ich, dass ich ihm nicht trauen kann. Er klingt genau wie ein Betrüger, wie einer der vielen Straßenhändler auf der Janpath Road, die einem schauderhafte Kunstledergürtel oder billige Taschentücher anzudrehen versuchen. Ich warte auf das angedeutete Lächeln, mit dem er mir sicher gleich zu verstehen geben wird, dass er nur Spaß macht, aber er verzieht keine Miene.
»Danke, kein Interesse«, antworte ich bestimmt und beginne, die Stufen hinunterzugehen. Er folgt mir.
»Sie wollen mir sagen, dass Sie das Angebot des Jahrhunderts ausschlagen? Mehr Geld, als Sie in sieben Leben verdienen könnten?«, fragt er in scharfem, schneidendem Ton.
»Hören Sie, Mr Acharya oder wer immer Sie auch sein mögen. Ich habe keine Ahnung, was für ein Spiel Sie treiben, aber ich bin nicht daran interessiert. Würden Sie also bitte aufhören, mich zu behelligen«, sage ich und hole mir meine Bata-Slipper von der alten Dame wieder, die am Tempeleingang gegen ein kleines Trinkgeld auf die ausgezogenen Schuhe aufpasst.
»Ich verstehe. Sie halten dies vermutlich für einen Scherz«, sagt er und schlüpft dabei in ein Paar brauner Sandalen.
»Nun, ist es keiner?«
»Ich habe es in meinem ganzen Leben noch nie so ernst gemeint.«
»Dann sind Sie sicher von einer dieser TV-Ulksendungen. Sobald ich einwillige – Überraschung! Versteckte Kamera.«
»Sie glauben, ein Mann in meiner Position gibt sich mit dummen Fernsehshows ab?«
»Na ja, einer beliebigen Fremden Ihr Geschäftsimperium anzubieten, klingt für mich ziemlich dumm, meinen Sie nicht? Was mich übrigens daran zweifeln lässt, dass Sie wirklich der sind, der Sie zu sein behaupten.«
»Zugegeben.« Er nickt. »Ein bisschen Skepsis ist gesund.« Er fasst in die Tasche seiner Kurta, zückt ein schwarzes Lederportemonnaie und reicht mir eine Visitenkarte. »Vielleicht kann Sie das ja überzeugen.«
Neugierig schaue ich mir die Karte an. Sie sieht wirklich beeindruckend aus, eine Karte aus halb transparentem Plastik mit dem eingeprägten Logo der ABC-Group, darunter in kräftigen schwarzen Lettern: Vinay Mohan Acharya, Vorsitzender.
Ich gebe ihm die Karte zurück. »So was kann sich jeder für ein paar Hundert Rupien drucken lassen.«
Er zieht eine weitere Plastikkarte aus dem Portemonnaie und hält sie mir hin. »Wie ist es mit dieser hier?«
Er zeigt mir eine gänzlich schwarze American-Express-Centurion-Karte, auf der am anderen Rand Vinay Mohan Acharya eingraviert steht. Nur ein einziges Mal habe ich bislang eines dieser seltenen Exemplare gesehen, als nämlich ein protziger Bauunternehmer aus Noida damit einen knapp vierhunderttausend Rupien teuren, sechzig Zoll breiten Sony-LX-900-Fernseher gekauft hat. »Die ändert überhaupt nichts«, sage ich und zucke mit den Achseln. »Woher soll ich wissen, dass sie nicht gefälscht ist?«
Mittlerweile haben wir den Vorplatz des Tempels überquert und fast die Straße erreicht. »Das da ist mein Wagen«, sagt er und zeigt auf ein chromblitzendes Fahrzeug am Straßenrand. Am Steuer sitzt ein Chauffeur mit Schirmmütze und weißer gestärkter Uniform. Ein bewaffneter, militärisch gekleideter Bodyguard steigt auf der Beifahrerseite aus und nimmt Haltung an. Als Acharya mit den Fingern schnippt, öffnet er hastig die hintere Tür. Sein eilfertiger Gehorsam wirkt nicht gespielt, sondern wie über Jahre antrainiert. Und bei dem Wagen handelt es sich, wie ich bewundert feststelle, um einen silberfarbenen Mercedes CLS-500; Kostenpunkt: irgendwas über neun Millionen Rupien.
»Geben Sie mir noch eine Sekunde«, sagt Acharya, beugt sich in den Wagen vor, fischt eine Zeitschrift vom Rücksitz und reicht sie mir. »Mein letzter Versuch. Wenn Sie das nicht überzeugt, wird Sie nichts überzeugen.«
Es ist die Business Times vom Dezember 2008. Auf dem Cover prangt das Porträt eines Mannes, darüber der Titel in Großbuchstaben: Geschäftsmann des Jahres. Ich sehe mir das Gesicht auf dem Foto und das des Mannes vor mir an. Sie sind identisch. Die krumme Nase, die stechenden braunen Augen und das auffällige, nach hinten gekämmte Silberhaar sind unverwechselbar. Ich habe es also tatsächlich mit dem Industriellen Vinay Mohan Acharya zu tun. »Okay«, gebe ich klein bei. »Dann sind Sie eben Mr Acharya. Und was wollen Sie von mir?«
»Das habe ich Ihnen bereits gesagt. Ich möchte Sie zu meiner Geschäftsführerin machen.«
»Und Sie erwarten von mir, dass ich Ihnen das glaube?«
»Dann geben Sie mir zehn Minuten, damit ich Sie überzeugen kann. Können wir nicht irgendwohin gehen und uns unterhalten?«
Ich werfe einen Blick auf meine Uhr. Bis zum Ende der Mittagspause bleiben noch zwanzig Minuten. »Wir könnten ins Coffee House gehen«, sage ich und zeige auf jenes heruntergekommene Gebäude auf der anderen Straßenseite, das in dieser Gegend als gesellschaftlicher Mittelpunkt der tratschenden Klasse dient.
»Die Lobby Lounge im Shangri La wäre mir eigentlich lieber«, sagt er so zögerlich wie jemand, der sich mit einer bedauernswerten Entscheidung abfindet. »Macht es Ihnen etwas aus, wenn uns einer meiner Kollegen begleitet?«
Kaum hat er zu Ende gesprochen, taucht wie ein Geist ein Mann aus der Menge der Fußgänger auf und stellt sich neben ihn. Er ist deutlich jünger, vermutlich Anfang dreißig und gut eins achtzig groß. Er hat die sehnige, drahtige Figur eines Sportlers und ist mit einem dunkelblauen Reebok-Trainingsanzug eher lässig gekleidet. Mir fallen der Kurzhaarschnitt, die kleinen Frettchenaugen und der schmale, grausame Mund auf. Die Nase sitzt ein wenig schief, fast, als wäre sie ihm einmal gebrochen worden, was sie zum einzig Bemerkenswerten in einem ansonsten völlig unauffälligen Gesicht macht. Ich nehme an, dass er Acharya die ganze Zeit im Auge behalten hat. Selbst jetzt wandert sein bohrender Blick ruhelos umher, und wie ein Bodyguard prüft er die Umgebung, ehe er sich mir zuwendet.
»Das ist Rana, meine rechte Hand«, stellt Acharya ihn vor. Ich nicke höflich und welke unter seinem eisigen Blick dahin.
»Sollen wir?«, fragt Rana. Er hat eine heisere, verlebte Stimme, die wie über den Boden raschelndes Laub klingt. Ohne meine Antwort abzuwarten, geht er zur Unterführung voraus.
Der schwere Geruch gebratener Dosas und gerösteter Kaffeebohnen überfällt meine Sinne, sobald wir durch die Schwingtür treten. Das Restaurant hat den Charme einer Krankenhauscafeteria, und mir entgeht nicht, dass Acharya die Nase rümpft und es offenbar bereits bedauert, hergekommen zu sein. Um die Mittagszeit ist es hier rappelvoll. »Minimum zwanzig Minuten«, wird uns gesagt, »bitte warten.«
Ich sehe, wie Rana dem Besitzer einen gefalteten Hundert-Rupien-Schein in die Hand drückt, und gleich darauf wird ein Ecktisch für uns eingedeckt. Acharya und sein Lakai nehmen an der einen Seite Platz; ich setzte mich ihnen gegenüber auf den einsamen Stuhl. Barsch bestellt Rana drei Filterkaffee, dann übernimmt Acharya und schaut mir mit festem Blick in die Augen. »Lassen Sie mich ganz offen sein. Das hier ist für mich wie eine Blindwette. Könnten Sie mir daher den Gefallen tun, ein wenig über sich zu erzählen, bevor ich Ihnen meinen Vorschlag näher erläutere?«
»Na ja, da gibt es nicht viel zu erzählen.«
»Sie könnten damit anfangen, dass Sie mir Ihren Namen verraten.«
»Ich bin Sapna. Sapna Sinha.«
»Sapna.« Er lässt sich den Namen auf der Zunge zergehen, ehe er offensichtlich zufrieden nickt. »Ein guter Name. Wie alt sind Sie, Sapna, wenn ich Sie das fragen darf?«
»Dreiundzwanzig.«
»Und was machen Sie? Sind Sie Studentin?«
»Ich habe meinen Abschluss an der Universität Kumaun in Nainital gemacht. Seither arbeite ich als Verkäuferin bei Gulati & Sons, die am Connaught Place eine Filiale für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte haben.«
»Ich war schon mal da. Ist doch ganz in der Nähe, oder?«
»Ja, in Block B.«
»Und wie lange arbeiten Sie schon dort?«
»Etwas über ein Jahr.«
»Was ist mit Ihrer Familie?«
»Ich lebe mit meiner Mutter und meiner jüngeren Schwester, Neha, zusammen. Neha macht gerade ihren Bachelor am Kamala Nehru College.«
»Und was ist mit Ihrem Vater?«
»Er ist vor anderthalb Jahren gestorben.«
»Oh, das tut mir leid. Also müssen Sie in Ihrer Familie jetzt die Brötchen verdienen.«
Ich nicke.
»Macht es Ihnen etwas aus, mir zu sagen, wie viel Sie im Monat bekommen?«
»Zusammen mit den Provisionen um die achtzehntausend Rupien.«
»Mehr nicht? Sollten Sie da nicht freudestrahlend zugreifen, wenn sich Ihnen die Chance bietet, einen millionenschweren Multikonzern zu leiten und ein Vermögen zu machen?«
»Hören Sie, Mr Acharya, Ihr Angebot verwirrt mich immer noch. Ich meine: Warum brauchen Sie denn überhaupt eine Geschäftsführerin?«
»Warum? Ich bin achtundsechzig Jahre alt und werde nicht jünger. Gott hat den menschlichen Körper wie eine Maschine mit eingeplantem Verschleiß konstruiert. Und ich habe mein Verfallsdatum bald erreicht. Doch bevor ich abtrete, will ich für einen ordentlichen Übergang in jener Organisation sorgen, um die ich mich vierzig Jahre lang gekümmert habe. Ich will sichergehen, dass mir jemand nachfolgt, der an dieselben Werte glaubt wie ich.«
»Aber warum ich? Warum nicht Ihr Sohn oder Ihre Tochter?«
»Das lässt sich leicht beantworten: Ich habe keine Familie mehr. Meine Frau ist mit meiner Tochter vor achtzehn Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.«
»Mein Beileid«, sage ich und zögere kurz. »Und was ist mit jemandem aus Ihrem Unternehmen?«
»Innerhalb des Konsortiums habe ich intensiv gesucht, konnte aber niemanden finden, der auch nur entfernt infrage käme. Meine Angestellten können Ideen gut umsetzen; sie sind ausgezeichnete Untergebene, aber in keinem von ihnen konnte ich die Ansätze einer großen Führungspersönlichkeit erkennen.«
»Und was erkennen Sie in mir? Ich weiß nicht das Geringste darüber, wie man ein Unternehmen führt. Ich habe nicht einmal einen Abschluss in Betriebswirtschaft.«
»So was ist letztlich nur ein Blatt Papier. Im Studium lernt man nicht, wie man Menschen führt, höchstens wie man etwas verwaltet. Deshalb bin ich auch nicht an eine Managerschule gegangen, um mir meinen Geschäftsführer zu suchen, sondern hierher zu einem Tempel.«
»Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet. Warum ich?«
»Da ist etwas in Ihren Augen, ein Funkeln, das ich bei niemandem sonst gesehen habe.« Wie um sich zu vergewissern, schaut er mir kurz ins Gesicht, ehe er den Blick wieder abwendet. »Ich habe schon immer Menschen beobachtet«, fährt er fort und sieht sich um, mustert Leute an den Nachbartischen. »Und unter allen Menschen, die ich mir im Tempel angesehen habe, fand ich keinen so konzentriert wie Sie. Nennen Sie es Intuition, ein Gespür, wie auch immer, aber irgendwas verrät mir, dass Sie die Richtige sein könnten. Sie allein haben diese zwingende Mischung aus Entschlossenheit und Verzweiflung, nach der ich suche.«
»Ich dachte, Verzweiflung sei etwas Negatives.«
Er schüttelt den Kopf. »Zufriedene Menschen sind keine guten Geschäftsführer. Glück gebiert Faulheit. Streben allein gebiert Leistung. Ich will Leute, die hungrig sind. Und solch ein Hunger gedeiht in der Wüste der Unzufriedenheit. Sie scheinen dieses Verlangen, diesen Hunger zu haben.«
Ich merke, wie ich mich in seinen weitschweifigen Überlegungen und großspurigen Behauptungen verfange, kann aber die Logik hinter seinem Gerede nicht ganz nachvollziehen. »Treffen Sie Ihre Entscheidungen immer aus einer bloßen Laune heraus?«
»Unterschätzen Sie niemals die Macht der Intuition. Vor elf Jahren habe ich in Rumänien eine angeschlagene Fabrik namens Iancu Steel gekauft. Sie fuhr Tag für Tag Verluste ein, und meine Experten haben mir ausnahmslos vom Kauf abgeraten. Sie sagten, ich würde gutes Geld schlechtem hinterherwerfen, aber ich blieb bei meiner Entscheidung. Dabei hat mich allein der Name der Fabrik überzeugt, Iancu heißt ›Gott ist gnädig‹. Heute kommen dreiundfünfzig Prozent unserer Stahlerträge aus dieser Fabrik. Gott ist wahrhaft gnädig.«
»Sie sind also religiös?«
»Ist das nicht Hinweis genug?« Er deutet auf das zinnoberrote Zeichen auf seiner Stirn. »Ich suche einen Gläubigen wie mich, das ist der eigentliche Grund, weshalb ich zu einem Tempel gegangen bin. Wir leben im Kalyug, der dunklen Zeit voller Sünde und Korruption. Religion ist nicht länger in Mode. Die jungen Leute, die für mich arbeiten, werden vom Konsum verzehrt. Sie haben wahrscheinlich seit Jahren keinen Tempel mehr betreten. Ich will damit nicht sagen, dass sie allesamt Atheisten sind, aber ihr erster und wichtigster Gott ist das Geld. Sie dagegen … Er nickt mir anerkennend zu. »Sie scheinen mir genau die fromme, gottesfürchtige Kandidatin zu sein, nach der ich gesucht habe.«
»Okay, ich hab’s kapiert. Sie lassen sich von Ihren Launen leiten, und Ihre jüngste Laune sagt Ihnen, dass ich die Auserwählte bin. Aber jetzt verraten Sie mir bitte, wo der Haken an der ganzen Sache ist.«
»Es gibt keinen Haken, nur ein paar Bedingungen. Außerdem müssen Sie einige Prüfungen bestehen.«
»Prüfungen?«
»Keine Sorge: Sie müssen nicht noch einmal die Schulbank drücken. Schulen testen bloß das Erinnerungsvermögen, das Leben aber testet Ihren Charakter. Meine sieben Prüfungen sind so etwas wie ein Eignungsritual und sollen herausfinden, aus welchem Holz Sie geschnitzt sind, welches Potenzial Sie als Geschäftsführerin haben.«
»Warum sieben?«
»Eines habe ich gelernt in diesen vierzig Jahren, in denen ich dem Konsortium vorstehe: Ein Unternehmen ist nur so gut wie der Mensch, der es führt. Und ich konnte die Charakterzüge eines erfolgreichen Geschäftsführers auf sieben grundsätzliche Eigenschaften reduzieren. Jede der sieben Prüfungen wird sich daher auf eine dieser sieben Eigenschaften konzentrieren.«
»Und was genau habe ich zu tun, wenn ich diese Prüfungen bestehen will?«
»Nichts, was Sie nicht auch in Ihrem täglichen Leben tun würden. Ich werde Sie weder bitten, etwas zu stehlen noch zu töten oder sonst etwas Ungesetzliches zu tun. Ehrlich gesagt, Sie werden nicht einmal mitbekommen, dass Sie geprüft werden.«
»Wie meinen Sie das?«
»Meine Prüfungen sind dem Lehrbuch des Lebens entnommen. Das Leben stellt uns jeden Tag auf die Probe. Wir haben jeden Tag Entscheidungen zu treffen. Ich werde Ihre Entscheidungen auswerten, Ihre Reaktionen auf die täglichen Herausforderungen des Lebens.«
»Und was, wenn ich diese Prüfungen nicht bestehe?«
»Tja, dann werde ich mir jemand anderen suchen müssen, aber mein Instinkt sagt mir, dass Sie nicht scheitern. Mir scheint es geradezu vorherbestimmt zu sein. Sie werden den größten Lotteriegewinn aller Zeiten einheimsen.«
»In dem Fall steht meine Entscheidung fest. Ich bin an Ihrem Angebot nicht interessiert.«
Er wirkt verblüfft. »Und warum nicht?«
»Ich halte nichts von Lotterien.«
»Aber Sie glauben an unsere Götter. Und manchmal geben sie mehr, als man sich gewünscht hat.«
»Ich bin nicht habgierig«, sage ich und stehe vom Tisch auf. »Danke, Mr Acharya. Es war nett, Sie kennenzulernen, aber ich muss nun wirklich zurück ins Geschäft.«
»Setzen Sie sich!«, befiehlt er mit stählernem Ton. Ich muss schlucken und setze mich wieder wie eine gehorsame Schülerin.
»Hören Sie mir zu, Sapna.« Seine Stimme wird sanfter. »Es gibt auf der Welt nur zwei Sorten Menschen: Gewinner und Verlierer. Ich biete Ihnen die Chance, eine Gewinnerin zu sein. Im Gegenzug bitte ich Sie nur, diese Zustimmungserklärung zu unterzeichnen.« Er nickt Rana zu, der daraufhin ein bedrucktes Blatt aus der Tasche seines Trainingsanzugs zieht und auf den Tisch legt.
In manchen Dingen habe ich seit Alkas Tod eine Art sechsten Sinn entwickelt, eine kleine Warnglocke in meinem Kopf, die anschlägt, sobald irgendwas nicht stimmt. Diese Glocke läutet, als ich die Erklärung in die Hand nehme. Sie ist kurz, nur fünf Sätze:
Der Unterzeichner erklärt sich hiermit einverstanden, gegebenenfalls die Stelle des Geschäftsführers der ABC-Unternehmensgruppe anzunehmen.
Der Unterzeichner gestattet der ABC-Group, alle notwendigen Prüfungen und Vorgänge durchzuführen, die der Eignungsfeststellung des Kandidaten dienen.
Dem Unterzeichner ist es nicht gestattet, seine Zustimmung zu diesem Verfahren zurückzuziehen, solange die notwendigen Prüfungen und Vorgänge noch nicht abgeschlossen sind.
Der Unterzeichner erklärt sich einverstanden, völliges Stillschweigen über diese Erklärung zu wahren und mit keiner dritten Partei darüber zu reden.
In Anbetracht des oben Aufgeführten erhält der Unterzeichner einen nicht rückzahlbaren Vorschuss von 100.000 Rupien.
»Hier ist nur die Rede von hunderttausend Rupien«, stelle ich fest. »Hatten Sie nicht von zehn Milliarden Dollar gesprochen?«
»Diese hunderttausend sind allein für die Teilnahme an den Prüfungen. Sollten Sie scheitern, dürfen Sie die hunderttausend trotzdem behalten. Sollten Sie bestehen, bekommen Sie die Stelle, und ich kann Ihnen versichern, das Gehalt eines Geschäftsführers hat noch ein paar Nullen mehr.«
Mittlerweile läutet die Glocke in meinem Kopf Sturm. Ich weiß, dass ich einem Betrüger gegenübersitze und dass Acharya diese Masche schon öfter abgezogen hat. »Sagen Sie, wie viele Leute konnten Sie schon dazu bringen, diese Erklärung zu unterschreiben?«
»Sie sind die siebte Kandidatin«, seufzt Acharya, »aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Sie die letzte sind. Meine Suche ist vorbei.«
»Und meine Zeit ist um.« Entschlossen stehe ich auf. »Ich habe nicht die Absicht, diese Erklärung zu unterschreiben oder an irgendwelchen Tests teilzunehmen.«
Daraufhin legt Rana einen Stapel Rupien auf den Tisch. Die Tausender sehen brandneu aus, frisch von der Bank. Er will mich ködern, aber ich habe kein Interesse. »Sie glauben, Sie können mich mit Ihrem Geld kaufen?«
»Na ja, schließlich verhandeln wir gerade«, stellt Acharya fest. »Vergessen Sie nicht, im Geschäft wie im Leben bekommt man nie, was man verdient, sondern nur, was man für sich heraushandelt.«
»Ich verhandle nicht mit Leuten, die ich kaum kenne. Was, wenn das hier eine Falle ist?«
»Die einzige Falle ist die Falle allzu geringer Erwartungen. Wissen Sie, ich verstehe ja Ihre Bedenken.« Acharya beugt sich vor und stützt sich auf den Ellbogen ab. »Aber vielleicht sollten Sie die menschliche Natur nicht ganz so pessimistisch beurteilen, Sapna. Ich kann Ihnen nur ernsthaft versichern, dass ich Sie wirklich zu meiner Geschäftsführerin machen will.«
»Haben Sie eigentlich eine Ahnung, wie lächerlich unsere Unterhaltung klingt? So etwas gibt es doch nur in Filmen oder Büchern, aber nicht im realen Leben.«
»Ich bin real, Sie sind real, und mein Angebot ist real. Ein Mann wie ich vergeudet seine Zeit nicht mit irgendwelchen Albernheiten.«
»Ich bin sicher, Sie finden andere Kandidaten, die bereit sind, Ihr Angebot anzunehmen. Ich habe jedenfalls kein Interesse.«
»Sie machen einen großen Fehler.« Acharya droht mir mit dem Zeigefinger. »Vielleicht den größten Ihres Lebens, aber ich will Sie nicht weiter unter Druck setzen. Nehmen Sie meine Karte und rufen Sie mich an, falls Sie Ihre Meinung innerhalb der nächsten achtundvierzig Stunden ändern. So lange steht mein Angebot.« Er schiebt die Visitenkarte über den Tisch; Rana beobachtet mich wie ein Habicht.
Ich nehme die Karte, werfe ihnen ein knappes Lächeln zu und gehe zur Tür, ohne mich noch einmal umzudrehen.
Während ich zum B-Block haste, drehen sich meine Gedanken schneller im Kreis als eine CD. Vor allem aber fühle ich mich erleichtert, fast, als wäre ich mit knapper Not einer großen Gefahr entronnen. Hin und wieder werfe ich einen Blick über die Schulter, um sicherzugehen, dass mir die beiden nicht folgen. Je mehr ich über die Sache nachdenke, desto überzeugter bin ich, dass Acharya entweder ein eiskalter Betrüger oder ein irrer Spinner ist. So oder so, ich will nichts mit ihm zu tun haben.
Ich beruhige mich erst wieder, als ich sicher zurück im Geschäft bin, in meiner klimatisierten Welt der Plasma-Fernseher, vereisungsfreien Kühlschränke und Waschmaschinen mit Fuzzy-Logic. Acharya und sein verrücktes Angebot verdränge ich aus meinen Gedanken, ziehe die Uniform wieder an und beginne mit der gewohnten Jagd auf Käufer. Nachmittags läuft das Geschäft meist eher schleppend, und es sind auch nicht allzu viele Kunden da, um die ich mich kümmern könnte. Also bemühe ich mich, einen verwirrt dreinblickenden Mann mit Bierbauch für den neusten Samsung-Camcorder mit Full-HD zu begeistern, aber er scheint sich eher für meine Beine zu interessieren, die unter dem kurzen roten Rock gut zu sehen sind. Wer auch immer diese gewagten Uniformen entworfen hat (und der Verdacht fällt seit jeher auf Raja Gulati, den nichtsnutzigen Sohn des Besitzers), wollte uns Verkäuferinnen wie Stewardessen aussehen lassen. »Eine Mogelpackung«, kommentierte das meine Kollegin Prachi. »Wir kriegen zwar genauso eindeutige Angebote wie sie, aber nicht ihr Gehalt.«
Ehrlich gesagt, ich muss längst nicht so oft lüsterne Avancen abwehren wie die übrigen drei Verkäuferinnen. Mit ihrem schick frisierten Haar, dem makellosen Make-up und der hellen Haut sind sie diejenigen, die wie Flugbegleiterinnen aussehen. Ich dagegen, mit meinem verlegenen Lächeln und einer Haut, die in Heiratsanzeigen gern weizenbraun genannt wird – ein Euphemismus für »nicht hell« – erinnere eher an eine Reklame für eine dieser »sanften Bleichcremes«. In unserer Familie bin ich schon immer das hässliche Entlein gewesen. Alka und Neha, meine beiden jüngeren Schwestern, haben ihre milchweiße Haut von Ma geerbt, ich die dunklere Haut von meinem Vater. Und in diesem Teil der Welt bestimmt die Hautfarbe dein Schicksal.
Erst als ich anfing, in diesem Laden zu arbeiten, wurde mir klar, dass dunkle Haut und schlichtes Aussehen auch von Vorteil sein können. Konkurrenz schüchtert reiche Kundinnen ein; sie mögen es nicht, von schönen Frauen umgeben zu sein. Bei mir aber fühlen sie sich sicher. Und da die meisten Familienkäufe von Frauen erledigt werden, erreiche ich meine monatlichen Umsatzziele meist schneller als meine Kolleginnen.
Außerdem habe ich gelernt, Kunden niemals nach ihrem Äußeren zu beurteilen. Es gibt sie in allen Größen, Kleidern und Erscheinungsformen. So zum Beispiel der Mann mittleren Alters, der kurz nach drei Uhr das Geschäft im dhoti und farblich dazu unpassendem Turban betritt. Mit seinem mächtigen Oberkörper, den dicken Armen und einem Schnauzbart, den er zu einem echten Kunstwerk hochgezwirbelt hat, könnte man ihn für einen Gewichtheber halten. Scheinbar ziellos wandert er durch die Gänge wie ein verirrtes Kind, überwältigt vom funkelnden Glanz der Auslagen. Da die anderen Verkäuferinnen nur über sein schlichtes Äußeres und seine unbeholfene Art kichern, wendet er sich an mich. Nach kaum zehn Minuten habe ich ihm die Geschichte seines Lebens entlockt. Er heißt Kuldip Singh und ist der Patriarch einer wohlhabenden Bauernfamilie in einem Dorf namens Chandangarh in Haryana, im Bezirk Karnal, gut hundertvierzig Kilometer außerhalb von Delhi. Nächste Woche heiratet seine achtzehnjährige Tochter Babli, und er ist in die Hauptstadt gefahren, um ihre Mitgift aufzustocken.
Sein Problem ist, dass er sich nur mit Traktoren und Brunnenpumpen auskennt. Er hat in seinem Leben noch keine Mikrowelle gesehen und hält die 15-Kilo-Frontlader von LG für eine geniale Erfindung, um damit Lassi zu mixen. Außerdem will er mit mir über den Preis verhandeln. Ich versuche ihm zu erklären, dass sämtliche Geräte in diesem Geschäft einen Fixpreis haben, aber er weigert sich, das einzusehen.
»Dekh chhori. Hör zu, Mädchen«, knurrt er in seinem ländlichen Dialekt. »Bei uns in Haryana haben wir ein Sprichwort. Egal, wie sehr eine Ziege rumzickt, am Ende muss sie doch Milch geben.«
Da er nicht nachgibt, gehe ich schließlich zum Manager, der ihm fünf Prozent Rabatt einräumt; und so kauft er zu guter Letzt eine ganze Wagenladung ein, darunter einen 42-Zoll-Plasma-Fernseher, einen dreitürigen Kühlschrank, eine Waschmaschine, einen DVD-Player und eine Hi-Fi-Anlage. Die anderen Verkäuferinnen sehen mit ehrfürchtigem Staunen zu, wie er ein dickes Bündel Tausend-Rupien-Scheine zückt, um für seinen Einkaufsbummel bar zu bezahlen. Ihr Bauerntrampel erwies sich als wahrer Shopping-Baron. Und ich breche wieder mal alle Verkaufsrekorde!
Der Rest des Tages rauscht nur so vorbei. Wie immer verlasse ich das Geschäft um Viertel nach acht und gehe zur Metrostation Rajiv Chowk.
Die Fahrt bis Rohini, der riesigen Vorstadt im Nordwesten Delhis, dauert fünfundvierzig Minuten. Es heißt, sie sei der zweitgrößte Wohnbezirk in ganz Asien, der billige, hässliche Tentakel einer Großstadt voll elender, langweiliger Betonblöcke und chaotischer Märkte.
In Rithala, der letzten Haltestelle der Roten Linie, steige ich aus. Zur Siedlung UEG im Abschnitt B-2, Sektor 11, sind es von hier aus noch zwanzig Minuten zu Fuß. Unter all den Gegenden Rohinis ist keine so trist wie meine. Allein der Name – UEG steht für Untere Einkommensgruppe – ist wie ein Schlag ins Gesicht. In den Achtzigerjahren von der Stadtentwicklungsbehörde gebaut, sehen die vier Hochhäuser aus rotem Stein wie eine Ansammlung von Ziegeleischornsteinen aus, deren entstelltem Äußeren und verunstaltetem Inneren die typischen Spuren schlampiger Behördenbauweise anhaften. Trotzdem bin ich froh, dass wir hier untergekommen sind. Nach Papas Tod hätten wir uns eine der elenden Dreizimmerwohnungen, die im Monat über tausendzweihundert Rupien Miete kosten, gar nicht mehr leisten können. Zum Glück müssen wir für B-29, unsere Wohnung im zweiten Stock, keine Miete zahlen, da sie Mr Dinesh Sinha gehört, Papas gut betuchtem jüngerem Bruder. Aus Mitleid erlaubt uns Onkel Deenu, umsonst zu wohnen. Na ja, nicht völlig umsonst. Hin und wieder muss ich seine idiotischen Söhne Rolu und Golu zum Abendessen in ein schickes Restaurant einladen. Dabei will mir nicht in den Kopf, warum ich die beiden auf meine Kosten einladen soll, wo ihrem Vater doch drei Tandoori-Restaurants gehören.
Das Erste, was man sieht, wenn man die Wohnung betritt, ist ein gerahmtes Schwarz-Weiß-Foto von Papa, das in dem kleinen Flur hängt, in dem auch der Kühlschrank steht. Es ist mit einem Kranz angewelkter Rosen geschmückt und zeigt einen jungen Mann, der noch gänzlich unbelastet ist von der Verantwortung eines Lehrers für drei erwachsene Töchter. Der Fotograf hat es nett mit ihm gemeint und die vorzeitigen Sorgenfalten auf seiner Stirn wegretuschiert. Gegen den missmutigen Zug, der Papas Mund unauslöschlich umspielt, konnte er allerdings nichts machen.
Unser bescheidenes Wohn- und Esszimmer wird von einem vergrößerten Farbfoto an der mittleren Wand dominiert. Alka trägt darauf einen riesigen roten Hut und posiert wie eine Dame auf der Rennbahn von Ascot, den Kopf leicht in den Nacken gelehnt, die dunklen Augen weit offen, die Lippen zu naivem Lächeln gespitzt. So werde ich sie immer in Erinnerung behalten: schön, jung und sorglos. Jedes Mal, wenn ich dieses Bild sehe, meine ich zu hören, wie ihr ansteckendes Lachen durchs Zimmer hallt. »Didi! Didi! Kamaal ho gaya! Heute ist was ganz Unglaubliches passiert!« Und ich höre sie, wie sie mich aufgeregt begrüßt, bereit, mir alle Einzelheiten des neusten Streichs zu erzählen, den sie in der Schule ausgeheckt hat.
Unter dem Foto stehen das ausgebleichte grüne Sofa mit dem bestickten weißen Schonbezug, zwei geradlehnige Bambussessel mit zerschlissenen Kissen, auf der Anrichte für Geschirr und Besteck ein alter Videocon-Fernseher und links davon ein Esstisch aus recyceltem Teakholz, den ich spottbillig bei einer Auktion ergattert habe, dazu vier passende Stühle.
Geht man durch einen Perlvorhang, kommt man ins erste Schlafzimmer, das Ma gehört. Am Bett stehen zwei Kleider-Almirahs aus Holz sowie ein Aktenschrank aus Metall, der mittlerweile hauptsächlich ihre Medizin enthält. Um Mas Gesundheit war es noch nie zum Besten bestellt; und der plötzliche Tod ihrer jüngsten Tochter sowie der ihres Mannes haben ihr fast den Rest gegeben. Sie hat sich wie in ein Schneckenhaus zurückgezogen, wurde still und reserviert, aß kaum noch und vernachlässigte ihr Äußeres. Und je weiter sie sich von der Welt zurückzog, desto stärker nahm die Krankheit ihren Körper in Besitz. Mittlerweile leidet sie an chronischer Diabetes, Hypertonie, Arthritis und Asthma, was regelmäßige Fahrten ins Regierungskrankenhaus nötig macht. Sieht man ihr silbernes Haar und den abgemagerten Körper, mag man kaum glauben, dass sie erst siebenundvierzig Jahre alt ist.
Neha und ich teilen uns das andere Schlafzimmer. Meine jüngere Schwester kennt in ihrem Leben nur ein einziges Ziel: berühmt zu werden. Sie hat die Wände unseres kleinen Zimmers mit den Postern von Schlagersängern, Models und Filmstars tapeziert und hofft, eines Tages ebenso reich und berühmt zu sein. Zum Glück ist Neha nicht nur mit einem hübschen Gesicht, einer Figur schlank und tailliert wie eine Eieruhr gesegnet, sondern sich darüber hinaus sehr genau des ökonomischen Potenzials bewusst, den der Gewinn des Jackpots in der Gen-Auswahl bedeuten kann. Dabei hilft natürlich, dass sie eine ausgebildete Sängerin mit einem soliden Repertoire indischer Musik und einer großartigen Stimme ist.
Ausnahmslos alle Jungen in der Nachbarschaft sind in Neha verknallt, sie aber sieht sie nicht mal an. Drei Buchstaben fassen ihre Zukunft zusammen: B-I-G, und da gibt es keinen Platz für jemanden aus U-E-G. Tagsüber hängt sie meist mit ihren Schickeriafreunden aus dem College ab, abends schreibt sie Bewerbungen an Reality Shows, Talent- und Schönheitswettbewerbe. Neha Sinha ist der Inbegriff von skrupellosem Ehrgeiz.
Außerdem hat sie eine Vorliebe für hirnlosen Konsum und äfft blindlings jede gerade angesagte Mode nach. Monat für Monat geht die Hälfte meines Gehalts dafür drauf, ihre ständig wachsenden Bedürfnisse zu befriedigen: hautenge Jeans, glossy Lippenstift, Designerhandtaschen, das neuste Smartphone … Die Liste hört nie auf.
Während der letzten beiden Monate hat sie mir wegen eines Laptops in den Ohren gelegen, aber irgendwo muss ich eine Grenze ziehen. Ein Gürtel für achthundert Rupien, okay, darüber lässt sich reden, aber dreißigtausend Rupien für irgend so einen Quatsch sind eine ganz andere Sache.
»Hallo, didi, schön, dass du wieder da bist«, begrüßt sie mich, als ich die Wohnung betrete, und ringt sich sogar ein Lächeln ab, statt nur einen Flunsch zu ziehen, ihre Standardreaktion, wenn ich ihr etwas ausschlage.
»Weißt du, dieser Acer-Laptop, den ich so wahnsinnig gern hätte?« Sie schenkt mir ihren Dackelblick, den ich so gut kenne, da sie ihn meist aufsetzt, wenn sie sich was Neues wünscht.
»Ja«, antworte ich zurückhaltend.
»Der wurde herabgesetzt. Kostet jetzt nur noch zweiundzwanzigtausend! Das können wir uns doch leisten, oder?«
»Nein, können wir nicht«, erwidere ich bestimmt. »Das ist immer noch viel zu teuer.«
»Bitte, didi. Ich bin die Einzige in meiner Klasse ohne Laptop. Und ich verspreche dir, danach werde ich dich nie wieder um was bitten.«
»Tut mir leid, Neha, aber das ist gerade nicht drin. Bei den aktuellen Ausgaben kommen wir mit meinem Gehalt kaum über die Runden.«
»Kannst du bei deinem Arbeitgeber keinen Kredit aufnehmen?«
»Nein, kann ich nicht.«
»Du bist echt fies.«
»Ich bin realistisch. Wir sind arm, Neha, daran wirst du dich gewöhnen müssen. Das Leben ist nicht einfach.«
»Lieber sterbe ich, als mich mit so einem Leben abzufinden. Ich bin zwanzig Jahre alt, und was habe ich bislang von der Welt gesehen? Ich war noch nicht mal in einem Flugzeug.«
»Tja, ich auch nicht.«
»Aber das solltest du! All meine Freundinnen fliegen im Sommer in die Schweiz oder nach Singapur in den Urlaub. Und wir können uns nicht mal ein Bergdorf in Indien leisten.«
»Schluss jetzt. Laptops und Urlaube sind nicht so wichtig. Du solltest dich vor allem darum kümmern, gute Noten zu bekommen.«
»Und was nützen mir gute Noten? Sieh doch, was aus dir geworden ist, obwohl du die Beste an der Uni warst.«
Neha hat schon immer diese unheimliche Fähigkeit besessen, mich zu verletzen, ob nun mit Worten oder mit ihrem Schweigen. Und obwohl ich mich inzwischen an ihre ätzenden Kommentare gewöhnt habe, bin ich angesichts der brutalen Ehrlichkeit ihrer Worte doch wie vor den Kopf gestoßen. Im selben Moment klingelt mein Handy.
»Hallo«, melde ich mich.
Es ist Onkel Deenu, der ziemlich aufgebracht klingt. »Sapna, beti, ich muss dir was Wichtiges sagen. Und ich fürchte, es sind schlechte Neuigkeiten.«
Innerlich wappne ich mich gegen einen weiteren Tod in der Familie. Wahrscheinlich eine kränkliche Tante oder eine meiner Großmütter, doch was er dann sagt, schlägt ein wie eine Bombe. »Ihr müsst innerhalb der nächsten zwei Wochen die Wohnung räumen.«
»Was?«
»Ja, tut mir leid, aber mir sind die Hände gebunden. Ich habe in ein neues Restaurant investiert und brauche dringend Bargeld, weshalb ich die Wohnung in Rohini vermieten muss. Heute hat sich ein Makler mit einem sehr guten Angebot gemeldet. In meiner Lage bleibt mir da keine andere Wahl, als dich und deine Familie zu bitten, nach einer neuen Bleibe zu suchen.«
»Aber Onkel, wie sollen wir so schnell eine neue Wohnung finden?«
»Ich helfe euch. Das Problem ist nur, dass ihr von jetzt an Miete zahlen müsst.«
»Wenn wir sowieso Miete zahlen müssen, können wir doch ebenso gut hierbleiben, oder?«
Onkel Deenu denkt kurz nach. »Klingt vernünftig«, willigt er widerstrebend ein. »Nur werdet ihr euch meine Wohnung nicht leisten können.«
»Wie viel soll denn der neue Mieter bezahlen?«
»Wir haben uns auf vierzehntausend im Monat geeinigt. Das sind zweitausend mehr als üblich. Und er muss mir eine Jahresmiete als Kaution im Voraus zahlen. Wenn ihr mit diesen Bedingungen einverstanden seid, habe ich nichts dagegen, wenn ihr in der Wohnung bleibt.«
»Das heißt, wir sollen dir im Voraus hundertachtundsechzigtausend Rupien zahlen?«
»Ganz genau. In Mathe warst du schon immer gut.«
»Ich kann unmöglich so viel Geld auftreiben, Chacha-ji.«
»Dann sucht euch eine neue Wohnung.« Sein Ton wird härter. »Ich muss auch an meine eigene Familie denken, schließlich leite ich keine Wohltätigkeitsorganisation. Und immerhin habe ich euch erlaubt, sechzehn Monate mietfrei zu wohnen.«
»Hat Papa nicht auch viel für dich getan? Willst du seine Familie auf die Straße setzen? Was bist du nur für ein Onkel, Chacha-ji?«, rede ich ihm ins Gewissen.
Die Strategie geht nach hinten los. »Ihr seid doch bloß undankbare Schmarotzer«, fällt er über mich her. »Und lassen wir diese Süßholzraspelei mit ›Onkel‹ dies und ›Onkel‹ das. Von jetzt an sind wir füreinander nur noch Mieter und Vermieter. Also, entweder ihr zahlt innerhalb einer Woche die volle Summe, oder ihr räumt meine Wohnung.«
»Gib uns wenigstens noch ein bisschen mehr Zeit, das Geld aufzutreiben«, flehe ich ihn an.
»Ihr habt eine Woche. Zahlt oder zieht aus«, sagt er und legt auf.
Vor lauter Empörung zittern meine Hände. Ich brauche einen Moment, um Onkel Deenu alle möglichen qualvollen Tode zu wünschen, bevor ich für meine beiden Mitbewohner das Gespräch zusammenfassen kann. Ma schüttelt den Kopf, eher bekümmert als wütend. Die Schlechtigkeit dieser Welt steht für sie schon lange außer Frage.
»Ich habe dem Mann noch nie getraut. Gott sieht alles. Und eines Tages wird Deenu für seine Sünden zahlen müssen.«
Neha reagiert überraschend optimistisch. »Was soll’s? Wenn das Schwein uns rausschmeißt, verschwinden wir eben aus dieser Absteige. Ich würde sowieso ersticken, wenn ich hier noch länger wohnen muss.«
»Und wo willst du hin?«, entgegne ich. »Glaubst du, es wird ein Kinderspiel, eine neue Wohnung zu finden?«
Doch ehe wir uns erneut in die Haare kriegen, spricht Mutter das größte Problem an.
»Wie sollen wir nur so viel Geld auftreiben?« Die Frage schwebt über uns wie eine drohende Gewitterwolke.
Papa hat uns nicht viel hinterlassen. Um Onkel Deenus erste Schritte im Restaurantgeschäft zu unterstützen, hat er vor Jahren seine Rente belastet. Und der Umzug in die Stadt verbrauchte die bescheidenen Ersparnisse aus seiner Lehrtätigkeit, sodass zum Zeitpunkt seines Todes kaum zehntausend Rupien auf seinem Konto waren.
Ma hat die Antwort auf ihre Frage bereits gefunden. Sie öffnet den Schrank und holt zwei Paar goldene Armreifen heraus. »Eigentlich wollte ich die für eure Hochzeit aufbewahren, aber wenn wir sie verkaufen müssen, um die Wohnung halten zu können, dann soll es wohl so sein.« Mit einem tiefen Seufzer gibt sie mir die Reifen.
Ich kann Mas Gefühle verstehen. Seit Papas Tod ist dies das dritte Erbschmuckstück, von dem sie sich trennen muss: Mit dem ersten wurde Nehas Ausbildung bezahlt, mit dem zweiten ihre Arztkosten, und dies jetzt soll die Wohnung retten.
Lähmende Stille liegt über unserem Zuhause, als wir uns zum Abendbrot an den Tisch setzen. Ich ringe mit einem brennenden Gefühl des Versagens, fast, als hätte ich meine Familie gerade dann im Stich gelassen, als sie mich am dringendsten brauchte. Nie zuvor habe ich derart darunter gelitten, dass wir so wenig Geld haben. Einen Moment lang blitzt in meinen Gedanken die Erinnerung an all die druckfrischen Geldscheine auf dem Tisch im Coffee House auf, bevor ich sie als schlechten Scherz abtue. Wie sollte man auch einen Irren wie Acharya ernst nehmen können? Und doch kreist sein Name wie eine hartnäckige Fliege in meinem Kopf herum.
Nach dem Essen treibt mich meine Neugier an den Computer, einen uralten Dell-Tower, den ich in letzter Sekunde aus dem Geschäft gerettet habe, bevor ihn sich ein Trödelhändler unter den Nagel reißen konnte. Ein Dinosaurier, noch mit Windows 2000, aber ich kann damit im Internet surfen, meine E-Mails lesen und am Ende jeden Monats eine Excel-Tabelle mit den Haushaltsausgaben erstellen.
Ich gehe auf Google und tippe ›Vinay Mohan Acharya‹ ein: 1,9 Millionen Treffer.
Der Mann ist einfach überall! Nachrichten über Geschäftsabschlüsse, Spekulationen über die Höhe seines Vermögens, Bilder, die ihn in den verschiedensten Gemütslagen zeigen, und bei Youtube Videos mit Reden auf Aktionärsversammlungen und internationalen Konferenzen. Innerhalb der nächsten halben Stunden erfahre ich viel Neues über diesen Mann, über seine Kricketleidenschaft, seine (erfolglosen) Ausflüge in die Politik, die erbitterte Rivalität mit seinem Zwillingsbruder Ajay Krishna Acharya und seine großzügige Hilfsbereitschaft. Offenbar spendet er haufenweise Geld an alle möglichen Wohltätigkeitsorganisationen. Das Internet bestätigte auch, dass er Frau und Tochter am 31. Juli 1992 beim Absturz einer Maschine der Thai Airways von Bangkok nach Kathmandu verlor, bei dem alle einhundertdreizehn Passagiere ums Leben kamen.
Je länger ich mich durch den Informationsdschungel im Netz kämpfe, desto deutlicher erweist sich Acharya als eine komplexe und sehr widersprüchliche Person. Bewunderer kennen keinen zweiten Geschäftsmann in Indien, der es mit ihm in moralischer Hinsicht aufnehmen könnte; Kritiker dagegen bemängeln seine Exzentrik, seinen Narzissmus und Größenwahn. Niemand aber bezweifelt sein Genie, mit dem er die ABC-Group im Alleingang aus einem Start-up-Unternehmen zu Indiens achtgrößtem Multikonzern gemacht hat mit Anteilen in Stahl, Zement, Textilien, Stromerzeugung, Viskose, Aluminium, Konsumgütern, Chemikalien, Computern, Beratungsfirmen und sogar in der Filmindustrie.
Meine Recherche macht eines ganz deutlich: Der Eigner der ABC-Group ist weder ein irrer Spinner noch ein eiskalter Betrüger. Habe ich doch einen Fehler gemacht, als ich sein Angebot so entschieden ablehnte, frage ich mich jetzt und spüre, wie mir erste Zweifel kommen. Schon im nächsten Moment aber rate ich mir, mein klares Urteilsvermögen nicht mit naiver Hoffnung zu vernebeln. In dieser Welt gibt es nichts umsonst. Und falls sich ein Angebot zu gut anhört, um wahr zu sein, dann ist es das meist auch.
Trotzdem plagt mich beim Zubettgehen die Ahnung, dass mir die Zeit davonläuft, dass ich mit meinem Job in einer Sackgasse stecke und die Zukunft für immer in der Warteschleife hängt. Es ist gar nicht so lange her, da schien das Schiff meines Lebens Fahrt aufgenommen zu haben und auf Kurs zu sein. Jetzt aber treibt es ruder- und steuerlos dahin, eine Woche geht in die nächste über, ein Tag ist wie der andere, und nie ändert sich was.
Immerhin sind meine Träume in dieser Nacht anders als sonst. Trotz des wirren Durcheinanders bruchstückhafter Bilder erinnere ich mich lebhaft daran, wie ich in einem luxuriösen Privatjet sitze und über die schneebedeckten Schweizer Berge fliege. Es gibt nur ein kleines Problem: Der Pilot ist ausgerechnet der Industrielle Vinay Mohan Acharya.
Zuversichtlich und mit klarem Kopf mache ich mich am nächsten Morgen auf den langen, gefahrvollen Weg zur Arbeit. Am Wochenende ist die Metro nicht so überfüllt wie sonst, trotzdem bin ich mit meiner Handtasche extrem vorsichtig und lege sie keine Sekunde aus der Hand. Sie ist ein Geschenk meiner Freundin Lauren und sieht richtig edel aus. Nine West, beigefarbenes Kunstschlangenleder. Heute enthält sie außerdem die vier Goldreifen, von denen die Zukunft meiner ganzen Familie abhängt.
An der Station Inderlok drängt sich ein irgendwie bekannt aussehender Mann mit gefärbtem Haar und langen Koteletten in meinen Waggon. Er trägt khadi wie alle Politiker und ist von einigen Anhängern sowie einem Trupp bewaffneter Bodyguards umgeben, die Reisende aus dem Weg drängen, um Platz für den VIP und seine Entourage zu schaffen. Dieser Mann, so höre ich von einem seiner Lakaien, ist unser Bezirksabgeordneter Anwar Noorani auf seiner »wöchentlichen Metrofahrt zwecks Tuchfühlung mit dem einfachen Volk«. Ich habe in der Zeitung von diesem Herrn gelesen, dem Vorsitzenden einer Kette von Privatkrankenhäusern, die angeblich durch Einkünfte aus unsauberen hawala-Geschäften finanziert werden. »Falls Sie mich auf irgendwelche Probleme in meinem Bezirk aufmerksam machen möchten, dürfen Sie mich gern in meinem Wählerbüro hinterm Delhi-Technologieinstitut aufsuchen«, verkündet der Abgeordnete. Unter Schlupflidern huscht der unruhige Blick durch den Waggon und bleibt an mir haften. »Wie geht es Ihnen, Schwester?« Er schenkt mir sein Plastiklächeln, aber ich schlage die Augen nieder und tue dann so, als schaute ich aus dem Fenster. Zum Glück steigt er an der nächsten Station wieder aus.
Delhi ist wirklich eine seltsame Stadt. Gesellschaftlicher Status wird hier nicht dadurch definiert, dass du einen Anzug von Armani trägst, Mercedes fährst oder auf Cocktailpartys Jean-Paul Sartre zitieren kannst. Der Status hängt allein davon ab, wie viele Regeln du brechen und wie viele Leute du schikanieren kannst. Allein das macht dich zu einer VIP.
Schon am frühen Vormittag geht es im Geschäft zu wie in einem Taubenschlag. Kein Tag ist so hektisch wie der Samstag. Außerdem findet bald der Kricket World Cup statt, und unsere Promotionskampagne läuft auf Hochtouren. Wir rechnen damit, beim Verkauf von Flachbildschirmen innerhalb der nächsten zwei Monate Spitzenwerte zu erzielen.
Ein frisch verheiratetes Paar sucht meinen Rat beim Kauf eines Fernsehers. Sie können sich nicht zwischen LCD und Plasma entscheiden. Im Handumdrehen habe ich sie zum neusten Sony LEDTV überredet, gibt es doch im Rahmen unserer Zwei-für-eins-Aktion noch einen Elektrotoaster als Bonus dazu, trotzdem ist heute nicht mein bester Tag. Ich bin abgelenkt und nervös, warte auf die Mittagspause. Kaum zeigt die Uhr eins, schleiche ich mich zur Hintertür hinaus, um prompt Raja Gulati in die Arme zu laufen, Delhis widerlichstem Playboy. Aus irgendeinem Grund lümmelt er sich vor dem Beckett’s herum, einem irischen Pub, nur vier Häuser vom Geschäft entfernt. Er trägt die für ihn typische Lederjacke, sitzt auf seiner Yamaha und zählt ein Bündel Geldscheine. In dem Moment als er mich sieht, stopft er die Rupien weg und strahlt mich an. Mit Stoppelkinn, buschigem Schnauzbart und langem Haar besteht der einzige Anspruch des kleinen und pummeligen Raja auf Ruhm darin, dass seinem millionenschweren Vater das Geschäft gehört. Seine einzigen Hobbys sind Frauenanmachen und Saufen. Falls man dem Tratsch im Geschäft glauben darf, konnte er schon bei einer Verkäuferin landen. In letzter Zeit versucht er es mit seiner primitiven Tour bei Prachi und mir, aber lieber würde ich lebende Kakerlaken essen, als mich auf die Annäherungsversuche dieses Schleimbolzens einzulassen.
»Hallöchen, wen haben wir denn da? Die Eisprinzessin höchstpersönlich!« Er mustert mich mit wölfischem Grinsen und klopft auf den Rücksitz der Yamaha. »Lust auf eine kleine Spritztour?«
»Nein, danke«, erwidere ich kühl.
»Klasse Beine.« Sein Blick wandert an mir herab. »Wann haben die geöffnet?«
Ich spüre, wie mir die Wut heiß ins Gesicht steigt, aber dies ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort für eine Auseinandersetzung. »Warum fragen Sie nicht Ihre Mutter?«, gebe ich zurück und gehe an ihm vorbei. Er seufzt und verschwindet im Pub, sicher, um sich nach dieser Abfuhr ein Glas zu gönnen.
Ohne eine weitere Minute zu vergeuden, laufe ich weiter zum Juwelier Jhaveri im N-Block. Prashant Jhaveri, der junge Ladenbesitzer, ist früher einmal Papas Schüler gewesen und hat uns immer einen fairen Preis gemacht. Ich rechne damit, dass er mir deutlich mehr als zweihunderttausend Rupien für die vier Goldreifen in meiner Handtasche bietet.
An der Kreuzung Radial Road 6 wird der Verkehr von einer Art Prozession aufgehalten. Aberhundert Männer, Frauen und Kinder in safrangelben Kleidern singen und tanzen zur Musik von Trompete und Dohl. Autofahrer hupen verärgert, Fußgänger schäumen vor Wut, aber die fröhliche Menge nimmt keine Rücksicht auf die von ihr verursachten Unannehmlichkeiten. Außerdem passiert hier so etwas jeden Tag. Delhi ist eine Stadt der Menschenaufläufe und Straßensperren geworden.
Während ich noch darauf warte, dass die Prozession vorbeizieht, stupst mich jemand an, ein Straßenjunge im zerlumpten Pullover. Er ist keine acht Jahre alt, das Gesicht staubig, das Haar fettig. Er sagt nichts, hält mir nur die hohle Hand hin, eine universale Geste der Bedürftigkeit. Nichts regt mich so auf wie der Anblick bettelnder Kinder. In einem Alter, in dem sie in der Schule sein sollten, streunen sie auf den Straßen herum und versuchen zu überleben, indem sie das einzige Talent nutzen, das sie besitzen: Mitleid wecken. Ich gebe eigentlich nie etwas, da die Kinder dadurch nur ermuntert werden, immer weiter zu betteln. Oft führt Geld auch zu Schlimmerem, zu Abhängigkeit von Klebstoff, Alkohol oder sonstigen Drogen. Dabei brauchen sie im Grunde bloß ein bisschen Glück, eine Umgebung, die sie fördert, eine ordentliche Dosis Selbstachtung. Etwas, das Lauren und ihre RMT Asha Foundation ihnen geben können.
So leicht aber lässt sich dieser Betteljunge nicht abschütteln. »Ich habe seit zwei Tagen nichts gegessen. Können Sie mir nicht ein bisschen Kleingeld geben?«, murmelt er, eine knochige Hand auf den Bauch gepresst. Beim Blick in seine großen, flehenden Augen kann ich nicht einfach Nein sagen. »Ich gebe dir kein Geld«, sage ich, »aber ich kaufe dir was zu essen.« Seine Miene hellt sich auf. Gleich neben uns steht ein Straßenhändler, der chhole kulcha für zehn Rupien die Portion verkauft. »Möchtest du was davon?« frage ich.
»Ich liebe kulchas«, sagt er und schmatzt mit rissigen Lippen.
Ich streife die Handtasche von der Schulter und öffne den Reißverschluss, um nach Bargeld zu suchen. Im selben Moment kommt jemand von hinten angeschossen und reißt mir die Tasche aus der Hand. Es geht alles so schnell, dass ich nicht mal das Gesicht des Diebes erkennen kann und nur etwas Safrangelbes vorüberhuschen sehe. Ehe ich begreife, wie mir geschieht, ist er in die Menge der Gläubigen untergetaucht. Ich drehe mich um, aber der Bettlerjunge ist auch verschwunden. Ich bin auf einen der ältesten Tricks der Welt hereingefallen.
Einen Moment lang bleibe ich wie versteinert stehen, betäubt vom Geschehen. Meine Hände werden eiskalt, fast bleibt mir die Luft weg. »Neeiin!«, bricht es dann aus mir heraus, und ich stürze mich ins safrangelbe Meer der Gläubigen. Von allen Seiten knufft und schubst man mich, aber in blinder Verfolgung des Diebes dringe ich immer weiter in das Gedränge vor.
Ich kann den Täter nicht finden, aber kaum ist die Prozession vorbei, sehe ich meine ausgeleerte Handtasche am Straßenrand liegen. Ich stürze darauf zu. Mein Handy ist noch da, ebenso Hausschlüssel, Ausweis, Lippenstift, Sonnenbrille und Pfefferspray. Alles, nur die vier Goldreifen nicht.
Ich sacke am Straßenrand zusammen, fühle mich schwindlig, und mir ist übel. Die Arme werden schwer wie Blei, der Blick verschwimmt. Als ich endlich wieder klar sehen kann, hockt ein Polizist vor mir. »Alles in Ordnung?«, fragt er.
»Ja«, erwidere ich matt. »Man hat mir meine Handtasche geklaut.«
»Und was ist das hier?« Mit seinem Stock tippt er die Nine West in meinem Schoß an.
»Er – er hat die Goldreifen meiner Mutter rausgenommen und die Tasche weggeworfen.«
»Haben Sie sein Gesicht gesehen? Können Sie ihn beschreiben?«
»Nein, aber kennt die Polizei nicht alle Gangs, die in dieser Gegend arbeiten? Sie können den Kerl doch bestimmt schnappen.« Wie einen Rettungsanker umklammere ich seinen Arm. »Bitte, Sie müssen was unternehmen. Wenn ich die Reifen nicht wiederbesorgen kann, sind wir am Ende. Ich erstatte auch gern Anzeige.«
»Das nützt nichts. So etwas passiert hier jeden Tag. Und ohne Personenbeschreibung können wir nicht das Mindeste tun. Folgen Sie meinem Rat: Verplempern Sie nicht Ihre und unsere Zeit, indem Sie eine Anzeige aufgeben. Passen Sie in Zukunft einfach besser auf Ihre Sachen auf.« Er hilft mir auf die Füße, wirft mir noch einen mitleidigen Blick zu und geht, wobei er sich mit dem Stock in die offene Hand schlägt.
Verzweifelt durchwühle ich noch einmal meine Handtasche und hoffe, wider besseres Wissen doch noch die Goldreifen zu finden, aber Wunder geschehen nur in Märchen oder im Film. Mir steckt ein dicker Kloß im Hals, und Tränen laufen über meine Wangen, während mir allmählich das ganze Ausmaß des Diebstahls klar wird. Überall um mich herum lachen Leute, essen, kaufen ein, genießen den Sonnenschein. Keiner von denen kann meine Qual verstehen. Als Kind habe ich einmal meine Lieblingspuppe verloren und deshalb zwei volle Tage geweint. Jetzt habe ich den kostbaren Schmuck meiner Mutter verloren, aber der Dieb hat mehr als nur Gold geklaut: Er hat uns unsere Zukunft gestohlen.
Ich stehe immer noch schluchzend auf dem Bürgersteig, als mein Blick auf eine riesige Reklamewand fällt, die Temperatur und Uhrzeit anzeigt. Mit einem Schock sehe ich, dass es schon nach zwei ist. Madan, mein unausstehlicher Chef, hat nicht viel für Angestellte übrig, die ihre Mittagspause überziehen.
Nicht auch das noch, denke ich und renne los. Meine sieben Zentimeter hohen Hacken tun höllisch weh und lassen mich immer wieder stolpern, aber ich schaffe es schließlich atemlos bis zum Laden – und hier ist irgendwas im Gange. Laute Stimmen sind zu hören, verwirrte Kunden werden mit unterwürfig vorgebrachten Entschuldigungen nach draußen geführt und das Gitter wird hastig zur Hälfte heruntergefahren, was einer Flagge auf halbmast gleichkommt, ein sicheres Zeichen für Ärger.
Ich schlüpfe unter dem Gitter durch in noch größeres Chaos, laute Rufe und Flüche. Gegenseitige Anschuldigungen sausen wie Papierflieger durch die Luft. Alle scheinen zur Kassiererkabine zu drängen, sogar Mr O.P. Gulati persönlich, der angesehene Besitzer des Geschäftes. Irgendwer schreit vor Schmerz. Ich drängle mich an Botenjungen, Büroangestellten, Lieferanten und Verkäufern vorbei und stelle fest, dass die Schreie von Mr Choubey kommen, unserem glatzköpfigen fünfundfünfzig Jahre alten Kassierer. Er wälzt sich auf dem Boden und wird gnadenlos von Madan verprügelt, unserem Manager und dem meistgehassten Mann im Laden. »Namak-haram! Du falsche Schlange!«, flucht Madan und schlägt Choubey dabei ins Gesicht, tritt ihm in den Unterleib. Madan, dieser brutale, aggressive Mann, kennt in seinem Leben nur zwei Vergnügen: vor Mr Gulati katzbuckeln und die sadistische Lust, wenn er Angestellte zusammenstauchen kann.
»Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich war nur zwanzig Minuten in der Mittagspause«, jammert der Kassierer, kann aber einen weiteren heftigen Schlag nicht verhindern. Eine Welle von Mitgefühl überschwemmt mich; mir wurden bloß ein paar goldene Armreifen gestohlen, aber Choubey hat seinen Stolz verloren, seine Würde.
»Was ist los?« Ich stupse Prachi an, und sie erzählt, was in meiner Abwesenheit passiert ist. Offenbar hat Mr Gulati nach dem Mittag eine überraschende Kassenprüfung angeordnet und dabei herausgefunden, dass aus der Vormittagsschicht fast zweihunderttausend Rupien fehlen. Da nur der Kassierer Zugriff auf die Kasse hat, wird Choubey vorgeworfen, das Geld unterschlagen zu haben.
»Ich hab’s nicht getan, ich schwöre es bei meinen drei Kindern«, greint der Kassierer.
»Sagen Sie mir, wo das Geld ist, dann verschone ich Sie vielleicht«, sagt Mr Gulati, dessen buschige Augenbrauen wie zwei Raupen zucken, die aufeinander zu kriechen.
»Ich hab das Geld nicht; Madan hat mich schon durchsucht«, ruft Choubey.
»Der Dreckskerl hat es bestimmt einem Komplizen in die Hand gedrückt«, überlegt Madan. »Ich finde, wir sollten ihn der Polizei übergeben, die holt im Handumdrehen die Wahrheit aus ihm heraus. Seit einiger Zeit unterhalte ich gute Kontakte zu Goswami, dem Inspektor des Polizeireviers am Connaught Place. Jetzt wäre der richtige Augenblick, sie zu nutzen.«
»Bitte, nur das nicht, sahib.« Choubey umklammert Mr Gulatis Beine. »Seit dreißig Jahren arbeite ich in diesem Geschäft. Ohne mich sterben meine Frau und meine Kinder.«
»Sollen sie doch krepieren«, erwidert Mr Gulati höhnisch und befreit sich von Choubeys Händen. »Rufen Sie diesen Inspektor an, Madan«, befiehlt er dann.
Ich kenne Choubey nicht besonders gut. Er ist ein stiller Mann, der gern für sich bleibt. Bislang hat sich unsere Beziehung auf den Austausch von Nettigkeiten beschränkt, doch habe ich ihn bislang stets für gewissenhaft, höflich und fleißig gehalten. Einfach undenkbar, dass er seinen Arbeitgeber betrogen haben könnte. Und selbst hartgesottene Verbrecher schwören keine falschen Eide auf ihre Kinder. Im selben Moment kommt mir eine Erinnerung in den Sinn: Raja Gulati, der auf seinem Motorrad hockt und ein Bündel Geldscheine zählt. Ich weiß, dass Gulati die Sauferei und Hurerei seines Sohnes nicht gefällt. Und dem korrupten Raja wäre es durchaus zuzutrauen, dass er die Kasse plündert, um seinen extravaganten Lebensstil zu finanzieren, wenn sein Vater ihm den Hahn abdreht.
»Warten Sie!«, wende ich mich an Madan. »Woher wissen Sie, dass Mr Choubey der Schuldige ist?«
Alle drehen sich zu mir um. Madan wirft mir einen mörderischen Blick zu, lässt sich aber zu einer Antwort herab. »Er hat als Einziger den Schlüssel zum Safe.«
»Haben die Mitglieder der Familie Gulati nicht auch einen Schlüssel?«
»Was wollen Sie damit andeuten?«, unterbricht mich Mr O.P. Gulati. »Dass ich mein eigenes Geschäft bestehle?«
»Ich sage ja nicht, dass Sie es waren, Sir, aber was ist mit Raja?«
Alle um mich herum scheinen die Luft anzuhalten.
»Haben Sie den Verstand verloren?« Madan bekommt fast einen cholerischen Anfall. »Raja-babu ist heute doch überhaupt nicht im Geschäft gewesen.«
»Aber vor einer Stunde habe ich ihn vor dem Laden gesehen, wie er ein Bündel Geldscheine gezählt hat.«