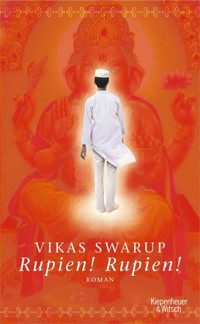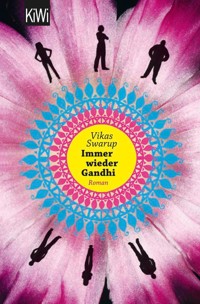
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Feuerwerk an Ideen, ein Plot, der Kapriolen schlägt. Vicky Rai, kaltblütiger Sohn des indischen Innenministers und selbst ein erfolgreicher und korrupter Unternehmer, ist erschossen worden, und das auf dem Fest, das er zur Feier seines Freispruchs schmeißt. Er hatte unter Mordanklage gestanden, nachdem er das Barmädchen Ruby Gill erschossen hatte: Sie hatte sich geweigert, ihm nach der Sperrstunde noch einen Drink zu servieren. Der Fall ist heikel, denn die Öffentlichkeit ist empört über Vicky Rais Machenschaften und Arroganz. Sechs Personen auf der Party haben eine Pistole und könnten ihn somit umgebracht haben, alle sechs hatten aufgrund der aberwitzigsten Geschichten mit Vicky Rai Kontakt. Warum sie ihn kannten, welche unglaublichen Dinge geschahen, die sie zur Party führten, und warum sie sogar ein Interesse an Vickys Tod haben könnten, das erzählt Vikas Swarup dem staunenden Leser auf seine unnachahmliche Weise. Alle Fans von »Rupien! Rupien!« dürfen sich auf einen würdigen Nachfolger freuen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 746
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Vikas Swarup
Immer wieder Gandhi
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Vikas Swarup
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Vikas Swarup
Vikas Swarup, 1963 geboren in Allahabad, studierte Geschichte, Psychologie und Philosophie in Allahabad, seit 1987 als Diplomat in der Türkei, den USA, Äthiopien, England und Südafrika, seit 2009 Generalkonsul in Osaka. 2006 erschien sein Roman »Rupien! Rupien!« der in zahlreiche Länder verkauft, von Danny Boyle verfilmt und rasch zum internationalen Bestseller wurde.
Bernhard Robben lebt als Journalist und Übersetzer in Brunne, wo er aus dem Englischen u.a. Hanif Kureishi, Ian McEwan, Brian Moore und Frank Ronan übersetzt.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Vicky Rai, kaltblütiger Sohn des indischen Innenministers und selbst ein erfolgreicher und korrupter Unternehmer, ist erschossen worden, und das auf dem Fest, das er zur Feier seines Freispruchs schmeißt. Er hatte unter Mordanklage gestanden, nachdem er das Barmädchen Ruby Gill erschossen hatte: Sie hatte sich geweigert, ihm nach der Sperrstunde noch einen Drink zu servieren. Der Fall ist heikel, denn die Öffentlichkeit ist empört über Vicky Rais Machenschaften und Arroganz. Sechs Personen auf der Party haben eine Pistole und könnten ihn somit umgebracht haben, alle sechs hatten aufgrund der aberwitzigsten Geschichten mit Vicky Rai Kontakt. Warum sie ihn kannten, welche unglaublichen Dinge geschahen, die sie zur Party führten, und warum sie sogar ein Interesse an Vickys Tod haben könnten, das erzählt Vikas Swarup dem staunenden Leser auf seine unnachahmliche Weise. Ein Feuerwerk an Ideen, ein Plot, der Kapriolen schlägt – alle Fans von »Rupien! Rupien!« dürfen sich auf einen würdigen Nachfolger freuen.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: Six Suspects
Copyright © by Vikas Swarup 2008
Aus dem Englischen von Bernhard Robben
© 2010, 2011, 2019, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © plainpicture / Lonely Planet; Silhouetten: © Kirsty Pargeter / stock.abobe.com
ISBN978-3-462-32069-5
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Indische Begriffe
Mord
1. Die nackte Wahrheit
Sechs Waffen und ein Mord
Verdächtige
2. Der Bürokrat
3. Die Schauspielerin
26. März
31. März
3. Mai
31. Mai
16. Juni
30. Juli
2. August
4. Der Stammesangehörige
5. Der Dieb
6. Der Politiker
7. Der Amerikaner
Motive
8. Die Verwandlungen von Mohan Kumar
9. Liebe in Mehrauli
10. Operation Schachmatt
11. Die Katalogbraut
12. Der Fluch der Onkobowkwe
13. Das Aschenputtel-Projekt
8. August
9. August
10. August
12. August
24. August
26. August
27. August
28. August
30. August
14. September
23. September
11. Oktober
25. Oktober
24. November
15. Dezember
31. Dezember
7. Januar
13. Januar
14. Januar
16. Januar
18. Januar
20. Januar
21. Januar
24. Januar
15. Februar
16. Februar
17. Februar
20. Februar
4. März
8. März
12. März
13. März
14. März
17. März
18. März
20. März
21. März
22. März
Beweise
14. Wiederherstellung
15. Annäherungen
16. Opfer
17. Rache
18. Erlösung
19. Evakuierung
24. März
Auflösung
20. Die nackte Wahrheit
Sex, Mord und Hörkassetten
21. Eilmeldung
Dies ist ein Transkript. Der Text ist vorläufig und wird u.u. noch aktualisiert.
22. Eilmeldung
Dies ist ein Transkript. Der Text ist vorläufig und wird u.u. noch aktualisiert.
23. Eilmeldung
Dies ist ein Transkript. Der Text ist vorläufig und wird u.u. noch aktualisiert.
24. Die nackte Wahrheit
Ich klage an!
25. Eilmeldung
Dies ist ein Transkript. Der Text ist vorläufig und wird u.u. noch aktualisiert.
26. Operation Stachel
Geständnis
27. Die Wahrheit
Danksagung
Glossar
Für Aparna
Eine Erklärung der indischen Begriffe befindet sich am Ende des Buches.
Mord
»Wie jede wahre Kunst widersteht ein Mord allen Erklärungsversuchen und verlangt nach Interpretationen.«
Michelle de Kretser: Der Fall Hamilton
1.Die nackte Wahrheit
Arun Advanis Kolumne, 25. März
Sechs Waffen und ein Mord
NICHT ALLE TODE SIND GLEICH, und selbst für Mord gilt das Kastenwesen. Wird ein armer Rikschafahrer abgestochen, ist das nur etwas für die Statistik, eine Meldung, die irgendwo im hinteren Teil der Zeitung verschwindet. Der Mord an einem Prominenten aber macht sofort Schlagzeilen, denn die Reichen und Berühmten werden selten umgebracht. Sie führen ein Fünf-Sterne-Leben und sterben, wenn nicht an einer Überdosis Kokain oder durch irgendeinen verrückten Unfall, meist auch einen Fünf-Sterne-Tod, glücklich ergraut in hohem Alter, allerdings nicht ohne zuvor die eigene Sippe samt dazugehörigem Vermögen kräftig vermehrt zu haben.
Das ist auch der Grund, weshalb die Ermordung von Vivek ›Vicky‹ Rai – dem zweiunddreißig Jahre alten Eigentümer der Industriegruppe Rai und Sohn des Innenministers von Uttar Pradesh – die Nachrichten der letzten beiden Tage derart dominierte.
Während meiner langen und bewegten Karriere als Enthüllungsjournalist konnte ich so manches aufdecken, angefangen bei Korruption an höchster Stelle bis hin zu Pestiziden in Coca-Cola-Flaschen. Meine Storys haben Regierungen zu Fall gebracht und zum Bankrott von Weltkonzernen beigetragen. Habgier, Bosheit und Verderbtheit musste ich im Verlauf meiner Arbeit aus nächster Nähe erleben, doch kaum etwas hat mich derart angewidert wie diese Saga um Vicky Rai. Sein Name war in unserem Land der Inbegriff von Korruption. Länger als ein Jahrzehnt habe ich seinem Leben und seinen Verbrechen nachgespürt wie eine Motte, die unwiderstehlich vom Licht angezogen wird. Es war gewiss eine morbide Faszination, der Lust vergleichbar, mit der man sich einen Horrorfilm anschaut. Man weiß, dass etwas Schreckliches geschehen wird, und doch sitzt man da wie gebannt, hält den Atem an und wartet darauf, dass das Unvermeidliche geschieht. Ich erhielt mehrere ernst gemeinte Warnungen und sogar Todesdrohungen, und man hat auch versucht, mich zu entlassen, mich aus der Redaktion dieser Zeitung zu feuern. Ich habe überlebt, Vicky Rai nicht.
Inzwischen sind die Einzelheiten seiner Ermordung so bekannt wie die neuesten Schicksalswendungen in einer Familienserie aus dem Vorabendprogramm. Am letzten Sonntag wurde Vicky Rai um fünf Minuten nach Mitternacht in seinem Landhaus in Mehrauli am Stadtrand von Delhi von einem bislang unbekannten Täter erschossen. Laut forensischem Befund wurde der Tod durch eine aus kurzer Distanz abgefeuerte Kugel herbeigeführt, die sich in seine Brust bohrte, das Herz durchschlug, am Rücken wieder austrat und im Holztresen stecken blieb. Es wird angenommen, dass Vicky Rai auf der Stelle tot war.
Er hat zweifellos eine Menge Feinde gehabt. Vielen Menschen war seine Arroganz verhasst, sein Playboydasein und seine freche Missachtung von Recht und Gesetz. Aus dem Nichts hat er ein gigantisches Industrieimperium aufgebaut. Und niemand baut in Indien ein Imperium auf, ohne dabei irgendwelchen Leuten auf die Füße zu treten. Leser dieser Kolumne werden sich an meine Artikel über Vicky Rais Insidergeschäfte an der Börse erinnern, darüber, wie er Investoren um ihre Dividende betrogen, Beamte bestochen und die Körperschaftssteuer hinterzogen hat. Trotzdem bekam man ihn niemals zu fassen, immer wieder konnte er dem Zugriff des Gesetzes durch irgendein Schlupfloch entwischen.
Diese Kunst lernte er schon ziemlich früh zu perfektionieren. Er war gerade siebzehn, als man ihn zum ersten Mal vor Gericht brachte. Ein Freund seines Vaters hatte ihm zum Geburtstag einen dicken BMW geschenkt, einen aus der 5er- Reihe, woraufhin er mit drei Kumpeln eine kleine Spritztour machte. Bis in die Nacht hinein hatten sie eine laute, ausgelassene Party in einer angesagten Bar gefeiert. Als Vicky Rai dann gegen drei Uhr morgens durch dichten Nebel heimfuhr, bretterte er über sechs Obdachlose, die auf dem Bürgersteig schliefen. Am nächsten Checkpoint wurde er von der Polizei angehalten; wie sich herausstellte, war Vicky Rai sturzbetrunken. Also hat man ihn wegen rücksichtslosen Fahrens und Alkohol am Steuer angeklagt. Doch als es schließlich zum Prozess kam, waren alle Familienmitglieder der Verstorbenen längst geschmiert worden. Kein Zeuge konnte sich daran erinnern, in jener Nacht einen BMW gesehen zu haben. Man wusste nur noch, dass da ein LKW mit einem Nummernschild aus Gujarat gewesen war. Vicky Rai wurde vom Richter über die Gefahren von Trunkenheit am Steuer aufgeklärt und freigesprochen.
Drei Jahre später stand er wieder vor Gericht. Ihm wurde zur Last gelegt, in einem Tierreservat in Rajasthan zwei schwarze Hirschziegenantilopen gejagt und erlegt zu haben. Vicky Rai gab zu, er hätte nicht gewusst, dass es sich dabei um eine geschützte Tierart handelte, fand es aber doch sehr merkwürdig, dass man in einem Land, in dem Bräute aus Mitgiftgründen verbrannt und junge Frauen wegen Prostitution verhaftet werden, Menschen nur deshalb verklagte, weil sie Antilopen jagten. Nun, Gesetz ist Gesetz. Er wurde also verhaftet und musste zwei Wochen im Gefängnis bleiben, ehe er auf Kaution wieder freikam. Wir wissen alle, was dann geschah. Kishore, der einzige Augenzeuge – der Förster im offenen Jeep –, starb sechs Monate später unter reichlich mysteriösen Umständen. Der Fall schleppte sich noch einige Jahre hin, endete aber, wie vorherzusehen gewesen wäre, mit Vicky Rais Freispruch.
Angesichts dieser Vorgeschichte war es zweifellos nur eine Frage der Zeit, bis Vicky Rai es wagte, unverhohlen einen Mord zu begehen. Es geschah vor sieben Jahren während einer heißen Sommernacht im Mango, dem trendigen Restaurant am Highway von Delhi nach Jaipur, in dem Vicky eine große Party zur Feier seines fünfundzwanzigsten Geburtstags veranstaltete. Das Fest begann um neun Uhr abends und dauerte bis lang nach Mitternacht. Eine Live-Band gab die neuesten Hits zum Besten, importierter Alkohol floss in Strömen, und Vicky Rais Gäste – eine bunte Mischung aus höheren Beamten, Schickeriatypen, aktuellen wie verflossenen Geliebten, Leuten aus der Filmindustrie und ein paar berühmten Sportlern – ließen es sich gut gehen. Vicky hatte ordentlich einen über den Durst getrunken. Gegen zwei Uhr morgens taumelte er zum Tresen und verlangte noch einen Tequila von der Kellnerin, einer hübschen, jungen Frau in Jeans und weißem T-Shirt. Sie hieß Ruby Gill, war Doktorandin der Universität Delhi und jobbte im Mango, um ihre Familie ernähren zu können.
»Tut mir leid, ich darf Sie nicht mehr bedienen, Sir. Die Bar ist jetzt geschlossen«, sagte sie.
»Ich weiß, Honey.« Er warf ihr sein verführerischstes Lächeln zu, »aber ich will nur einen letzten Drink, und dann gehen wir auch alle brav nach Hause.«
»Tut mir leid, Sir. Die Bar ist geschlossen. Wir müssen uns an die Vorschriften halten«, sagte sie, diesmal in eher resolutem Ton.
»Scheiß auf die Vorschriften«, fauchte Vicky sie an. »Weißt du nicht, wer ich bin?«
»Nein, Sir, und das ist mir auch egal. Die Vorschriften gelten für alle. Ich werde Ihnen keinen Drink mehr ausschenken.«
Vicky Rai bekam einen Tobsuchtsanfall. »Du dreckige Nutte!«, schrie er und riss einen Revolver aus seiner Anzugsjacke. »Das soll dir eine Lehre sein!« Er feuerte zweimal und schoss ihr im Beisein von mindestens fünfzig Gästen in Hals und Gesicht. Ruby Gill sank tot zu Boden, und im Mango brach die Hölle los. Ein Freund, so wurde berichtet, packte Vicky am Arm, zerrte ihn zu seinem Mercedes und brachte ihn weg. Fünfzehn Tage später wurde Vicky Rai in Lakhnau verhaftet und vor den Richter gebracht; es gelang ihm erneut, auf Kaution freizukommen.
Ein Mord, nur weil ihm ein Drink verweigert wurde – das erschütterte das Gewissen der Nation. Und die Kombination aus Vicky Rais notorischer Berühmtheit und Ruby Gills Schönheit sorgte dafür, dass der Fall noch wochenlang Schlagzeilen machte. Dann aber ging der Sommer in den Herbst über, und wir wandten uns neuen Geschichten zu. Als der Fall schließlich vor Gericht kam, hieß es im ballistischen Gutachten, dass die zwei Kugeln aus verschiedenen Waffen stammten. Vicky Rais Revolver war unerklärlicherweise aus der Asservatenkammer der Polizei ›verschwunden‹. Und mehrere Zeugen, die behaupteten, sie hätten gesehen, wie er zur Waffe griff, zogen ihre Aussagen zurück. Nach einem fünf Jahre dauernden Prozess wurde Vicky Rai schließlich heute genau vor einem Monat, am fünfzehnten Februar, von jedem Verdacht freigesprochen. Um das Urteil zu feiern, gab er eine Party auf seinem Landsitz in Mehrauli. Und da sollte er dann sein Ende finden.
Manch einer mag dies ausgleichende Gerechtigkeit nennen, für die Polizei aber ist es ein Verbrechen gemäß indischem Strafgesetzbuch, Paragraf 302 – Totschlag, vermutlich Mord –, weshalb eine landesweite Fahndung nach dem Täter ausgelöst wurde. Der Polizeipräsident persönlich leitet die Untersuchung, da ihn zweifellos die Sorge antreibt, der in Aussicht gestellte Posten des Vizegouverneurs von Delhi (wie vor sechs Wochen in dieser Kolumne berichtet) könnte für ihn wieder in weite Ferne rücken, sollte es ihm nicht gelingen, diesen Fall zu lösen.
Seiner Sorgfalt sind beachtliche Ergebnisse zu verdanken. Aus zuverlässigen Quellen weiß ich, dass man sechs Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen und des Mordes an Vicky Rai angeklagt hat. Offenbar war Unterinspektor Vijay Yadav zum Zeitpunkt des Mordes im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Mehrauli im Einsatz. Er ließ den Landsitz unverzüglich weiträumig absperren und ordnete eine Leibesvisitation aller etwa dreihundert geladenen Gäste an, ebenso der ungeladenen Gäste, der Kellner und der neugierigen Zuschauer. Auf dem Gelände wimmelte es nur so vor Waffen, und die Untersuchung ergab, dass allein sechs Personen im Besitz einer Pistole waren. Sie wurden festgenommen. Ich nehme an, dass sie heftig protestiert haben. Schließlich ist es kein Vergehen, eine Waffe bei sich zu tragen, sofern man im Besitz eines gültigen Waffenscheins ist. Nimmt man allerdings eine Waffe auf eine Party mit, auf der irgendwer den Gastgeber erschießt, wird man automatisch zum Verdächtigen.
Die Verdächtigen bilden einen kunterbunten Haufen, eine merkwürdige Mischung aus den Bösen, Schönen und Hässlichen. Dazu gehört Mohan Kumar, der ehemalige Staatsminister von Uttar Pradesh, dessen Ruf als korrupter Beamter und Schürzenjäger innerhalb des indischen Verwaltungsdienstes geradezu legendär ist. Zweiter im Bunde ist ein etwas beschränkter Amerikaner, der behauptet, Filmproduzent aus Hollywood zu sein. Pikant wird die Sechser-Mischung durch die berühmte Schauspielerin Shabnam Saxena, in die Vicky Rai hemmungslos verknallt war, wenn man dem Klatsch der Boulevardzeitschriften glauben darf. Außerdem gehört zur Runde ein rabenschwarzer, genau anderthalb Meter kleiner Stammesangehöriger aus einem gottverlassenen Flecken in Jharkhand, der nur unter Einhaltung strengster Sicherheitsmaßnahmen verhört wird, da man Angst hat, er könnte zu den gefürchteten Naxaliten gehören, die diesen Staat im Norden terrorisieren. Verdächtiger Nummer fünf ist ein Arbeitsloser namens Munna, der einen BA in Politologie hat, sich aber hauptsächlich als Handy-Dieb über Wasser hält. Und komplettiert wird die Runde zu guter Letzt durch Jagannath Rai höchstpersönlich, den Innenminister von Uttar Pradesh, Vicky Rais Vater. Kann ein Vater noch tiefer sinken?
Die sechs sichergestellten Waffen sind recht verschieden. Da wäre eine britische Webley & Scott zu nennen, eine österreichische Glock, eine deutsche Walther PKK, eine italienische Beretta, eine chinesische Black Star sowie ein einheimischer Revolver, auch katta genannt. Die Polizei scheint überzeugt zu sein, dass eine der sechs Pistolen die Mordwaffe ist, weshalb sie auf das ballistische Gutachten wartet, um der Kugel eine Waffe zuordnen und den Schuldigen nennen zu können.
Barkha Das hat mich gestern in ihrer Fernsehsendung interviewt. »Einen Großteil Ihrer Karriere haben Sie darauf verwandt, die Machenschaften von Vicky Rai aufzudecken und ihn in Ihrer Kolumne an den Pranger zu stellen. Was werden Sie jetzt tun, da er tot ist?«, hat sie mich gefragt.
»Seinen Mörder finden«, habe ich geantwortet.
»Warum?«, wollte sie wissen. »Sind Sie nicht einfach nur froh, dass Vicky Rai tot ist?«
»Nein«, lautete meine Antwort, »denn mein Feldzug hat sich nie allein gegen Vicky Rai gerichtet. Er galt dem System, das die Reichen und Mächtigen glauben lässt, sie stünden über dem Gesetz. Vicky Rai war nur ein sichtbares Symptom jener Krankheit, die unsere ganze Gesellschaft befallen hat. Und wenn die Gerechtigkeit wirklich blind ist, dann verdient es Vicky Rais Mörder ebenso zur Rechenschaft gezogen zu werden wie Vicky Rai selbst.«
Und ich sage dies auch meinen Lesern. Ich werde Vicky Rais Mörder aufspüren. Ein echter Enthüllungsjournalist darf sich nicht von persönlichen Vorurteilen lenken lassen. Er muss den Weg der kalten Logik bis zu Ende gehen, wohin und zu wem er auch immer führen mag. Und er muss ein unparteiischer Profi bleiben, der nichts als die nackte Wahrheit sucht.
Ein Mord kann schmutzig sein, aber die Wahrheit ist oft noch schmutziger. All die losen Stränge zu verknüpfen ist nicht einfach, ich weiß. Die Lebensgeschichten der sechs Verdächtigen müssen durchleuchtet, Motive gefunden und Beweise gesammelt werden; erst dann können wir den wahren Schuldigen finden.
Welcher der sechs Verdächtigen wird es sein? Der Bürokrat oder die Schöne? Der Ausländer oder der Stammesangehörige? Ein großer oder ein kleiner Fisch?
Zu diesem Zeitpunkt kann ich Ihnen nur sagen: Lesen Sie weiterhin diese Zeitung, bleiben Sie meiner Kolumne treu.
Verdächtige
»Die Angeklagten sind eben die Schönsten.«
Franz Kafka: Der Prozess
2.Der Bürokrat
MOHAN KUMAR WIRFT EINEN BLICK auf seine Armbanduhr, löst sich aus den Armen seiner Geliebten und steht auf.
»Es ist schon drei. Ich muss los«, sagt er, während er im Kleiderhaufen neben dem Bett nach seiner Unterwäsche sucht.
Hinter ihm springt die Klimaanlage an und bläst einen Schwall lauwarmer Luft ins abgedunkelte Zimmer. Missmutig starrt Rita Sethi auf das Gerät. »Hat dieses elende Ding eigentlich jemals funktioniert? Ich habe dir gesagt, du sollst ein White Westinghouse besorgen. Diese indischen Fabrikate halten keinen Sommer durch.«
Die Rollladen vor den Fenstern sind unten, doch die drückende Hitze dringt trotzdem ins Schlafzimmer, sodass die Laken sich wie dicke Decken anfühlen.
»Ausländische Fabrikate sind nichts für die Tropen«, erwidert Mohan Kumar. Er hat größte Lust, nach der Flasche Chivas Regal auf dem Nachtschränkchen zu greifen, entscheidet sich aber dagegen. »Ich sollte mich lieber auf den Weg machen. Um vier Uhr ist Vorstandssitzung.«
Rita streckt die Arme aus, gähnt und lässt sich zurück in die Kissen fallen. »Warum gehst du noch zur Arbeit? Hat Mohan Kumar vergessen, dass er nicht mehr Staatsminister ist?«
Er verzieht das Gesicht, als hätte Rita an einer frischen Wunde gerührt. Mit seinem Ruhestand kann er sich immer noch nicht abfinden.
Siebenunddreißig Jahre lang war er in der Regierung gewesen – hatte Politiker manipuliert, Kollegen vorgesessen und Geschäfte abgeschlossen. Im Laufe dieser Jahre hat er Häuser in sieben Städten erworben, ein Shoppingcenter in Noida und ein Bankkonto in Zürich. Er hat es genossen, ein Mann von Einfluss zu sein. Ein Mann, der die Staatsmaschinerie mit einem einzigen Anruf in Gang setzen konnte, dessen Freundschaft verschlossene Türen öffnete, dessen Ärger Karrieren und Firmen zerstörte und dessen Unterschrift wahre Schätze im Wert von mehreren Millionen Rupien freigeben konnte. Sein stetiger Aufstieg im Bürokratieapparat hatte ihn selbstzufrieden werden lassen. Er dachte, es würde immer so weiter gehen. Doch dann besiegte auch ihn die Zeit, das unaufhaltsame Ticken der Uhr, die sechzig schlug und ihn mit diesem einen Schlag aller Macht beraubte.
In den Augen der Kollegen ist ihm der Ausstieg aus der Regierung ziemlich gut gelungen. Er sitzt jetzt im Vorstand von einem halben Dutzend privater Firmen, die zum Industriekonzern Rai gehören und das Zehnfache seines früheren Gehalts einbringen. Außerdem kann er über eine Firmenvilla in Lutyens’ Delhi und einen Firmenwagen verfügen. Aber diese Vergünstigungen vermögen ihn nicht über den Verlust an Einfluss hinwegzutrösten. An Macht. Ohne ihre Aura kommt er sich minderwertig vor, wie ein König ohne Reich. In den ersten Monaten des Ruhestandes ist er nachts manchmal schweißgebadet aufgewacht, um gleich nach dem Handy zu greifen und zu prüfen, ob er nicht vielleicht einen Anruf des Ministerpräsidenten verpasst hat. Tagsüber blickte er unwillkürlich immer wieder zur Auffahrt hinüber und suchte nach dem tröstlichen Anblick des weißen Ambassadors mit blitzendem Blaulicht. Manchmal fühlte sich die fehlende Macht wie ein körperlicher Mangel an, wie der Phantomschmerz, der nach einer Amputation zurückbleibt. Die Krise nahm solche Ausmaße an, dass er seinen ehemaligen Arbeitgeber sogar um ein Büro bat. Vicky Rai tat ihm den Gefallen und wies ihm am Bhikaj Cama Place ein Zimmer in der Konzernzentrale von Rai Industries zu. Da fährt er jetzt jeden Tag hin, bleibt von neun bis fünf und liest ein paar Projektberichte, spielt aber meist auf seinem Laptop Sudoku und klickt sich im Internet durch Pornoseiten. Die Routine erlaubt ihm die Illusion, er sei noch erwerbstätig; und sie liefert ihm den Vorwand, eine Weile aus dem Haus zu verschwinden und seine Frau nicht sehen zu müssen. Außerdem kann er sich so an den Nachmittagen problemlos für ein Stelldichein mit seiner Geliebten verdrücken.
Immerhin ist mir Rita geblieben, denkt er, während er sich den Schlips bindet und ihren nackten Körper betrachtet, das schwarze Haar, das wie ein Fächer über die Kissen fällt.
Sie ist geschieden und hat keine Kinder, dafür aber einen gut bezahlten Job, der sie nur dreimal die Woche zwingt, ins Büro zu gehen. Der Altersunterschied zwischen ihnen beträgt siebenundzwanzig Jahre, einen Unterschied in Naturell und Vorlieben aber gibt es nicht. Manchmal kommt es ihm vor, als sei sie ein Spiegelbild seiner selbst, als wären sie Seelenverwandte, die sich nur durch das Geschlecht voneinander unterscheiden. Trotzdem gibt es das ein oder andere, das er an ihr nicht mag. Sie ist zu fordernd, nörgelt ständig, er solle ihr mehr Gold und Diamanten schenken. Und sie beklagt sich einfach über alles, ob über ihr Haus oder über das Wetter. Außerdem besitzt sie ein ungezügeltes Temperament, hat einmal sogar, wie allgemein bekannt, einen früheren Boss geohrfeigt, als der sich ihr gegenüber zu viel herausnehmen wollte. Allerdings macht sie diese Mängel durch ihre Fähigkeiten im Bett mehr als wett. Er bildet sich ein, ein guter Liebhaber zu sein. Mit sechzig hat seine Manneskraft noch kein bisschen nachgelassen. Und er weiß, dass er mit seiner Körpergröße, der hellen Haut und dem vollen Haarschopf, den er sich alle vierzehn Tage sorgsam färben lässt, auf Frauen keineswegs unattraktiv wirkt. Trotzdem fragt er sich, wie lange Rita noch bei ihm bleibt und wann seine gelegentlichen Geschenke, das Parfüm und die Perlen nicht mehr verhindern können, dass sie mit einem jüngeren, reicheren und mächtigeren Mann anbandelt. Bis dahin allerdings gibt er sich mit diesen gestohlenen Nachmittagen zweimal die Woche zufrieden.
Rita greift unter ihr Kissen und fischt eine Packung Virginia Slim sowie ein Feuerzeug hervor. Lasziv steckt sie sich eine Zigarette an, nimmt einen Zug und bläst dann einen Rauchring aus, der sofort von der Klimaanlage aufgesogen wird. »Hast du die Tickets für die Show am Dienstag?«
»Was für eine Show?«
»Die, in der man an Gandhis Geburtstag Kontakt mit seinem Geist aufnehmen will.«
Mohan sieht sie neugierig an. »Seit wann glaubst du an einen solchen Mumpitz?«
»Eine Séance ist kein Mumpitz.«
»Für mich schon. Ich glaube nicht an Geister.«
»Du glaubst auch nicht an Gott.«
»Nein, ich bin Atheist und seit dreißig Jahren in keinem Tempel mehr gewesen.«
»Tja, ich auch nicht, trotzdem glaube ich an Gott. Und es heißt, Aghori Baba sei ein großartiges Medium und könne wirklich mit Geistern reden.«
»Pah!«, schnaubt Mohan Kumar verächtlich. »Dieser Baba ist kein Medium, höchstens ein billiger Tantriker, der gewiss der Fleischeslust frönt. Und Gandhi ist kein internationaler Popstar. Meine Güte, er ist der Vater der Nation! Er verdient wirklich ein bisschen mehr Respekt.«
»Wieso sollte es respektlos sein, mit seinem Geist Kontakt aufzunehmen? Ich bin froh, dass eine indische Firma den Abend managt und noch kein ausländischer Konzern auf die Idee gekommen ist, Gandhi zu vermarkten als wäre er Basmatireis. Lass uns am Dienstag hingehen, Liebling.«
Er schaut ihr in die Augen. »Wie sieht das denn aus, wenn ein ehemaliger Staatsminister zu einer so absonderlichen Veranstaltung wie einer Séance geht? Ich muss an meinen Ruf denken.«
Rita bläst einen weiteren Rauchring zur Decke und antwortet mit einem spöttischen Lachen. »Na ja, wenn dir die nachmittäglichen Techtelmechtel mit mir nichts ausmachen, obwohl du eine Frau und einen erwachsenen Sohn hast, verstehe ich nicht, wieso du etwas gegen diese Show haben kannst.«
Sie bringt die Worte leichthin vor, doch sie verletzen ihn. Er weiß genau, vor sechs Monaten, als er noch Staatsminister war, hätte sie so etwas niemals gesagt. Und er begreift, dass sich auch seine Geliebte geändert hat. Selbst der Sex mit ihr ist anders, so als hielte Rita sich zurück, da sie wusste, dass seine Macht, für sie Einfluss auszuüben, geringer geworden, wenn nicht gar ganz verschwunden ist.
»Hör mal, Rita, ich gehe da bestimmt nicht hin«, erklärt er mit verletztem Stolz und zieht sich die Jacke an. »Aber wenn du unbedingt zu dieser Séance willst, besorge ich dir natürlich eine Eintrittskarte.«
»Warum nennst du es ständig Séance? Stell dir einfach vor, es sei eine Show, eine Filmpremiere. All meine Freundinnen gehen hin. Sie sagen, der Abend schafft es sicher auf Seite drei. Ich habe mir sogar extra einen neuen Chiffon-Sari gekauft. Komm schon, sei kein Spielverderber, Darling.« Sie zieht einen Schmollmund.
Er weiß, wenn Rita etwas kann, dann beharrlich sein. Hat sie sich erst einmal etwas in den Kopf gesetzt, ist es so gut wie unmöglich, sie wieder davon abzubringen – wie er zu seinem eigenen Leidwesen erfahren musste, als sie sich zu ihrem zweiunddreißigsten Geburtstag einen Tanzanit-Anhänger gewünscht hatte.
Also gibt er großmütig nach. »Na schön, dann besorge ich eben zwei Karten. Aber gib mir ja nicht die Schuld, wenn dir bei Aghori Baba übel wird.«
»Wird mir nicht!«, ruft Rita und gibt ihm einen Kuss.
Und so kommt es, dass Mohan Kumar am Abend des zweiten Oktober um fünf vor halb acht vor dem Siri Fort Auditorium ein wenig widerstrebend aus seinem von einem Chauffeur gelenkten Hyundai Sonata steigt.
Der Veranstaltungsort gleicht einer Festung im Belagerungszustand. Ein großer Trupp Polizisten in voller Kampfmontur versucht, eine Meute aufsässiger Demonstranten zu bändigen, die wütend irgendwelche Slogans ruft und Plakate schwenkt: DER VATER DER NATION STEHT NICHT ZUM VERKAUF; AGHORI BABA IST EIN SCHARLATAN; BOYKOTTIERT UNITED ENTERTAINMENT: GLOBALISIERUNG IST DER UNTERGANG. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht eine Batterie von Fernsehkameras, die ernst dreinblickende, atemlos Bericht erstattende Nachrichtensprecher filmen.
Mohan Kumar drängt sich durch das Getümmel und hält dabei eine Hand schützend über die Brieftasche in der Innentasche seines hellgrauen Leinenanzugs. Rita, elegant mit schwarzem Chiffon-Sari und Korsettbluse, folgt ihm auf ihren Stilettoabsätzen.
Er entdeckt Barkha Das, Indiens bekannteste Fernsehjournalistin, die direkt vor dem schmiedeeisernen Eingangstor steht. »Der verehrteste Name im Pantheon der Staatsführer Indiens ist jener von Mohandas Karamchand Gandhi oder auch Bapu, wie er liebevoll von Millionen Indern genannt wird«, spricht sie in ein Handmikro. »United Entertainments Absicht, anlässlich der feierlichen Wiederkehr seines Geburtstages Kontakt mit Gandhis Geist aufzunehmen, hat Proteste im ganzen Land entfacht. Mahatma Gandhis Familie nannte dieses Vorhaben eine Entwürdigung der Nation. Doch da sich der Oberste Gerichtshof weigert, dagegen einzuschreiten, hat es ganz den Anschein, als ob man auch diesen heiligsten aller Namen heute auf dem Altar kommerzieller Habgier opfern wird. Offenbar wird diese schändliche Séance also tatsächlich stattfinden.« Sie spitzt die Lippen und verzieht das Gesicht auf eine Weise, die ihr Publikum nur allzu gut kennt.
Mohan Kumar nickt in stummem Einverständnis, während er sich zentimeterweise weiter auf das Tor zubewegt. Plötzlich wird ihm das knollenförmige Mikro der Reporterin unter die Nase gehalten. »Entschuldigen Sie, mein Herr, glauben Sie an Geister?«
Ein Kameramann, der unauffällig zur Linken der Reporterin steht, schwenkt zu ihm um und richtet die Sony Betacam auf sein Gesicht.
»Verdammt!«, flucht Mohan Kumar lautlos vor sich hin, während er sich instinktiv dagegen sträubt, vom nationalen Fernsehen aufgenommen zu werden. Neben ihm plustert sich Rita auf und hofft, das Auge der Kamera auf sich lenken zu können.
»Glauben Sie an Geister?«, wiederholt Barkha Das ihre Frage.
»Höchstens an Weingeister«, erwidert er in sarkastischem Ton und hastet durch das Tor, um sich in die lange Schlange der Kartenbesitzer einzureihen, die vor dem Metalldetektor der Sicherheitskontrolle anstehen.
»Klasse Antwort!« Rita strahlt und drückt sanft seinen Arm.
Nach einer nicht enden wollenden Wartezeit, in der seine Eintrittskarte von drei verschiedenen Kartenprüfern sorgfältig kontrolliert, sein Körper nach Waffen und spitzen Metallgegenständen abgetastet und ihm das Handy für die Dauer der Veranstaltung abgenommen wird, lässt man Mohan Kumar endlich in das hell erleuchtete Foyer des Auditoriums. Livrierte Kellner verteilen Limonade und vegetarische Kanapees. Auf einer erhöhten Plattform in der hintersten Ecke sitzt eine Sängergruppe mit überschlagenen Beinen und trägt zur Begleitung von Tablas und Harmonium Vaishanv Janato vor, Mahatma Gandhis Lieblings-Bhajan. Mohan Kumars Laune bessert sich, als er in der Menge mehrere bekannte Persönlichkeiten entdeckt – den obersten Prüfer des Rechnungshofes, den stellvertretenden Polizeipräsidenten, fünf oder sechs Parlamentsmitglieder, einen ehemaligen Kricketspieler, den Vorsitzenden des Golfklubs sowie eine Reihe von Journalisten, Geschäftsleuten und hochrangigen Bürokraten. Rita löst sich von ihm, um sich ihren Schickeriafreundinnen anzuschließen, die einander mit gekünstelten Freudenjuchzern und gespielter Überraschung begrüßen.
Der Besitzer einer Textilfabrik, ein Mann mittleren Alters, den Mohan Kumar einmal um eine ordentliche Bestechungssumme erleichtert hat, geht an ihm vorbei und weicht gezielt jedem Blickkontakt aus. Vor sechs Monaten wäre er noch um mich herumscharwenzelt, denkt Mohan Kumar verbittert.
Es dauert eine weitere Viertelstunde, ehe sich die Türen zum Auditorium öffnen und ein Saaldiener sie nach vorn führt. Dank des Entgegenkommens einer IT-Firma, in deren Vorstand Kumar jetzt sitzt, hat er zwei der besten Plätze besorgt, direkt in der Mitte der ersten Reihe. Rita wirkt sichtlich beeindruckt.
Rasch füllt sich der Saal mit Delhis Mächtigen, Reichen und Schönen. Mohan wirft einen Blick auf die Leute in seiner unmittelbaren Nachbarschaft. Die dauergewellten Damen wirken ein wenig vulgär in ihrem Seidenbrokat, die Männer leicht lächerlich in ihren Fabindia kurtas und Nagra jutis.
»Siehst du, Darling, ich habe dir doch gesagt, heute Abend kommt alles, war Rang und Namen hat.« Rita zwinkert ihm zu.
Das Publikum hüstelt, rutscht unruhig auf den Stühlen hin und her und wartet auf den Beginn der Show, aber der Samtvorhang vor der Bühne rührt sich keinen Millimeter.
Um halb neun, also mit einer Stunde Verspätung, wird das Licht endlich heruntergedimmt. Kurz darauf breitet sich gespenstische Dunkelheit im Saal aus. Gleichzeitig ertönen Sitarklänge, und langsam hebt sich der Vorhang. Ein einzelner Scheinwerfer erhellt die Bühne, die bis auf eine Strohmatte leer ist. Vor der Matte hat man diverse Dinge ausgebreitet – ein handbetriebenes Spinnrad, eine Brille, einen Spazierstock und ein Bündel Briefe. Ein schlichtes Banner mit dem blauweißen Logo von United Entertainment ziert den Hintergrund.
Ein vertrauter Bariton tönt aus den großen schwarzen Boxen zu beiden Seiten der Bühne. »Seien Sie gegrüßt, meine Damen und Herren. Ich, Veer Bedi, werde heute Abend Ihr Gastgeber sein. Ja, genau, derselbe Veer Bedi, den Sie von Ihrer Mattscheibe daheim kennen. Sie können mich nicht sehen, aber Sie wissen natürlich, dass ich hier bin, gleich hinter der Bühne. Mit Geistern verhält es sich ähnlich. Sie können sie nicht sehen, aber sie sind immer unter uns.
In wenigen Minuten werden wir nun Kontakt mit dem berühmtesten aller Geister suchen, mit jenem Mann, der im Alleingang den Lauf des zwanzigsten Jahrhunderts verändert hat. Mit dem Mann, von dem Einstein sagte: ›Künftige Generationen werden kaum glauben, dass einer wie er in Fleisch und Blut auf dieser Erde gewandelt ist.‹ Ja, ich rede von keinem Geringeren als Mohandas Karamchand Gandhi, unserem geliebten Bapu, der im Jahre 1869 an eben diesem Tag geboren wurde.
Und vor fast sechs Jahrzehnten wurde Bapu nur wenige Kilometer von hier zum Märtyrer, doch heute kehrt er ins Leben zurück. Mit Ihren eigenen Ohren werden Sie Mahatma Gandhi durch Baba Aghori Prasad Mishra reden hören, einem international anerkannten Medium. Aghori Baba besitzt siddhi, jene göttliche, durch Yoga erlangte Energie, die es ermöglicht, den Schleier zwischen dieser Welt und der nächsten zu heben und mit den Geistern zu reden.
Ich weiß, es sind noch einige Zweifler im Publikum, die diese Begegnung mit Bapu für einen bloßen Schwindel halten. Ich gehörte früher selbst zu den Skeptikern – ich wurde eines Besseren belehrt. Lassen Sie mich Ihnen allen etwas Persönliches anvertrauen.« Verschwörerisch senkt Veer Bedi die Stimme. »Vor fünf Jahren verlor ich meine Schwester durch einen Autounfall. Wir standen uns sehr nahe, und ich habe sie schrecklich vermisst. Vor zwei Monaten dann hat Baba Aghori Prasad Mishra Kontakt mit ihr aufgenommen. Durch ihn habe ich mit meiner Schwester geredet und von ihrer Reise ins Jenseits erfahren. Es war die erstaunlichste, erschütterndste Erfahrung meines Lebens. Und deshalb bin ich heute hier, um persönlich für Aghori Baba einzustehen. Ich kann Ihnen garantieren, dass das, was Sie heute Abend erleben, eine einmalige Erfahrung sein wird, die Sie auf immer verändert.«
Zustimmendes Gemurmel aus dem Publikum.
»Wie Sie alle wissen, haben wir uns gewünscht, dass Mahatma Gandhis Familie heute Abend bei uns ist, doch zog sie es vor, diesem historischen Ereignis fernzubleiben. Dennoch konnten wir die Unterstützung mächtiger Wohltäter gewinnen, die Mahatma zu seinen Lebzeiten gut gekannt haben. Von ihnen wurden uns einige seiner Sachen zur Verfügung gestellt, die Sie hier auf der Bühnenmitte sehen können. Da ist zum einen sein hölzernes charkha, das Spinnrad, mit dem er das khadi-Baumwolltuch seiner Kleider gesponnen hat. Daneben liegt sein Lieblingsspazierstock sowie eine seiner typischen Brillen mit den runden Gläsern; das Bündel dort drüben enthält übrigens einige Briefe, die vom großen Mahatma persönlich geschrieben wurden.
Lassen Sie mich, ehe ich Baba Aghori Prasad Mishra nun auf die Bühne bitte, kurz an die Regeln für diese Séance erinnern. Es ist ein höchst kritischer und äußerst delikater Moment, wenn der Geist in das Medium eindringt. Dann sollte wirklich kein Laut zu hören sein, nicht das geringste Geräusch irgendwelcher Art. Deshalb sind heute Abend in diesem Saal auch keine Handys gestattet. Bitte, bewahren Sie während der gesamten Show absolutes Schweigen. Zuletzt möchte ich im Namen von United Entertainment noch den Sponsoren des heutigen Abends danken – Solid Zahncreme für solide weiße Zähne und Yamachi Motorräder – Freiheit ohne Grenzen! Dank auch an City Television, unsere Media-Partner, die dieses Ereignis live an Millionen Zuschauer in Indien und auf dem ganzen Erdball ausstrahlen. Jetzt folgt eine kurze Werbepause, aber gehen Sie nicht fort, denn wenn wir uns wieder melden, wird Baba Aghori Prasad Mishra auf der Bühne sein.«
Gemurmel brandet im Saal auf. Irgendwer sagt laut: »Ich kann Tote sehen«, was für einiges Gelächter sorgt. Heiterkeit breitet sich aus und hält sich eine Weile, ehe sie von der Last nervöser Anspannung erstickt wird.
Nach exakt fünf Minuten meldet sich Veer Bedis Stimme wieder. »Ich heiße Sie erneut willkommen zu United Entertainments Begegnung mit Bapu. Und nun ist der Augenblick da, meine Damen und Herren, auf den Sie so atemlos gewartet haben. Halten Sie sich fest, denn gleich werden Sie Zeuge eines der erstaunlichsten Ereignisse in der Geschichte der Menschheit. Ich bitte jetzt Baba Aghori Prasad Mishra auf die Bühne.«
Eine Maschine versprüht Trockennebel, was die gespenstische Atmosphäre noch verstärkt. Durch den Dunstschleier wird eine schattenhafte Gestalt in weißem dhoti und safranfarbener kurta sichtbar. Baba Aghori Prasad Mishra ist ein schlanker Mann von durchschnittlicher Körpergröße. Er scheint Ende vierzig zu sein, hat dunkles, zu einem hohen Knoten aufgestecktes Haar, einen dichten schwarzen Bart und durchdringende braune Augen. Er vermittelt den Eindruck eines Mannes, der die Welt gesehen und seine Ängste überwunden hat.
Der Baba tritt an den Bühnenrand, verbeugt sich vor dem Publikum, presst dabei zum Gruß die Handflächen aneinander und sagt: Namaste. Seine Stimme ist sanft und wohlklingend. »Ich heiße Aghori Prasad Mishra, und ich werde Sie auf eine Reise mitnehmen, auf eine spirituelle Entdeckungsreise. Lassen Sie uns mit dem beginnen, was in unserem allerheiligsten Buch steht, in der Bhagavad Gita. Es gibt zwei Wesenheiten in dieser Welt: das Vergängliche und das Unvergängliche. Die physischen Leiber aller Lebewesen sind vergänglich, aber atma, die Seele, ist unvergänglich. Waffen können diese Seele nicht verletzen, Feuer sie nicht verbrennen, Wasser sie nicht benetzen und der Wind sie nicht trocknen. Die Seele ist ewig, alldurchdringend, unveränderlich, unbewegt und unsterblich.
Doch das Wichtigste ist, und ich zitiere wieder aus der Gita, dass, so wie die Luft den Duft der Blume aufnimmt, die Seele die Fähigkeiten der sechs Sinne von unserem physischen Leib aufnimmt, den sie im Tode abwirft und hinter sich zurücklässt. Sie kann, mit anderen Worten, auch weiterhin hören, fühlen, sehen, schmecken, riechen und denken. Dadurch erst wird es möglich, mit einer Seele Kontakt aufzunehmen.
Durch die Gnade des Allmächtigen wurde mir das Privileg zuteil, im Laufe der Jahre mit mehreren Geistern kommunizieren zu dürfen. Doch keine Begegnung hat mich so stark berührt wie die mit dem Geist von Mahatma Gandhi. Der Beiname ›Mahatma‹ bedeutet ja nichts anderes, als ›Große Seele‹. Bapu hat meine persönliche, spirituelle Entwicklung der letzten fünf Jahre geleitet. In jeder wachen Minute spüre ich seine Gegenwart. Bislang war dies ein privater Dialog zwischen dem Mahatma und mir, doch heute will ich seine Gnade mit der ganzen Welt teilen. Es ist also eine sehr bedeutsame Reise, zu der wir gemeinsam aufbrechen. Eine Reise der Seele, aber auch eine Reise der Hoffnung. Denn am Ende dieser Reise werden Sie wissen, dass der Tod nicht das Ende, sondern der Beginn eines neuen Lebens ist. Das wir ewig und unsterblich sind.
Ich werde nun mit meiner Meditation beginnen. Bald wird Bapus Geist in mich eindringen und durch mich reden. Dann möchte ich Sie alle bitten, sich aufmerksam anzuhören, was Bapu uns heute mitzuteilen hat. Doch vergessen Sie nicht, sollte die Kommunikation plötzlich gestört werden, ist dies für den Geist wie auch für mich äußerst schmerzhaft. Deshalb möchte ich, wie Veer Bedi es bereits getan hat, Sie nun noch einmal nachdrücklich bitten, so still zu sein, dass man eine Stecknadel fallen hören kann.«
Wieder wird die Nebelmaschine aktiv, und eine dichte Wolke hüllt Baba einen Moment lang ein.
Als der Nebel sich legt, sitzt Baba mit überschlagenen Beinen auf der Matte und singt Beschwörungen in einer Sprache, die wie Sanskrit klingt, aber kein Sanskrit ist. Die Farbe des Scheinwerfers wechselt von Weiß zu Rot. Allmählich verebbt der Gesang, und Baba schließt die Augen. Eine große, innere Gelassenheit breitet sich auf seinem Gesicht aus, und er ist völlig reglos, als befände er sich in Trance.
Plötzlich explodiert ein Lichtblitz auf der Bühne, und ein weißer Rauchball schwebt in den Saal. Wie ein Mann schnappt das Publikum nach Luft.
»Feuerwerkspulver!«, schnaubt Mohan Kumar verächtlich.
Ebenso plötzlich beginnt sich das Spinnrad zu drehen. Es scheint dies ohne äußeren Antrieb zu tun, da der Baba etwa zwei Meter davon entfernt sitzt. Wie gebannt schaut das Publikum zu, während das Spinnrad sich schneller und schneller dreht.
»Bestimmt über Funk gesteuert, mit der Fernbedienung in Veer Bedis Hand«, brummt Mohan Kumar, aber Rita hört ihm nicht zu. Fasziniert beugt sie sich vor, ihre Hände umklammern die Sessellehnen.
Während das Spinnrad sich unablässig dreht, beginnen Spazierstock und Brille sich zu regen und langsam vom Boden emporzuschweben. In einem synchronen, der Schwerkraft trotzenden, übernatürlichen Duett steigen sie höher und immer höher zur Decke auf. Dem Publikum entfährt ein ungläubiges Stöhnen.
Mohan Kumar spürt ein Prickeln in den Handflächen. »Unsichtbare Drähte, an der Decke befestigt«, vermutet er, doch fehlt es seiner Stimme an Überzeugung. Rita starrt einfach bloß nach vorn.
So abrupt, wie das Spinnrad anfing, sich zu drehen, bleibt es auch wieder stehen. Scheppernd fällt der Stock auf die Bühne, die Brille zersplittert auf dem Boden.
Es folgt eine lange Pause, und für einen Moment glaubt Mohan, der Baba wäre eingeschlafen. Dann beginnt sein Körper unbeherrscht zu zucken, als würde er von einem heftigen Fieber geschüttelt.
»O mein Gott, ich kann gar nicht hinsehen«, jammert Rita. Und im selben Moment ertönt eine Stimme, die anders klingt als alles, was Mohan Kumar je zuvor gehört hat.
»Ich möchte mich in aller Demut dafür entschuldigen, dass es so lang gedauert hat, an diesen Ort vorzudringen«, sagt die Stimme. »Und Sie werden meine Entschuldigung gewiss bereitwillig akzeptieren, wenn ich Ihnen sage, dass ich selbst keine Schuld an dieser Verzögerung trage, ebenso wenig wie sonst irgendeines Menschen Wirken.«
Es ist eine krächzende, aber seltsam ergreifende Stimme, klar, volltönend und so androgyn, dass sich unmöglich sagen lässt, ob sie männlich oder weiblich ist. Und auch wenn sie Aghori Baba über die Lippen kommt, scheint sie doch nicht zu ihm zu gehören.
Eine tödliche Stille senkt sich über das Publikum, als ob es die Gegenwart einer übernatürlichen Macht spürte, die man weder sehen noch gänzlich verstehen kann.
»Schauen Sie mich nicht an, als wäre ich ein Tier im Zirkus. Ich bin einer von Ihnen, und heute möchte ich über Ungerechtigkeit sprechen. Ja, über Ungerechtigkeit«, fährt die Stimme fort. »Ich habe immer wieder gesagt, dass Wahrheit und Gewaltlosigkeit für mich wie meine beiden Lungenflügel sind, doch sollte Gewaltlosigkeit niemals als Vorwand für Feigheit dienen dürfen. Sie ist eine Waffe der Tapferen. Wenn aber die Mächte der Ungerechtigkeit und Unterdrückung Überhand gewinnen, ist es die Pflicht der Tapferen …«
Ehe der Satz zu Ende gesprochen werden kann, wird der Hintereingang zum Auditorium aufgestoßen und ein bärtiger Mann in weitem, weißem kurta-Paijama stürmt in den Saal. Das lange schwarze Haar hängt ihm wirr ins Gesicht, und seine Augen funkeln unnatürlich hell. Er stürzt zur Bühne, gefolgt von mehreren Knüppel schwingenden Polizisten. Bei seinem plötzlichen Eindringen verstummt Aghori Baba.
»Das ist pervers!«, schreit der Bärtige, als er den Bühnenrand erreicht und direkt vor Mohan Kumar stehen bleibt. »Wie können Sie es wagen, das Andenken an Bapu durch so ein kommerzielles Spektakel zu schänden? Bapu ist unser Erbe und Vermächtnis, aber Sie vermarkten ihn wie Zahnpasta oder Shampoo«, ruft er Aghori Baba wütend zu.
»Bitte, beruhigen Sie sich, mein Herr. Regen Sie sich nicht auf.« Veer Bedi taucht so plötzlich wie ein Kaninchen aus dem Hut eines Zauberers auf und hüpft auf die Bühne. »Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause, in der wir uns dieser Situation annehmen werden«, sagt er an niemand bestimmten gewandt.
Der aufgebrachte Mann beachtet ihn überhaupt nicht. Er fährt mit einer Hand unter seine kurta, zieht einen schwarzen Revolver hervor, umklammert ihn mit festem Griff und zielt damit auf Aghori Baba. Veer Bedi schluckt und verzieht sich hastig in die Kulissen. Die Polizisten scheinen zu erstarren, das Publikum wirkt wie gelähmt.
»Sie sind schlimmer als Nathuram Godse«, schreit der Bärtige Aghori Baba an, der die Augen noch immer geschlossen hält, nur die Brust hebt und senkt sich, während er mühsam nach Atem ringt. »Godse hat bloß Bapus Körper getötet, Sie aber schänden seine Seele.« Und dann jagt er kurzerhand drei Kugeln in den sadhu.
Der Lärm der Schüsse brandet wie eine riesige Welle durch den Saal. Auf der Bühne flammt erneut ein Lichtblitz auf, und Aghori Babas Kopf sackt vornüber auf die Brust, seine safranfarbene kurta färbt sich rot.
Im Publikum bricht die Hölle aus. Schreie hallen durch die Gänge, während die Menschen in Panik zum Ausgang strömen. »Hilfe, Mohan!«, schreit Rita, als sie von der rempelnden Menge aus dem Sessel gerissen wird. Heldenhaft versucht sie noch, ihre Handtasche zu retten, wird dann aber vom Menschenstrom fortgespült, der wie ein schäumender Fluss zu den Türen flutet.
Wie betäubt und ein wenig verloren sitzt Mohan Kumar noch auf seinem Platz, als er spürt, dass etwas sein Gesicht streift. Es ist weich wie ein Wattebausch, aber so schleimig wie der Bauch einer Schlange. »Ach, lass nur«, ruft er geistesabwesend zu Rita, die schon nicht mehr zu sehen ist, doch ehe sich seine Lippen wieder schließen, huscht ihm dieses fremde Objekt mit Lichtgeschwindigkeit in den Mund. Er würgt und spürt, wie es die Kehle hinabgleitet und auf der Zunge einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt, ein unbehagliches Gefühl, fast so, als hätte er ein Insekt verschluckt. Sein Herz flattert sanft, ein protestierendes Beben, plötzlich aber steht sein ganzer Körper in Flammen. Eine pochende, pulsierende Energie durchzischt ihn vom Hirn bis hinab zu den Füßen. Er weiß nicht, ob sie von außen oder von innen kommt, von oben oder von unten. Sie hat kein bestimmtes Zentrum, reißt aber alles in einen Strudel, der sich tiefer und tiefer in den Kern seiner Existenz frisst. Krampfhafte Zuckungen schütteln ihn, als wäre er vom Wahn befallen. Und dann beginnt der Schmerz. Er meint, einen heftigen Schlag auf den Kopf zu erhalten, eine stumpfe Nadel wird ihm ins Herz gerammt, und mächtige Hände umklammern seine Brust, reißen ihm das Gedärm aus dem Leib. Der Schmerz ist so unerträglich, dass er glaubt, sterben zu müssen. Vor Angst und Entsetzen schreit er auf, wird aber vom allgemeinen Lärm im Saal übertönt. Er sieht bloß noch verschwommene Bewegungen, schreiende, stürzende, vorwärtstaumelnde Menschen, dann verliert er das Bewusstsein.
Als er die Augen wieder aufschlägt, ist der Saal still und leer. Aghori Babas lebloser Körper liegt zusammengesunken auf der Matte, eine hügelige Verwerfung in einem Meer aus Blut. Der Holzboden ist mit Halbschuhen, Sneakern, Sandalen und Highheels übersät, und irgendwer tippt ihm auf die Schulter. Er dreht sich um und sieht einen Gummiknüppel tragenden Polizisten, der ihn aufmerksam mustert.
»He, Mister, was machen Sie hier? Haben Sie nicht gesehen, was passiert ist?«, faucht der Beamte.
Verständnislos stiert er den Mann an.
»Hat es Ihnen die Sprache verschlagen? Wer sind Sie? Wie heißen Sie?«
Er macht den Mund auf, doch fällt ihm das Sprechen schwer. »Ich … ich … ich heiße …«
»Ja, genau, wie heißen Sie? Raus damit«, wiederholt der Polizist ungeduldig.
Er will ›Mohan Kumar‹ sagen, aber die Worte kommen ihm nicht über die Lippen. Er tastet mit den Fingern nach seinem Kehlkopf und knetet die Stimmbänder, als versuchte er, die Worte aus sich herauszupressen. Doch sie bleiben in seinem Schlund, werden umgedreht, durcheinandergewirbelt und zu den Worten eines anderen. »Ich heiße Mohan … Mohandas Karamchand Gandhi«, hört er sich selbst sagen.
Der Beamte hebt den Stock. »Sie machen mir den Eindruck eines vernünftigen Mannes, aber dies ist kein guter Zeitpunkt für Scherze. Ich frage Sie also noch einmal: Wie heißen Sie?«
»Das habe ich Ihnen gesagt. Ich bin Mohandas Karamchand Gandhi.« Diesmal fallen ihm die Worte leichter, sie klingen zuversichtlich und selbstsicher.
»Sie Dreckskerl, wollen Sie mich vielleicht auf den Arm nehmen? Wenn Sie Mahatma Gandhi sind, dann bin ich Hitlers Vater.« Mit einem Grunzen lässt der Polizist den Knüppel niedersausen, und gleich darauf explodiert Mohan Kumars Schulter vor Schmerz. Das Letzte, was er hört, bevor er erneut das Bewusstsein verliert, ist das Jaulen einer Polizeisirene.
3.Die Schauspielerin
26. März
ES IST NICHT LEICHT, eine Leinwandgöttin zu sein. Man muss ständig fantastisch aussehen. Man darf nicht pupsen, nicht spucken, und ans Gähnen darf man nicht einmal denken, sonst starrt einem, ehe man es sich versieht, das eigene, weit aufgerissene Maul von den Hochglanzseiten der Zeitschriften Maxim oder Stardust entgegen. Außerdem kann man nirgendwo hingehen, ohne eine Horde von Menschen auf den Fersen zu haben. Das Schlimmste aber ist, dass man als berühmte Schauspielerin immer wieder mit den unglaublichsten Fragen konfrontiert wird.
Nehmen wir zum Beispiel den Vorfall gestern auf dem Rückflug von London. In Jeans und mit der neuesten, flaschengrünen Versace-Jacke, mit Nietengürtel und dunkler Dior-Brille hatte ich gerade die Business-Class der Air India 777 betreten. Ich setzte mich auf meinen Platz – 1A, wie immer – und legte meine Louis-Vuitton-Handtasche aus Krokodilleder auf den Platz neben mir – 1B, frei, wie immer, denn ich bleibe gerne ungestört. Ich streifte meine Blahniks ab, fischte den iPod aus der Tasche, steckte mir die Stöpsel in die Ohren und entspannte mich. Ich habe festgestellt, dass man sich nervtötende Fans und autogrammjagende Stewardessen oder Piloten am besten mit Kopfhörern vom Leib hält. Die Ohrstöpsel erlauben es mir, meine Umgebung zu beobachten, während sie mich zugleich von der Notwendigkeit befreien, auf sie reagieren zu müssen.
Da saß ich also, versunken in meinem privaten, digitalen Ökosystem, als eine Stewardess mit einer Frau und ihrem kleinen Jungen im Schlepp auf mich zukam.
»Tut mir leid, Sie zu stören, Shabnamji«, sagte die Stewardess in einem Ton, den Stewardessen immer dann anschlagen, wenn sie einen Passagier um einen Gefallen bitten, ihn etwa fragen wollen, ob er sich nicht auf einen anderen Platz setzen könnte. »Frau Daruwala hier hat Ihnen etwas ganz Wichtiges mitzuteilen.«
Ich musterte Frau Daruwala. Sie sah wie eine der Parsi-Frauen in den Bollywoodfilmen aus – stämmig, hellhäutig, mit pausbäckigem Gesicht. Sie trug einen fuchsienroten Sari und roch nach Talkumpuder, eindeutig Economy-Class.
»Shabnamji, ach Shabnamji, was für eine Ehre, Sie zu treffen«, sprudelte es mit Singsangstimme aus ihr heraus.
Ich setzte meine höfliche, aber distanzierte Miene auf, die besagen soll: ›Ich bin nicht an Ihnen interessiert, ertrage Sie aber, also machen Sie schnell.‹
»Dies ist mein Sohn Sohrab.« Sie zeigte auf den Jungen, der einen schlecht sitzenden blauen Anzug mit Fliege trug. »Sohrab ist Ihr allergrößter Fan auf der Welt. Er hat jeden Ihrer Filme gesehen.«
Ich zog die Augenbrauen in die Höhe. Da die Hälfte meiner Filme nur für Erwachsene freigegeben ist, war die Mutter eine Lügnerin oder der Junge ein Zwerg.
Frau Daruwala setzte eine ernste Miene auf. »Bedauerlicherweise leidet mein Sohn an chronischer Leukämie. An Blutkrebs. Wir wollten ihn am Sloane-Kettering behandeln lassen, aber die Ärzte haben ihn aufgegeben. Sie sagen, ihm bleiben höchstens noch ein paar Monate.« Die Stimme brach, und Tränen flossen ihr über die Wangen. Ich merkte, dass sich meine Rolle gerade geändert hatte und wechselte meinen Gesichtsausdruck sofort in besorgt und mitfühlend, jene Miene, die ich stets bei öffentlichen Besuchen auf Krebsstationen oder in AIDS-Pflegeheimen aufsetze.
»Ach, das tut mir ja so leid.« Ich drückte Frau Daruwalas Hand und bedachte ihren Sohn mit einem engelhaften Lächeln. »Würdest du dich vielleicht gern ein wenig mit mir unterhalten, Sohrab? Warum kommst du nicht her und setzt dich zu mir?« Ich nahm die Handtasche vom Nachbarsitz und stellte sie auf den Boden. Sohrab nahm das Angebot augenblicklich an und ließ sich in den Sessel 1B plumpsen, als wäre er sein Leben lang nichts anderes als Business-Class geflogen. »Kannst du uns eine Weile allein lassen, Mami?«, sagte er im nachdrücklichen Ton eines Bürochefs, der seine Sekretärin hinauskomplimentiert.
»Natürlich, mein Junge, aber mach Shabnamji keinen Kummer.« Frau Daruwala wischte sich die Tränen fort und strahlte mich an. »Damit wird für ihn ein Traum Wirklichkeit. Gönnen Sie ihm einfach nur einige Augenblicke Ihrer kostbaren Zeit, und entschuldigen Sie bitte nochmals die Störung.« Mit diesen Worten watschelte sie zurück zu ihrem Platz.
Ich schaute Sohrab an, der mich anstarrte wie ein liebestoller Galan. Seinen intensiven Blick fand ich ein wenig beunruhigend, und ich begann mich zu fragen, worauf ich mich da eingelassen hatte.
»Nun, wie alt bist du denn, Sohrab?«, fragte ich in dem Versuch, ihn ein wenig aufzulockern.
»Zwölf.«
»Das ist ein schönes Alter. Du lernst eine Menge und hast noch viel, worauf du dich freuen kannst, nicht wahr?«
»Ich habe nichts mehr, worauf ich mich freuen kann, da ich keine dreizehn Jahre alt werde. In drei Monaten bin ich tot«, sagte er mit völlig ausdruckslosem Gesicht und ohne die geringste Spur von Gefühl.
»Ach, sag so was nicht. Du wirst das schon schaffen«, sagte ich und tätschelte seinen Arm.
»Nein, werde ich nicht«, erwiderte Sohrab, »aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass ich noch etwas wissen möchte, bevor ich sterbe.«
»Aha, und was genau möchtest du wissen?«
»Versprechen Sie mir, dass Sie mir antworten?«
»Natürlich, das verspreche ich dir.« Ich ließ meine Beißerchen aufblitzen und dachte mir, von jetzt an wird es einfacher. Im Umgang mit meinen kleinen Fans bin ich ein Profi. Sie wollen immer nur wissen, wie mein Lieblingsfilm heißt, welche Projekte ich als Nächstes mache und ob ich vorhabe, bald mal wieder mit einem ihrer Lieblingsschauspieler aufzutreten. »Schieß los, Sohrab.« Ich schnippte mit den Fingern. »Ich bin für all deine Fragen bereit.«
Sohrab beugte sich zu mir vor. »Sind Sie noch Jungfrau?«, flüsterte er.
Es konnte keine bessere Bestätigung dafür geben, dass ich direkt neben Psycho junior saß.
Natürlich war dies das Ende meiner Unterhaltung mit dem kleinen Knilch – ich habe ihn auf der Stelle zum Teufel gejagt. Und der Stewardess habe ich so die Leviten gelesen, dass ich sicher sein durfte, auf diesem Flug nicht mehr von irgendwelchen todkranken Passagieren belästigt zu werden.
Später dann, als mein Ärger verraucht war, habe ich über Sohrabs Frage nachgedacht. Er war so frech und unverschämt, mich zu fragen, doch bin ich überzeugt, dass die zwanzig Millionen Inder, die behaupten, in mich verliebt zu sein, die Antwort ebenfalls gern wüssten.
Indische Männer teilen Frauen in zwei Klassen ein – in erreichbar und unerreichbar. Ihre Mütter und Schwestern sind die heiligen Kühe, der Rest ist bloß Vorlage für ihre voyeuristischen Träume und Onanier-Fantasien. Jede junge Frau, die in diesem Land ein T-Shirt trägt, gilt als unmoralisch. Und mich sieht man meist, wie ich der Kamera in hauteng anliegenden Kostümen den Busen hinhalte und Hüfte wackelnd auf irgendwelche scharfen Typen zustolziere. Kein Wunder also, dass es heißt, ich sei der ultimative feuchte Traum. Und je unerreichbarer ich wirke, desto begehrenswerter findet man mich. Die Männer schreiben mir Briefe mit ihrem eigenen Blut und drohen, sich als Opfer darzubringen, wenn sie kein signiertes Foto von mir bekommen. Manche schicken mir Samenproben, verfärbte Flecke auf Löschpapier; und Heiratsanträge von Dorftrotteln oder einsamen Callcenter-Bossen erhalte ich zu Tausenden. Eine Männerzeitschrift hat mir ein unbegrenzt gültiges Angebot für eine Nacktaufnahme gemacht und einen Blanko-Scheck geschickt. Sogar Frauen lassen mir ihre rakhis zukommen, behaupten, meine Schwestern zu sein, und hoffen, ich könnte ihnen helfen, ihre Männer an die Leine zu legen. Vorpubertäre Mädchen schreiben schmeichelhafte Briefe und bitten mich, dafür zu beten, dass sie körperlich bald ebenso gesegnet sind wie ich.
92-60-90, das sind meine magischen Maße. Im Silikonzeitalter verkörpere ich pralle Fülle und natürliche Schönheit. Man mag es die zynische Ausbeutung des unterdrückten Es nennen oder das unfaire Privileg der Berühmtheit, doch hat mir mein Aussehen alles gegeben, was ich mir vom Leben wünschte – und noch einiges mehr.
Im Grunde der Dinge ist das Leben trotz allem Wechsel der Erscheinungen unzerstörbar mächtig und lustvoll, schrieb Friedrich Nietzsche, mein Meister. In den letzten drei Jahren habe ich dem Leben jedes nur erdenkliche Quantum Glück abgerungen, doch hat es mich für das Elend entschädigt, das ich in den vorangegangenen neunzehn Jahren erlitt?
31. März
Ich war heute Ehrengast einer Feier zum Gedächtnis von Meena Kumari, der ›Königin der Tragödie‹, die am heutigen Tage vor fünfunddreißig Jahren starb. Der Abend war entsetzlich langweilig, vollgestopft mit den immergleichen salbungsvollen Reden, die man bei jeder Preisverleihung hört, was mich doch einigermaßen ins Grübeln brachte. Ist der Charakter eines Schauspielers auf das begrenzt, was wir auf der Leinwand von ihm sehen? Beurteilte man mich allein nach meinen Filmen, würde mich die Geschichte als geistloses Glamour-Püppchen in Erinnerung behalten, doch bin ich weit mehr als nur ein banaler Zelluloidtraum. Und wenn irgendwann meine Tagebücher veröffentlicht werden (natürlich nach angemessener redaktioneller Bearbeitung), wird die Welt dies auch begreifen. Ich habe mir bereits einen exzellenten Titel für das Buch überlegt: Eine Frau von Format: Die Shabnam-Tagebücher.
3. Mai
Seit heute Morgen herrscht ein Heidenlärm in meiner Wohnung. Sechs Arbeiter in blauen Overalls sind in Schlafzimmer und Bad eingefallen, um mir meinen Frieden zu rauben. Bhola führt die Aufsicht und kommandiert die Männer herum, als wäre er irgendein Bauleiter. Es war seine Idee, neue Lampen im Bad anzubringen, in die Decke eingelassene Strahler, bei denen keine Glühbirnen mehr zu sehen sind. Wirklich sehr hübsch, vor allem, wenn man den Dimmer runterdreht, fast wie Sterne am Nachthimmel. Im Schlafzimmer lässt er meinen alten Firozabad-Leuchter durch einen brandneuen Swarovski-Lüster ersetzen und ein paar schadhafte Leitungen reparieren.
Ich muss sagen, Bhola bedeutete für mich eine angenehme Überraschung. Einer der Vorteile des Berühmtseins ist die Entdeckung lang vergessener Tanten und Onkel, entfernter Kusinen und nie zuvor gesehener Vettern. Bhola gehört zu diesen entfernten Verwandten. An einem strahlenden Sommermorgen tauchte er vor meiner Wohnungstür auf, behauptete, der Sohn meiner Tante Jaishree aus Mainpuri zu sein, und flehte mich an, ihm eine Rolle in einem Film zu verschaffen. Ich musterte ihn und musste lauthals lachen. Mit seinem glatten, öligen Haar, dem kugeligen Wanst und bäurischen Gehabe passte er besser in die Agrar- als in die Filmindustrie. Dann aber hatte ich Mitleid mit seiner Unbeholfenheit, stellte ihn als Sekretariatsassistent und Faktotum ein und versprach ihm eine Rolle, falls er sich in dieser Aufgabe bewährte. Das ist jetzt zwei Jahre her. Ich glaube, inzwischen hat er längst den Traum aufgegeben, jemals Schauspieler zu werden, aber als mein Handlanger hat er sich wirklich bewährt. Er versteht es nicht nur, mir lästige Fans und Autogrammjäger vom Leib zu halten, er hat auch ein Händchen für alles Elektronische und vor allem für Computer, die mir immer noch ein Rätsel sind. Außerdem hat er ein wunderbares Finanzgeschick bewiesen, weshalb ich ihm nach und nach all meine Geldangelegenheiten überlassen habe; nur um meine privaten Verabredungen kümmert sich weiterhin mein Sekretär Rakeshji, den ich mir mit Rani teile.
Bhola verfügt über keine besonderen Gaben und kein besonderes Talent. Er ist ein ganz und gar durchschnittlicher Mensch, aber die Welt wird nun mal größtenteils von Durchschnittsmenschen bevölkert, von den mittelmäßigen, deren einzige Aufgabe darin besteht, den Außergewöhnlichen zu dienen …
31. Mai
Mir tun die Finger weh. Ich habe gerade neunhundert Briefe signiert, ein Ritual, das ich viermal im Jahr vollziehe, ein weiterer kleiner Preis, den man als Star zu zahlen hat.
Mit diesen Briefen antworte ich Fans, die mir aus allen Teilen der Erde schreiben, von Agra bis Zagreb. Jede Woche treffen fünftausend Briefe ein, zwanzigtausend im Monat. Aus diesen Briefen wählt Rosie Mascarenhas, meine Managerin, vierteljährlich etwa tausend für eine persönliche Antwort aus, die mit einem Standard-Textbaustein erklären, wie sehr ich mich freue, von meinen Bewunderern zu hören, danach folgt irgendein Blablabla über meine nächsten Filmprojekte, und zum Schluss übermittle ich die besten Wünsche für Gesundheit, Glück und Wohlergehen. Den Briefen wird ein Hochglanzfoto beigelegt, eine Nahaufnahme – für weibliche Fans und Kinder ein nettes, züchtiges Bild, ein moderat erotisches für meine männlichen Anhänger. Rosie hat mir zu einem Autopen geraten, einer Maschine, mit der meine Unterschrift auf jeden Brief vervielfältigt wird, was es mir ersparen würde, sie alle persönlich zu signieren, aber ich habe mich gegen ihren Vorschlag entschieden. Ich gehöre sowieso schon der unwirklichen Filmwelt an, in der alles unecht und irreal ist, da soll wenigstens meine Unterschrift echt sein. Ich stelle mir vor, wie die Gesichter meiner Fans leuchten, wenn sie den Brief öffnen und mein Bild sehen. Ein Schrei der Überraschung, der Begeisterung. Dann zeigen sie den Brief der Familie, den Freunden und Verwandten. Die ganze Nachbarschaft sonnt sich eine Zeit lang in seinem Glanz. Tagelang wird man darüber reden, debattieren, diskutieren, wird ihn küssen, seinetwegen Tränen vergießen. Dann wird er fotokopiert, laminiert, gerahmt und angehimmelt, vielleicht sogar angebetet.
Der Schmerz in meinen Fingern lässt nach.
Rosie öffnet grundsätzlich keine Briefe, auf denen ›persönlich‹ oder ›vertraulich‹ steht, die kommen direkt zu mir und haben mir schon viele vergnügliche Stunden bereitet. Kein anderes Land der Erde ist so auf Stars und Sternchen versessen wie Indien. Jeder Zweite möchte Schauspieler werden, nach Mumbai fahren und in Bollywood groß rauskommen. Und diese Möchtegern-Schauspieler schreiben mir aus ihren staubigen Dörfern und Betel-Buden, aus malariaverseuchten Sümpfen und winzigen Fischerdörfern. Sie schreiben in gebrochenem Hindi und in Pidgin-Englisch, in stockenden Sätzen und holpriger Syntax, weil sie ihren Traum mit mir teilen und mich um Rat bitten wollen, um Unterstützung, manchmal auch um Geld. Den meisten Briefen ist ein Foto beigelegt, auf dem sie kokett posieren, prunken und protzen und all ihre Verwunderung, ihre Sehnsucht, Leidenschaft und Verzweiflung in ein Bild zwängen, von dem sie hoffen, es könnte das Herz eines Produzenten erweichen. Doch welche Mühe sie sich auch geben, dem gnadenlosen Auge der Kamera bleibt nichts verborgen. Die Posen verraten nicht bloß ihre tiefste Vulgarität und Ungehobeltheit, sondern auch ihre blöde Schlichtheit, ihre erbärmliche Hilflosigkeit.
Die Briefe junger Mädchen finde ich besonders anrührend, einige der Kleinen sind gerade mal dreizehn Jahre alt. Für ihre fünfzehn Minuten Ruhm würden sie von zu Hause fortlaufen, ihre Familien verlassen. Sie haben keine Ahnung, was zählt und was es sie kostet, nach Mumbai zu kommen. Lange ehe sie es auf die Casting-Couch schaffen, hat irgendein schmieriger Fotograf oder vermeintlicher Agent sie in einen anrüchigen Massagesalon oder ein billiges Bordell gelockt. Und ihre spröden Träume vom Sternchenhimmel zerplatzen an der albtraumhaften Realität sexueller Sklaverei.
Doch ich erinnere mich an meine eigene Lebensgeschichte und lasse die Briefe dieser Mädchen unbeantwortet. Ich habe keine Interesse daran, mich in ihre traurigen Leben einzumischen, habe auch nicht die Kraft, in die Bahn ihrer fatalen Schicksalswege einzugreifen. Da draußen herrscht das Gesetz des Dschungels, nur die Stärksten werden überleben. Der Rest landet auf dem Abfallhaufen der Geschichte, der Müllkippe der Gesellschaft.