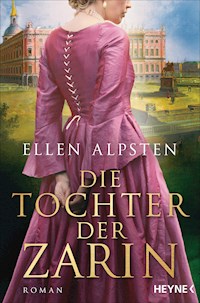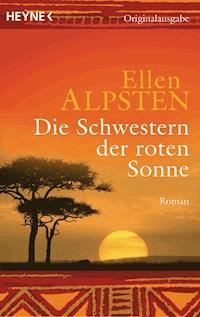9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Zarin-Saga
- Sprache: Deutsch
Leibeigene, Liebende, Zarin - der bewegende Aufstieg von Zarin Katharina I.
Sankt Petersburg, 1725. Es ist eine stürmische Nacht, in der Peter I. stirbt. Für seine Frau Katharina I. steht alles auf dem Spiel: Wird sie durch die korrupte Hand ihrer Gegner ihr Leben verlieren oder zur ersten Zarin in der Geschichte Russlands erklärt? Sie hält Totenwache und reist in Gedanken zurück. Zu den zwölf Kindern, die sie Peter schenkte, und von denen die meisten starben. Zur Ehe mit dem Zaren, den sie geliebt und verachtet, gefürchtet und umworben hat. Zu dieser Stadt, Sankt Petersburg, Peters Stadt, die sie zusammen gebaut haben. Und in die Zeit, als sie noch Marta hieß und die uneheliche Tochter eines Leibeigenen war – bevor ihr unaufhaltsamer Aufstieg an die Spitze der russischen Gesellschaft begann.
Ellen Alpstens emotionsgeladenes Epos über Zarin Katharina I. in überarbeiteter und modernisierter Fassung.
»Ein herausragendes Epos über eine ungewöhnliche Liebe.« Freundin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 846
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
Ich sank neben Peters Lager auf die Knie, und die drei Ärzte wichen wie vom Feld aufgescheuchte Krähen in den Halbschatten des Raumes zurück. Die Vögel, die Peter in den letzten Jahren seines Lebens am meisten gefürchtet hatte. Er hatte im ganzen Reich zur Jagd auf die schwarzen Vögel blasen lassen, und die Bauern fingen sie gegen eine Belohnung, um sie zu töten, zu rupfen und zu braten. Doch umsonst. Der Vogel glitt still durch Wände und die verriegelten Türen seines Schlafgemaches und verdunkelte mit seinen Ebenholzschwingen das Licht in Peters nächtlichen Träumen. Im kühlen Schatten seines Fluges wollte das Blut an des Zaren Händen niemals trocknen. Noch war seine Hand nicht die eines Toten, sondern weich und warm, als ich seine Finger an meine Lippen führte. Es war wichtig, allen zu zeigen, dass mir allein diese Geste zustand. Mir, seiner Gattin und der Mutter seiner Kinder.
»Ellen Alpstens Zarin erweckt das dramatische Leben von Katharina I., der Ehefrau Peters des Großen und Zarin von Russland, zum Leben. Sie zeichnet das farbenfrohe Bild der damaligen Zeit und dieser bemerkenswerten Frau in Form eines Romans, wobei sie sich durchweg auf Fakten stützt. Da Katharinas Karriere so melodramatisch war wie die einer Romanheldin, erweist sich dies als ein höchst wirksames Mittel.«
Graf Nikolai Tolstoi, Historiker und Schriftsteller
Die Autorin
Ellen Alpstens wurde 1971 in Kenia geboren, verbrachte ihre Kindheit und Jugend dort und studierte dann in Köln und Paris. Sie arbeitete in der Entwicklungshilfe an der Deutschen Botschaft Nairobi und als Moderatorin bei Bloomberg TV. Heute ist sie freie Schriftstellerin und Journalistin, u. a. für die FAZ, Vogue und Spiegel Online. »Die Zarin« – erstmals 2002 in Deutschland erschienen – ist ihr Debüt. Heute ein internationaler Bestseller, liegt der erste und einzige Roman über Katharina I. nun in überarbeiteter Neuausgabe vor.
ELLEN ALPSTEN
DIEZARIN
Roman
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by Ellen Alpsten
Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Friedel Wahren
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Arcangel/Malgorzata Maj und Bridgeman/Gemälde von Sadonikov, Vasili Semenovich »View of the Mary Cascade«
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-24657-0V001www.heyne.de
»Dieses Buch sollte mit einem Warnhinweis für Suchtgefährdung versehen werden – wenn man einmal anfängt zu lesen, kann man nicht mehr aufhören.«
Hannah Rothschild, Autorin von Die Launenhaftigkeit der Liebe
»Einfach großartig: Alpsten hat eindeutig brillant recherchiert. Dieses Buch liest sich wie Game of Thrones, nur ohne Drachen.«
Natasha Pulley, Autorin von The Watchmaker of Filigree Street
»Was für ein köstlicher, sinnlicher Borschtsch von einem Buch. Dies ist die ultimative Aschenputtel-Geschichte eines ungebildeten Bauernmädchens, das zur Kaiserin von Russland wird. Daneben ist Game of Thrones ein Kinderreim.«
Daisy Goodwin, Bestseller-Autorin von Der Besuch der Kaiserin
»In dieser faszinierenden Geschichte der zweiten Frau Peters des Großen – einer Frau, deren leidenschaftlicher Überlebenswille sie bis ins Bett des Zaren und zu einem gefährlichen Schachzug zur Thronbesteigung führt – gehen Intrigen, Rivalität und prachtvolle Dekadenz Hand in Hand. Die Beschreibungen vom prächtigen Marmor des Winterpalastes bis zur Armut Russlands im 18. Jahrhundert und die Erzählung des gefährlichen Aufstiegs der ersten Zarin ist eine fesselnde und unvergessliche Reise.«
C. W. Gortner, Autor von Marlene und die Suche nach Liebe
»Ellen Alpstens Zarin erweckt das dramatische Leben von Katharina I., der Ehefrau Peters des Großen und Zarin von Russland, zum Leben. Sie zeichnet das farbenfrohe Bild der damaligen Zeit und dieser bemerkenswerten Frau in Form eines Romans, wobei sie sich durchweg auf Fakten stützt. Da Katharinas Karriere so melodramatisch war wie die einer Romanheldin, erweist sich dies als ein höchst wirksames Mittel.«
Graf Nikolai Tolstoi, Historiker und Schriftsteller
»Die Zarin ist ein üppiger Roman. So detailliert wie die Juwelenbesetzung und Emaillearbeiten auf den Kreationen von Fabergé erzählt Ellen Alpsten die Geschichte von Katharina, die arm und mit einem Hunger nach Macht und Reichtum geboren wurde, der sie antreibt. Dieser Hunger setzt alles in Bewegung, was in der russischen Geschichte folgen wird, einschließlich der Herrschaft von Katharina der Großen. Sie werden staunen angesichts dieser lebendigen, glamourösen, farbenprächtigen und von Emotionen und Elan durchzogenen Darstellung der Geschichte.«
Adriana Trigiani, Bestsellerautorin von The Shoemaker’s Wife
»Was für eine fesselnde Lektüre! In Die Zarin erweckt Ellen Alpsten die unglaubliche Geschichte von Katharina I., der wohl fesselndsten Aschenputtel-Saga der Geschichte, in ihrer ganzen prächtigen, glorreichen Komplexität zum Leben. Liebe, Erotik und Loyalität wetteifern mit Krieg, Intrigen und Verrat. Dabei wird eine epische Erzählung geschaffen, die so exotisch, sinnlich und mächtig ist wie das Russland des achtzehnten Jahrhunderts selbst. Meisterhaft recherchiert und wunderschön geschrieben, ist dieser historische Roman vom Feinsten.«
Nancy Goldstone, Autorin von Daughters of the Winter Queen und Rival Queens
Für Tobias: Danke
PROLOG
Im Winterpalast, 1725
Er ist tot. Mein geliebter Mann, der mächtige Zar aller Russen, ist gestorben, und das gerade zur rechten Zeit.
Als Peter im Augenblick vor seinem Tod, dort in seinem Schlafzimmer in den oberen Räumen des Winterpalastes, noch nach Feder und Papier verlangt hatte, stolperte mir der Herzschlag. Nein, er hatte nicht vergessen. Er wollte mich mit sich ziehen – in die Dunkelheit, in den Tod, in das Vergessen. Doch die Feder war seinen Fingern während seines letzten tödlichen Schwächeanfalls entglitten; auf den Laken sah ich Spritzer von schwarzer Tinte. Der späte Abend hielt den Atem an. Was hatte der Zar mit einem letzten Aufbäumen seines ungeheuren Willens noch regeln wollen?
Ich kannte die Antwort auf diese Frage.
Die Kerzen in den hohen Leuchtern füllten den Raum mit ihrem würzigen Duft und tauchten ihn in ein unstetes Licht. Ihr Schein erweckte die Schatten in den Ecken wie auch die gewebten Figuren auf den flämischen Gobelins zum Leben und zeichnete Pein und Unverständnis auf die groben Gesichter. Draußen vor der Tür hörte ich dieselben Stimmen, die dort schon die ganze Nacht hindurch gemurmelt und geflüstert hatten; sie mischten sich in das Heulen des kalten Februarwindes, der zornig an den fest geschlossenen Fensterläden rüttelte.
Die Zeit zog Ringe, so wie Öl auf Wasser. Peter hatte Russlands Seele geprägt wie sein Siegelring heißes Wachs. Es schien unglaublich, dass sich nichts verändert haben sollte. Mein Mann, der Russland seinen Willen wie kein anderer Zar je aufgezwungen hatte, war mehr als unser größter Herrscher gewesen. Er war unser aller Schicksal – und das meinige auch weiterhin.
Die Ärzte Blumentrost, Paulsen und Horn standen schweigend um Peters Bett. Der Zar hätte mit Medizin im Wert von fünf Kopeken gerettet werden können. Hofften sie auf einen weiteren Atemzug? Gott sei gedankt für die Pfuscherei dieser Quacksalber, dachte ich. Ihr werdet besser bezahlt, wenn er wirklich tot ist.
Ich wusste, dass sowohl Feofan Prokopowitsch als auch Alexander Menschikow mich beobachteten. Prokopowitsch, der Erzbischof von Nowgorod, hatte Peters Träume in Worte gefasst und ihnen damit Bestand verliehen. Peter und Russland hatten ihm viel zu verdanken. Menschikow dagegen … nun, da lagen die Dinge genau andersherum. Er, der reichste und mächtigste Mann des Russischen Reiches, wäre ohne Peter weniger wert gewesen als der Dreck zwischen den Klauen einer Sau. Aber wie hatte Peter einmal gesagt, als man Alexander Danilowitsch wegen seiner vielen undurchsichtigen Geschäfte bei ihm anschwärzen wollte? »Menschikow bleibt Menschikow, was auch immer er tut.« Damit war der Fall erledigt gewesen.
Der Arzt Paulsen mochte ihm die Augen geschlossen und die Hände auf der Brust gekreuzt haben, aber er hatte es nicht gewagt, den klammen Fingern des Zaren seinen Letzten Willen zu entziehen. Peters Hände, die für seinen mächtigen Körper viel zu zart wirkten und die nun zu früh zu schwach geworden waren für alles, was er noch hatte vollbringen wollen. Diese Hände nun so kraftlos zu sehen rührte mich. Ich vergaß die Angst der vergangenen Monate und bemühte mich um die letzten verbliebenen Regungen von Liebe. Vor nur wenigen Wochen hatte er genau diese Hände in meinem Haar vergraben, meine dichten Locken um die Finger geschlungen, ihren Duft nach Sandelholz und Orangenwasser eingesogen und mich angelächelt. »Meine Katharina. Wie bringst du das nur zuwege? Du bist noch immer eine Schönheit. Doch wie wirst du wohl als Nonne im Kloster aussehen, kahl geschoren und in einer groben Kutte? Die Kälte dort wird selbst dich niederringen, obwohl du stark bist wie ein Ross. Ewdokia, die Arme, schreibt mir noch immer und fleht um einen zweiten Pelz. Ihr Gejammer ist schwer erträglich. Zum Glück kannst du wenigstens nicht schreiben.«
Ewdokia, die unglückliche Frau, die ihm als junges Mädchen angetraut worden war. Ich hatte sie nur einmal gesehen, seitdem sie fast dreißig Jahre zuvor in ein Kloster verbannt worden war. Der Irrsinn leuchtete ihr aus den Augen, und ihr kahl geschorener Schädel war von Kälte und Schmutz mit Beulen und Pusteln übersät. Eine buckelige Zwergin, der Peter die Zunge aus dem Rachen hatte schneiden lassen, leistete ihr als Dienerin Gesellschaft. Ewdokias endlose Klagen beantwortete sie nur mit einem Lallen. Ewdokia nur dieses eine Mal zu sehen, so hatte Peter zu Recht angenommen, sollte mich für den Rest meines Lebens mit Schrecken erfüllen.
Ich sank neben Peters Lager auf die Knie, und die drei Ärzte wichen wie vom Feld aufgescheuchte Krähen in den Halbschatten des Raumes zurück. Die Vögel, die Peter in den letzten Jahren seines Lebens am meisten gefürchtet hatte. Er hatte im ganzen Reich zur Jagd auf die schwarzen Vögel blasen lassen, und die Bauern fingen sie gegen eine Belohnung, um sie zu töten, zu rupfen und zu braten. Doch umsonst. Der Vogel glitt still durch Wände und die verriegelten Türen seines Schlafgemaches und verdunkelte mit seinen Ebenholzschwingen das Licht in Peters nächtlichen Träumen. Im kühlen Schatten seines Fluges wollte das Blut an des Zaren Händen niemals trocknen.
Noch war seine Hand nicht die eines Toten, sondern weich und warm, als ich seine Finger an meine Lippen führte. Ich ahnte den vertrauten Geruch seiner Haut – Tabak, Tinte, Leder und die Parfumtinktur, die er eigens in Grasse hatte anfertigen lassen.
Das Papier ließ sich leicht aus seinem Griff lösen, obwohl mein Blut sich vor Furcht verdickte und meine Adern sich mit Frost und Reif überzogen wie die Äste meines baltischen Winters. Es war wichtig, allen zu zeigen, dass mir allein diese Geste zustand. Mir, seiner Gattin und der Mutter seiner Kinder. Zwölfmal war ich niedergekommen.
Das Papier raschelte, als ich es entrollte, und ich schämte mich einmal mehr, nicht lesen zu können. Und so reichte ich Feofan Prokopowitsch Peters Letzten Willen. Wenigstens war Menschikow genauso unwissend wie ich. Seit dem Augenblick, da Peter uns in seinen Bannkreis gezwungen hatte, waren wir wie zwei Kinder, die sich um die Liebe und die Aufmerksamkeit des Vaters balgten. Batjuschka, Zar, wie sein Volk ihn nannte, unser Väterchen Zar. Prokopowitsch dagegen hatte ich stets gefürchtet, sein Wissen und seinen scharfen Witz, ihn, dem himmlische und weltliche Reiche vertraut waren. Was bitte sollte ein einzelner Mann mit dreitausend Büchern anfangen? Denn so viele – so schwor es mir zumindest meine Vertraute Darja – standen in seiner Bibliothek. Hatte er sie alle gelesen? Wie fand er noch Zeit für alle seine anderen Interessen, die Gedichte, die Geschichte und die Mathematik? Wusste er, welches Schicksal Peter nach den letzten Wochen für mich vorgesehen hatte?
Er neigte den Kopf, und die Rolle lag leicht in seinen von Altersflecken übersäten Händen. Alter Fuchs. Schließlich hatte er selbst dem Zaren vor zwei Jahren geholfen, eine unerhörte Entscheidung zu treffen. Peter hatte sich über jede Sitte und jedes Gesetz hinweggesetzt, und wollte seine Nachfolge selbst bestimmen. Er wollte sein Reich eher einem würdigen Fremden hinterlassen als einem zwar leiblichen, aber unwürdigen Kind.
Sein Kind Alexej. Wie scheu er bei unserem ersten Treffen gewesen war und mit seinem schwimmenden, von dichten Wimpern verhangenen Blick und seiner hohen, gewölbten Stirn seiner Mutter Ewdokia wie aus dem Gesicht geschnitten. Damals hatte er nicht gerade sitzen können, nachdem Menschikow ihm den Rücken und das Hinterteil blutig und entzündet gestäupt hatte. Erst als sein Schicksal entschieden war, verstand Alexej. Für seinen Traum von einem starken Russland war Peter kein Preis zu hoch gewesen, und er schonte niemanden, weder sich selber noch seinen Sohn. Du warst kein Blut von meinem Blut, kein Fleisch von meinem Fleisch, Alexej. So konnte ich ruhig schlafen, trotz allem, was geschehen ist. Wie sagte mein Vater in der schlichten Weisheit der Seelen – der Leibeigenen – immer? »Anderer Leute Tränen sind nur Wasser.«
Peter jedoch schlief nie wieder ohne den Alb auf seiner Brust.
Unter meiner nur leicht geschnürten Korsage schlug mein Herz so heftig, dass mir das Blut in den Ohren rauschte, doch ich sah Feofan Prokopowitsch gelassen an. Ich konnte mir keine Ohnmacht leisten und bewegte meine Zehen in den vor Stickereien und Edelsteinen steifen Pantoffeln. Obwohl ich den Zobelpelz enger um die Schultern zog, bildete sich unter dem seidenen Stoff meines Kleides eine Gänsehaut auf den Armen. Prokopowitschs Lächeln war so dünn wie die Hostien seiner Kirche. Er kannte die Geheimnisse des menschlichen Herzens. Alle. Vor allen Dingen die meinen.
»Lies, Feofan!«, bat ich leise.
Er gehorchte. »Gebt alles an …« Er stockte und sah auf. »An…«
Menschikow fuhr auf, so als hätte man ihm wie in den guten alten Tagen eins mit der Peitsche übergezogen.
»An wen?«, fuhr er Prokopowitsch an. »Sag schon, Feofan, an wen?«
Der Pelz lag plötzlich viel zu heiß auf meiner Haut.
Feofan zuckte mit den Schultern. »Der Zar hat den Satz nicht mehr zu Ende geschrieben. Das ist alles.« Täuschte ich mich, oder huschte wieder ein Lächeln über sein zerfurchtes Gesicht? Feofan senkte den Blick. Natürlich! Nichts hatte Peter zu Lebzeiten besser gefallen, als die Welt auf den Kopf zu stellen. Ich begriff, dass er uns über den Tod hinaus beherrschte. Meine Gedanken überschlugen sich. Peter war tot und seine Nachfolge nicht geregelt. Doch dies bedeutete nicht, dass ich mich in Sicherheit wiegen konnte. Ganz im Gegenteil.
»Das soll alles sein?« Menschikow riss Feofan das Papier aus der Hand und starrte auf die Buchstaben.
Prokopowitsch nahm ihm das Blatt wieder ab. »Das hast du nun davon, dass du immer Besseres zu tun hattest, als lesen und schreiben zu lernen, Alexander Danilowitsch.«
Männer, dachte ich. Dies war nicht der Augenblick für Streitereien, wollte ich nicht doch noch Ewdokias Schicksal teilen, auf einen Schlitten nach Sibirien steigen oder – schlimmer noch – mit dem Gesicht nach unten zwischen den schweren Eisschollen auf der Newa treiben. »Feofan, sag mir, ist der Zar gestorben, ohne einen Erben zu benennen?«
Er nickte. Seine Augen waren von den langen Stunden der Wache am Bett seines Herrn blutunterlaufen. Nach Art der Popen trug er sein dunkles Haar ungepudert. Von grauen Strähnen durchzogen, lag es ihm glatt bis auf die Schultern. Sein schlichter schwarzer Kittel war der eines einfachen Geistlichen. Nichts an ihm verriet die Ehren und Ämter, mit denen Peter ihn belohnt hatte. Eine Ausnahme bildete nur das schwere goldene und edelsteinbesetzte Kreuz auf seiner Brust, die panagia, die ihn als Erzbischof von Nowgorod auszeichnete. Feofan war alt, doch er war einer jener Männer, die leicht noch vielen Zaren dienen konnten. Er verneigte sich und reichte mir die Rolle aus Papier. Ich schob sie wie nebensächlich in den schmalen Ärmel meines Kleides.
Feofan richtete sich auf. »Zarina. Ich lege die Zukunft Russlands in deine Hände.«
Mir stockte der Atem, als er mich mit diesem Titel ansprach. Wie ein Bluthund, der eine Spur aufnimmt, hob Menschikow aufmerksam den Kopf und ließ uns nicht aus den Augen.
»Geh nach Hause, Feofan!«, sagte ich vernehmlich. »Du brauchst deinen Schlaf. Ich lasse dich rufen. Bis dahin vergiss nicht, dass nur wir drei die letzten Worte des Zaren kennen.«
»Meine immerwährende Treue und Bewunderung«, sagte er mit klarer Stimme.
»Ich verleihe dir den Sankt-Andreas-Orden«, bot ich ihm leise an. »Zudem schenke ich dir ein Landgut bei Kiew mit tausend, nein, mit zweitausend Seelen.« Ich überlegte rasch, wen ich dazu ins Exil schicken, wem ich seine Güter entziehen musste. An einem Tag wie diesem, an dem Geschichte geschrieben wurde und an dem Vergangenheit und Zukunft sich die Waage hielten, sollte sich leicht eine Lösung finden lassen. Beständigkeit war der Schlüssel zur Treue von Prokopowitsch, dem Weisen. Sein Blick begegnete dem meinen, und was wir uns zu sagen hatten, bedurfte keiner Worte. Zwanzig Jahre gemeinsamer Kampf verbanden uns unlösbar. Ich winkte dem Diener, der stumm und starr neben der Tür stand. Hatte er unser Flüstern verstanden? Hoffentlich nicht.
»Lass den Schlitten von Feofan Prokopowitsch anspannen! Hilf ihm nach unten! Niemand darf mit ihm sprechen. Hörst du?« Er nickte. Seine langen Wimpern warfen Schatten auf seine rosigen Wangen. Hübsch. Doch plötzlich erinnerte er mich an einen anderen Mann. An das Antlitz eines Toten, das ich zu viele Tage und Nächte hindurch neben meinem Bett hatte betrachten müssen, wo Peter mir den enthaupteten Kopf hatte hinstellen lassen. Er trieb in einem schweren Glas mit Alkohol, ganz so, wie man Äpfel über den Winter in Wodka einlegte. Die weit aufgerissenen glasigen Augen starrten mich traurig an. Die im Leben weichen Lippen waren blutleer, schmal geschrumpft und im Todesschmerz von den weißen Zähnen zurückgezogen, die ihm in den langen Stunden der Folter zum Teil ausgeschlagen worden waren. Als ich im ersten Entsetzen das Gefäß von meiner Zofe entfernen lassen wollte, drohte Peter mir mit dem Kloster und der Peitsche. So stand es viele Wochen lang neben meinem Bett.
Feofan lächelte, und vor lauter Falten zersprang sein Gesicht wie in tausend Splitter. »Keine Angst, Zarin. Komm, Junge, reich einem alten Mann deinen Arm!« Beide Männer traten auf den Korridor. Ich stand in der offenen Tür, und dank meiner üppigen Formen versperrte ich dabei den Blick auf das Bett des Zaren. Dabei sah ich in verschreckte, blasse Gesichter. Adlige wie Diener saßen dort wie Kaninchen in der Falle. Madame de la Tour, die dürre französische Erzieherin, hielt meine jüngste Tochter Natalja an sich gedrückt. Was hatte sie hier mit der Kleinen zu suchen? Es war viel zu kalt im Korridor, und am Vortag hatte Natalja bereits gehustet. Ihre älteren Schwestern Elisabeth und Anna standen neben ihr, doch ich mied auch ihre Blicke. Sie waren so jung. Wie konnten sie verstehen, was hier geschah? Noch wusste niemand, ob ich es war, die sie zu fürchten hatten. Mein Blick schweifte durch die Menge und suchte den kleinen Petruschka, Peters Enkelsohn, und seine Anhänger, die Prinzen Dolgoruki. Sie waren nirgends zu sehen. Wo waren sie? Heckten sie gerade ihre Pläne zur Übernahme des Thrones aus? Ich musste ihrer so schnell wie möglich habhaft werden.
»Ruf mir den Obersten Rat, die Grafen Peter Andrejewitsch Tolstoi und Apraxin, den Baron Ostermann und Pawel Jaguschinski! Spute dich! Befehl des Zaren!«, rief ich und achtete darauf, dass meine Worte im Korridor gehört wurden. Sobald sich die Untergebenen aus ihrer Verbeugung wieder aufrichteten, steckten sie die Köpfe zusammen.
Zurück in Peters Sterbezimmer, zwinkerte Menschikow mir zu.
»Komm mit nach nebenan, in die kleine Bibliothek«, sagte ich. Er nahm seinen bestickten Rock aus grünem Brokat vom Stuhl, auf dem er seit zwei Tagen und Nächten Wache an Peters Lager gehalten hatte. Die in den Stoff eingewebten Silberfäden hätten einer Bauernfamilie ohne Weiteres zwei Jahre ihr Auskommen gesichert. Seinen Stock mit dem Griff aus Elfenbein klemmte er sich unter den Arm.
Ich wandte mich an die Ärzte. »Blumentrost! Niemand verlässt diesen Raum, bevor ich es erlaube.«
»Aber …«, begann er.
Ich hieß ihn schweigen. »Niemand darf erfahren, dass der Zar gestorben ist. Kein Wort! Oder du wirst in Russland nie wieder als Arzt arbeiten. Habe ich mich klar genug ausgedrückt?« Mit diesem Ton wäre auch Peter einverstanden gewesen.
»Wie Ihr befehlt.« Blumentrost verneigte sich.
»Gut. Du wirst später entlohnt. Für deine Kollegen gilt dasselbe.«
Menschikow wartete bei der Tür, die sich in der Wandtäfelung verbarg und die in Peters kleine Bibliothek führte. Dabei schwankte er leicht. War er vor Müdigkeit unsicher auf den Beinen? Oder hatte er … Angst? Ich ging ihm in den dunklen kleinen Raum voran, und er griff nach einer Karaffe Burgunder und einigen Pokalen aus buntem venezianischem Glas. Ich runzelte die Stirn, doch er lächelte. »Jetzt ist weder Zeit für Geiz noch für Nüchternheit.« Mit diesen Worten stieß er mit der Ferse die Tür hinter uns zu, als befände er sich in einem Wirtshaus.
Das Kaminfeuer war niedergebrannt, doch die holzgetäfelten Wände speicherten die Wärme. Der Boden war mit den bunten Teppichen ausgelegt, die von unserem Feldzug in Persien stammten. Unser Zug war dadurch um mehr als ein Dutzend Wagen länger geworden, doch ihre Schönheit und die Muster mit all den Blumen und Vögeln aus Gottes Schöpfung waren es Peter wert gewesen. Die schlichten Stühle, die vor dem Schreibtisch, dem Kamin und vor den Regalen standen, hatte Peter selbst gezimmert. Manchmal hobelte und hämmerte er bis weit nach Mitternacht, denn das Schreinern vertrieb seine Dämonen und schenkte ihm die besten Einfälle. Nichts fürchteten seine Minister so sehr wie eine durchzimmerte Nacht. Oft war Peter vor Erschöpfung über seiner Hobelbank eingeschlafen. Nur Menschikow war stark genug, sich den Zaren dann über die Schultern zu legen und ihn zu Bett zu bringen. Wenn ich dort nicht auf ihn wartete, schlief Peter auf dem Bauch eines jungen Kammerherrn als Kopfkissen. Haut an seiner Haut hielt seine Angst in Bann. Vor den hohen Fenstern hingen die Vorhänge, die er noch vor dem Jahrzehnte andauernden Großen Nordischen Krieg – dem Kampf ums Überleben und die Vormacht im Westen des Reiches gegen die Schweden – als junger Mann auf seiner Reise nach Holland gekauft hatte. Die Regale bogen sich unter der Last der Bücher. Es waren Reiseberichte, Schriften über die Seefahrt, Schlachten zu Wasser und zu Lande, Erinnerungen an Herrscher und Lehren über das Herrschen wie auch religiöse Werke. In jedem Buch hatte er immer wieder und wieder geblättert und gelesen, wenn eine Stelle ihn gefangen nahm. Es war eine Welt, in die ich ihm nie hatte folgen können, von der ich ausgeschlossen blieb. Schriften lagen noch aufgeschlagen auf seinem Schreibtisch oder stapelten sich in den Ecken. Einige davon waren gedruckt und in dickes Schweinsleder gebunden, andere vor langer Zeit von Hand in den Klöstern geschrieben. Auf dem Kaminsims stand ein naturgetreues Modell der Natalja, Peters stolzer Fregatte, und darüber hing ein Bild meines Sohnes Peter Petrowitsch. Gemalt worden war es Monate vor seinem plötzlichen Tod, der seinem Vater und mir das Herz zerrissen hatte. Ich hatte den Raum lange Zeit gemieden, denn das Gemälde war allzu lebensnah, so als wolle mein Sohn mir seinen roten Lederball gleich zuwerfen. Seine blonden Locken fielen auf ein weißes Spitzenhemd, und hinter seinem Lächeln war eine Reihe perlender kleiner Zähne zu erahnen.
Ich hätte mein Leben gegeben, um ihn hierzuhaben und zum Zaren von Russland auszurufen. Ein Kind noch, sicherlich. Aber doch ein Sohn von meinem und deinem Blut, Peter. Eine Dynastie. Wünscht sich das nicht jeder Herrscher? Nun waren nur Töchter übrig … und der gefürchtete, ungeliebte Enkel Petruschka.
Der Gedanke an Petruschka erschreckte mich. Peter hatte ihn nach seiner Geburt in die Arme genommen und sich von der unglücklichen Mutter abgewandt. Arme Sophie Charlotte. Sie wirkte stets wie ein aufgescheuchtes edles Pferd, und genau wie ein Ross hatte ihr Vater sie aus dem heiteren Braunschweig an den russischen Hof verkauft. Wo war ihr kleiner Sohn nun? Im Dolgoruki-Palast? In den Kasernen? Draußen vor der Tür? Petruschka war gerade erst zwölf Jahre alt, doch ich fürchtete ihn mehr als den Teufel. Dabei hatte Peter ihm nicht einmal den Titel eines Zarewitsch zugestanden.
Menschikow stellte den Wein und die Pokale neben dem Kamin ab und lächelte. »Des alten Narren Feofan hast du dich ja geschickt entledigt.«
»Die Narren sind wir«, sagte ich. »Ich hoffe, er hält sein Wort.«
»Welches Wort hat er dir gegeben?«,
»Du hörst nur die Worte, die gesprochen werden. Aber es wird so viel mehr gesagt als das.« Ich fasste ihn am Hemdkragen, der sich in einem Wasserfall aus Spitze über seine eng geschnittene Weste ergoss. Er hob die Hände so unvermittelt, dass seine weiten Manschetten flogen, doch er wehrte sich nicht.
»Menschikow, wir sitzen beide im selben Boot. Gnade dir Gott für jede Sekunde, die du verschwendest. Weißt du, wen ich dort draußen im Korridor nicht gesehen habe?«
Er schüttelte den Kopf, denn zum Reden fehlte ihm der Atem.
»Weder den kleinen Petruschka noch seine liebenswerten Ratgeber. Und weshalb hält sich der rechtmäßige Erbe des Zaren aller Russen nicht am Sterbebett seines Großvaters auf, wo er sein müsste?«
Schweiß glänzte auf Menschikows Stirn.
»Weil er wohl in den kaiserlichen Kasernen weilt, wo ihn die Truppen bald hochleben lassen. Bald, wenn Peters Tod bekannt wird. Was geschieht dann mit uns? Wird er sich erinnern, wer seinen Vater gerichtet hat? Petruschka muss doch wissen, wer Alexejs Urteil als Erster unterzeichnet hat, wenn auch nur mit einem Kreuz neben dem Namenszug. Schließlich kannst du ja nicht schreiben.« Ich ließ ihn los, und er schenkte sich mit unsteten Fingern den Pokal voll. Doch ich war noch nicht fertig mit ihm. »Menschikow! Guter Gott, Sibirien wird ihnen zu gut für uns sein. Die Dolgorukis werden unsere Asche in alle Winde verstreuen. Niemand außer uns weiß, dass der Zar tot ist«, flüsterte ich. »Wir haben einige Stunden Vorsprung. Das Geheimnis gewährt uns Zeit.«
Zeit bis zum Morgen, der sich bleiern über Peters Stadt wölben sollte.
Menschikow fuhr sich mit seinen starken Fingern, an denen mehrere Ringe steckten, über seine Lider. War meine Furcht ansteckend? Nein, Menschikow, der so viele Schlachten zum Besseren gewendet hatte, der so oft seinen Kopf aus den widrigsten Schlingen gezogen hatte, wirkte wie betäubt. Er fiel in einen Lehnstuhl vor dem Kamin, den Peter aus Versailles mitgebracht hatte, streckte mit einem Seufzer seine noch immer wohlgeformten Beine aus und lehnte sich im Sessel zurück. Ein Wunder, dass das zarte Möbelstück ihn aushielt. Er trank einige Schlucke, schweigend, und drehte das bunte Glas vor dem Feuer hin und her. Die Flammen leuchteten durch seinen farbigen Schliff, und der Becher sah aus wie mit Blut gefüllt. Ich setzte mich ihm gegenüber, nippte aber nur an meinem Wein. In dieser Nacht würde es keine Trinkspiele geben. Menschikow hob seinen Pokal.
»Ich trinke auf dich, Katharina Alexejewna. Für mich hat es sich gelohnt, auf dich zu setzen, meine Fürstin. Auf dich, meinen schmerzlichsten Verlust. Auf dich, meinen höchsten Gewinn.«
Plötzlich lachte er; lachte so sehr, dass ihm die Perücke über die Augen glitt und er sie sich vom Kopf riss. Es klang wie ein Wolfsrudel in unserem Winter, hoch und höhnisch. Ich nahm seine Frechheit gelassen hin. Peter hätte ihm dafür die Knute gegeben, die allzeit bereit an seiner Seite gehangen hatte. Menschikow litt wie ein Hund, und sein Leid machte ihn unberechenbar. Auch sein Herr war soeben gestorben. Was stand nun für ihn in den Sternen? Ich brauchte ihn dringend. Ihn, den Geheimen Rat und die Truppen. Das Testament des Zaren raschelte in meinem Ärmel auf der nackten Haut.
Menschikow beruhigte sich, sein Gesicht unter dem struppigen, noch immer aschblonden Haarschopf war rot, als er mich unsicher, aber auch trotzig über den Rand seines Glases hinweg ansah. »Hier sitzen wir nun. Welch außergewöhnliche Zeit. Welch außergewöhnliches Leben, meine Fürstin. Es lässt sich nur mit göttlicher Vorsehung erklären.«
Ich schwieg. Außergewöhnlich? Ja, das sagte man wohl an den Höfen Europas, wo man über mich lachte und spottete. Ich war ein gelungener Scherz, der bei den Gesandten immer für beste Laune sorgte. Nur Peter fand immer das gewöhnlich, was gerade seinem Willen entsprach. Was sollte nun geschehen? Und stand es in meiner Macht? Ich konnte frei sein. Der größte Wunsch aller Leibeigenen, der Seelen.Wolja, die vollkommene, wilde, große Freiheit; mir nun zum Greifen nahe und doch schmerzlich weit entfernt.
Menschikows Glas entglitt seinen Händen. Das Kinn sank ihm auf die Brust. Der Wein hinterließ einen großen roten Fleck auf seinem weißen Spitzenhemd und der blauen Weste. Er war eingeschlafen. Die vergangenen Tage und Wochen holten ihn ein. Er schnarchte und hing schlaff wie eine Puppe im Sessel. Einige Minuten Rast, bevor Tolstoi kam, wollte ich ihm gönnen. Dann hieß es handeln. Später sollte man ihn in seinen Palast tragen, wo er den Rausch ausschlafen konnte. Den Sankt-Andreas-Orden besaß Menschikow bereits, und dazu mehr Leibeigene und Titel, als ich sie ihm je geben konnte. Ich konnte ihm nichts versprechen, doch er würde aus freien Stücken bleiben. Nichts bindet stärker als die Angst ums Überleben, schien Peter mir ins Ohr zu flüstern. Ich trat an ein Fenster, das einen der Innenhöfe des Winterpalastes überblickte. Die kleinen goldenen Ikonen, die zu Dutzenden an den Saum meines Kleides genäht waren, klirrten leise bei jedem Schritt. Als die junge Prinzessin Wilhelmine von Preußen mich damals in Berlin in diesem Aufzug gesehen hatte, hatte sie lachend mit dem Finger auf mich gedeutet. »Die Kaiserin von Russland sieht aus wie eine Spielmannsbraut!«
Ich schob den abgefütterten Stoff vor dem Fenster beiseite, der die tintenschwarze Kälte der Winternacht von Sankt Petersburg – unserer Stadt, Peter! Unser Traum! – aus dem Gemach fernhielt. Die Nacht, die dich nun auf ewig in ihren Armen hielt, hüllte auch die Wasser der Newa und den Großen Prospekt, die Allee zum Newski-Kloster, in Dunkelheit. Das eisige Grün des Flusses passte vollkommen zu den ebenen Hausfassaden, die im Morgengrauen dann in allen Farben des Regenbogens leuchten würden. Diese Stadt, die du mit deinem schieren, unbeugsamen Willen und unter hunderttausendfachem Leid deiner Untertanen, Adligen wie Seelen, aus dem sumpfigen Boden gestampft hattest. Die Knochen unzähliger Zwangsarbeiter, die in der marschigen Erde begraben lagen, bildeten ihr Fundament. Doch wer erinnerte sich ihrer angesichts dieser Pracht? Männer, Frauen, Kinder – alle ohne Namen und ohne Gesicht. Wenn es in Russland eines im Überfluss gab, dann war es menschliches Leben.
Der Morgen wird sich erst fahl und kühl, dann aber in blass brennender Glut auf den hellen, ebenen Wänden der Paläste spiegeln. Du hast das Licht hierhergelockt, Peter, und ihm eine Heimat gegeben. Was wird nun geschehen? Hilf mir!
Hinter den Fensterscheiben der Häuser gegenüber dem Palast wanderte Kerzenlicht, wie von Geisterhand getragen, durch die Gänge und Räume, ein furchtsames und doch forderndes Flackern. Im Hof stand ein Posten über seinem Bajonett zusammengekrümmt, doch plötzlich stürzten Soldaten aus dem Schloss. Pferdehufe klapperten, Funken stoben auf dem Kopfsteinpflaster, Rosse wieherten, und Reiter preschten zum Tor hinaus. Meine Finger krampften sich um den Fenstergriff. Hatte Blumentrost sich an meinen Befehl gehalten? Waren diese Boten mir treu? Oder wollten sie der Welt das schier Unglaubliche verkünden? Der russische Riese war tot.
Doch was sollte nun geschehen? Wolja oder die Verbannung und der Tod? Ich drehte mich vom Fenster weg und sank an der Wandtäfelung in die Knie. Mein Mund wurde trocken vor Furcht, die Zunge klebte mir am Gaumen. Ich hatte schon lange keine echte Furcht mehr verspürt. Dieses beißende Gefühl, das den Magen verknotet, den Schweiß sauer macht und die Gedärme öffnet. Nicht mehr seit … Halt! Ich musste den Kopf frei halten. In meinem ungeschulten Geist konnte ich nur eines auf einmal tun, während Peter wie ein Akrobat mit zehn Einfällen und Vorhaben gleichzeitig jonglierte.
Menschikow murmelte im Schlaf. Wenn nur Tolstoi und der Rat bald kämen! Die Stadt lauerte dunkel draußen vor den Fenstern und gab mir keine Antwort.
Ich nagte an einem Fingernagel, bis ich Blut schmeckte, und stand auf. Wie schwer mein Kleid auf meinen müden Knochen wog, als ich mich Menschikow gegenübersetzte und aus meinen Pantoffeln schlüpfte. Die Wärme der Flammen kroch mir durch die Glieder in den Kopf. Der Februar war einer der kältesten Monate in Sankt Petersburg. Vielleicht sollte ich mir heißen Wein und Brezeln bestellen, was mir immer einen schnellen, leichten Rausch schenkte. Hoffentlich war Peter im Nebenzimmer warm genug. Wenn er eines nicht hatte ausstehen können, dann war es zu frieren. Im Feld war uns stets kalt gewesen. Nichts ist frostiger als der Morgen vor einer Schlacht. Nur in der Nacht konnte ich ihn warm halten, und er schlug sein Lager in den Grübchen meines Körpers auf.
Menschen, die schlafen, sehen entweder lächerlich oder rührend aus, so wie Menschikow nun, der mit offenem Mund schnarchte. Ich zog Peters Letzten Willen aus dem Ärmel und hielt die Zukunft aller Russen in meinen Händen. Ich schloss die Augen, denn nun kamen mir brennend die Tränen. Endlich! Echte, unverfälschte Tränen voll tiefster Verzweiflung und Trauer, trotz aller Erleichterung. Vor mir lagen noch lange Stunden der Nacht, ein langer Tag und lange Wochen. Für diese Zeit benötigte ich viele Tränen, denn das Volk und der Hof wünschten sich eine trauernde, liebende Frau mit zerrauftem Haar, zerkratzten Wangen, gebrochener Stimme und verquollenen Augen. Meine Trauer und meine Liebe allein gaben mir das Recht, das Unerhörte zu tun, und waren mächtiger, als jeder Stammbaum es sein konnte. Schwer fielen mir die Tränen nicht. In nur einigen Stunden war ich entweder tot, wünschte mir den Tod herbei, oder ich war die mächtigste Frau in ganz Russland. Niemand sollte mich hören in dieser einen Nacht.
1. Kapitel
Mein Leben begann mit einem Verbrechen. Natürlich meine ich nicht den Augenblick meiner Geburt, denn wer erinnert sich schon genau an seine frühen Jahre? Über das Leben als Leibeigene, als sogenannte Seele, ist es besser, nichts als nur wenig zu wissen. Unser Dasein als deutsche Seelen, den nemzy in russischem Kirchenbesitz, war noch elender, als man es sich vorstellen kann. Wo lag das Nest, in dem ich aufwuchs? Irgendwo, verloren in den Weiten Schwedisch-Livlands. Ein Dorf wie auch ein Land, die es nicht mehr gibt. Stehen seine isby noch? Es kümmert mich nicht, was aus den armseligen Hütten geworden ist, denn ich habe in meinem Herzen eine Heimat gefunden. Als ich jung war, waren die isby entlang der roten Erde der Dorfstraße, die dort aufgereiht waren wie die Perlen am Rosenkranz der Mönche, meine Welt. Wie die Russen verwendete ich für beides ein und dasselbe Wort: mir. Unser Dorf war eines von so vielen anderen kleinen Dörfern im schwedisch beherrschten Livland, einer jener baltischen Provinzen, wo Polen, Letten, Russen, Schweden und Deutsche mehr oder minder friedlich zusammenlebten. Damals.
Die Dorfstraße hielt unser Leben zusammen wie ein Gürtel unsere losen Sarafane, die Schürzenkleider, die wir Mädchen trugen. Im Frühling, nach der Schmelze, oder nach den ersten heftigen Regengüssen im Herbst wateten wir bis zu den Knien im Matsch von unserer isba zu den Feldern und dem Fluss, der Vaïna. Im Sommer verwandelte sich die Straße in Wolken aus rotem Staub, der sich in die aufgesprungene Haut unserer Fußsohlen fraß. Im Winter dagegen versanken wir bei jedem Schritt bis zu den Oberschenkeln im Schnee, oder wir rutschten auf spiegelglattem Eis nach Hause. Hühner und Schweine liefen über die Straße. Dreck hing ihnen in den Federn und den Borsten. Kinder mit verfilztem und verlaustem Haar spielten dort, solange sie klein waren. Mit acht oder neun Jahren mussten die Jungen auf die Felder, um mit Stöcken und Steinen die Vögel zu verjagen, bevor sie säen und ernten halfen. Die Mädchen dagegen saßen an den Webstühlen des Klosters, wo ihre kleinen Finger für den feinsten Stoff bürgten. Ich selbst half in der Waschküche des Klosters aus, seit ich neun Jahre alt war. Dann und wann rollte ein voll beladener Karren durch das Dorf, vor den Rosse mit langen Mähnen und schweren Hufen gespannt waren. Er lud Waren am Kloster ab und brachte andere Güter zum Markt. Ansonsten geschah nichts.
An einem Tag im April, kurz vor Ostern – laut dem Kalender, den Zar Peter für seine Untertanen eingeführt hatte, war es das Jahr 1699 –, liefen meine jüngere Schwester Christina und ich die Straße entlang. Nach der letzten geduckten isba aus Holz, Lehm und Stroh weitete sich die Straße und führte an den Feldern vorbei zum Fluss. Es war der erste echte Frühlingstag, und die reine Luft roch noch nach dem größten Wunder unserer baltischen Länder, der ottepel, der Schmelze. Christina tanzte, drehte sich um die eigene Achse und klatschte in die Hände, und die Freude am Ende der langen, dunklen Wintermonate war ihr anzusehen. Ich versuchte, sie trotz des schweren Bündels Wäsche in meinem Arm einzufangen, aber sie entzog sich geschickt meinem Griff.
Den Winter über ruhte alles Leben im mir, ähnlich dem flachen Atem eines Bären, der das Fett unter seinem Fell bis zum Frühjahr aufbraucht. Das bleierne Licht der langen Jahreszeit lähmte unseren Geist, und wir versanken in einer schlaffen, stumpfsinnigen Düsterkeit, durch die Schwaden von kwass trieben. Wodka konnte sich niemand leisten, und das bittere, hefige Getränk aus altem Brot war genauso berauschend. Wir lebten überhaupt beinahe nur von Korn, von Hafer, Roggen, Gerste, Weizen und Dinkel, das wir zu ungesäuerten Brotfladen buken oder an Festtagen als Teig dünn rollten und mit eingekochtem Gemüse und Pilzen füllten. Unseren Brei, den kascha, süßten wir mit Honig und trockenen Beeren oder salzten ihn mit Speckrinden und dem Kraut, das wir im Herbst in Mengen klein schnitten, salzten und einstampften. Jeden Winter dachte ich mich vor lauter Sauerkraut übergeben zu müssen, doch ich zwang mich zum Essen. Es half uns, der Kälte zu widerstehen, die den Schleim im Rachen gefrieren ließ, bevor man ihn ausspucken konnte.
Gerade wenn Schnee und Frost zur Gewohnheit des Unerträglichen wurden, schwand die Kälte unmerklich. Erst herrschte nur einen Hahnenschrei länger Tageslicht, dann bog sich ein Zweig nach dem anderen nicht mehr unter der Schneelast. Gerade wenn wir nicht glauben konnten, dass die ottepel, die große Schmelze und das Wunder unserer Länder, je kommen sollte, hörten wir das mächtige Krachen, mit welchem das Eis auf der Vaïna brach. Die Wassermassen spritzten auf, wild und befreit, und trieben die letzten Eisplatten mit mächtigen Schnellen stromabwärts. Nichts konnte sich ihrer Gewalt widersetzen, selbst kleinste Bäche schwollen an, traten über ihre Ufer, und die starken, schuppigen Fische der Vaïna sprangen wie von selbst in unsere Netze.
In den fiebrigen Sommermonaten waren die Blätter an den Bäumen dicht und von dunklem Grün. Schmetterlinge torkelten in der Luft, die Bienen hatten es viel zu eilig, um lange auf einer Blüte zu verweilen, bevor sie weiterflogen, vom Nektar berauscht und die Beine schwer von Pollen. Selbst die Vögel sangen unbeirrt die weißen Nächte hindurch. Niemand wollte auch nur einen Augenblick dieses Wunders verpassen. Und unsere Welt war wie gefangen in einem plötzlichen Rausch der Fruchtbarkeit und des Lebens.
»Glaubst du, es liegt noch Eis auf dem Fluss, Martha?«, fragte mich Christina zum mindestens zehnten Mal. Martha, so hieß ich damals, und am nächsten Tag sollte das große Frühlingsfest stattfinden. Seit Wochen sprachen wir von nichts anderem. Wir konnten es kaum abwarten, nach dem Waschen der Kleider selbst ins Wasser zu springen und uns den klebrigen, nach Rauch riechenden Winter von der Haut zu schrubben. Beim Fest am nächsten Tag erwarteten uns ungeahnte Wunder und Köstlichkeiten, von denen wir uns vielleicht einige leisten konnten. Die Leute aus den umliegenden miry kamen ebenso wie vielleicht ein unbekannter, gut aussehender Mann. So hofften wir zumindest.
»Lass uns um die Wette rennen!«, schlug Christina vor und lief los. Ich aber stellte ihr ein Bein und fing sie gerade noch auf, ehe sie stolperte und fiel. Sie klammerte sich an mich wie ein Bub, der einen Bullen reitet. Wir verloren lachend und uns drehend und balgend das Gleichgewicht und fielen die Böschung hinunter, wo schon erste Primeln und wilde Kresse blühten. Das scharfe junge Gras kitzelte mich an meinen nackten Armen und Beinen, als ich aufstehen wollte. Oje! Die Kleider lagen über die ganze staubige Straße verteilt. Nun hatten wir wirklich einen guten Grund zum Waschen. Wenigstens konnten wir am Fluss arbeiten. Vor einigen Wochen noch hatte ich am Bottich hinter der isba mit der Axt das Eis aufhacken und beim Schrubben die Eisstücke beiseiteschieben müssen. Die Hände froren mir blau dabei, und Frostbeulen heilten nur langsam und schmerzhaft.
»Komm, ich helfe dir«, sagte Christina, sah aber doch rasch zum Dorf zurück. Gut, wir waren außer Sichtweite der isba.
»Du musst mir nicht helfen«, versicherte ich ihr aus falschem Stolz. Die Wäsche wog schwer auf meinem Arm.
»Sei nicht albern! Je schneller wir waschen, umso schneller können wir baden«, widersprach sie und nahm die Hälfte der Wäsche aus meiner Armbeuge.
Christina musste eigentlich keine Wäsche tragen, denn sie war die Tochter der Frau meines Vaters, Tanja. Ich dagegen war ihm von einem Mädchen im Nachbardorf neun Monate nach Mittsommer geboren worden. Da er schon mit Tanja verlobt gewesen war, hatte er meine Mutter nicht heiraten müssen. Die Mönche hatten das letzte Wort und verheirateten ihn natürlich lieber mit einem ihrer Mädchen. Meine Mutter starb bei meiner Geburt, und Tanja hatte keine andere Wahl, als mich aufzunehmen. Die Familie meiner Mutter hielt ihr auf der Schwelle der isba mein Bündel Leben entgegen. Sonst hätten sie mich am Waldrand ausgesetzt.
Tanja behandelte mich nicht ausgesprochen schlecht. Wir mussten alle hart arbeiten. Nur wenn sie ärgerlich war oder zu viel kwass getrunken hatte, zog sie mich an den Haaren, kniff mich in den Arm und zischte dann: »Du hast schlechtes Blut. Wer weiß schon, wo du wirklich herkommst? Schau dich doch an! Haare schwarz wie Rabenschwingen. Deine Mutter hat für alle die Beine breit gemacht. Pass nur auf, du Hurenbalg!«
War mein Vater in der Stube, so schwieg er, sah dann aber noch trauriger aus als sonst. Sein Rücken war von der Arbeit auf den Feldern des Klosters gebeugt, und erst nach mehreren Bechern kwass konnte er zahnlos lachen. Der Trank aus vergorenem Brot brachte ein stumpfes Licht in seine eingefallenen Augen.
Ehe wir weitergingen, drehte Christina mich zur Sonne. »Eins, zwei, drei … wer länger in die Sonne sehen kann!«, rief sie, noch atemlos von unserer Rauferei. »Schau hin, auch wenn es dir die Lider versengt! Zwischen den Flecken, die in deinen Augen tanzen, siehst du den Mann, den du heiraten wirst.«
Der Mann, den du heiraten wirst. Mehr hielt das Schicksal für Mädchen wie uns nicht bereit, und wir wollten der Zukunft in die Karten sehen. Um Mitternacht stellten wir drei wertvolle Lichter um eine Schale Wasser und legten einen Kohlekreis darum, doch kein Gesicht außer dem unseren spiegelte sich auf der Wasseroberfläche. Kein Mittsommer verging, ohne dass wir sieben Sorten Wildblumen pflückten und den Strauß unter unser Kopfkissen schoben. Unser Zukünftiger wanderte dennoch nicht durch unsere Träume.
Ich gehorchte und schloss die Augen. Die Nachmittagssonne stand warm am Himmel, und Flecken tanzten sinnlos golden unter meinen Lidern. Ich küsste Christina auf die Wange. »Lass uns gehen! Ich will mich nach dem Baden auf den warmen Steinen am Ufer trocknen.«
Wir teilten die Wäsche und liefen Hand in Hand an den Feldern vorbei, wo die Seelen mit gebeugtem Rücken bei der Arbeit waren. Ich erkannte meinen Vater unter ihnen. Im Frühling wurde nur ein Teil des Feldes für die erste Ernte bestellt. Auf einem zweiten Teil wurden im Sommer Rüben, Bete und Kraut gepflanzt, alles, was man auch bei hart gefrorener Wintererde ernten konnte. Das letzte Drittel Erde ruhte bis zum folgenden Jahr. Die Zeit, in der wir für den Rest des Jahres vorsorgen konnten, war kurz, und einige vertrödelte Tage konnten eine Hungersnot bedeuten. Im August blieb mein Vater leicht achtzehn Stunden auf den Feldern. Die Erde, die uns ernährte, liebten wir nicht, im Gegenteil: Sie war uns eine mitleidlose Herrin. Sechs Tage der Woche gehörten dem Kloster, der siebte dann uns. Für Seelen hatte Gott keinen Ruhetag vorgesehen. Die Mönche in ihren langen dunklen Gewändern liefen zwischen den Arbeitern hin und her und hielten ein scharfes Auge auf ihr Eigentum – das Land wie auch die Seelen, die es beackerten.
»Was, glaubst du, hat ein Mönch unter seiner Kutte?«, neckte mich Christina.
Ich hob die Schultern. »Viel kann es nicht sein, sonst sähe man es doch durch.«
»Das stimmt. Vor allen Dingen, wenn sie dich sehen«, antwortete sie.
Ich dachte an Tanjas Art, meine Mutter zu beleidigen. »Was meinst du damit?«, fragte ich vorsichtig.
»Martha! Und du willst älter sein als ich?«, rief sie, bevor sie ihren Knoten löste und die langen blonden Haare schüttelte. »Auf dem Jahrmarkt werden alle Männer mit dir tanzen wollen, und mich wird keiner beachten.«
»Unsinn! Du siehst aus wie ein Engel. Allerdings wie ein Engel, der dringend ein Bad benötigt. Komm jetzt!«
Wir fanden die seichte Stelle vom vorigen Jahr am Fluss sofort wieder. Ein kleiner Weg führte durch einen Birkenhain und niedriges Gebüsch bis dorthin. Ich sah erste Knospen an allen Zweigen. Bald sollten wilde Iris und Labkraut hier blühen. Beim Abstieg zum Ufer setzten wir vorsichtig einen Fuß vor den anderen. Am Fluss angekommen, ordnete ich die Wäsche und legte die guten Leinenhemden und Hosen der Männer auf die eine Seite, die Sarafane und Leinentuniken, die wir Frauen an Feiertagen trugen, auf die andere. An den langen Winterabenden hatten wir ihre Kragen, Ärmel- und Rocksäume ebenso wie die Biesen unserer gesmokten Leinenblusen farbenfroh bestickt. Die Muster, die oft wie eine geheime Sprache in der Familie von Mutter zu Tochter weitergegeben wurden, leuchteten in den Nachmittag. Vielleicht konnten wir auf dem Jahrmarkt neues, buntes Garn gegen einige von Vaters Schnitzereien – Löffel und Becher – eintauschen.
Ich schlang mein Haar zu einem losen Knoten, damit es nicht in den schmutzigen Schaum hing, und faltete mein ausgeblichenes Kopftuch zum Schutz gegen die Sonne. Dann zog ich an den Bändern, die in die Ärmelnähte meiner Bluse eingelassen waren. Ihr Stoff bauschte sich in unzähligen Falten, als ich den Rock meines wegen der noch frischen Temperaturen gefütterten und gesteppten Sarafans um meine Schenkel knotete. Aus der Entfernung sah ich wahrscheinlich wie eine Wolke auf zwei Beinen aus.
»Lass uns anfangen!«, schlug ich vor, griff nach dem ersten Hemd, und Christina reichte mir das wertvolle Stück Seife. Ich tauchte das Waschbrett in das klare Wasser und rieb die Seife sorgsam über seine scharfen Rippen, bis sie alle dick mit einer glitschigen Schicht bedeckt waren. Seife kochen war harte Arbeit, nach der einem alle Glieder schmerzten. Trug Tanja sie deshalb mir mit Vorliebe auf? Die beste Zeit dazu war der Herbst, nach den Schlachttagen des Klosters, wenn die Mönche das Fleisch für den Winter salzten, pökelten und räucherten und es Unmengen von Knochen gab. Oder der Frühling mit der gesammelten Asche des Winters. Alle Frauen des mir kochten in großen Kesseln eine beißende Lauge aus Regenwasser und Asche, zusammen mit dem angesammelten Schweine- oder Rinderfett und Pferdeknochen, stundenlang ein. Die schleimige graue Brühe mit den großen heißen Blasen auf der Oberfläche, die laut und spritzend aufplatzten, wurde nur langsam von Stunde zu Stunde dicker. Wir mussten sie ständig umrühren, damit sie nicht anlegte. Es fühlte sich an, als wollten uns die Arme abfallen. Am Abend schütteten wir die Masse in Formen aus Holz. Hatten wir Salz, das wir dazugeben konnten, bekamen wir einen festen Brocken Seife. Aber Salz war oft zu wertvoll dafür. Wir benötigten es für die Tiere und um Fleisch und Kraut für den Winter haltbar zu machen. So war die Seife oft nur ein Schleim, den wir dem Waschwasser zusetzten.
Der Fluss glitzerte verlockend in der Aprilsonne. Christina und ich arbeiteten rasch. Bei der lockenden Aussicht auf ein Bad tauchten wir die Kleider eifrig ein, schrubbten kräftig und schlugen sie auf die flachen Steine. »Stell dir vor, es ist der Abt!«, trieb ich Christina an, härter zu schlagen, auszuwringen und über die tief hängenden Zweige der Böschung zum Trocknen zu hängen.
»Auf die Plätze, fertig, los!«, rief Christina plötzlich, als ich noch das letzte Hemd glatt strich. Sie löste den Knoten in ihrem Gürtel, zog sich im Laufen den Sarafan und die Bluse über den Kopf und stand nackt in der Frühlingssonne. Wie anders sie aussah als ich! Christinas Haut war hell wie Rahm – smetana –, ihr Körper schlank, mit schmalen Hüften und knospenden kleinen Brüsten, die wohl genau in ihre hohle Hand passten. Ihre Brustwarzen erinnerten mich an Himbeeren. Dennoch konnte sie schon Kinder haben. Ihr Blut hatte im letzten Jahr zu fließen begonnen. Ich selbst dagegen … nun, Tanja hatte schon recht. Meine Haare waren schwarz und voll, meine Haut schimmerte matt wie Tonerde … oder getrockneter Rotz, wie Tanja es nannte. Meine Hüften waren breit, meine Brüste groß und fest.
Christina planschte in der seichten Uferströmung. Ihr Kopf tauchte zwischen den Felsen auf und ab, dort wo sich das Wasser in Teichen sammelte. Unter ihren Füßen leuchtete weiß der Sand des Flussbettes. »Komm, worauf wartest du?«, rief sie lachend, stürzte sich kopfüber in die Wellen und trieb zum Tiefen hin ab. Ich zog mich so schnell wie möglich aus, löste mein Haar und eilte ihr nach. Wie lange wir dort badeten, tauchten und uns – wunderbar verboten! – die Körper mit der kostbaren Seife abschrubbten, weiß ich nicht mehr. Unter Wasser öffnete ich die Augen, haschte nach Wasserschnecken, brach am Ufer spitze Schilfrohre ab, um einen Aal zu spießen, und zwickte Christina in die Zehen, als wäre ich ein dicker Fisch. Das Wasser war noch immer eisig. Auf meiner Haut bildete sich sofort eine Gänsehaut, als ich als Erste aus dem Fluss kam. Ich schüttelte mein Haar aus, und die fliegenden Tropfen funkelten in der Sonne, bevor ich es zu einem losen Knoten schlang.
»Besser als das Badehaus«, gurgelte Christina, die noch im Seichten trieb. »Wenigstens wird man nicht mit Zweigen beinahe blutig gepeitscht.«
»Das kann ich ändern«, sagte ich und brach einen Zweig von einem Busch. Christina quietschte und tauchte unter.
»Keine Sorge! Zu viel Baden und Peitschen kann nicht gut sein«, entschied ich, als ich Geräusche von der Straße her hörte. Pferde wieherten. Kies knirschte unter Karrenrädern. Männer sprachen. »Bleib im Wasser!«, wies ich Christina an und trat einen Schritt zur Seite, um den Weg überblicken zu können. Drei bewaffnete Reiter kreisten um einen Karren, der mit einer hellen Plane bedeckt war. Auf dem Kutschbock hielt ein Mann die Zügel in den Händen. Ich hatte das Gefühl, dass er mich trotz der Entfernung musterte, und ich wünschte mir sehnlich mein langes Hemd herbei.
»Wer ist das?« Christina ließ sich, auf dem Bauch liegend, in der seichten Strömung hin und her treiben, das Gesicht halb im Wasser.
»Pst! Ich weiß es nicht! Bleib, wo du bist!«
Zu meinem Schrecken sah ich, dass der Mann vom Kutschbock stieg. Er warf einem seiner Begleiter die Zügel zu und schlug den kleinen Weg zum Ufer ein. Ich rannte zu dem Busch, auf dem mein frisches Hemd trocknete. Es war noch immer feucht, aber ich schlüpfte hinein. Es gelang mir gerade noch, es über meine Schenkel zu ziehen, doch es klebte überall an meiner feuchten, sandigen Haut.
Kurz darauf stand der Mann vor mir. Er mochte so alt sein wie mein Vater, hatte in seinem Leben aber sicher weniger hart gearbeitet. Ein dunkler Fellkragen lag auf den Schultern seines langen russischen Mantels, und seine Hose war aus weichem Leder gefertigt. Der Gürtel war reich bestickt, doch seine hohen Stiefel waren mit Matsch und Kot bespritzt. Ich legte mir die flache Hand über die Augen. Trotz des Schattens, den sein flacher Hut aus Biberfell auf sein Gesicht warf, standen ihm Schweißperlen auf der Stirn. Wie alle Russen damals trug er einen Vollbart. Sein Blick glitt abschätzend über mich hinweg, bevor er seine Handschuhe auszog. An seinen kurzen dicken Fingern trug er mehrere Ringe mit bunten Steinen. Selbst der Abt trug nicht so viel Schmuck. Ich trat einen Schritt zurück, doch zu meinem Entsetzen folgte er mir.
»Kannst du mir den Weg zum Kloster sagen, Mädchen?«, fragte er mich in hartem Deutsch.
Er hatte noch alle Zähne im Mund, doch sein Zahnfleisch war dunkelrot vom Kautabak. Nach dem langen Ritt roch er nach Schweiß, aber hätte ich das Gesicht verzogen, wäre ich einem Fremden und Reisenden gegenüber unhöflich gewesen. Dennoch, seine Art, mich zu mustern, bereitete mir Unbehagen. Ich spürte, dass meine Brüste sich unter dem dünnen, nassen Leinen abzeichneten. Schlimmer noch, mein Haar glitt aus dem Knoten, den ich zu hastig geschlungen hatte. Als ich nach den losen Strähnen griff, rutschte mir die Bluse von den Schultern.
Der Fremde fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Sein Anblick erinnerte mich an die Schlange, die mein Bruder Fjodor und ich im letzten Sommer im Gestrüpp unseres Gemüsefeldes entdeckt hatten. Sie war hellgrün und fast durchsichtig gewesen, sodass ihre Gedärme dunkel durch die Haut schimmerten, als sie gefährlich langsam auf uns zuglitt. Sie sah giftig aus, tödlich. Obwohl Fjodor kleiner war als ich, hatte er mich hinter sich geschoben, sich gebückt und nach einem schweren Stein gegriffen. In dem Augenblick, als die Schlange mit geöffnetem Kiefer nach vorn geschossen war, hatte er ihr den Kopf zerschmettert. Der tote Körper zuckte und wand sich noch, als Fjodor ihn mit einem Stock in die Büsche warf.
Der Mann kam einen Schritt auf mich zu.
»Martha, gib acht!«, schrie Christina aus dem Wasser.
Der Mann wandte den Kopf und sah zu ihr hinunter. Ich nutzte den Augenblick, bückte mich und hob einen bemoosten Stein auf. Ich war noch Jungfrau, aber schließlich hatten wir Hennen und Hahn im Hinterhof und oft genug Hengste die Stuten auf den Weiden des Klosters besteigen sehen. Außerdem gab es in den isby, in denen die ganze Familie Körper an Körper, Atem an Atem auf dem flachen Ofen schlief, nur wenig menschliche Geheimnisse. Ich wusste genau, was er wollte. »Das Kloster liegt die Straße geradeaus weiter. Du bist bald dort, wenn du dich beeilst.« Es ärgerte mich, dass meine Stimme zitterte.
Er kam noch einen Schritt näher auf mich zu. »Deine Augen haben dieselbe Farbe wie der Fluss. Was gibt es sonst noch an dir zu entdecken?«, fragte er und zupfte an meinem Hemd.
Nur ein Atemzug trennte uns. Ich wich nicht zurück, sondern zischte ihn an. »Wenn du näher kommst, schlage ich dir den Schädel ein. Mach, dass du auf deine Kutsche und zu den verfluchten Mönchen kommst!« Ich wog den Stein drohend in meiner Hand.
Aus den Augenwinkeln nahm ich wahr, dass seine drei Begleiter nun ebenfalls abstiegen. Sie schüttelten die Glieder wie nach einem langen Ritt und ließen ihre Pferde grasen. Ich biss mir auf die Lippen. Einen Schädel konnte ich einschlagen, aber gegen vier Männer war jede Gegenwehr sinnlos. Mein Mut schwand, und mein Herz schlug hart in meiner Brust. Der erste der Männer schien sich an den Abstieg zu machen.
Der Fremde lächelte siegesgewiss. In diesem Augenblick hörte ich, wie Christina im Wasser leise zu weinen begann. Ihr Schluchzen machte mich wütend. Der Zorn verlieh mir neue Kraft und neuen Mut. »Mach, dass du wegkommst, Russe!«, herrschte ich ihn an.
Er zögerte, befahl dem anderen Mann mit einem Handzeichen, er möge verharren, und grinste. »Bei Gott, du machst mir Spaß, Mädchen! Wir werden uns wiedersehen, und dann wirst du freundlicher zu mir sein.«
Er streckte eine Hand aus, so als wolle er auch noch mein Haar berühren. Christina schrie auf. Ich spuckte ihm vor die Füße. Sein Gesicht wurde hart. »Warte nur!«, drohte er. »Martha, hm? So hat sie dich doch genannt, die Kleine im Wasser, oder?«
Ich schwieg, stumm vor Furcht, doch er drehte sich um und stieg die Böschung hinauf. Erst als er die Pferde vor dem Karren mit einem Zungenschnalzen angetrieben hatte und das Geklapper der Hufe wie auch das Rattern der Räder verklungen waren, ließ ich den Stein aus den verschwitzten Fingern gleiten und sank in dem groben grauen Sand in die Knie. Ich zitterte am ganzen Körper.
Christina watete aus dem Wasser zu mir. Sie umschlang mich und weinte. Wir hielten einander fest, bis ich nur noch vor Kälte und nicht mehr vor Furcht zitterte. Sie strich mir über das Haar. »Mein Gott, bist du mutig, Martha! Ich hätte es nie gewagt, den Mann mit dem lächerlichen kleinen Stein zu bedrohen.«
Ich sah auf den Stein neben mir. Er sah wirklich klein und lächerlich aus.
»Meinst du, wir müssen ihn fürchten?«, fragte sie dann.
Er hatte nach dem Kloster gefragt, dem wir gehörten. Unsere isba, unser Land, das Hemd auf meinem Körper ebenso wie wir selbst. Ich verjagte den Gedanken. »Unsinn! Den Fettsack sehen wir nie wieder. Hoffentlich fällt er vom Kutschbock und bricht sich den Hals.« Ich versuchte zu lachen, doch es gelang mir nicht. Christina nickte. Sehr überzeugt wirkte sie ebenfalls nicht.
Wolken zogen vor die Sonne. Das erste zarte Blau der Dämmerung verschleierte das Tageslicht. Mir wurde kalt in dem feuchten Hemd, an dem nun wieder Schmutz klebte. So ein Unfug. Nun durfte ich es am nächsten Tag vor dem Fest noch einmal waschen. Ich klopfte mir Sand und Kieselsteine von den Schienbeinen.
»Lass uns gehen! Es wird dunkel«, sagte ich.
Schweigend schlüpften wir in unsere alten Kleider und sammelten die feuchte Wäsche ein, um sie über den flachen Ofen zu hängen, obwohl dadurch die Luft in der Hütte schwül wurde und Fjodor husten musste.
»Wir erzählen niemandem, was wir erlebt haben, nicht wahr?«, bat ich Christina. Vielleicht hoffte ich, das Treffen am Fluss ungeschehen machen zu können. Insgeheim aber ahnte ich bereits, dass der Vorfall Folgen haben würde. Nichts auf dieser Welt ereignet sich ohne Grund. An jenem Nachmittag am Fluss schlug mein Leben eine andere Richtung ein, so wie der Wetterhahn auf dem Dach des Klosters, der sich in einem unerwarteten Sturmwind drehte.
2. Kapitel
Es hatte geregnet in der Nacht vor dem Frühlingsfest. Die Mönche zwangen uns nemzy am Sonntag nicht wie ihre anderen Seelen in ihre Kirche. Wir waren katholisch getauft, doch Glaube war für mich nur Bitten, Beschwörung und das stete Schlagen des Kreuzes mit drei Fingern. Am Tag unseres Todes, so hofften wir Seelen wenigstens, sollte das genügen, um uns in den Himmel der Freigeborenen zu bringen.
Unsere nackten Füße sanken mit einem leisen, schmatzenden Geräusch in den weichen, warmen Schlamm des Weges hin zur Dorfwiese. Die Sandalen aus Bast und Holz trugen wir in den Händen, um sie vor dem Fest nicht zu verschmutzen. Tanja, Christina, meine jüngste Schwester Marie und ich liefen gemeinsam zur Festwiese neben dem Kloster. Marie konnte mit ihren vier Jahren kaum mit uns Schritt halten. Ich nahm sie an der Hand und passte meine Schritte ihrem Getrippel an.
Nach dem feuchten Morgen war der Nachmittag nun sonnig und der Himmel weit und blau. Männer bereiteten neben der Festwiese den Tanzboden für den Abend vor, und Frauen spannten zwischen den Birken rings um die Lichtung Seile straff, auf denen die Kinder schaukeln konnten. Andere standen in ihren langen bunten Kleidern beisammen, lachten, redeten, sangen Lieder und klatschten dabei in die Hände.
Auf der Festwiese selbst herrschte ein buntes Durcheinander. Menschen aus der ganzen Provinz waren zum Markt und zum Fest am Kloster gekommen. Vor dem ersten Zelt, an dem ich vorbeikam, war ein Bär angepflockt. Sein Fell war schmutzig und zerzaust. Als er sein Maul öffnete, sah man seine stumpf gefeilten Zähne. Auch seine Klauen waren beinahe bis zum Fleisch zurückgeschnitten. Von den gefangenen Tieren hielt ich mich besser fern. Ihre zornige, unberechenbare Natur schlummerte nur und war durch die Ketten nicht besänftigt. Im Winter fanden die fahrenden Händler, die sie gefangen hielten, oft keine Unterkunft und erfroren am Wegrand. Die Bären rissen ihre Kette aus den Händen des Toten, und der Hunger trieb sie in die nächstgelegenen Häuser und Höfe. So machten Anna und ich einen ehrerbietigen Bogen um den Petz, der seine Klauen sinnlos an einem Pfosten wetzte.
Marie sah sich rasch nach Tanja um, doch die bestaunte an einem Stand Ketten und Armbänder. Sie legte den kleinen Finger an die Lippen und hob dann neugierig die Klappe eines mit bunten Flicken besetzten Zeltes an.