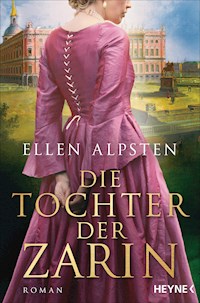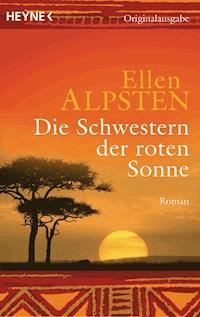3,99 €
3,99 €
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein großes Frauenschicksal in einem faszinierenden Land
Kilima, die Farm ihrer Familie am Fuße des Mount Kenia, bedeutet Kim Knudsen mehr als alles andere. Dort verbrachte die studierte Artenschützerin ihre Kindheit, und dort hat sie jetzt, nach zehn Jahren in Europa, mit dem Forscher Mark ihr Glück gefunden. Als Kim die Spur einer Löwin im Sand entdeckt, ahnt sie noch nicht, dass diese ihr ganzes Leben verändern wird. Doch dann fällt das Tier einen Gast der Farm an. Plötzlich steht nicht nur Kilima auf dem Spiel, sondern auch Kims große Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2011
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Bei dem Gedicht im Prolog handelt es sich um die erste Strophe aus:Der Panther, Im Jardin des Plantes, Rainer Maria Rilke, Paris 1902
Copyright © 2011 by Ellen Alpsten Copyright © 2011 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbHNeumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Patricia CzeziorSatz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-05305-5V002
www.heyne.dewww.penguinrandomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
ZUM BUCH
ZUR AUTORIN
LIEFERBARE TITEL
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Copyright
ZUM BUCH
Als Kim Knudsen dem attraktiven Mark begegnet, den ein Forschungsprojekt auf die Farm ihrer Familie geführt hat, ist es für beide Liebe auf den ersten Blick. Doch Kim bleiben nur wenige unbeschwerte Stunden an seiner Seite. Eine ungewöhnlich aggressive Löwin bedroht Kilima und seine Bewohner. Steckt eine alte Weissagung oder gar ein Fluch der Kikuyu dahinter? Ihr Angriff zwingt die Knudsens, den jährlichen Marathon abzusagen – finanziell eine Katastrophe für die Farm. Zudem wird Kim offenbar von einem Stalker verfolgt, der sogar in ihr Haus eindringt. Kaum weiß sie noch, wem sie trauen kann. Doch am Ende hört Kim auf ihr Herz – und auf Juya, die weise Frau der Kikuyu …
Eine bewegte Liebesgeschichte vor der farbenprächtigen Kulisse Kenias.
»Alpsten baut nie abreißende Spannung auf.«
Augsburger Allgemeine Zeitung zu Die Schwestern der roten Sonne
ZUR AUTORIN
Ellen Alpsten wurde 1971 in Kenia geboren, verbrachte ihre Kindheit und Jugend dort und studierte dann in Köln und Paris. Sie arbeitete in der Entwicklungshilfe an der Deutschen Botschaft Nairobi und als Moderatorin bei Bloomberg TV. Heute ist sie freie Schriftstellerin und Journalistin, u. a. für die FAZ und Spiegel Online. Nach den historischen Romanen Die Lilien von Frankreich, Die Zarin und Die Quellen der Sehnsucht wandte sich die Autorin mit Die Schwestern der Roten Sonne und Die Löwin von Kilima dem zeitgenössischen Afrikaroman zu. Ellen Alpsten lebt mit ihrer Famlie in London.
LIEFERBARE TITEL
Die Quellen der SehnsuchtDie Lilien von FrankreichDie ZarinDie Schwestern der Roten Sonne
Prolog
Als Kim im Busch um die kleine Lichtung nach Feuerholz suchte, senkte sich die Sonne gerade über den drei Gipfeln des Mount Kenia. Die Bergspitze war nach dem Glauben der Kikuyu die Heimat der Wolken und der Sitz ihres Gottes Mungu. Das wusste Kim von ihrem Kindermädchen Juya, der weisen Frau des Stammes. Im Abendlicht färbte sich der graue Fels kupfern und die Ebene von Kilima wie auch der Busch um Kim glühten wie gebrannter Ton. Trotz all ihrer Gefahren war dies die einzige Heimat, die Kim kannte und die ihr ein Gefühl von Geborgenheit gab.
»Hast du noch was gefunden?«, fragte ihr Vetter Chris sie, als sie wieder auf die Lichtung trat. »Warum hast du so lange gebraucht?«
»Ich habe mir den Berg angesehen und von ihm Abschied genommen«, sagte Kim.
»Sieh dir nur alles an, bevor du morgen nach England fährst. Dort verschmelzen Himmel und Horizont zu einem einzigen Klumpen Blei«, sagte ihr Nachbarssohn Patrick Miller.
»Ist deine Schule weit weg von meiner?«, fragte Kim ihn und Patrick nickte mit bedrücktem Gesicht.
»Zwei Stunden Fahrzeit. Ohne eigenes Auto ist die Reise nicht zu machen.«
»Ihr solltet euch mal jammern hören. Ich wäre froh, wenn ich nach England in die Schule dürfte«, sagte Chris zu Patrick. »Ich darf nur nach Nairobi zu Tante Georgia ziehen und muss dort jeden Morgen ihre stinkenden Hunde striegeln, um mir meinen Unterhalt zu verdienen.«
Kim lachte. »So schlimm wird es doch auch nicht sein. Wenigstens kannst du hierbleiben.«
Sie versuchte Chris Worten die Spitze zu nehmen, denn sein Vater war der Verwalter der wohlhabenden Millers.
Moto, der junge Massai, hatte während der Unterhaltung zwischen Kim und den beiden Jungen geschwiegen und die Rebhühner auf Stecken gespießt.
»Ich beneide dich«, wandte Kim sich an ihn, als er ihr die dünnen Hölzer abnahm und zu einem Haufen stapelte. Die Stecken waren feucht von der langen Regenzeit, aber Moto trug seinen Namen zu Recht und kannte alle Gesetze des Feuers. »Moto« bedeutete »Feuer« auf Swahili. Er rieb zwei Hölzer aneinander, bis Rauch zwischen ihnen aufstieg und er die ersten Funken mit einem trockenen Zweig auffangen konnte.
»Weshalb beneidest du mich?«, fragte Moto, ohne den Blick von den Flammen zu lösen.
»Weil du hierbleiben kannst. Weil sich vielleicht etwas ändert, während ich weg bin, und ich Kilima dann nicht mehr verstehe.«
Moto erhob sich und zog die rote Shuka fester um seinen sehnigen Körper. Er war in den letzten Monaten sehr gewachsen und überragte sowohl Chris als auch Patrick um Haupteslänge. In zwei Jahren würde er an seinem sechzehnten Geburtstag ein Moran werden, ein junger Krieger.
»Keine Angst. Ich passe gut auf Kilima auf. Du wirst alles hier wiedererkennen«, sagte er.
Kilima, »Maulwurfshügel« auf Swahili, beschrieb treffend die Hügel der Farm gegenüber dem Mount Kenia, der die Landschaft beherrschte.
Sie würde ja wiederkommen, dachte Kim. Und eines Tages würde Kilima ihr gehören. Ihren Vater schien es nie gestört zu haben, dass sein einziges überlebendes Kind ein Mädchen war. Kims um eine Minute älterer Zwillingsbruder Ben war im Alter von nur vier Monaten gestorben. Soweit Kim wusste, lag er eines Morgens aus unerklärlichen Gründen tot in ihrem gemeinsamen Bettchen. Manchmal hatte sie das Gefühl, ihren Eltern beide Kinder ersetzen zu müssen, und das vor allen Dingen für ihre Mutter.
Zu dieser Stunde des Wechsels zwischen Tag und Nacht war es still im Busch um die Kinder. Die kleinen harmlosen Tiere schliefen in der Abendkühle, während die großen Raubtiere sich auf die Nacht und ihre Jagd vorbereiteten. Die Zikaden sangen noch nicht. Moto nannte sie die »Jagdhunde der Sterne«. Die Dunkelheit glitt zwischen Kim und ihre Freunde und sie rückten näher an das Feuer heran, das nun hell loderte. Ihre gegenseitige Nähe bildete einen Wall gegen die unberechenbare Welt um sie herum, deren Gefahren sie umso verlockender scheinen ließ.
»Brr. Wie kalt es ist«, sagte Patrick Miller und schlang sich die mageren Arme um die Knie. Gänsehaut überzog seine braune Haut und die blonden Härchen richteten sich auf. »Ich habe meinen Pullover vergessen, zu dumm.«
»Jetzt fängst du auch schon mit dem Vergessen an«, bemerkte Chris.
Kim sah ihren Vetter überrascht an. Die Bemerkung war herzlos. Jeder wusste, dass sowohl Patricks Großvater als auch sein Vater an Huntington litten. Vergesslichkeit war nur eines der frühen Anzeichen dieser Erbkrankheit. Statt Chris zu antworten, hob Patrick Miller vorsichtig einen Käfer von seinem Arm und setzte ihn auf den staubigen Boden.
Ein Wind kam auf und brachte Bewegung in die Wolken und Kim sah nach oben. Mitte August schoss gewöhnlich eine Unzahl an Sternschnuppen über den Kenianischen Himmel. Das Feuer brannte nun hell und Moto stand auf, um aus dem Busch zwei passende Stecken zu brechen, die er als Gabeln rechts und links der Flammen in den Boden steckte. Darauf legte er die beiden Spieße mit den Rebhühnern, die er mit einem einzigen Schuss seiner Steinschleuder erlegt hatte. Das Fleisch begann zu garen. Funken sprühten und Kim wich etwas von dem Lagerfeuer zurück. Moto aber stand auf, sah in die Flammen und begann das Lied der Löwen zu singen, das eigentlich nur die jungen Massai-Krieger lernen durften. Kim lächelte unwillkürlich. Moto machte ihr damit zum Abschied das größte Geschenk, das ihm zu geben möglich war.
Als er zu Ende gesungen hatte, kniete er wieder nieder und drehte die Vögel über den Flammen um. Selbst bei dieser Tätigkeit setzte er seinen Fuß wie ein Jäger auf: Die Zehen hatte er tief in die rote Erde gedrückt, während die Ferse vom Boden zu schnellen schien. Kims eigene Fußspur wirkte flach dagegen. »Du läufst wie ein dicker, müder Pavian, Kim«, sagte Moto immer. »Patsch, patsch, patsch.«
In der Stille, die dem Lied folgte, hörte Kim Vögel zwitschern. Wie seltsam, es war doch schon dunkel. Normalerweise steckten alle Vögel um diese Zeit bereits ihre Köpfe unter die Flügel und schwiegen bis zum Morgengrauen. Sie ließ ihre Taschenlampe aufflammen und suchte die Zweige der umliegenden Fieberbäume ab. Der Lichtstrahl traf eine Gruppe von Vögeln, wie Kim sie noch nie gesehen hatte. Ihr Gefieder war von intensivem Blau und ihr Gesang war süß und melodisch. Kim wollte sie nicht durch das Licht aufschrecken und so schaltete sie die Taschenlampe aus und die Dunkelheit verschluckte die Vögel wieder. Man hörte nur noch ihr Gezwitscher, als Kim sich wieder dem Lagerfeuer zuwandte.
»Brate sie gar, Moto. Kein Blut bitte«, sagte Chris gerade. »Uns schmeckt nicht allen, was dir schmeckt.«
Was war heute Abend nur in ihren Vetter gefahren? So kannte Kim ihn gar nicht. Was sollte diese Anspielung auf die Sitte der Massai, Ochsenblut mit Milch zu einer gallertartigen, süßen Masse zu vermischen und zu trinken? Das war ihre Hauptnahrung und das machte sie ihrer eigenen Überzeugung nach zu den schönsten Menschen der Welt.
Doch ehe Kim etwas erwidern konnte, zerriss ein Geräusch die Stille um sie herum. Es klang rau und ursprünglich.
Moto sprang auf und griff nach seinem langen Stecken, während Patrick den Atem anzuhalten schien und Chris Moto gespannt ansah. Der legte einen Zeigefinger auf die Lippen.
»Simba«, flüsterte er. Ein Löwe. Er blickte in die Richtung des dornigen Busches. Patrick rutschte näher an die Flammen heran, entzündete einen Zweig am Lagerfeuer und ließ damit eine der Gaslampen aufflammen. Motten flatterten herbei und verglühten mit einem leisen Zischen im Licht.
»Hat der Löwe keine Angst vor dem Feuer?«, fragte er leise.
»Das kommt darauf an, wie hungrig er ist«, sagte Chris. Er griff nach seiner Panga, einer leicht gebogenen und scharf geschliffenen Machete, und stellte sich neben Moto.
Die Katze rief wieder. Es klang nahe und drohend. Kim sprang auf und drückte sich an Moto. Seine Haut roch nach einer Paste aus Fett, Asche und Ocker. Der Duft beruhigte sie ein wenig, obwohl ihr die Gefahr mehr als bewusst war. Was, wenn dort in der Dunkelheit ein ganzes Rudel Löwen unterwegs war, die ihre Witterung aufgenommen hatten? Kims kleine doppelläufige Holland & Holland-Flinte, die sie von ihrer Urgroßmutter geerbt hatte, lag neben ihr im Sand und sie bückte sich vorsichtig nach ihr. Wenigstens etwas.
»Das ist hier eigentlich kein Gebiet für Löwen«, flüsterte Chris.
»Woher willst du das wissen?«, fragte Kim.
»Weil ich jeden Krumen Erde hier kenne. Weil ich ebenso wie du mein Leben hier verbracht habe. Weil ich hierher gehöre, so wie du.«
»Löwen haben vier Pfoten. Daher können sie bekanntermaßen eine vor die andere setzen und wandern«, entgegnete Kim.
»Still«, befahl Moto. Kim und Chris verstummten sofort. Sie alle waren schließlich hier aufgewachsen und konnten das Ausmaß der Bedrohung einschätzen. Sie waren bewaffnet und sie wussten, was zu tun war. Nun hieß es, einen kühlen Kopf zu bewahren.
Der Löwe rief wieder, jedoch diesmal aus größerer Entfernung, wie es schien. Es klang missmutig, als müsse er einen gefassten Plan fallen lassen.
»Das Tier jagt alleine«, sagte Moto heiser. »Und es entfernt sich von uns.«
Kim war erleichtert. Chris ging in die Knie und Patrick wollte die Lampe in Richtung des Busches anheben. Moto aber legte ihm die Hand auf den Arm.
»Pst. Rührt euch nicht. Noch nicht. Vielleicht ist es ein Simba Mtu«, flüsterte er.
»Ein Simba Mtu? Was soll das heißen, ein Löwenmensch?«, fragte Kim.
»Eine jagende, getriebene Seele«, sagte Moto leise. Er schien sich etwas zu entspannen. »Er ist verzaubert worden.«
»Du meinst, verflucht?«, fragte Kim.
Moto schüttelte den Kopf. »Nicht unbedingt. Viele halten einen Simba Mtu auch für auserwählt. Tagsüber sind sie Menschen wie wir. Aber in der Nacht gleiten sie in das Fell der Löwen. Es ist ein mächtiges Tier mit langen Klauen und einer schwarzen Mähne, wenn es ein Männchen ist. Die Weibchen dagegen jagen schneller als der Wind und töten mit einem Schlag. Sie nehmen Rache für getanes Unrecht oder schützen einen geliebten Menschen. Doch manchmal schlagen sie auch ohne einen für uns ersichtlichen Grund zu. Ihre Wege sind undurchschaubar.«
»Na, du musst das ja wissen«, sagte Chris. Er kauerte sich vor das Feuer. »Ein Massai, der nicht mehr jagen darf, ist auch so eine verfluchte Seele. Du wirst auch mal ein Simba Mtu, Moto.« Der ausgestandene Schrecken machte ihn wagemutig. Er nahm einen der Spieße vom Feuer und hielt das duftende Fleisch in die Dunkelheit.
»He, Simba Mtu. Komm essen. Chakulla, Chakulla mingi sana, Essen, ganz viel Essen«, rief er.
Moto nahm ihm den Spieß aus der Hand und legte ihn wieder über die Flammen. »Wie kannst du nur so dumm sein? Willst du uns alle umbringen? Der Duft wird ihn wieder anlocken.«
»Sprich nicht so mit mir«, warnte Chris ihn. »Dein Simba Mtu kann meinethalben mit den bluttrinkenden Fledermäusen des Mount Kenia Versteck spielen. Das sind doch alles Hirngespinste.«
Moto und Chris fixierten einander. Keiner wollte den Blick zuerst senken und damit nachgeben. Chris sagte leise etwas zu Moto. Kim versuchte ihn zu verstehen, aber es war Maa, die subtile und doppeldeutige Sprache der Massai, die er so gut wie akzentfrei sprach.
»Schluss jetzt«, sagte Patrick. Er ließ die Klinge an seinem Taschenmesser aufspringen und stach prüfend in die beiden Vögel. »Das Essen ist fertig.«
Er begann, die Vögel zu zerlegen.
»Ich nehme einen Flügel«, kündigte Kim an.
»Simba mtu. Da lachen ja die Hühner«, murrte Chris noch, als er sich neben Kim setzte.
»Du wirst schon sehen«, meinte Moto und ließ sich ihnen gegenüber am Feuer nieder. »Ihr werdet alle noch sehen. Es gibt den Simba Mtu.«
»Schluss mit dem Streit. Das ist unser letzter gemeinsamer Abend für sehr lange Zeit«, sagte Kim bestimmt. »Gott sei Dank ist der Löwe weg, verzauberte Seele oder nicht.«
»Du hast Recht«, stimmte Chris zu. Er legte seinen Arm um ihre Schultern. »Du wirst mir und Kilima fehlen. Darf ich dir ein Gedicht aufsagen?«
»Welches denn?«, fragte sie erfreut. Chris liebte Poesie und lernte Gedichte akzentfrei, selbst in Sprachen, die er nicht verstand. Die Schönheit der Worte, sagte er, war dennoch offensichtlich.
»Es geht darin nicht um einen Simba Mtu, sondern um einen Panther.«
»Ich höre dir zu«, erklärte Kim erwartungsvoll.
Chris stand auf, räusperte sich und legte sich eine Hand auf die Brust, ehe er mit voller Stimme deklamierte:
Sein Blick ist vom Vorübergehn der StäbeSo müd geworden, dass er nichts mehr hält.Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe undHinter tausend Stäben keine Welt.
Er stockte, ehe er zuversichtlich fortfuhr: »Vielleicht wird es dir im Internat auch so gehen, denn Kilima wird dir furchtbar fehlen. Aber hinter deinen Stäben gibt es eine Welt, und der Käfig wird sich wieder öffnen.«
Kim streckte stumm ihre Hand nach der seinen aus und spürte den freundschaftlichen Druck seiner Finger. Im Haupthaus arbeitete ihre Mutter wohl noch in ihrem Atelier und sie würde sich morgen von ihr verabschieden können. Ihr Vater schlief sicher irgendwo, wo er es ganz gewiss nicht sollte. Sie selbst aber saß hier bei den Menschen, die immer für sie da sein würden. Daran konnte nichts und niemand etwas ändern. Sie würden, wenn sie aus England zurückkehrte, alle in Frieden auf Kilima leben. So sollte es immer sein.
Kapitel 1
Als Kim die Spur der Löwin zum ersten Mal sah, wusste sie nicht, was dies für sie alle auf Kilima bedeuten würde. Der schwache Abdruck im sandigen Erdboden, nahe einem der letzten Wasserlöcher während der Trockenzeit auf der Farm, veränderte ihr Leben für immer.
Vor zehn Jahren hatte sie Kilima als junges Mädchen verlassen und war nur in den Ferien auf die Farm zurückgekehrt. Nun aber war sie gekommen, um zu bleiben. Das Studium des Artenschutzes und die Leitung von Wildreservaten in Canterbury hatten ihr Spaß gemacht, und die Zeit in der kleinen Stadt mit ihrer weltbekannten Kathedrale war schön gewesen. Vielleicht aber, dachte Kim später, hatten die Jahre dort sie etwas Wesentliches vergessen lassen: In Afrika waren die Dinge selten so, wie sie zu sein schienen. In der Mittagshitze hielt einen die flirrende Luft zum Narren. Wo nur trockener Sand war, glitzerte ein See. Wo kein Leben war, zogen Herden von Tieren vorbei. Genauso war es andersherum: Aus der Entfernung konnte einem die Steppe leer vorkommen. Aber wenn das Auge sich an den Anblick gewöhnt hatte, wimmelte es dort vor Leben.
Kim hatte die Löwin in den frühen Morgenstunden rufen hören. Das Tier musste am Wasserloch gelauert haben, das unweit des Hauses auf einer kleinen Lichtung im Busch lag. Trotz der langen Trockenzeit konnten sich die Tiere dort noch erfrischen und sie sammelten sich in den kühlen Abendstunden in großer Zahl. Idealere Jagdbedingungen konnte sich eine große, hungrige Katze kaum wünschen. Vor Aufregung vermochte Kim nicht mehr einzuschlafen und stand nun auf der Terrasse des kleinen Bungalows, den ihr Vater ihr als Willkommensgeschenk gebaut hatte. Es war ihr eigenes Reich, das zum Schutz gegen Schlangen und Skorpione nach Art der ersten Siedlerhäuser auf Stelzen inmitten der gut dreißigtausend Hektar von Kilima stand. Kim hatte sich die Stelle in den letzten Semesterferien selbst ausgesucht und ihrem Vater und dem Architekten dabei geholfen, den Grundriss zu entwerfen. Das Herzstück war das geräumige Wohnzimmer, das man über wenige Stufen und eine langgezogene Veranda betrat, und von dem die Küche und ein Gang zum Schlafzimmer und Bad abgingen. Insgesamt war der Bungalow nicht groß, aber Kim war das gerade recht. Gäste konnten im Haupthaus bei ihren Eltern unterkommen.
Sie hatte sich einen Tee nach Art der Kikuyu zubereitet: Die Teeblätter kamen direkt in die kochende Milch und dann wurde soviel Zucker dazu gelöffelt, wie Kim es vor ihrem Zahnarzt verantworten konnte. Das weiße Licht des Morgens wich gerade erst den Farben. Es musste kurz nach sieben sein. Kim brauchte keine Uhr, der Ablauf der Tage und der Jahreszeiten am Äquator war so gleichmäßig, dass man die Zeit ziemlich genau schätzen konnte.
War es wirklich eine Löwin gewesen, die sie gehört hatte? Wenn ja, so musste sie Spuren im Busch um das Wasserloch hinterlassen haben. Oder sie lauerte noch im hohen Gras. Die großen Katzen waren selten hier oben um den Mount Kenia. Sie konnte der Versuchung einfach nicht widerstehen, entschied Kim, und stellte die Tasse auf dem Verandatisch ab. Sollte sie Moto anrufen, damit er sie begleitete? Nein. Sie würde es alleine wagen. Vielleicht spürte sie die Löwin ja tatsächlich auf und konnte Moto und ihrem Vater stolz von ihrem Erfolg berichten.
»Bis später, Misty«, sagte sie zu ihrem zahmen Affen. Dieser griff gerade nach der Tasse und schüttete den Inhalt auf den Boden, ehe Kim einschreiten konnte.
»Du machst deinem Namen wieder alle Ehre«, schimpfte sie. Sie hatte den jungen verwaisten Colabusaffen an den unteren Hängen des Mount Kenia gefunden, aber sein Name leitete sich nicht vom Nebel des Berges ab, sondern von der Tatsache, dass er ein richtiges Miststück war. Der Tee, der noch in der Tasse gewesen war, formte eine Lache auf dem Zement, die in Windeseile alle Siafu-Ameisen der Umgebung anziehen würde. Die bissigen, roten und mehr als zentimeterlangen Ameisen suchten sich an Mensch oder Tier immer die weichste und wärmste Stelle aus, wo sie ihrem Opfer dann ganze Stücke Fleisch ausrissen. Kim zog das bunt gestreifte Kikoituch vom Verandatisch und ging in die Knie.
»Das Letzte, was ich hier im Haus brauche, sind Siafus. Erwachsene Männer springen schreiend aus ihren Hosen, weil sie Siafus zwischen den Beinen hatten, merk dir das«, schimpfte sie mit Misty, der ungerührt keckerte.
»Ich gehe jetzt los«, sagte Kim, nachdem sie die Lache aufgewischt hatte. Es war tröstlich, sich wenigstens von einem Affen verabschieden zu können, selbst wenn er einen schlechten Charakter hatte. Was ihr Verhältnis zu Männern anging, hatte Kim bislang keine besonderen Erfolge vorzuweisen. Aber sie machte sich keine Sorgen, der Richtige würde selbst hier auf der abgelegenen Farm schon noch kommen.
Kim schulterte die kleine, doppelläufige Holland & Holland, die sie von ihrer dänischen Urgroßmutter, der Gründerin von Kilima, die ebenfalls Kim hieß, geerbt hatte, zog sich die dicken Socken zum Schutz gegen die Dornen über die Schienbeine und ging los. Eidechsen klebten noch starr auf den Steinen des Gartens, als Kim vor das Gatter trat, das das Wild aus ihren Gemüsebeeten fernhalten sollte. Sie sah kurz hinüber zum Mount Kenia, aus dessen dicht bewaldeten Hängen Nebel stieg, der sich weiter oben mit graugescheckten Wolken vermischte. Sie waren ein leeres Versprechen: Die Trockenzeit dauerte schon zu lange an und ihre gnadenlose Hitze schien allen hier im Hochland buchstäblich das Hirn aus dem Kopf zu brennen. Kilimas Böden hatten die Farbe von gebranntem Ton angenommen und die Welt schien ohne Gerüche.
Nach wenigen Schritten bog Kim von der groben Piste, die zu ihrem Haus führte, in den Busch hinein ab, wo das Wasserloch ungefähr zehn Minuten Fußmarsch von ihrem Haus entfernt verborgen lag. Die trockenen Zweige der Bäume hingen voll dorniger, hohler Früchte, in denen sich der Wind fing und ein pfeifendes Geräusch verursachte.
Mehr und mehr kam ihr der Ruf der Löwin nun wie einer der lebhaften Träume vor, wie die dünne Luft sie verursachen konnte. Kim hielt ihren Blick aufmerksam auf den unebenen Boden geheftet, je weiter sie sich vom Haus entfernte. Die Spur konnte überall zwischen den vertrockneten Grasbüscheln und knorrigen Wurzeln sein, die sich wie Adern durch den Sand zogen. Zuerst war der Busch noch voller Leben. Kleine Vögel mit leuchtend blauen Federn saßen in den Zweigen der Büsche und zwitscherten melodisch. Im Unterholz konnte Kim zwei Dikdik ausmachen, Zwergantilopen, die perfekt getarnt waren. Zikaden, Schmetterlinge und schillernde Käfer hingen an den Gräsern. Je weiter Kim jedoch ging und je mehr sie sich dem Wasserloch näherte, um so mehr ließen auch die Geräusche nach.
Sie verlangsamte ihren Schritt und lauschte in die Stille, die im Busch keinen Frieden, sondern eine Warnung bedeutete. Sogar die Vögel mit dem blauen Gefieder waren verstummt. Ihr Blick suchte weiter den Boden ab, während sich auf ihren Armen eine Gänsehaut bildete. Sie spürte, dass sie gleich etwas finden würde. Bei unzähligen Pirschgängen mit Moto hatte sich dieser Instinkt entwickelt und die Vorahnung verursachte ihr ein Kribbeln im Nacken. Sie setzte behutsam einen Fuß vor den anderen, als vor ihr eine Wolke von Fliegen aus dem hohen Gras aufstieg. Kim erschrak und verjagte die Insekten mit schnellen Handbewegungen. Das konnte nur eines bedeuten: Sie machte noch einen Schritt und sah zu ihren Füßen einen blutigen Kadaver liegen. Kim zog scharf die Luft ein, ging in die Knie und untersuchte ihn.
»Hm. Ein junges Zebra«, murmelte sie und der Laut ihrer eigenen Stimme erschreckte sie. Ihr wurde bewusst, wie alleine sie hier draußen war und dass sie mit dem Busch nicht mehr so vertraut war wie früher. Die Löwin könnte hier in der Nähe sein und sie im hohen Gras belauern.
Sie betastete den Kadaver. Nein, das Blut an dem Fell des toten Tieres war beinahe getrocknet. Es musste also in der Nacht gerissen worden sein, entschied sie, stand wieder auf und nahm das Gewehr von ihrer Schulter, ließ es jedoch noch gesichert.
Da sah sie zwischen den von der Sonne verbrannten Gräsern im sandigen Grund die erste Spur. Es war der Abdruck von drei ganzen Pfoten und einer halben, die zu schleifen schien. Offenbar war die Löwin verletzt und trat nicht voll auf. Vielleicht war sie in einen Dorn getreten und die Wunde hatte sich infiziert. Ihre Verwundung machte für die Katze die leichte Beute, die am Wasserloch zu erwarten war, noch attraktiver. Kim folgte der Spur mit den Augen, bis sie sich im Busch verlor. Unwillkürlich wurde ihre Kehle trocken und die Haare in ihrem Nacken stellten sich auf. Wenn doch Moto bei ihr wäre! Sie hätte auf ihn warten sollen, schalt sie sich und ging doch, wie einem stummen Ruf folgend, weiter in den Busch hinein, wo sich die unregelmäßige Spur verlor.
Unter Kims Fuß knackte ein Zweig, und sie fuhr herum. Ihr Herz schlug hart in der Brust, als sie die Waffe in Anschlag nahm und sie entsicherte. Die Löwin konnte ohne jede Warnung aus dem Busch hervorbrechen und sie mit ihrem schieren Gewicht zu Boden reißen. Verletzt waren die Tiere aggressiv und mutiger als sonst und Kim hätte trotz ihrer Waffe keine Chance gegen sie. Doch sie nahm allen Mut zusammen und bog die Zweige beiseite. Auf dem sandigen Boden zu ihren Füßen konnte sie deutlich eine Kuhle erkennen, wo die Löwin wohl gelegen hatte, und sie legte die flache Hand in die Mulde. Der Sand war kühl und wirkte unberührt, doch ein Baumstumpf, der in der letzten Regenzeit vom Blitz getroffen und gespalten worden war, glänzte feucht neben dem Abdruck des Tierkörpers. War es Tau, Harz oder etwas anderes, das den Glanz erzeugte? Kim legte ihre Waffe neben sich in den Sand und presste ihre Nase an den Stamm, um seinen Geruch tief einzusaugen. Er roch scharf nach Ammoniak.
»Katzenpisse«, entfuhr es ihr.
Allzu weit konnte die Löwin nicht gekommen sein, wenn der Stamm noch feucht war. Sie wollte gerade wieder aufstehen, da fragte eine männliche Stimme hinter ihr:
»Riecht das gut?«
Kim fuhr herum. Hinter ihr stand ein Mann, den sie nicht kannte.
»Habe ich Sie erschreckt? Entschuldigung. Ich dachte, eine Frau, die hier alleine herumgeht, wäre nicht besonders furchtsam.«
Er schob sich seinen ausgebeulten Filzhut in den Nacken. Seine Haare, die ihm über die Ohren fielen, waren fast so schwarz wie ihre eigenen. Seine Haut war dunkel und er wirkte wie ein Indianer. Federn im Haar hätten ihm sicher gut gestanden. Er rückte den Hut wieder zurecht, so dass sie im Schatten der Krempe seine Augen nicht erkennen konnte.
Kim griff nach ihrer Waffe, sicherte sie wieder und stand auf. Das Gewehr des Fremden steckte in einem Futteral auf seinem Rücken, während er um seinen Hals ein Fernglas trug. An ihren Knien klebte noch der vom Katzenurin feuchte Sand, wie sich Kim plötzlich unter seinem prüfenden Blick bewusst wurde.
»Ich suche nach Spuren«, sagte sie so selbstsicher wie möglich und spürte dennoch, wie sie rot wurde. Das war auch ein Erbe ihrer Urgroßmutter: Ihre sehr helle Haut, die sie vor der Sonne schützen musste und die sich bei jeder Gelegenheit, oder eher Verlegenheit, rötete. Sie ließ sich ihre halblangen, dunklen Haare vor das Gesicht fallen und versuchte gleichzeitig, sich den klebrigen Sand von ihren Knien zu klopfen.
»Und wie gründlich Sie das tun«, entgegnete der Mann. Er kam näher, und Kim bemerkte, wie groß er war. Sie reichte ihm in ihren flachen Bata Boots gerade mal bis zum Oberarm.
»Sie haben mich nicht erschreckt«, sagte sie, aber ihre Stimme klang seltsam zittrig. »Ich habe bloß nicht erwartet, jemanden zu treffen.«
»Und, haben Sie die Spuren gefunden, die Sie gesucht haben?«
»Ja. Den Urin einer Löwin.«
Kim hob den Kopf, um ihm ins Gesicht zu blicken. Er lachte, und Kim bemerkte seine weißen Eckzähne, die so spitz wie bei einem Wolf aussahen. Es war ein angenehmes Lachen, das tief aus seiner Brust kam.
»So, so. Den Urin einer Löwin also«, wiederholte er.
Kim errötete zu ihrem Ärger noch mehr. Unter dem Schatten seiner Hutkrempe konnte sie nun seine grünen Augen erkennen, die spöttisch funkelten. Ihre Farbe erinnerten sie an Blätter nach dem Regen.
»Urin ist ein wesentlicher Dünger für viele Pflanzen und Nahrung für kleine Insekten«, sagte sie heftig. Endlich war es ihr gelungen, sich die Knie mit der Seite ihre Schuhsohle zu reinigen, aber sie verlor dabei beinahe ihr Gleichgewicht. Der Mann stützte sie gerade noch mit einem festen Griff um ihren Unterarm. Seine Hand fühlte sich warm und stark an. Kim hielt ob der plötzlichen Berührung die Luft an und auch der Fremde blickte kurz verwirrt auf seine Hand, ehe er sie zurückzog und sie sich dann wie zum Schwur auf die Brust legte.
»Ich verehre Insekten. Vor allen Dingen kleine«, verkündete er feierlich.
Ja, ganz sicher, er machte sich über sie lustig, dachte Kim. Ehe sie ihm jedoch eine schnippische Antwort geben konnte, streckte er seine Hand wieder aus und Kim ergriff sie überrascht. Sein Händedruck war fest, aber nicht zu fest.
»Ich heiße Mark. Ich arbeite seit einigen Wochen bei Rosie am Fluss.«
Er musste ungefähr zur selben Zeit wie Kim auf Kilima angekommen sein. Bei Rosie, die eigentlich Maria-Agneta Rosenkranz hieß, aber deren Name allen viel zu kompliziert war, arbeiteten immer mehrere Forscher gleichzeitig und blieben zumeist etwas über ein Jahr. Rosie hatte auf Kilima ein Reservat für Schimpansen aufgebaut, die in Kenia nicht heimisch waren. Sie reiste durch ganz Afrika, rettete die Tiere aus zu engen Käfigen in verrauchten Restaurants oder zahlte Tierfängern dank großzügiger Spenden aus Amerika das Doppelte von dem, was ihre Auftraggeber ihnen boten. Mittlerweile hausten in ihrem weitläufigen Gelände unten am Fluss an die dreißig Affen und die jährliche Ankunft der neuen Mitarbeiter sorgte immer für Trubel auf Kilima.
»Mein Name ist Kim«, sagte sie und musterte ihn dabei. Er wirkte eigentlich schon zu alt, um noch bei Rosie anzuheuern. In dem Alter hatten andere Wissenschaftler schon lange ihr eigenes Projekt und ihre eigenen Mittel.
»Kim. Das ist ein schöner Name. Ungewöhnlich.«
»Ich bin nach meiner dänischen Urgroßmutter benannt. Was machen Sie genau bei Rosie?«
»Das ist ziemlich kompliziert«, antwortete er, aber es klang nicht herablassend.
»Ich werde mich bemühen, es zu verstehen«, versprach Kim.
Er lächelte sie an und auf seinen Wangen formten sich Grübchen. »Ich bin Arzt und hoffe, aus dem Erbgut der Affen auf Heilungsmöglichkeiten für menschliche Krankheiten zu schließen.«
Kims Augen weiteten sich. »Machen Sie etwa Tierversuche? Das erlaubt Rosie?«
»Unsinn«, erwiderte er, »Rosie würde mir die Hände abhacken, wenn ich ihren Affen etwas zuleide täte. Sie ist schließlich bei Jane Goodall in die Schule gegangen. Ich führe Untersuchungen im Labor durch und analysiere meine Beobachtungen dann. Mehr nicht, aber auch nicht weniger.«
Mit diesen Worten nahm er Kim, ohne sie zu fragen, ihre Waffe ab und klappte den Lauf nach vorne. Sie war so überrascht, dass sie es ohne Widerrede geschehen ließ. »Na, wenigstens ist sie auch geladen«, stellte er fest. »Wo haben Sie denn die Waffe her? Das ist ein feines, altes Stück.« Dann sah er sie tadelnd an. »Aber was für ein Unsinn, hier so alleine unterwegs zu sein. Sie sind wohl gerade erst auf Kilima angekommen?«
Kim schwieg. Er hatte ja Recht. Sie hätte auf Moto warten sollen, aber etwas hatte sie in den Busch getrieben. Wenn er erst wüsste, dass Kilima ihrer Familie gehörte, würde er sie für komplett leichtsinnig halten, also war es besser zu schweigen. Er zeigte wieder auf die Spur der Löwin.
»Typischer Anfängerfehler, sich so zu überschätzen. Auch eine Praktikantin sollte wissen, dass man einer Katze nicht alleine folgt. Aber keine Sorge, das bleibt unter uns.«
»Sie sind doch auch allein hier unterwegs.«
»Das ist was anderes: Ich bin schließlich ein Mann.«
Kim wusste nicht, ob sie lachen oder ärgerlich werden sollte. Schließlich war er ein Mann! Oho. So etwas hatte sie schon lange nicht mehr gehört. Eigentlich noch nie, wenn sie genauer darüber nachdachte. Er zeigte auf die Stelle, wo die Löwin gelegen hatte. »Das Tier ist gefährlich. Wir müssen es vor dem Marathon noch finden.«
»Haben Sie mit dem Marathon auch etwas zu tun?«, fragte Kim spitz und nahm ihm ihr Gewehr wieder ab, schloss den Lauf und schulterte es.
»Nein, Sie? Wohnen Sie mit den anderen Praktikanten in den kleinen Bandas nahe dem Haupteingang? Ich muss sagen, die Idee mit dem Marathon ist schon ein tolles Ding. Angeblich kommen Läufer aus aller Welt, um hier zwischen Elefanten und Rhinos ihre Bestzeit zu erzielen. Was für ein Abenteuer! Da könnte ich selbst noch anfangen zu trainieren.«
Er sah aus, als könne er aus dem Stand eine Bestzeit laufen, dachte Kim und sagte: »Die ersten Läufer werden bald ankommen, damit sie sich an die Höhe hier gewöhnen können. Um den Lauf durchzuhalten, brauchen sie mehr rote Blutkörperchen.«
Sie verstummte, denn es sollte nicht so aussehen, als sei sie allzu gut informiert. Dabei arbeitete sie in diesem Jahr gemeinsam mit ihrem Vater an der Vorbereitung des Kilima-Marathons, der als wesentliche Einnahmequelle der Farm schon zum zehnten Mal stattfinden sollte.
»Hoffentlich machen die verspäteten Regenfälle den Leuten da mal keinen Strich durch die Rechnung«, sagte Mark. »Sonst bleiben die Läufer im Matsch stecken.«
Kims Blick glitt über den Horizont, der sich leer und blau über den nun staubigen Weiten von Kilima wölbte. Er wartete ihre Antwort nicht ab, sondern sagte:
»Lassen Sie uns gehen. Ich bin sicher, die Katze lauert irgendwo. Bald wird sie weiter jagen und muss betäubt und behandelt werden, ehe sie für Menschen gefährlich wird.« Er bog einige der dornigen Zweige beiseite und verbeugte sich leicht.
»Bitte, nach Ihnen. Damit Sie sich nicht das hübsche Gesicht zerkratzen. Was werden denn sonst Ihre Eltern in Europa dazu sagen, wenn Sie so aus Afrika wiederkommen?«
Kim ging an ihm vorbei und ihm voraus in den Busch. Sie spürte seinen Blick auf sich und fühlte sich zu nackt in ihren kurzen Shorts und dem Hemd, dessen Ärmel sie bis zum Ellenbogen hochgekrempelt hatte. Seine Selbstzufriedenheit beeindruckte und ärgerte sie zugleich, doch seine schweigende Anwesenheit gab ihr ein Gefühl von Sicherheit, wie sie es früher sonst nur in Motos Gesellschaft verspürt hatte.
Nach zehn Minuten Marsch stießen sie auf die Hauptstraße. Hundert Meter die staubige Piste hinunter sah sie einen im Schatten eines Fieberbaumes geparkten Land Rover, der Mark gehören musste. In einiger Entfernung stieg Rauch aus dem Schornstein des Haupthauses in den Himmel empor. Sicher gab es dort gleich Frühstück und Kims Magen knurrte bei dem Gedanken an frisches Obst, warmen Toast und Eier mit Speck. Ihr Bungalow lag nur einen Steinwurf entfernt, doch vollkommen verborgen im Busch. Sie hatte es nun eilig, dorthin zu kommen, wollte aber Mark ihren Wohnort nicht verraten. Schweigend gingen sie bis zu seinem Land Rover. Mark stieg in den alten, verbeulten Wagen und fragte sie bei offener Tür und laufendem Motor: »Kann ich Sie mitnehmen? Wo auf Kilima sind Sie untergekommen? Leben Sie in einer der Bandas mit den anderen Praktikanten?«
Kim ließ seine letzten beiden Fragen unbeantwortet.
»Danke, ich habe noch zu tun.«
Er zögerte. »Sind Sie sicher?«
Kim nickte. »Ganz sicher.«
»Gut. Jeder wie er mag«, sagte er und stieg in seinen Wagen. »Aber gerne lasse ich Sie hier nicht zurück. Sie kennen doch den Busch gar nicht.«
Kim verbiss sich ein Lachen. Die Spannung von vorhin, als sie die Katze so nahe geglaubt hatte, war von ihr gewichen.
»Ich passe schon auf mich auf, Papi«, sagte sie und zwinkerte ihm zu, ehe sie ergänzte: »Sie können mich duzen, Dr. Mark.«
»Nett, dich kennenzulernen, Kim. Auf bald«, rief er ihr noch hinterher.
Kim trat in den Busch und wartete noch, bis das Motorengeräusch sich auf der staubigen Piste entfernt hatte, ehe sie weiterging. Ja, auf bald, denn sie würden sich früher wiedersehen als erwartet. Am Abend fand im Haupthaus ein Essen für Rosie und ihre neuen Mitarbeiter statt. Praktikantin! Na, der würde noch Augen machen! Der Gedanke daran machte ihr schon jetzt Freude.
Kapitel 2
Rosie kam gerade aus dem Affengehege, als sie Mark aus seinem Wagen steigen sah. Es war noch früher Vormittag, doch schon wieder sehr warm und die Gipfel des Mount Kenia schnitten scharf in einen blauen Himmel. Wieder kein Regen, dachte sie enttäuscht, als sie das Tor hinter sich schloss. Die Büsche waren verdorrt und der Flussarm, der das Gelände durchschnitt, war bis auf ein Rinnsal ausgetrocknet. Die Erde seiner Uferbänke leuchtete brennend rot. Als sie das Vorhängeschloss einrasten ließ, warfen sich zwei der Tiere gerade aufeinander und begannen mit gebleckten Zähnen und rollenden Augen zu kämpfen.
»Hey, Juli, lass Kleo in Ruhe«, rief Rosie und versuchte, sie durch Rufe und Winken zu trennen, aber es war umsonst. Sie seufzte und wandte sich ab, denn das verdorrte Land und der Aufruhr der Tiere machten sie unglücklich. Das Reservat und ihre Arbeit hier waren ihr Leben, das sie sich zielstrebig und mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln aufgebaut hatte. Sie war so egoistisch wie sonst nur ein Mann, hieß es in Forscherkreisen. Der Vergleich erschien ihr mehr als ungerecht, hatte sie doch Opfer für ihre Karriere gebracht, die kein Mann bringen musste. Zeit für viel anderes war ihr nicht geblieben, und so hatte Rosie nie geheiratet und sich den Gedanken an Kinder verboten. Dafür war sie frei gewesen, um für ihre Forschung zu leben. Ihre Familie war hier, hatte sie bisher gedacht. Die Knudsens, ihre Affen und ihre Mitarbeiter.
Rosie kam bei Marks Auto an und er neigte seinen Kopf, so dass sie ihn auf beide Wangen küssen konnte. Sie musste dennoch auf die Zehenspitzen gehen und sog seinen Geruch nach Sonne und frischer Luft ein. In seiner Nähe fühlte sie sich wie immer sehr viel jünger, dabei war sie schon beinahe fünfzig, was man ihr zu ihrer Erleichterung aber nicht ansah. Irgendetwas an ihm bewirkte, dass Frauen sich unweigerlich attraktiv und begehrt fühlten. Vielleicht war es die Aufmerksamkeit, die er ihnen schenkte und die Gelassenheit, mit der er durch das Leben ging. Sehr wenig war für Mark ein Grund zur Aufregung, das hatte sie inzwischen begriffen. Er war sich offenbar sicher, dass er eine Lösung für jedes Problem finden konnte.
»Da ist ja ganz schön was los«, sagte Mark und sah zum Gehege, wo Juli gerade von Kleo abließ. Das jüngere Affenbaby schlug sich heulend in die Büsche und Juli jagte ihm nach.
»Allerdings. Die Hitze macht die Tiere ganz fertig.«
»Wie geht es dir?« Er sah sie freundlich an und Rosie wusste, dass ihm die Schatten unter ihren Augen nicht entgingen.
»Es geht.« Rosie zuckte mit den Schultern. »Ich habe gestern Abend lang gearbeitet. Tagsüber schaffe ich bei dieser Hitze einfach nichts. Jetzt ist es gerade erst neun Uhr und mein Hirn fühlt sich an wie Brei.«
»Du Arme. Trink etwas und versuch, nach dem Mittagessen zu schlafen. Du arbeitest zu viel, finde ich.«
Rosie blieb ihm eine Antwort schuldig und fragte stattdessen: »Wo kommst du um diese Zeit eigentlich her?«
»Ich habe eine Spazierfahrt unternommen. Es gibt auf Kilima noch so viele Ecken, die ich nicht kenne. Heute wollte ich am Wasserloch, von dem Patrick mir erzählt hat, Tiere beobachten. Wie war dein Morgen?«
»Mühsam. Ich hoffe, die Regenzeit beginnt bald.«
Mark sah zum Mount Kenia, dessen dreizackige Spitze sich scharf gegen den blanken Himmel abzeichnete. Keine Wolke war um den Berg herum zu sehen.
»Na, nach Regen sieht das heute wieder nicht aus«, sagte er und nahm einen Aktenordner von der Rückbank seines Wagens. Er war trotz seines erst kurzen Aufenthalts in Kenia bereits mit Blättern voller Notizen gefüllt.
Der erste positive Eindruck, den sie von Mark während einer Konferenz in Amerika gewonnen hatte, hatte Rosie nicht getäuscht. Seine damalige Rede für die Internationale Huntington’s Society hatte ihre Welt auf den Kopf gestellt: Sensationell erschien ihr sein Ansatz, aus der DNA der Affen eine Heilungsmöglichkeit für die Erbkrankheit ableiten zu wollen.
»Gehst du ins Labor?«, fragte sie ihn.
Er nickte. »Von nichts kommt nichts. Und darum hast du mich ja gebeten, zu kommen, oder?«
Ja, darum hatte sie ihn gebeten zu kommen. Sie erinnerte sich an das Gefühl der Erleichterung, als Patrick und sie Mark am Jomo Kenyatta-Flughafen aus dem Flugzeug steigen sahen. »Jetzt wird alles gut«, hatte sie zu Patrick gesagt und fest seine Hand gedrückt.
»Vielleicht«, war seine Antwort gewesen. »Aber vielleicht brauchen wir ihn auch gar nicht auf Kilima.«
»Oh Patrick«, hatte sie nur antworten können, ehe er sie geküsst hatte.
»Wie dem auch sei, ich bin sicher, dieser Amerikaner leistet ausgezeichnete Arbeit.«
Sie verstand, was sich hinter seinen distanzierten Worten verbarg: Die Furcht, ebenso wie sein Vater und Großvater an Huntington zu erkranken. Eine Heilung der Erbkrankheit war noch immer in weiter Ferne. Vielleicht würde sie bei Patrick nicht zum Ausbruch kommen, vielleicht aber doch. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, den sie gemeinsam antreten würden, wenn Rosie den Mut dazu fand. Bisher hatte sie nur für sich gelebt. Das war ihre Wahl gewesen und sie war glücklich damit. Zufriedenheit bedeutete schließlich nicht mehr als eine Akzeptanz der eigenen Lebensumstände, hatte sie sich immer gesagt. Nun war alles anders: Patrick brachte ihr Leben und ihre Pläne für die Zukunft aus dem Gleichgewicht und zwar mehr, als sie es je einem Menschen zuvor erlaubt hatte. Aber war sie wirklich bereit, ihre Freiheit und ihre Forschung aufzugeben, um Patrick so beistehen zu können, wie er es brauchte?
»Willst du mit Patrick und mir zu Mittag essen?«, fragte Rosie Mark.
Er schüttelte den Kopf. »Danke. Ich will heute so einiges schaffen. Außerdem lasse ich euch Turteltauben lieber allein.«
Euch Turteltauben. Bei dem Gedanken an Patrick stieg ein warmes Gefühl in Rosie auf. Sie versuchte erst es abzuwehren – und ließ es dann zu. Sie könnte Patricks Mutter sein, flüsterte eine warnende Stimme in ihrem Inneren, aber Rosie trotzte ihr. Sie war nicht seine Mutter, sondern seine Geliebte.
»Bis später dann.« Mark streifte sich im Gehen das Band des Fernglases über den Kopf, ehe er in seinem Schritt innehielt. »Jetzt habe ich doch glatt meine Waffe im Wagen vergessen.«
»Greenhorn«, sagte Rosie freundlich. »Weshalb hattest du das Gewehr dabei?«
»Ich habe gestern mit Moto gesprochen. Er hat mir von einer verwundeten Löwin erzählt, die auf Kilima unterwegs zu sein scheint. Er befürchtet, dass sie Menschen angreifen könnte. Da wollte ich vorbereitet sein, denn wenn sie jetzt noch irgendwo jagt, dann ja wohl am Wasserloch.«
Rosie runzelte die Stirn. »Davon habe ich noch nichts gehört.«
Mark sperrte den Wagen noch einmal auf und griff nach seinem Gewehr. »Du kennst Moto ja. Er trägt seinen Namen zu Recht. Er ist mal hier, mal da, weiß aber über alles auf Kilima bestens Bescheid und ist voll Leidenschaft für das, was er gerade tut.«
Rosie nickte gedankenvoll.
»Wo hat er ihre Spuren gesehen?«
»An der Nordgrenze. Ich dagegen habe um das Wasserloch herum eine Spur gefunden.« Mark schien noch etwas hinzufügen zu wollen, schwieg dann aber doch.
»Was ist?«, fragte Rosie.
»Nein, nichts, wirklich. Afrika steckt voller Überraschungen. Ich freue mich, dass du mich hierher eingeladen hast, Rosie. Danke.« Er sah auf seine Uhr. »Jetzt muss ich aber mit der Arbeit anfangen. Ist der Käfig von Juli und Kleo schon saubergemacht worden? Kann ich die beiden einfangen?«
Rosie nickte. »Viel Glück dabei und sei vorsichtig mit Juli. Du hast ihn ja gerade gesehen. Er ist in den letzten Tagen unberechenbar.«
Juli und Kleo waren ihr aus Nigeria geschickt worden. Damit sie in den Käfig der früheren Besitzer passten, hatten diese ihnen alle Knochen gebrochen. Es würde schwer werden, die noch jungen Tiere dieses Trauma vergessen zu lassen.
»Ich wollte dich nicht aufhalten. Bis später. Vergiss nicht, dass wir heute Abend bei den Knudsens im Haupthaus zum Abendessen eingeladen sind. Aggy kommt auch mit.«
Mark sah kurz hinüber zu dem anderen Bungalow, in dem Aggy, die junge polnische Forscherin, die zur selben Zeit wie Mark bei Rosie mit ihrer Arbeit begonnen hatte, wohnte. Die Jalousien an den Fenstern waren noch heruntergelassen.
»Ist sie alleine?«, fragte Mark mit gesenkter Stimme.
Rosie verschränkte ihre sehnigen und mit Sommersprossen übersäten Arme vor der Brust. »Mark, du wirst schon zum Kenianer. Wenn man selber hier gerade keinen Sex hat, dann kümmert man sich eben um das Liebesleben der anderen. Ich weiß nicht, ob sie alleine ist. Es geht mich auch nichts an.«
»Du hast ganz Recht. So habe ich das nicht gemeint. Entschuldige. Bis nachher. Wollen wir heute Abend zusammen zu den Knudsens?«
»Ja. Wir nehmen meinen Wagen. Den kann ich auch sturzbetrunken noch fahren.«
»Na, das klingt ja vielversprechend. Wenn es dir nichts ausmacht, fahre ich selber. Mein Leben ist mir lieb«, lachte er.
Rosie sah ihm nach, bis er im Labor verschwunden war.
War ihr Leben, so wie es war, ihr lieb? Ja. Seltsam, dass sie erst in der Wildnis Afrikas diesen Frieden hatte finden können. Das Land und seine Menschen hatten ihr eine Heimat geboten und ihrem Leben den Sinn gegeben, den sie zuvor vergeblich suchte. Zum ersten Mal genoss sie die Gegenwart – bis sie durch Patrick gezwungen wurde, mehr als je zuvor an die Zukunft zu denken. Wollte sie das?
Vielleicht war ihre Einladung an Mark, die sie vor Monaten auf dem Kongress ausgesprochen hatte, schon ein Teil der Antwort auf diese Frage.
Kapitel 3
Juya stand mit dem Rücken zu Kim, als diese die Küche des Haupthauses vom Garten aus betrat. Die Kikuyu war gerade dabei, Limonen neben die in Scheiben geschnittene Papaya auf die Teller zu legen.
Sie musste ihre Schritte gehört haben, denn sie drehte sich zu Kim um.
»Kim. Ich wusste nicht, dass du kommst, sonst hätte ich noch zwei Eier mehr gemacht.«
»Ich habe vorgesorgt«, sagte Kim und zog vorsichtig zwei braune Eier aus der Tasche, die sie eben noch im Hühnerstall den Hennen unter dem Hintern weggezogen hatte.
Juya lachte und schaltete den Herd wieder an. Salzige Butter schmolz in der heißen Pfanne, ehe Juya die beiden Eier hineinschlug.
»Kommst du heute Abend zu dem Essen?«, fragte Juya dann.
Kim nickte. Die Einladung ihrer Eltern schien das Ereignis des Tages zu sein. Wenn sie an Mark dachte, freute sie sich darauf.
»Gut.« Juya nickte zufrieden. »Ich brate ein Lamm. Wambui muss es nachher noch schlachten.«
Wambui war Juyas Mann und der Häuptling der Kikuyu auf Kilima. Sein Stamm hatte Kilima an Kims Urgroßmutter verkauft, wobei die Kikuyu das Recht besaßen, auf dem Land weiterhin zu siedeln und zu weiden. Wambuis Kinder besuchten die Schule auf der Farm und seine Männer arbeiteten als Hirten und Dienstpersonal auf Kilima. Juya hatte eine gute Wahl getroffen, denn Wambui war mit dreißig Stück Vieh ein wohlhabender Mann. Nichts war einem Kikuyu so wichtig wie das Vieh, das wusste Kim. Das Vieh – und die Söhne.
Juya fuhr unterdessen fort: »Das Essen mit Rosies neuen Mitarbeitern ist schon fast eine Tradition. Und dieses Mal ist es fast wie eine Feier für deine Rückkehr. Wir freuen uns alle, dass du endlich wieder zu Hause bist. Jetzt kannst du in deine Aufgabe hineinwachsen. Ich bin so stolz auf dich, mein Mädchen.«
»Das mit der Aufgabe hat, Gott sei Dank, noch Zeit«, sagte Kim und stibitzte ein Stück Papaya.
Juya ließ Kims knusprige Spiegeleier gekonnt auf einen Teller gleiten und stellte ihn auf ein Tablett.
»Was wissen wir schon von unserer Zeit? Wir sind alle in Mungus Hand. Auf jeden Fall ist deine Mutter heilfroh, dass du wieder da bist. Und ich auch.«
Kim beobachtete, wie Juya sich trotz ihres einen etwas kürzeren Beines mit der Gelassenheit einer Wildkatze in der Küche bewegte. Juya erlaubte dieser leichten Behinderung unter keinen Umständen, ihr Leben zu beeinträchtigen.
Ihre Mutter war heilfroh? »Hat sie dir das gesagt?«, fragte Kim.
Juya schüttelte tadelnd den Kopf. »Kim, Kim. Das muss sie doch nicht sagen. Das weißt du doch auch so. Wie könnte es denn anders sein? Du bist doch ihr einziges Kind.«
Nein, natürlich hat sie nichts gesagt, dachte Kim, schwieg aber.
»So, Frühstück ist fertig.« Juya wusch sich die Hände und sah aus dem Fenster.
»Wer kommt denn da?«, fragte sie dann. Kim trat neben sie.
In die Auffahrt rollte ein Lieferwagen aus der Stadt, der dem Fundi dort gehörte. Er war ein Handwerker, der alles Mögliche reparieren konnte, und auf Kilima war immer irgendetwas kaputt. Der Fundi stieg aus, winkte den beiden Frauen am Fenster zu, holte seinen Werkzeugkasten aus dem Kofferraum und ging auf die Wasserpumpe am anderen Ende des Hofes zu.
»Den Generator muss er auch mal ansehen«, meinte Juya und wischte sich die Hände an der Schürze ab. »Ich sage ihm schnell Bescheid.«
In diesem Augenblick stieg Wambui aus dem Auto, dem man, so schlank und hochgewachsen wie er war, seine Häuptlingswürde ansah. Ihm folgte eine Frau, die in zwei Kangas gehüllt war. Eines der mit Mustern und Sprichwörtern bunt bedruckten Tücher bedeckte ihren Oberkörper, das andere fiel ihr von der Taille bis auf die Füße. Sie konnte nicht älter als siebzehn oder achtzehn sein und ihr ebenmäßiges Gesicht blieb ausdruckslos, als sie sich kurz umsah. Wambui ergriff ihre kleine Tasche, während sie selbst sich einen Beutel aus Kikoi-Stoff über die Schulter warf.
»Wer ist das?«, fragte Kim.
Juya verschränkte die Arme vor ihrer Brust und blickte stumm aus dem Fenster. Zwischen ihren Augenbrauen bildete sich eine steile Falte.
»Ich weiß es nicht. Sie ist nicht von hier, so viel steht fest. Das ist eine Bora. Ein Mädchen von der Küste.«
Kim reckte den Hals.
Wambui fasste das Mädchen nun am Handgelenk und beide schlugen den Weg zum Kral ein, wo Wambuis und Juyas Hütten sowie die seiner beiden anderen Frauen standen. Sie gingen schnell, und einmal stolperte die Fremde über ihre eigenen Füße. Wambui fasste sie am Ellenbogen, richtete sie wieder auf und strich ihr über die Wange. Seine Geste wirkte unerwartet zärtlich.
Juya kaute auf ihrer Unterlippe herum. Die Falte zwischen ihren Augenbrauen war noch tiefer geworden. Kim wusste nicht, was sie sagen sollte.
»Komm jetzt«, sagte Juya und hob das Tablett an. »Das Frühstück wird sonst kalt.«
Sie ging vor Kim her in den Gang, der von der Küche erst durch den Eingangsbereich des Hauses und von dort in alle anderen Zimmer führte. Den Rücken hielt Juya dabei besonders gerade und glich das Nachziehen ihres rechten Beines damit aus.
Juya war so wütend, dass ihre Hände bei der Arbeit zitterten, als sie die Reste des Frühstücks wegräumte. Oh ja, sie wusste genau, weshalb Wambui die Fremde in den Kral gebracht hatte. Weshalb hatte er ihr nichts gesagt? Wie konnte er sie so gar nicht in seine Pläne einbeziehen? Alle Männer waren geile Böcke, das stand fest. Sie versuchte, sich zu beruhigen. Nicht, dass sie diese junge Frau da beneidete. Sie wusste genau, was ihr bevorstand.
Juya dachte an den Tag, an dem sie selbst mit Wambui verheiratet worden war. Sie war vierzehn Jahre alt und sie hatte den um zwanzig Jahre älteren Mann nicht heiraten wollen. Ihre Mutter, die vor ihr die weise Frau der Kikuyu gewesen war, hatte ihr den Kiefer, den Juya störrisch zusammengepresst hielt, mit einem Keil aufgestemmt und ihr dann einen betäubenden Saft eingeflößt. Der Austausch des Brautpreises und das Hochzeitsfest waren wie im Traum an Juya vorbeigezogen. Dann war sie mit Wambui allein in seiner Hütte gewesen. Rückblickend war sie ihrer Mutter noch immer für den Betäubungssaft dankbar.
Sie war schon vier Jahre vor der Hochzeit mit Wambui beschnitten worden. Das war Schmerz, hatte sie damals gedacht, als die Rasierklinge, die ihre Mutter in der Hand hielt, mehrere Male über ihre inneren Schamlippen gefahren war und als sie dann bis auf eine kleine Öffnung, so rund wie die Spitze ihres kleinen Fingers, zugenäht wurde. Der Schmerz begleitete sie seitdem ständig und wurde stärker, wenn sie ihre Blutungen hatte oder wenn sie sich auch nur draußen im Busch erleichterte.
Aber Wambui hatte ihr erst in der Hochzeitsnacht gezeigt, was wirklicher Schmerz war.
Bei jedem ihrer Schreie hatte er tiefer in sie gestoßen. »Einen Sohn, einen Sohn«, hatte Juya ihn noch rufen hören, ehe sie ohnmächtig geworden war.
Einen Sohn? Der Wunsch war ihm bislang nicht erfüllt worden. Weder sie noch eine seiner beiden anderen Frauen hatte ihm ein Kind geschenkt. Einmal hatte die kleine Kim sie gefragt, weshalb sie keine Kinder bekam.
»Es ist Mungus Wille«, hatte sie ihr geantwortet. Mungus Wille: Alle Bemühungen der Missionare in ihrer Schule waren vergebens gewesen, das wusste Juya, auch wenn sie manchmal noch in die Kirche in Nanyuki ging und dort gehorsam den Gottesdienst absaß. Mungu oder Gott, sei es drum. Er würde sie schon hören, wenn es darauf ankam. So, wie sie ihn mit ihrem Herzen und mit jeder Faser ihres Wesens hörte. Mungu hatte ihr vielleicht sogar eine Gnade erwiesen, indem sie keine Kinder bekommen konnte, dachte Juya. Sie war und blieb die weise Frau der Kikuyu und Wambuis Hauptfrau. Er würde sie nie verstoßen, denn sie sagte aus dem Flug der Vögel die Zukunft vorher, las das Schicksal der Menschen aus der Asche des Feuers, heilte Leiden und strafte Vergehen. Niemand machte ihr ihre Stellung streitig: Niemand. Auch diese schöne Fremde nicht, denn schließlich hatte Juya dafür teuer mit ihrem eigenen Blut bezahlt.
Kapitel 4
Das Abendessen sollte um acht beginnen. Kim hatte noch in der Auffahrt einige Zweige des großen Feuerbaumes abgeschnitten, dessen Blüten trotz der Trockenzeit voll und orange leuchteten. Es war kurz vor halb acht, als sie mit dem Strauß im Arm die Küche betrat, wo sie schon als Kind immer gerne vor Einladungen gewartet hatte. Überall roch es gut, und sie konnte ungestraft ihren Finger in die Soße tauchen oder von dem Avocadopudding naschen, der als Nachspeise gedacht war. Aber vor allen Dingen sah sie durch das Fenster zum Hof und zur Auffahrt hin die Gäste ankommen, ohne dass diese sie entdeckten.
Kim schnupperte. Es roch köstlich. Juya hatte die beiden Lammschlegel mit Knoblauch und Rosmarin gespickt und mit Olivenöl übergossen.
Sie blickte auf ihre Uhr. Rosie und ihre Mitarbeiter waren sicher gleich da und ihr Vetter Chris hatte es auch nicht weit. Er arbeitete mittlerweile als Manager auf der Farm der Millers, nachdem seine Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren. Den Millers gehörte hier um den Mount Kenia herum das meiste Land.
Kim bündelte die Zweige mit beiden Händen. Wo war nur die hohe Vase geblieben? Sie konnte sie nirgends entdecken. Juya musste sie im Arbeitszimmer von Kims Vater gelassen haben. Rasch verließ Kim die Küche und durchquerte die helle Eingangshalle, hinter der das Arbeitszimmer lag. Kurz vor der Tür aber stockte sie in ihrem Schritt, denn aus dem Zimmer drang gedämpft eine Frauenstimme, die sie nicht kannte. Ihre Aussprache klang leicht verwaschen und in Kims Ohren eher amerikanisch. Eine Engländerin oder Kenianerin war es auf jeden Fall nicht. Kim konnte deutlich hören, dass die Frau sich mit ihrem Vater stritt.
»Wie kannst du es wagen, Leo«, sagte sie gerade. »Mich einfach so abzuservieren.«
»Ich weiß gar nicht, wovon du redest.« Leo Knudsen klang abwehrend. »Du hast dir alles nur eingebildet. Ich habe dich und deine Gefühle nie ermutigt. Es ist doch nie irgendetwas passiert.«
»Unsinn!« Sie begann nun zu weinen. Es klang verzweifelt. »Bitte …«
Kim konnte förmlich fühlen, wie peinlich ihrem Vater die Situation war. Aber er war ja selbst schuld und er befand sich gewiss nicht zum ersten Mal in dieser Lage, dachte sie bitter. Wann war ihr bewusst geworden, dass die Ehe ihrer Eltern nicht so war wie die anderer Leute? Schon in ihrer Kindheit hatten die Eltern in getrennten Zimmern geschlafen. Dann, als sie älter wurde, begriff Kim, weshalb ihr Vater oft die Nächte außer Haus verbrachte. Seine Affären wechselten ständig. Eine seiner früheren Geliebten hatte ihm einst mit einer Panga, der langen, scharfen Machete der Kenianer, aufgelauert. Der Schnitt traf seinen Oberarm, und er hatte in Nairobi mehrere Stunden lang operiert werden müssen. Ein anderes Mal lauerte ihm ein betrogener Ehemann mitten in Nanyuki auf und verprügelte ihn in aller Öffentlichkeit mit seiner Nilpferdpeitsche.
Keiner der Vorfälle war Leo Knudsen anscheinend eine Lehre gewesen. Kim hielt den Atem an, als sie auf die nächsten Worte aus dem Arbeitszimmer wartete. Wo war ihre Mutter? Das Haus war still. Sie musste auf der Terrasse sein und Kim war froh darum. Die Untreue ihres Vaters hatte die Ehe längst zersetzt und doch war Monika Knudsen bei ihrem Mann geblieben und hielt zu ihm.
»Was hat sie denn zu bieten, was ich nicht habe? Was denn? Hält sie deinen Geist zwischen ihren Schenkeln gefangen? Hat sie dir das Gehirn rausgeblasen?« Die fremde Stimme klang nun so schrill und hässlich wie ihre Worte, die Kim schmerzten. Das waren Dinge, die sie über ihren Vater nicht wissen wollte.
Eine kurze Pause folgte auf diese Worte.
»Sei bitte nicht so vulgär. Das hat mit dir überhaupt nichts zu tun. Ich kann das nicht in Worte fassen. Ich habe euch nie verglichen. Die Dinge sind einfach so gekommen, wie sie gekommen sind. Ich habe immer versucht, mich dir gegenüber wie ein Gentleman zu verhalten«, sagte Leo Knudsen.
»Gentleman! Ich werde dir zeigen, was ich von dir und deiner kleinen Schlampe mit den dicken Titten halte …«
Kim hörte ein Geräusch, das wie eine Ohrfeige klang.
»Verzeih! Verzeih mir. Das habe ich nicht gewollt«, weinte die Frau. »Alles was ich will, ist, dass du mich liebst. Bitte. Ich will dir alles, alles geben, Leo. Alles, was du nur willst. Verlass deine Frau und vergiss dieses Flittchen, die es hier mit jedem treibt. Ich will dich! Nur dich. Lass uns von hier weggehen, von all den anderen, von ihr – vor allem von ihr …«
»Geh jetzt«, sagte Leo Knudsen und seine Stimme klang müde. »Lass uns all dies vergessen. Ich werde es zumindest vergessen. Um deinetwillen.«
Wieder herrschte Schweigen. Kim wagte es nicht, sich zu rühren.
»Vergessen? Wie kann ich dich vergessen?« Die Frau stieß ein zorniges Lachen aus. »Oh nein. Dafür wirst du bezahlen. Und zwar mit allem, was du hast. Darauf kannst du Gift nehmen.«
»Bitte, jetzt beruhig dich doch. Wir sind doch beide erwachsene Menschen. Lass uns das doch in Würde beenden…«
»Fass mich nicht an. Fass mich nie wieder an. Das wirst du noch bereuen. Das verspreche ich dir!«
Kim hörte Schritte, die sich der Tür näherten, und floh rasch in die Eingangshalle, ehe sie ins Esszimmer glitt und die Tür hinter sich schloss. Im Raum war der Tisch mit Monika Knudsens bestem Meisner Porzellan, dem Kristall und dem Tafelsilber gedeckt und die große Standuhr im Eck tickte gleichmäßig vor sich hin. Als Kind hatte sich Kim beim Versteckspiel darin verborgen, erinnerte sie sich, als sie hörte, wie die Tür zum Arbeitszimmer ihres Vaters geöffnet und mit einem Schlag wieder geschlossen wurde. Die Schritte der Frau entfernten sich durch den Gang zur Haustür hin und die Tür fiel ins Schloss.
Kim entspannte sich etwas. Sie wollte gar nicht wissen, wer ihrem Vater wieder einmal eine solche Szene gemacht hatte. Als einige Minuten verstrichen waren, verließ sie das Esszimmer und betrat das Arbeitszimmer ihres Vaters, der am Schreibtisch saß und sein Gesicht in den Händen vergraben hatte.
Als Kim eintrat, sah er auf und lächelte.
»Ah, du bist es. Die einzige Frau in meinem Leben, die mir immer nur Freude macht.«
Kim musste ebenfalls, gegen ihren Willen, lächeln. Alter Schmeichler. Er war eben so, wie er war.
»Ich komme nur die hohe Vase holen.« Kim zeigte auf das Fensterbrett. »Ich brauche sie für das Esszimmer.«
»Ist Rosie schon angekommen?«
An Rosie interessierte ihn sonst nur, ob sie die Pacht für ihr Land pünktlich überwies. Kim schüttelte den Kopf.
»Es ist noch niemand da.«
»Gut.« Er fuhr sich mit der Hand übers Kinn, auf dem sich ein dunkler Schatten abzeichnete. Ihr Vater konnte nur wenige Stunden lang sauber rasiert aussehen, ehe seine beinahe schwarzen Haare wieder sprossen.
»Dann kann ich mich noch duschen und rasieren. Sieht das Hemd noch frisch aus?«
»Du siehst sehr gut aus. Bis nachher«, sagte Kim und hob die schwere Vase vom Fensterbrett. Die Blumen darin waren bereits verwelkt.
Sein Gesicht wirkte schmal und müde, dachte Kim im Gehen. Hatte er etwa noch andere Sorgen außer einer Frau mehr, die ihm Rache schwor?