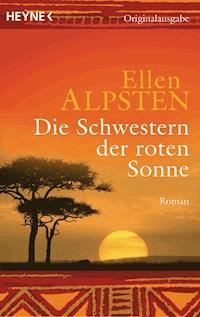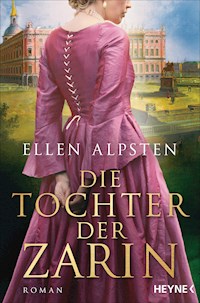Inhaltsverzeichnis
Zum Buch
Zur Autorin
Lieferbare Titel
Kenize und Qasim
EMELIE: DAS ERBE DER ERDE
Diane
Afrikanische Hinterlassenschaft
Frauensache
Blumen und Bienen
Copyright
Zum Buch
Emelie, Iman und Aischa könnten von Herkunft und Hautfarbe nicht unterschiedlicher sein. Die Farmerstochter Emelie ist eine weiße Kenianerin, Iman halbe Massai und Aischa ist indischer Abstammung. Sie verbindet die Liebe zu Kupenda, der Farm im ostafrikanischen Grabenbruch, auf der sie zusammen aufgewachsen sind. Nach dem tragischen Tod ihrer Mutter muss Emelie sich jedoch zwischen zwei Welten entscheiden und den Kampf um ihr Erbe wagen. Ein Massaifluch droht sich zu erfüllen, und alle drei Frauen müssen den Mut zu ihrem wahren Selbst beweisen.
Ellen Alpstens Die Schwestern der roten Sonne ist eine große, faszinierende Geschichte aus dem geheimnisvollen, fremden und abenteuerlichen Kontinent Afrika.
Zur Autorin
Ellen Alpsten wurde 1971 in Kenia geboren, verbrachte ihre Kindheit und Jugend dort und studierte dann in Köln und Paris. Sie arbeitete in der Entwicklungshilfe an der Deutschen Botschaft Nairobi und als Moderatorin bei Bloomberg TV. Heute ist sie freie Schriftstellerin und Journalistin, u.a. für die FAZ und Spiegel Online. Nach den historischen Romanen Die Lilien von Frankreich, Die Zarin und Die Quellen der Sehnsucht (alle Wilhelm Heyne Verlag) ist Die Schwestern der Roten Sonne ihr erster zeitgenössischer Afrikaroman. Ellen Alpsten lebt mit ihrer Famlie in London.
Lieferbare Titel
Die Quellen der SehnsuchtDie Lilien von FrankreichDie Zarin
Kenize und Qasim
Der Himmel glühte, als Kenize die Anhöhe erreichte. Ein Baum stand dort, gleichgültig dem Heute und dem Gestern gegenüber. Sie lehnte sich gegen seinen Stamm, um Atem zu schöpfen. Kenize war ihr Leben lang zu verwöhnt gewesen, als dass die Anstrengung der vergangenen Wochen sie gestählt hätte.
Sie sah hinunter auf die Ebene. Zwischen dem von der Dezembersonne verbrannten Gras weideten Herden von Zebras und Gnus. Die Seen glänzten im letzten Licht. Ihre Wasser waren rosig von den unzähligen Flamingos, die an ihren Ufern nisteten. Erloschene Vulkane ragten aus dem Land und sahen aus wie Schornsteine auf einem flachen Dach. Neben der Sonne war bereits die schmale Sichel des Mondes am Himmel zu erkennen. Der Hüter der Sonne, Enkai, traf auf Olapa, die Göttin des Mondes. So glaubten es die Leute hier.
»Gleich bin ich bei dir, Qasim«, sagte Kenize. Qasim hatte sie seine Sonne und seinen Mond genannt.
Sie setzte die Tasche ab, die sie in den vergangenen Wochen nicht aus den Augen gelassen hatte. In der Nacht hatte sie sie unter ihren Kopf geschoben, und am Tag hatte sie sie stets auf den Knien gehalten. Nun war Kenize am Ziel ihrer Reise angelangt. Die Küste, wo ihr Vater lebte, gehörte bereits einer anderen Welt an. Die Landschaft hier war ursprünglich und unberührt, doch der Händler, der sie auf seinem Ochsenkarren mitgenommen hatte, hatte ihr prophezeit: »Die Eisenbahn soll bald auch hier hoch gebaut werden. Dann ist es aus mit dem Frieden. Irgendein Weißer wird sich das Land schon kaufen.«
Irgendein Weißer? Das konnte sie nicht glauben. Die weißen Siedler waren zerlumpte Gestalten, die mit sonnengegerbten Gesichtern durchs Land zogen. Ihre Frauen hatten Schwielen an den Händen und rochen nach saurer Milch.
Auf der Ebene sah sie einen Mann still und aufrecht bei seiner Herde stehen. War dies ein Massai? Ihr Vater war ein Kaufmann und Prinz aus dem Oman. Er verachtete die Menschen des Landes für ihre Gelassenheit und ihr Ertragen. Er verstand es einfach nicht, dachte Kenize. Dieses Land ist altes Land. So alt wie die Welt selbst.
Sie begann, mit steifen Fingern ihre Stiefel aufzuschnüren. Die Haut an ihren Füßen war weiß vom Druck des harten Leders. Zwischen den Zehen hatten sich Blasen gebildet. Kein Wunder: Im Haus ihres Vaters hatte eine Magd ihr jeden Morgen die Füße mit Mandelmilch gewaschen und sie dann mit duftendem Öl eingerieben, ehe Kenize in ein Paar seidene Pantoffeln geschlüpft war.
Sie löste den Schnürverschluss am Kragen ihrer Jubbah. Das lange, weiße Hemd, das die Männer ihres Landes hier trugen, war so weit geschnitten, dass niemand auf Anhieb ihr wahres Geschlecht erraten konnte. Kenize hatte sich in der Nacht vor ihrer Flucht die schwarzen Haare abgeschnitten. Dann hatte sie dem fahrenden Händler in Mombasa drei Goldmünzen gegeben und war auf seinen Wagen gestiegen. Er hatte ihr von diesem Baum hier und der Schönheit des Landes erzählt. Drei Goldmünzen, das war eigentlich viel zu viel für die Reise ins Hochland. Aber nicht zu viel, damit der Mann ihr keine Fragen stellte.
Kenize streifte die Jubbah über ihren Kopf und stand einen Moment nackt im Schatten des Baumes. Ein leichter Wind kam auf, und Kenize fröstelte. Sie zog ein Gewand aus orangefarbener Seide aus der Tasche: Sie wollte Qasim in Schönheit begegnen. Ihre Finger glitten über die Münzen und den Schmuck, die unter dem Gewand verborgen gelegen hatten. Es war ihre Mitgift.
Wo sie hinging, konnte sie nichts mitnehmen. Kenize nahm einige der Ketten und warf sie weit von sich. Ein Armreif aus Gold und Saphiren rollte den Berg hinunter und verfing sich an einem Strauch. Kenize kippte nun den gesamten Inhalt der Tasche die Anhöhe hinunter und rüttelte an ihr, bis sie leer war.
Sie kleidete sich fertig mit dem Shalwar Khamiz: Erst band sie die weite, an den Fußgelenken schmal zulaufende Hose um ihre Taille, ehe sie sich das an Hals und Säumen bestickte Oberteil über den Kopf zog. Nun blieb nur noch der lange Schal. Qasim hatte ihn ihr geschenkt. Er kam aus einem der Länder, das er mit seiner Dhau angesteuert hatte. Das Schiff lag nun auf dem Grund des Indischen Ozeans. Das Meer war Qasims Grabtuch geworden. Nun wollte ihr Vater sie zwingen, einen anderen Mann zu heiraten. Als Brautgabe hatte er ihr einen Palast auf der Insel Lamu im Norden des Landes bauen lassen. Die Schwalben könnten dort ihre Nester haben, aber nicht sie selber, dachte Kenize.
»Ich komme, Qasim«, sagte sie und trat auf die knotigen Wurzeln des Baumes. Sie zog sich an einem Ast nach oben. Ihren Fuß setzte sie in ein Astloch, dessen dunkle Tiefe sie erstaunte. Sie stieg höher, bis es nicht mehr weiterging.
Die Sonne verschwand bereits hinter dem Horizont, und der Himmel füllte sich mit tiefdunklem Violett. Sie musste sich beeilen. Kenize formte eine Schlinge aus dem einen Ende des Schals. Sie legte sie sich um den Hals und knotete sein anderes Ende an den Ast, auf dem sie saß. Dann erhob sie sich und sprang.
Für Kenize begann die Nacht nur einen Augenblick früher als für die Welt um sie herum.
Kupenda heißt lieben, und so nannten die Menschen diesen Ort seitdem.
EMELIE: DAS ERBE DER ERDE
Diane
Diane erreichte die Anhöhe und trat in den Schatten des Baumes. Es war bereits später Nachmittag, doch die Kühle unter seinen Zweigen erfrischte sie wie ein Bad. Auf der Ebene wurden die Schatten lang, und die Farben schimmerten warm wie gebrannter Ton. Sie erinnerte sich an Paddys Vergleich für diese Landschaft: Er hatte gesagt, die Ebene wäre der Bauch einer liegenden Göttin, und die erloschenen Vulkane wären ihre vielen Brüste. Kein Wunder, dass er hier hatte begraben werden wollen.
»Guten Abend, Paddy«, sagte sie und entkorkte die Flasche Wein, die sie in ihrem Korb mitgebracht hatte. Es war ein Culemborg Rosé, sein Lieblingswein. Diane streckte ihre nackten, noch immer schlanken Beine im hohen Gras aus, und Guppy, der zahme Leopard, ließ sich an ihrer Seite nieder. Um sie herum lagen die knolligen Früchte des Baumes. Einige von ihnen waren aufgeplatzt und Wiedehopfe pickten nach den Samenkörnern.
Diane sah nach oben in die Baumkrone. Der Stamm wirkte wie aus der Erde gerissen und umgekehrt wieder hineingesteckt. Ihr Blick glitt an seiner Rinde entlang, und sie fand, wonach sie gesucht hatte: Ein Astloch, das beinahe unter den vielen Schichten aus Borke verborgen war.
»Später«, sagte Diane. »Erst das Vergnügen, dann die Arbeit.«
Sie schenkte zwei Gläser Wein ein. Eines davon stellte sie auf den Rand des Grabsteines, der aus dem Gras ragte. Paddy war nach seinem überraschenden Tod vor fünf Jahren auf einem riesigen Scheiterhaufen verbrannt worden. Der Hügel war an jenem Tag schwarz vor Menschen gewesen: Massai in ihren roten Shukas; Inder, die den weiten Weg von Nairobi und aus dem Hochland gemacht hatten und deren Autos auf ganz Kupenda kreuz und quer geparkt standen; Siedler aus dem ganzen Land.
»Prost, Paddy.« Diane setzte das Glas an die Lippen und trank.
Sie sah hinab auf die Ebene von Kupenda. Paddy hatte ihr die Farm vererbt. Zu seinen Lebzeiten war Kupenda ein Brunnen gewesen, aus dem das Geld nur so sprudelte. Heute war die Farm ein Schwamm, der es aufsaugte. Wenn Emelie wieder da wäre, könnte sie ihr und Carl die Leitung von Kupenda übergeben, dachte Diane. Ihre Kinder. Eine Woche noch, ermutigte sie sich.
Auf dem von den vielen Regen- und Trockenzeiten verwitterten Grabstein war Paddys Bild eingelassen, aber die beschlagene Glasscheibe über dem Foto ließ sein Gesicht beinahe unkenntlich erscheinen. Wir hätten auch Bruder und Schwester sein können, statt Mann und Frau, dachte Diane. Beide waren sie blond und blauäugig, beide feingliedrig und drahtig. Wo hatte Emelie nur ihren Wuchs und ihre starken Knochen her?
»Jetzt ist es also so weit: Emelie kommt nach Hause.« Sie hob die Hand, wie um Paddys Worte abzuwehren. »Ich weiß, wenn du noch am Leben wärst, dann hätte unsere Tochter nie davonlaufen müssen. Auch noch nach Paris! Fünf Jahre lang hat sie jetzt nicht mit mir gesprochen. Sie hat auf keinen Brief geantwortet, und ich habe es nicht gewagt, sie anzurufen. Fünf lange Jahre.«
Sie trank einen Schluck Wein. Paddy hätte es Emelie nie erlaubt zu gehen. Paddy, der Großwildjäger, der eine Wildtaube mit gebrochenem Flügel nach Hause brachte, um sie gesundzupflegen. Der es besser fand, auf Lizenz einen Büffel zu schießen, um damit die umliegenden Dörfer zu ernähren, als dass jeder da draußen herumknallen könnte. Er hatte Kupenda zu einer Oase des Friedens für die wilden Tiere gemacht, während die wachsende Bevölkerung den Lebensraum des Busches immer mehr beschnitt.
»Danke, Paddy«, sagte Diane.
Er hatte auch sie in sein Heim aufgenommen. Ihm war es damals gleich gewesen, was die Leute sagten. In Kenia sagten die Leute immer etwas. Das Mindeste, was sie nun tun konnte, war sein Erbe zu erhalten. Auch wenn Emelie an seinem Grab den Schwur getan hatte, selber nie wieder als Großwildjägerin zu arbeiten. Carl und sie mussten eben einen anderen Weg finden, Kupenda zu führen.
Wolken trieben vom Westen her über den Himmel, um sich über dem Grabenbruch aufzulösen. »Ich kann Emelie nicht selber abholen. Die letzte Safari für dieses Jahr geht morgen los, und wir fahren in das Selous Wildreservat. Ich bin erst am Weihnachtstag wieder da.« Sie überlegte. »Vielleicht ist es besser so. Ich glaube, ich hätte Angst davor, sofort vier Stunden mit Emelie in einem Auto zu verbringen. Richard fährt sowieso nach Nairobi, um Blumensamen und Schösslinge abzuholen. Er bringt Emelie nach Kupenda. Hoffentlich liegen sich die beiden nicht gleich wieder in den Haaren. Dabei sind sie doch zusammen aufgewachsen! Richard war doch ständig bei uns oder Carl und Emelie bei ihm und seinen Eltern. Aber die Mädchen haben mich davor gewarnt, ihn Emelie abholen zu lassen.«
Die Mädchen. Sie waren junge Frauen geworden: Iman und Aischa warteten ebenfalls auf Emelie. Sie waren zusammen auf Kupenda aufgewachsen und spiegelten in ihrer Verschiedenheit Kenia wider. Aischa half ihrem Vater Rai Kapoor mit der Verwaltung und der Buchhaltung der Farm. Die Kapoors waren eine der vielen indischen Familien, die vor drei Generationen zum Eisenbahnbau in das Land gekommen waren. Nun waren sie ebenso Kenianer wie Diane oder Emelie und Carl. Iman, eine entfernte Nichte Paddys, und ihr Zwillingsbruder Leander waren bereits als Säuglinge zu Waisen geworden. Die Geschwister verbanden in ihrem Blut zwei Welten, denn ihre Mutter war ein schönes Massaimädchen gewesen.
Es wurde Abend. Auf der Ebene zogen sich die letzten Tiere in den Busch zurück.
Emelie würde auch Leander wiedersehen, wagte Diane zu überlegen. Wenn sie die Zeit doch nur zurückdrehen könnte! Wenn sie doch nur den Mund gehalten hätte, als am Nachmittag nach Paddys Beerdigung endlich wieder Stille auf Kupenda eingekehrt war. Aber sie hatte es damals nicht gekonnt, und sie könnte es auch heute noch nicht. Dafür hatte sie vor langer Zeit selber zu viel erleiden müssen, und außerdem war sie noch immer zu stolz. Sie hatte ihre einzige Tochter nicht in ihr Unglück rennen lassen wollen. Ihr Mädchen.
Diane stand auf. Ihre Hand glitt in die Tasche ihrer Baumwolljacke und zog eine Kette heraus, die aus vierundzwanzig Karat schwerem Gold geschmiedet war. Das Metall war für ihre helle Haut zu gelb. An den Gliedern hing ein Anhänger, auf dem sich eine zum Kranz geschlungene Schlange in den Schwanz biss. Diane erinnerte sich an den Augenblick, als ihr diese Kette um den Hals gelegt worden war. Stolz und Schmerz hatten an jenem Morgen so nahe beieinandergelegen.
Sie ging zu dem Baum. Gute drei Armeslängen über ihrem Kopf fand sie das Astloch wieder. Sie setzte einen Fuß auf den Stamm, griff in die ersten Äste und zog sich hoch. Dann schob sie die Kette tief in das Loch. Unter sich sah sie Guppy, den Leoparden, der den Stamm umkreiste und zu ihr nach oben fauchte. Sie hatte ihn einst als Kätzchen neben dem leblosen Körper seiner Mutter gefunden, die Wilderer getötet und gehäutet hatten.
»Pst! Das ist unser Geheimnis«, sagte Diane zu ihm, als sie wieder auf der Erde aufkam. Wie befreit sie sich auf einmal fühlte! Das hätte sie schon lange tun sollen.
»Auch das muss ich Emelie und Carl eines Tages erklären. Aber wie? Hilf mir doch, Paddy! Was würdest du tun?« Diane nahm das volle Glas, das noch auf dem Rand von Paddys Grabstein stand, und leerte es ins Gras. Im Geist hörte sie Paddys Rat: Man müsse immer miteinander reden.
»Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll«, sagte sie.
Dann schreib es dir auf, schien Paddy zu sagen. Er hatte sich die Dinge immer notiert. Die Regale seines Arbeitszimmers standen voll mit seinen Tagebüchern. Diane sah hin zu dem Haus, das rosafarben wie die Flügel der Flamingos zwischen den Wipfeln der Schirmakazien lag.
Paddy hatte Recht. Sie könnte ihre Gedanken in einem Brief ordnen. In Paddys Arbeitszimmer würde sie niemand stören. Sie musste ihn ja Emelie nicht geben, sondern konnte ihn nur für sich selber schreiben. Diane kniete vor dem Grabstein nieder und küsste das beschlagene Glas über Paddys Bild.
»Ich kann nicht gehen, ehe du mich nicht segnest«, sagte sie leise. Die Worte stammten aus der Bibel und hatten Paddy und sie tief berührt. Sie hatten sie bei jeder noch so kurzen Trennung ausgesprochen: Nur ein einvernehmlicher Abschied erlaubte ein glückliches Wiedersehen und Weiterleben. Dann stand sie auf und legte die zugekorkte Flasche und die beiden Gläser in den Korb zurück. Sie sah ein letztes Mal nach oben und stellte fest, dass das Astloch an dem borkigen Baumstamm von unten kaum zu erkennen war. Ob es wohl stimmte, dass in den Tagen der osmanischen Händler eine junge Prinzessin sich hier aus Liebeskummer das Leben genommen hatte?
»Gute Nacht, Paddy. In einer Woche sprechen wir uns wieder.«
Kupenda heißt lieben, dachte sie noch, als sie den Hügel hinunterging. Gut, dass Emelie nach Hause kam.
Afrikanische Hinterlassenschaft
Pierre schenkte Emelie warme, schäumende Milch in ihren Kaffee und bot ihr ein Croissant an. Das Gebäck war noch warm: Er hatte es vorhin in der Bäckerei auf dem Boulevard Clichy gekauft. Es war ihr letztes gemeinsames Frühstück, ehe sie am folgenden Tag nach Kenia fliegen würde. Er trug bereits seinen Anzug, um in die Bank zu gehen, während sie sich nur schnell eines seiner Hemden übergezogen hatte.
»Eigentlich bin ich ja ganz froh, dass du alleine fährst. Mir wird schlecht im Flieger. Obwohl ich der Überzeugung bin, dass ich dich erst ganz verstehe, wenn ich alles dort gesehen und die Menschen getroffen habe, von denen du mir erzählt hast. Bist du dir wirklich ganz sicher, dass du nicht meine Hilfe brauchst? Du warst fünf Jahre lang nicht mehr daheim.«
Emelie schüttelte den Kopf und sah an Pierre vorbei aus dem Fenster. Sie hatte sich in diesen Blick verliebt, als sie vor vier Jahren die kleine Wohnung angemietet hatte. Es war ein grauer Morgen, typisch für einen Dezembertag in Paris. Die Häuser auf dem Hügel wirkten hinter den Regenschleiern wie graue Klumpen. Wenn sie in Kupenda aus dem Fenster gesehen hatte, waren die grauen Klumpen entweder Büffel oder Gnus, dachte Emelie. Hier waren es nur Häuser, in denen andere Menschen saßen und ebenfalls schwarzen Kaffee mit Zigaretten frühstückten. Die einzigen Geräusche, die sie in der Nacht auf Kupenda gehört hatte, waren das Fauchen eines Leoparden oder der kurze Pfiff der Nachtwache bei Schichtwechsel. Hier dröhnte schon morgens um acht der Verkehr vorbei.
»Gut, du musst es am besten wissen.« Er beugte sich vor und küsste sie auf die Wange.
Sein Vertrauen tat ihr gut. Dennoch fand sie, dass das wieder einmal typisch Pierre war. In seiner Welt hatte jede Sache und jeder Mensch seinen Platz, alles hatte seine Ordnung. Und alles, was diese Ordnung bedrohte, schloss er aus seinem Leben aus. Vielleicht machte ihn das zu einem glücklichen Menschen. Sie wusste nach vier Jahren mit ihm noch immer nicht, ob sie ihn um diese Fähigkeit beneidete. Sicher, er hatte ihr stets den richtigen Rat gegeben, und seine Ruhe hatte sie ihren Weg hier finden lassen.
Aber wenn es um Kupenda ging, konnte er ihr nicht helfen, das spürte sie. Kupenda gehörte ihr, ebenso wie die Erinnerung an das, was geschehen war. Sie musste ihre Entscheidung darüber alleine treffen, und sie musste Diane und Leander alleine gegenübertreten. Pierres Sicherheit, sein Vertrauen in sich und seinen Platz in dieser Welt, gaben ihr das Selbstbewusstsein dazu. Sein Leben war ruhig und sicher. Und damit ihres an seiner Seite. Der Gedanke gab ihr ein Gefühl, dem sie keinen Namen geben konnte oder auch mochte.
Emelie bestrich sich das Croissant mit Butter und Marmelade. »Das nächste Mal kommst du mit. Dann kannst du meine Mutter und meinen Bruder Carl kennenlernen, und auch Iman, Leander und Aischa. Und Richard natürlich auch«, fügte sie nach kurzem Nachdenken hinzu. »Meine ganze Familie und all meine Freunde. Aber dieses Mal muss ich alleine gehen.«
Pierre steckte sich eine neue Zigarette am Stummel der letzten an. »Richard? Ich dachte, er hätte dich immer nur gehänselt.«
Emelie zuckte mit den Schultern. »Er ist der beste Freund meines älteren Bruders. Seine Eltern waren unsere Nachbarn. Für ihn war ich damals tatsächlich immer nur ein kleines, dummes Mädchen. Du musst so was doch kennen …«
Pierre rauchte. Das graue Morgenlicht ließ ihn unter seinem schwarzen Haarschopf blass aussehen. Er hatte das feinknochige Gesicht eines Pariser Bürgersohnes. Dann nahm er seine randlose Brille ab und rieb sich die dunkelblauen Augen. »Nein, das kenne ich nicht. Jagt er auch, wie dein Vater? Stell dir bloß mal vor, wenn du weiter als Großwildjägerin gearbeitet hättest, hätten wir uns nie kennengelernt.«
Emelie schüttelte den Kopf. »Richard hat eine Blumenfarm geerbt. Ich bin froh, dass ich am Grab meines Vaters den Schwur geleistet habe, nie wieder auf der Jagd ein Tier zu töten. Jetzt bin ich eben Fotografin. Da gibt es nur ein anderes Fadenkreuz, und es ist eine andere Art zu schießen.« Sie trank von ihrem Kaffee.
»Und du bist eine gute Fotografin. Für mich klingt es schon wild genug, wenn ich Leuten bloß erzähle, dass du aus Afrika kommst«, sagte Pierre. »Hast du dich eigentlich damals mit deiner Mutter über diesen Schwur gestritten?«
Emelie war erstaunt. Es war nicht Pierres Angewohnheit, alte Wunden aufzureißen. Ehe sie ihm antworten konnte, fügte er rasch hinzu: »Ich will alles von dir wissen, bevor …« Er stockte.
Was machte ihn denn so unruhig? Vielleicht begriff er mehr als sie selber, was die Reise nach Kupenda bedeutete. »Bevor?«, half sie ihm weiter.
»Bevor wir uns so lange nicht sehen.« Es klang wie eine Ausrede. »Wir gehören zusammen«, sagte er zögernd.
Emelie strich ihm durch die Haare. »Ich fahre nur für zwei Wochen nach Kenia, Pierre. Gerade mal für Weihnachten und Neujahr«, sagte sie. »Du wirst alles verstehen, wenn wir das nächste Mal gemeinsam hinfahren.«
Es würde kein nächstes Mal geben, dachte sie. Sie hatte den Ansprüchen ihrer Mutter nie genügt. Jedes Wort, das sie ihr damals ins Gesicht geschleudert hatte, war die Wahrheit gewesen. Wenn Carl zustimmte, würden sie Kupenda verkaufen. Entweder an Kabir Khan, Aischas angeheirateten Onkel, der eine Lodge, ein Gästehaus nach modernen Ansprüchen, daraus machen wollte. Oder an Old Thompson. Doch was würde jemand wie er mit dem Land machen? Etwa neue Slums entstehen lassen und dem Wild noch mehr von seinem Lebensraum nehmen? Emelie vertrieb den Gedanken. Wenn Kupenda einmal verkauft wäre, dann hätte sie ihre Entscheidung wenigstens getroffen. Sie war Fotografin und lebte in Paris. Ihr Leben war hier bei Pierre.
»Sie hat dich mit einem Mann im Bett erwischt und euch beide aus dem Haus geworfen«, sagte Pierre nun.
Emelie lachte. »Pierre! Du bist und bleibst Franzose.«
Meinst du wirklich, er liebt dich nur um deiner selbst willen? Wie könnte er?
Emelie konnte die Worte nicht vergessen, die an jenem Nachmittag vor fünf Jahren gefallen waren. Es war der Tag nach Paddys Beerdigung gewesen. Carl hatte sie schützend im Arm gehalten, als sie in Paddys Arbeitszimmer so bloß und verletzlich dagesessen hatte. Noch nie hatte sie Diane so wütend gesehen, erinnerte sich Emelie. Ihr Zorn hatte Emelie dazu gebracht, ein Meer und einen Kontinent zwischen sich und Kupenda zu schieben. Leander hatte nur mit hängenden Armen neben ihnen gestanden. Entwaffnet, der junge Krieger. Er hatte weder Emelie noch sich selber gegen Diane verteidigt.
Meinst du wirklich, er liebt dich nur um deiner selbst willen? Wie könnte er?
Pierre erhob sich und schob seinen Stuhl an den Tisch heran. Dann beugte er sich zu Emelie herab und küsste ihre Stirn. Sie schloss die Augen. Als sie nach ihrer ersten Liebesnacht mit Pierre erwacht war, waren ihre Kleider, die sie am Abend auf dem Boden seines Wohnzimmers verstreut hatten, ordentlich gefaltet auf dem Stuhl neben dem Bett gelegen. Emelie musste bei der Erinnerung daran lächeln. Pierre würde sie nie verletzten, das wusste sie. Die kurze Zeit mit Leander war wie ein Wasserfall gewesen, der sie mit sich gerissen hatte. Leander, der halbe Massai. Bereit, einen Löwen zu töten, um seine Kraft zu beweisen. In seinen Armen hatte sie zum ersten Mal verstanden, was Leidenschaft bedeutete. War dies eine Speise, von der sie vielleicht lieber nicht hätte kosten sollen? Pierres Liebe war dagegen wie ein Bad in einem warmen, tiefen See, dessen Ufer bekannt und überschaubar waren.
Gab es irgendwo einen Ozean, der ihr Entdeckung und Abenteuer versprach?
»Ich muss jetzt zur Bank und fahre direkt nach der Arbeit aufs Land. Guten Flug morgen. Und übrigens, ich will Weihnachten nicht noch einmal von dir getrennt sein.«
»Weißt du nun alles, was du von mir wissen willst, ehe ich fahre?«, neckte sie ihn statt einer Antwort.
Pierre zog sie zu sich hoch und küsste sie wieder. Emelie roch sein Aftershave und strich ihm über die frisch rasierten Wangen. Sie war beinahe ebenso groß wie er, und sein Gesicht war dem ihren ganz nahe. Pierre fasste ihre Hand, und sein Daumen strich über ihre Finger.
»Ich will vor allen Dingen, dass du wiederkommst«, sagte er und zögerte kurz, bevor er hinzufügte: »Ich hätte es gern feierlicher gemacht.«
»Was denn, unseren Abschied?«
»Nein, meinen Antrag.«
»Deinen … was?« Emelies Herz schlug hart in ihrer Brust.
»Meinen Heiratsantrag. Ehe du Menschen triffst, die dich an dein altes Leben erinnern. Ehe diese Welt dort dich wieder einfangen kann. Ich liebe dich, Emelie. Ich will, dass du das weißt.«
»Pierre …«
Er legte ihr jedoch seine Fingerspitzen auf die Lippen. »Willst du mich heiraten?«, fragte er sie und griff in seine Hosentasche. Er zog ein kleines Etui hervor und ließ den Deckel daran aufspringen. Auf blauem Samt funkelte ein altmodisch gefasster zitronengelber Diamant. Er ging auf ein Knie nieder und fasste ihre linke Hand.
»Pierre …« Emelie wusste nicht, was sie sonst sagen sollte. Sie hatte ihn in ihrer ersten Woche in Paris kennengelernt, und er hatte die Stadt zu ihrer neuen Heimat gemacht. War es einfach für ihn gewesen, sich für sie zu entscheiden? Sicher nicht: Alles an ihr war anders, als er es von den jungen Pariserinnen seiner Gesellschaft gewohnt war. Sein Stolz auf sie und ihren beruflichen Erfolg gab ihr jeden Morgen wieder die Kraft, sich durchzusetzen. Und doch war sie nie auf den Gedanken gekommen, dass sie heiraten sollten.
Pierre küsste sie auf ihre Finger. »Der Ring ist ein Erbstück. Er stammt aus meiner Familie. Deiner Familie, wenn du möchtest. Maman hat ihn vergangene Woche aus dem Safe geholt. Emelie, möchtest du?«
Sie sah keine Unsicherheit in seinem Blick. Vielleicht war es das, was sie brauchte. Auch wenn sie keine Schmetterlinge im Bauch hatte, wenn er sie küsste. Sie respektierte ihn, und sie lachten über dieselben Dinge. Er war ein guter Mann.
Emelie schloss die Augen. Pierre stand nun auf und zog sie an sich. »Möchtest du?«, flüsterte er in ihr Ohr. »Sag Ja, bitte. Wir gehören zusammen, ein Leben lang.«
Sag Ja. Es schien so einfach. Ein kleines Wort, das die letzten vier Jahre besiegelte und den Weg frei machte für all die Zeit, die sie noch zusammen verbringen konnten. Ein Leben lang. Das klang nach mehr, als sie sich je hatte vorstellen können. Paddy und Diane waren glücklich verheiratet gewesen. Das gab Emelie Vertrauen, doch entmutigte sie auch zugleich.
Pierre sah sie nun bittend an. Der Ausdruck in seinen Augen berührte Emelie: Seine Seele lag darin bloß. Er hatte sich für sie entschieden, das spürte sie. Es war das Schönste, was ein Mensch für einen anderen tun konnte. Wie konnte sie also zögern? Weshalb auch? Sie nickte stumm.
Pierre lachte und stieß einen kleinen Jubelschrei aus. Er hob sie an, schlang seine Arme um sie und drehte sich einmal mit ihr um sich selber.
»Lass mich los, ich kann nicht mehr atmen!« Emelie lachte.
Pierre setzte sie ab, nahm den Ring aus dem Etui und schob ihn ihr über den Finger. Er saß etwas zu lose. »Wir lassen ihn dir anpassen, wenn du wiederkommst«, sagte er und küsste nun ihr ganzes Gesicht: Ihre hohe, breite Stirn, ihre Nase, die ihr immer zu groß schien, und ihr starkes Kinn. Dann strich er durch ihre honigfarbenen Locken.
»Ich bin so, so glücklich. Wenn du wieder da bist, organisieren wir die Hochzeit. Wir heiraten in Neuilly, in derselben Kirche, in der ich auch getauft worden bin.«
Emelie sah zu, wie Pierre sich seinen Trenchcoat über den Nadelstreifenanzug zog und zu seinem Regenschirm griff. Die Farben seiner Kleider passten zu dem Grau der Stadt. Er küsste sie noch einmal.
»Au revoir, ma chérie«, sagte er. »Nächstes Weihnachten sind wir eine Familie.«
Emelie stand in der offenen Tür und sah Pierre die Spirale der Treppe hinunter verschwinden. Ihre Wohnung lag an der Dienstbotentreppe eines großen Gebäudes am Boulevard Clichy. Das ausgetretene Holz der Stiege roch kalt und staubig. Sie dachte kurz daran, wie Paddy immer ausgesehen hatte, wenn er zu seiner Arbeit auf Kupenda gegangen war. Er hatte stets nur ein kurzärmliges Hemd und kurze Kakishorts getragen, die ihm kaum bis zur Mitte der Schenkel gereicht hatten. Doch sie lebten hier und heute, ermahnte sich Emelie augenblicklich. Sie erinnerte sich an die Worte, mit denen sich ihre Eltern für jede noch so kurze Trennung voneinander verabschiedet hatten.
»Pierre?«, rief sie über das Geländer.
»Ja?« Er sah nach oben.
»Ich kann nicht gehen, ehe du mich nicht segnest.«
Er schwieg einen Augenblick lang und sagte dann: »Ich wünsche dir eine gute Reise. Ruf mich an, wenn du auf Kupenda angekommen bist und komm gesund wieder zu mir zurück.«
Emelie warf ihm eine Kusshand zu und schloss die Tür erst, als seine Schritte im Hausflur verklungen waren. Wieder in der Wohnung trat sie an das Fenster und sah hinaus. Hatte Pierre eigentlich gesagt, dass er sie liebte? Sie konnte sich nicht erinnern. Sicher, das musste er doch gesagt haben! Und lagen diese Worte nicht jeden Tag in all seinen Gesten und seinen Worten?
Die grauen Häuser draußen auf dem Berg um Sacre Cœur verschwammen hinter den Regenschleiern. Sie zerflossen vor ihren Augen, und Emelie wischte sich beinahe zornig die Wangen ab. Sie würde nach Kupenda fahren, aber es fühlte sich nicht nach einer Heimkehr an. Emelie streckte die Hand mit dem Ring daran aus. Er war wirklich etwas zu groß, doch sie wollte ihn dennoch nicht ablegen. Das Morgenlicht ließ den Stein aufleuchten. Emelie ballte die Hand zur Faust. Sie hatte ihre Wahl getroffen.
Iman fand Leander genau dort, wo sie ihn vermutet hatte: Er steckte mit dem Kopf unter der Motorhaube seines Rennwagens. Von der letzten Rallye war noch ein Reifen platt, die Tür war verbeult, und die Windschutzscheibe hatte einen Sprung. Auf der einen Seite des Autos konnte sie unter all den Matschspritzern den Schriftzug Goldman 25 erkennen.
Die Türen des Wagens standen offen. Aus dem Radio plärrte die Musik so laut, dass Iman keine Melodie mehr ausmachen konnte. Es musste der letzte Schlager aus einem der Bollywoodfilme sein, die laut und bunt über die Leinwand in Naivasha flimmerten. Zwei Mechaniker halfen Leander bei der Reparatur: Der eine pumpte gerade am Wagenheber, der andere reichte Leander den Spanner. Iman sah, wie der eine Mann den Kopf hob und ihren schmalen Körper musterte: Sie trug einen kurzen, ausgewaschenen Jeansrock und ein weißes T-Shirt, an ihren Armen, Hals und Ohren hing schwerer Schmuck aus Silber, Leder und Bernstein. Iman war diese Blicke gewohnt. Sie war eine von ihnen und war es doch nicht. Es machte ihr nichts aus, bestärkte sie sich. Paddy und Diane hatten immer deutlich gemacht, dass sie zu ihnen gehörten. Sie hatten es den Kindern damals verboten, ihre Großeltern in ihrem Kral zu besuchen. Iman hatte das Verbot nie hinterfragt, ganz im Gegensatz zu Leander.
»Leander«, sagte sie nun. Er hörte nicht, sondern schraubte unter der Motorhaube weiter. Sie griff in das Innere des Wagens und drehte die Musik leiser.
Leander tauchte unter der Motorhaube auf und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Ein Streifen Motoröl blieb auf seiner Haut zurück, und sein schulterlanger bunter Perlenohrring schaukelte bei der Bewegung.
»Was ist denn? Ach, du bist es. Ich dachte schon, es sei Tante Diane mit ihrem ewigen Gemecker. Als ob sie mir nicht mehr schuldet als nur die paar Kröten für einen neuen Rennwagen. Mir sollte viel mehr hier gehören als nur dieser elende Schuppen.« Er zeigte auf die Garage hinter sich, die Paddy ihm kurz vor seinem Tod hatte bauen lassen.
»Diane hat uns ihr Leben lang nur Gutes getan. Sie hat uns wie ihre eigenen Kinder aufgezogen«, sagte Iman.
Leanders aufgeknöpftes Hemd aus roter Baumwolle hing lose über seine engen Jeans. Er trug oft ein rotes Kleidungsstück im Farbton der Massai. Iman sah auf seine nackte, glatte Brust. Seine Haut hat dieselbe Farbe wie die ihre. Die dunkle Hautfarbe der Massai hatte sich mit dem milchigen Teint ihres Vaters zu einem tiefen, bronzenen Ton vermischt. Leander, ihr schöner Zwilling.
»Die gute Diane.« Er verneigte sich spöttisch. »Lasst uns ihr auf ewig an ihrem Altar huldigen. Mach du nur weiter, ich habe die Nase voll davon. Ich bin genauso ein Goldman wie Carl. Wenn sogar nicht noch mehr.«
Iman sah, wie die beiden Mechaniker einen raschen Blick austauschten. Sie wusste, dass dieses Gespräch am Abend in allen Hütten auf Kupenda wiederholt werden würde.
»Red keinen Unsinn. Diane fährt morgen früh mit Kunden auf Safari. Sie kommt am Weihnachtsabend wieder. Sie will übrigens Kupenda an Carl und Emelie übergeben«, sagte Iman.
Leander hob den Kopf.
Es war besser, wenn er es von ihr erfuhr als von jemand anderem, dachte Iman. Niemand verstand ihn so, wie sie es tat. Nur sie beide wussten, wie es war, sie zu sein. Für sie war das Leben zwischen den Welten immer einfacher gewesen als für ihn. Ja, ihre Mutter war eine Massai, die nicht lesen und schreiben konnte. Ihr Vater war ein entfernter Vetter Paddys. Iman versuchte, ihr afrikanisches Erbe mit derselben Freude anzunehmen wie auch ihre Zugehörigkeit zu den Goldmans. Leander dagegen hatte seinen Platz noch nicht gefunden. Kupenda erben konnte er nicht, ein junger Krieger, der Löwen tötete, durfte er auch nicht sein. Obwohl die Leute wie die beiden Mechaniker hier genau das von ihm erwarteten.
Leander schüttelte den Kopf. »Das kann nicht sein«, sagte er.
»Leander, es ist ihr Land. Du konntest nichts anderes erwarten. Diane und Paddy haben uns ein Heim gegeben, als unsere Eltern über der Savanne abgestürzt sind.« Sie fasste Leander am Arm. »Carl ist wie unser Bruder, Emelie wie unsere Schwester. Carl ist nie gegangen, und nun kommt Emelie nach Hause«, sagte sie.
»Sie sind Weiße, Iman. Womit haben sie sich unser Land verdient? Damit, dass Emelie in Frankreich lebt? Ich bin ein Goldman, und ich bin ein Massai. Kupenda steht mir zu.« Er streckte sich zu seiner vollen Größe aus. »Du weißt nichts von unserem Erbe. Du hast unsere Großeltern nie im Kral besucht. Du hast wie ein Hündchen vor Paddys Verbot gekuscht.« Iman schwieg.
»Dieses Land gehört mir. Das ist es, was ich will und was der Stamm will. Die Stimmung kocht. Und wenn es sein muss, bringe ich sie zum Überlaufen«, sagte Leander.
»Schweig.« Iman legte ihm rasch ihre flache Hand auf die Lippen. »Wir brauchen eine gute Verwaltung, das ist alles. Emelie ist eine Kenianerin, genau wie du und ich. Sie und Carl werden eine Lösung finden. Du hast sie doch mal geliebt, oder? Wie kannst du nun so urteilen?«
Leander bückte sich zu seinem Werkzeugkasten. Er griff nach einem Hammer und begann, in der offen stehenden Tür von innen eine Beule im Blech auszuhämmern. »Nur weil sie einen kenianischen Pass hat, ist sie keine von uns. Ein Vanilla Gorilla, das ist sie.«
»Hast du sie einmal geliebt oder nicht?« Iman trat näher, sodass die Mechaniker ihre Worte nicht hören konnten, und fasste ihren Bruder am Handgelenk. »Oder war dir Kupenda schon damals wichtiger?«
»Emelie ist damals ohne Gruß gegangen. Ohne ein Wort, ohne eine Erklärung«, sagte Leander und drehte die Musik aus dem Autoradio wieder lauter.
Iman trat in die Wagentür, genau dorthin, wo er gerade die Beule geglättet hatte. Das Blech faltete sich. »Hast du denn versucht, mit ihr zu sprechen, tapferer Krieger?«
»Gott sei Dank trägst du flache Schuhe, Iman. Mit den hohen Hacken, die du zum Tanzen in den Bars von Nairobi trägst, hätte ich dir das nicht verziehen«, sagte er. »Hacken wie ein weißes Mädchen!«
»Was soll ich denn sonst tragen?«, schrie ihm Iman über die Musik hinweg zu. »Eine rote Shuka? Soll ich meine Haut mit Ochsenfett einschmieren und mich mit Glasperlen zudecken?«
Leander hämmerte nur mit neuer Kraft gegen die Tür.
Frauensache
Die Kühle des Verwalterhauses tat Aischa gut. Sie ließ die Tür zum Garten offen stehen. Der Motor ihres Landrover tickte noch erschöpft in der Mittagshitze.
Sie trat in den Gang, der an dem kleinen Esszimmer und der Küche vorbei zum Arbeitszimmer führte. Über Aischas Kopf drehte sich mit einem schleifenden Geräusch ein hölzerner Ventilator. An den Wänden blätterte die lindgrüne Farbe ab, und es roch nach frisch gebrühtem Kaffee. Aischa schnupperte. Hm, das roch gut. Die Bohnen kamen aus Thika, wo um diese Jahreszeit die Beeren rot in den Kaffeebäumen leuchteten. Vielleicht konnte sie sich ja eine Tasse holen, ehe sie sich an die Bücher setzte.
Ihre Großmutter Meena steckte ihren Kopf aus der Küche. »Aischa! Hab ich’s mir doch gedacht, dass du es bist. Ich habe schon auf dich gewartet.«
Jim, der Koch, verdrehte seine Augen hinter ihrem Rücken. Meenas Besuch zur Weihnachtszeit war von allen im Haus gefürchtet.
»Ich zeige Jim gerade, wie man Chapatis macht. Was er da gestern gebacken hat, war ja nicht mal als Wischlappen zu gebrauchen! Du kannst das auch gleich lernen, sonst bekommst du nie einen Mann.«
Aischa spürte die vertraute Mischung aus Schwäche und Zorn in sich aufsteigen. Nur Meena konnte dieses Gefühl in ihr auslösen.
»Ich wollte eigentlich zu Vater ins Büro. Wir müssen noch vor Weihnachten die Bücher fertig haben. Die Bank will die letzten Zahlen sehen, damit sie uns den Kredit verlängern können«, sagte sie.
»Zahlen! Bücher! Papperlapapp. Belaste deinen Kopf nicht mit solchem Unsinn. Das macht dir nur Falten auf der Stirn, oder du brauchst bald eine Brille. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Komm rein«, sagte Meena und zog Aischa in die Küche. »Jim, sieh nach, ob die braune Henne endlich Eier gelegt hat. Wenn nicht, kommt sie in den Kochtopf.«
Jim verschwand.
»Wie siehst du denn eigentlich aus?«, sagte Meena dann zu Aischa und kniff sie in die runde Hüfte, dorthin, wo die ausgewaschene Jeans eng saß.
Aischa schwieg. Ihre Großmutter fasste sie unter dem Kinn und hob ihr Gesicht ins Licht. Meena schnalzte zufrieden mit der Zunge.
»Deine Haare sähen offen schöner aus. Mach den Pferdeschwanz auf, denn das führt zu Haarbruch. Knete dir nach dem Waschen Kokosnussöl rein und lass es über Nacht einwirken, dann glänzen sie. Deine Haut ist rein, das ist gut. Wenn du dir die Nase dunkler schminkst, wirkt sie nicht so groß. Schließ beim Lachen den Mund, sodass man die Lücke zwischen deinen Schneidezähnen nicht sieht, und putz dir die Zähne mit Salz, das macht sie weißer.« Sie trat einen Schritt zurück und schüttelte missbilligend den Kopf. »Du hast meine Augen geerbt, aber nicht meine zarte Figur. Du kommst nach deiner Mutter. Lass die Finger von den Naschereien. Wenn du mal verheiratet bist, kannst du essen, was du willst. Merk dir, die Frau ist die einzige Beute, die ihrem Jäger auflauert. Ich schicke dir aus Nairobi einige neue Shalwar Khameez. Die Jeans verbrennen wir nachher. Schluss mit dem Unfug.«
Aischa dachte an die buntseidenen Gewänder in ihrem Kleiderschrank, die ihre Großmutter ihr aus Nairobi mitgebracht hatte: Weite, an der Fessel schmal zulaufende Hosen, am Hals ausgeschnittene Kaftane und dazugehörende Schals.
»Ich kann so was nur an Feiertagen tragen. Wie soll ich im Shalwar Khameez in den Jeep steigen? Und wie die Wildererschlingen aus den Dornbüschen schneiden?«, fragte sie.
Ihre Großmutter warf sich ihren Schal aus violetter und purpurfarbener Seide nach hinten über die Schulter. Ein Duft nach Sandelholz und Patschuli stieg aus allen Falten ihres Gewandes und aus den Poren ihrer sorgsam geölten Haut.
»Rede keinen Unsinn. Was soll dein Mann einmal denken, wenn du so aussiehst?«, sagte Meena. »Nun zieh dir eine Schürze über, sodass du die Fladen backen kannst.« Sie ging auf den Arbeitstisch zu, und die Ledersohlen ihrer mit Halbedelsteinen besetzten Sandalen schlugen dabei auf den Küchenboden auf. »Sieh her.« Sie griff nach einer der kleinen Teigkugeln. »Du legst dir den Teig so hin, drückst ihn mit der Hand flach, machst eine Mulde, ziehst ihn dann in die Länge und wirfst ihn einige Mal von Hand zu Hand, um ihn geschmeidig zu machen …« Der Teig flog mit einem leisen, klatschenden Geräusch von einer ihrer Handflächen in die andere.
Aischa schüttelte nur den Kopf und seufzte. Ah, da lag ja auch eine Zeitung. Sie war heute noch nicht dazu gekommen, einen Blick hineinzuwerfen. Ihr Blick fiel auf die Seite, die gerade aufgeschlagen war. Es waren Heiratsanzeigen. Aischa las India Star in dicken Lettern oben auf die Seite gedruckt. Das Blatt musste direkt aus Indien stammen.
»Was ist das?«, fragte sie.
Wollte Meena auf ihre alten Tage noch einmal jemanden unglücklich machen? Genügte es nicht, dass sie Aischas Vater und ihren angeheirateten Neffen Kabir Khan tyrannisierte?
Meena sah die Zeitung in Aischas Händen. Der eben noch so wertvolle Teig für die Chapatis fiel zu Boden, als sie nach dem Blatt griff. Aischa jedoch war schneller als sie und breitete die Zeitung wieder auf dem Küchentisch aus. Es war wirklich eine indische Zeitung. Sie verbiss sich ein Lachen: Ihre Großmutter, die in Kenia geboren und aufgewachsen war, ließ sich noch immer Zeitungen aus Indien kommen!
Da erkannte sie mit einem Mal ihr eigenes Gesicht. Es war das Bild, das am Tag ihrer Abschlussprüfung zur Buchhalterin aufgenommen worden war. Das Foto war in einer langen Reihe mit dem vieler anderer jungen Frauen in der Zeitung abgedruckt. Daneben stand geschrieben: Ausgebildete Buchhalterin, Anfang zwanzig, aus guter Familie. Hohe Mitgift. Nur Männer islamischen Glaubens brauchen vorstellig werden.
»Aber, Großmutter …«, sagte Aischa.
Meena hatte nun ihre Arme vor der Brust verschränkt und den rot geschminkten Mund zusammengekniffen. Sie schüttelte den Kopf so sehr, dass die schweren goldenen Ringe in ihren Ohrläppchen klirrten.
»Das ist nicht für deine Augen bestimmt, Aischa. Gib mir die Zeitung.«
Ihre Stimme klang beherrscht, doch Aischa kannte Meena besser. Sie las den Text noch einmal, und ihr Entsetzen wuchs mit jedem Wort.
»Weiß Vater davon?«, fragte sie dann leise.
Meena schüttelte den Kopf. »Seit wann kümmern sich die Männer unserer Familie um diese Angelegenheiten? Das ist Frauensache«, sagte sie bestimmt und nahm Aischa die Zeitung aus der Hand. »Also, die Chapatis musst du jeden Morgen backen, wenn du erst mal verheiratet bist. Das ist die erste Aufgabe einer Ehefrau. Nun, beinahe die erste Aufgabe.«
»Ich will nicht heiraten. Zumindest jetzt noch nicht. Und schon gar nicht jemanden, den ich nicht kenne. Jemanden, der nur mein Bild in der Zeitung gesehen hat. Ich will arbeiten und erfolgreich sein, so wie Emelie.«
»Emelie erfolgreich? Dass ich nicht lache! Unverheiratet ist sie, das ist alles«, erwiderte ihre Großmutter.
Aischa seufzte. Sie wollte jetzt keinen Streit. Meena war nur über die Weihnachtstage hier. Solange würden sie sich wohl vertragen, schon ihrem Vater zuliebe.
»Verzeih, Großmutter, aber ich muss jetzt Vater helfen. Er wird sonst mit der Buchhaltung nicht fertig, bis Emelie wiederkommt. Carl und sie werden sich gleich nach dem Weihnachtsfest mit jemandem aus der Bank treffen müssen.« Aischa gab ihrer Großmutter einen Kuss auf die Wange und wandte sich zur Tür.
Meena jedoch griff sie am Arm. »Ich bring dich schon zur Vernunft. Und wenn ich deinen Onkel Kabir Khan um Hilfe bitten muss.«
Aischa lief zur Tür hinaus. Draußen im Gang lehnte sie sich kurz gegen die Wand und schloss die Augen. Aus der Küche hörte sie ein klatschendes Geräusch. Ihre Großmutter hatte wohl den Chapati-Teig auf den Holztisch geworfen, und es hatte wie eine Ohrfeige geklungen. Mit Meena war nicht zu spaßen. Aber das war wirklich der Gipfel! Was Vater wohl dazu sagte? Wahrscheinlich lohnte es gar nicht, mit ihm darüber zu sprechen. Wenn es darauf ankam, war er stets mehr Meenas Sohn als Aischas Vater. Zudem hat er nun andere Sorgen: Kupenda stand kurz vor dem Bankrott, und niemand wusste, was Carl und Emelie damit machen wollten.
Als ob Kabir Khan nichts anderes zu tun hatte, als sich um das Arrangieren einer Ehe zu kümmern! Er war ein mächtiger Mann, der sein Vermögen selbst gemacht hatte. Seine Hotels, Rasthäuser und Lodges waren in ganz Kenia zu finden. Meena hatte zufrieden sein können, als sie ihn damals mit ihrer Nichte verheiratet hatte.
Wenn sie wenigstens mit Carl darüber sprechen könnte, dachte Aischa. Aber das war unmöglich. Wie könnte er sie verstehen? Meena würde von diesem verrückten Unternehmen schon wieder ablassen.
Blumen und Bienen
Richard lief über das ausgedörrte Gras auf seinen Wagen zu. Die Trockenzeit schien ihm heißer als sonst zu sein. Hoffentlich überlebten die Sprösslinge das, dachte er, er könnte sich keine verpasste Saison leisten. Die Bestellungen aus Europa zum Valentinstag häuften sich auf seinem Schreibtisch.
Er streifte seine groben Wildlederstiefel nachlässig an den scharfen Kanten des Trittbretts ab, ehe er die Autotür öffnete. »Autsch«, er zuckte zusammen, als er die Hände um das Steuer legte: Es war heiß von der Morgensonne. Im Auto roch es nach Bier und alten Kleidern. Richard stieß mit dem Fuß eine leere Flasche »Tusker«-Bier neben dem Gaspedal weg. Dann öffnete er die Beifahrertür. Sein schwarzer Mischlingshund Schnauz sprang mit nassen Pfoten auf den Sitz.
»Schnauz, du bist ein Schwein, das sich als Hund verkleidet hat. Sieh dir das an! Der ganze Sitz ist voller Matsch. Da soll morgen eine Dame sitzen, ist dir das klar?« Richard sah noch einmal zu dem gelb gestrichenen Haus hinüber.
Sein Koch Ujinda begann gerade, das Frühstück von der Veranda abzutragen: Es hatte Papaya, Tee, Toast und ein gekochtes Ei gegeben.
Richard hupte einmal, und der Alte winkte ihm zu. Der Massaischmuck an seinem Arm rutschte dabei nach oben. Er hatte schon bei Richards Familie gekocht, als der noch nicht hatte laufen können. Später hatte ihn Ujinda oft am Nachmittag mit in seine Hütte genommen, während Richards Eltern auf ihrer Farm unterwegs waren.
Richard winkte zurück. Das Wochenende steckte ihm noch in den Knochen und nun stand Weihnachten vor der Tür.
»Das wird wieder ein schönes Fest auf Kupenda, Schnauz. Auf die Damen dort kann man sich verlassen«, sagte er und ließ den Motor an. Er musste zuerst in Gilgil Massimo abholen, dann ging es über Dagoretti nach Nairobi. Richard mochte Dagoretti nicht, denn dort kam es in letzter Zeit immer wieder zu Überfällen, aber er hatte keine andere Wahl.
»Massimo will in Nairobi neue Talente suchen. So nennt man das, wenn man Fotograf ist, und dazu noch Italiener. Denen ist jeder Vorwand recht, schöne Frauen anzusehen. Die Einzige, die ich mir ein Leben lang ansehen will, ist Emelie.«
Emelie. Wie oft hatte er in den vergangenen fünf Jahren an sie gedacht? Die ganze Zeit, gestand er es sich ein. Er hatte darauf gewartet, dass sie zur Vernunft kommen und den Weg nach Hause finden würde. Nun war es so weit.
Richard gab Gas und winkte Ujinda noch einmal zu. Der Kragen seines aufgeknöpften karierten Baumwollhemdes verrutschte, und seine weiße Schulter kam zum Vorschein. Farmerbräune, nannte man das hier: Hals, Arme, Knie und Beine waren gebräunt, während Brust, Lenden und Oberschenkel ganz hell waren.
»Kwaheri, auf Wiedersehen«, hörte er Ujinda noch rufen und sah ihn im Rückspiegel den Kopf schütteln. Richard wusste genau, was er jetzt dachte. Meikooyu olelipon, sagten die Massai ganz richtig: Einem Mann, der verliebt ist, kann man keinen Rat geben.
Ujinda hatte immer Recht. Obwohl der Alte in letzter Zeit zerstreut gewesen war. Erst gestern hatte er ihm Salz statt Zucker in den Tee gelöffelt. Am Abend war er dann schon zum dritten Mal in einer Woche ausgegangen. Wohin? Richard nahm die erste Kurve die Auffahrt hinauf. Er las zu viel in Ujindas Verhalten hinein. Sicher hatte dieser nur seine Tochter besucht.
Richard lenkte den Wagen über die vom Regen ausgewaschenen Straßen, die über sein Land bis zum Tor der Farm hinführten. Zwei Warzenschweine standen an dem kleinen Sumpfloch zwischen den Feuerbäumen. Er passierte die Startbahn seiner Cessna, die er sich nahe des Sees hatte anlegen lassen. Beim Abheben hatte er jedes Mal den Eindruck, direkt in die Wasser des Sees zu tauchen. Dann und wann begegnete ihm ein Hirte mit roter Shuka und einem Stecken in der Hand oder Frauen, die Krüge mit Wasser auf ihrem Kopf trugen.
Er erreichte das Tor zur Einfahrt. Der Askari hob die Schranke.
»Asante. Danke. Ich bin morgen Abend wieder da.«
Beim Anfahren hörte er Kinder rufen und lachen. Im Rückspiegel sah er in einer Wolke aus Staub und schlaksigen Armen und Beinen drei, vier Jungen und Mädchen über die staubige, rote Straße auf seinen Pick-up zulaufen. Sie waren barfuß und trugen bunt bedruckte T-Shirts, kurze Hosen und geflickte Röcke. Die Zähne leuchteten weiß in ihren Gesichtern. Richard lehnte sich aus dem Fenster und schlug mit der Hand gegen das Blech der Tür. »Gilgil, Gilgil, Gilgil«, imitierte er den Ruf der Fahrer in den Sammeltaxis, den Matatus, und drückte auf die Hupe. Die Kinder kreischten vor Lachen und schwangen sich auf die Ladefläche des Pick-ups. Als alle saßen, gab Richard Gas. Die Kinder begannen zu singen. Die Fahrt mit ihm sparte ihnen den zehn Kilometer langen Fußweg zur Schule nach Gilgil.
Richard parkte seinen Wagen auf dem Kies vor Massimos Elternhaus. Auf dem Geländer der Terrasse saß eine zahme Meerkatze und knackte Nüsse. Richard drückte auf die Hupe. Hoffentlich hatte Massimo schon fertig gefrühstückt.
»Si, si, Mamma, ich verspreche es dir …« Richard sah seinen Freund aus dem Haus kommen. Seine Mutter folgte ihm in Gummistiefeln, die sie über der engen Jeans trug. In der einen Hand hielt sie einen Kescher. Richard sah, wie Massimo etwas in die Hosentasche schob und dann seine Mutter küsste. Sie musste sich auf die Zehenspitzen stellen, um ihren Sohn zu umarmen. Massimo war als Junge klein und ausgesprochen zart gewesen, erinnerte sich Richard. Zwerg Nase, so hatten sie ihn in der Schule von Pembroke gehänselt. Das hatte sich geändert. Aus Zwerg Nase war ein gut aussehender, immer bestens gelaunter und groß gewachsener Mann geworden.
»Ciao, Richard. Fahr vorsichtig und grüß mir Emelie«, rief Massimos Mutter ihm zu. Sie ging den schattigen Berg hinunter in Richtung des ersten der drei Seen, an denen die Familie Fischercamps betrieben.
Massimo öffnete die Tür zum Beifahrersitz und stieg ein. »Madonna mia! Wo der Teufel nicht hinkommt, da schickt er meine Mutter!«
»Was hat sie dir gegeben?«, fragte Richard seinen Freund.
»Kondome«, antwortete Massimo.
»Kondome?«
»Hast du noch nie was von Kondomen gehört? Klar, bei dir auf der Farm dreht sich ja alles um Blumen und Bienen.«
»Immer noch besser als Fischeier auszubrüten. Du solltest Massimo Del Kondomo heißen, bei deinem Verschleiß an Frauen.«
Massimo lachte und schob sich die dunkle Brille auf der noch immer großen Nase zurecht. »Fahr los. Solange die Frau meines Herzens mich nicht erhört, brauche ich noch Kondome. An dem Tag, an dem sie mich will, will ich auch keine andere mehr.«
Richard wendete den Wagen. Sie beide wussten, wen Massimo damit meinte, doch niemand nannte ihren Namen.
»Sie ist selber schuld. Irgendwann wird ihr schon aufgehen, was für ein Glück sie mit dir hat. Kurbel das Fenster hoch, sonst ist deine Uhr gleich weg. Ich nehme den Weg durch Dagoretti. Dreckiges Dagoretti«, sagte Richard und zog eine Packung Zigaretten aus seiner Hemdtasche. Sportsman stand darauf geschrieben.
»Wolltest du nicht aufhören zu rauchen?«, fragte Massimo.
»Im neuen Jahr.« Richard fuhr an, und der Kies der Auffahrt sprang unter den sich drehenden Rädern weg. Die Meerkatze auf der Terrasse kreischte.
Verlagsgruppe Random House
Originalausgabe 11/2009
Copyright © 2009 by Ellen Alpsten Copyright © 2009 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
eISBN : 978-3-641-03743-3
www.heyne.de
Leseprobe
www.randomhouse.de