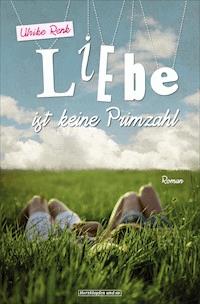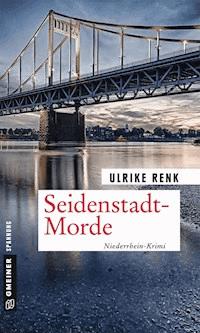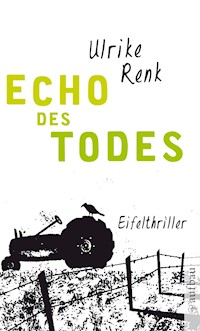Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ostpreußen Saga
- Sprache: Deutsch
Zeiten des Aufruhrs.
Nach dem dringlich herbeigesehnten Ende des Krieges besetzen die sowjetischen Truppen das Land. Viele Gutsfamilien verlassen ihre Heimat und ziehen in den Westen. Auch Gebhards Brüder und seine Mutter. Er jedoch kann sich einfach nicht dazu entschließen, das Land seiner Väter zu verlassen. Dann wird er denunziert und verhaftet. Frederike droht das gleiche Schicksal. In letzter Sekunde schafft sie es zu fliehen – aber wird ihr ein Neuanfang gelingen? Und was ist mit Gebhard?
Der Abschluss der großen Ostpreußen-Saga von Bestsellerautorin Ulrike Renk.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 682
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Über Ulrike Renk
Ulrike Renk, Jahrgang 1967, studierte Literatur und Medienwissenschaften und lebt mit ihrer Familie in Krefeld. Im Aufbau Taschenbuch liegen ihre Romane »Die Seidenmagd«, »Die Heilerin«, »Die Frau des Seidenwebers« und »Das Lied der Störche«, die Australien-Saga »Die Australierin«, »Die australischen Schwestern« und »Das Versprechen der australischen Schwestern« sowie die Ostreußen-Saga »Das Lied der Störche« und »Die Jahres der Schwalben« vor. Außerdem erschienen ihre Eifel-Thriller »Echo des Todes« und »Lohn des Todes«. Mehr Informationen zur Autorin unter www.ulrikerenk.de
Informationen zum Buch
Zeiten des Aufruhrs
Nach dem dringlich herbeigesehnten Ende des Krieges besetzen die sowjetischen Truppen das Land. Viele Gutsfamilien verlassen ihre Heimat und ziehen in den Westen. Auch Gebhards Brüder und seine Mutter. Er jedoch kann sich einfach nicht dazu entschließen, das Land seiner Väter zu verlassen. Dann wird er denunziert und verhaftet. Frederike droht das gleiche Schicksal. In letzter Sekunde flieht sie mit ihren Kindern in den Westen. Doch auch dort kann sie nicht bleiben. Ihre einzige Chance ist es, nach Schweden zu emigrieren – aber wird ihr ein Neuanfang gelingen? Und was ist mit Gebhard?
Der Abschluss der großen Ostpreußen-Saga von Bestsellerautorin Ulrike Renk
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Ulrike Renk
Die Zeit der Kraniche
Roman
Inhaltsübersicht
Über Ulrike Renk
Informationen zum Buch
Newsletter
Personenverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Epilog
Nachwort
Danksagung
Nachweise
Impressum
Für Claus. Weil ich dich liebe.
»And if I rise, we'll rise together
When I smile, you'll smile
And don't worry about me.«
Frances
Die Güter, die Bewohner und die wichtigsten Leute
MANSFELD BURGHOF
–
Die Familie
Gebhard zu Mansfeld
Frederike zu Mansfeld (geb. von Weidenfels, verw. von Stieglitz)
Friederike (Fritzi) geb. 1937
Mathilde geb. 1938
Gebhard (Klein Gebbi) geb. 1943
Die Leute auf Burghof Mansfeld
Ilse – 1. Hausmädchen
Else – Kindermädchen
Lore – Köchin
Nikolaus Pirow – Inspektor
Die Fremdarbeiter
Wanda – Kindermädchen
Pierre
Claude
Pascal
LESKOW
–
Adelheid (Heide) zu Mansfeld (geb. Hofer von Lobenstein), Mutter von Caspar, Werner und Gebhard
Die Leute auf Leskow
Fritz Dannemann – Inspektor
GROßWIESENTAL
–
Werner (Skepti) zu Mansfeld
Dorothea (Thea) zu Mansfeld, geb. von Larum-Stil
Wolfgang geb. 1932
Adrian geb. 1936
Walter geb. 1939
Barbara geb. 1941
KLEINWIESENTAL
–
Caspar zu Mansfeld
FENNHUSEN
–
Die Familie
Erik von Fennhusen
Stefanie von Fennhusen, geb. von XXX
Eriks Stiefkinder
Frederike von Weidenfels geb. 1909
Fritz von Fennhusen geb. 1911
Gerta von Fennhusen geb. 1913, gest. 1930
Gemeinsame Kinder
Irmgard (Irmi) geb. 1921
Gisela (Gilusch) geb. 1922
Erik geb. 1924
Albrecht (Ali) geb. 1927
Die Leute auf Fennhusen
Gerulis – 1. Hausdiener
Hans – Kutscher und Chauffeur
Leni – 1. Hausmädchen
Meta Schneider – Köchin
Nachbarn und Freunde der von Fennhusen
Familie von Hermannsdorf
Familie von Husen-Wahlheim
Familie von Olechnewitz
Familie von Larum-Stil
SCHWEDEN
–
Rigmor Svenoni – Lehrerin, Künstlerin
Kapitel 1
Mansfeld, Oktober1944
Frederike hielt die Andacht am frühen Morgen, obwohl sich ihr Magen schmerzhaft zusammenkrampfte. Nachdem sie das Vaterunser gesprochen hatte, schaute sie in die Runde. Die Leute, wie die Bediensteten des Guts genannt wurden, sahen genauso angespannt aus wie sie.
»Wat soll nun werden?«, fragte Lore, die Köchin, leise, nachdem die meisten Angestellten und die drei BDM-Mädchen das Zimmer verlassen hatten.
»Wir müssen zusammenhalten«, sagte Ursa Berndt, Gebhards Sekretärin. »Sie werden sicherlich bald zurückkommen.«
»Das hoffe ich«, murmelte Frederike. »Das hoffe ich sehr.« Dann straffte sie die Schultern. »Es hilft ja nichts – die Arbeit muss getan werden. Lassen Sie uns jetzt einfach so weitermachen wie immer und die Mahlzeiten besprechen«, sagte sie zu Lore. »Vorher muss ich noch schnell mit Pirow reden. Und auch mit Dannemann.«
Eigentlich hätte Gebhard, Frederikes Mann, die Andacht halten sollen, so wie er es jeden Morgen tat. Doch gestern waren er und seine Mutter von der Gestapo abgeholt und nach Potsdam gebracht worden. Jemand musste sie denunziert haben, ihnen wurden staatsfeindliche Einstellung und das Verbreiten von Fremdnachrichten vorgeworfen. Als Erstes war Heide zu Mansfeld auf Gut Leskow verhaftet worden, jemand hatte Gebhard angerufen und ihn vorgewarnt. In aller Eile hatte Frederike das zweite Radio, mit dem sie die Nachrichten der BBC gehört hatten, aus dem Kartoffelkeller geholt und es Lore gegeben, damit sie es versteckte.
Es gab keine Beweise für Gebhards und Heides staatsfeindliches Verhalten, aber Beweise waren in der jetzigen Zeit auch nicht mehr nötig. Das Wort eines Nationalsozialisten reichte.
»Es war sicherlich dieser Hittlopp«, flüsterte Fräulein Berndt Frederike zu, während sie in den kleinen Salon gingen. Dorthin hatte Ilse, das Hausmädchen, schon das Tablett mit dem Kaffee gebracht. In einer halben Stunde würde es das erste Frühstück geben, aber Frederike trank für gewöhnlich zusammen mit Ursa und Gebhard schon eine erste Tasse nach der Andacht, bevor sie dann alle ihrem Tagesgeschäft nachgingen. Natürlich gab es kaum noch echten Kaffee, aber Lore war sehr erfinderisch, wenn es um Rezepte für Ersatzkaffee ging. Sie röstete Wurzeln, Kastanien, Bucheckern, sogar Kartoffelschalen. Dann wurde alles gemahlen und mit Wasser aufgebrüht. Man musste diesen Kaffee sehr heiß und mit etwas Zucker trinken, sonst war er zu bitter.
Frederike nahm sich eine Tasse, blickte auf den nun leeren Sessel, auf dem sonst ihr Mann Platz nahm, und ging zum Fenster. Man konnte das erste Morgenlicht nur erahnen, noch lagen Ruhe und der herbstliche Morgennebel über dem Park. Die Nebelschwaden tanzten auf der Stepenitz, dem kleinen Flüsschen, das sich am Burghof vorbei und durch die Stadt schlängelte. Erst in einer Stunde würde die Sonne aufgehen und ihr goldenes Licht auf die rotgefärbten Blätter der Bäume gießen. Es würde ein warmer, angenehmer Herbsttag werden, dennoch fröstelte Frederike. Nicht zum ersten Mal war ihr Mann, Gebhard zu Mansfeld, verhaftet worden. Er hatte sich nie verbiegen lassen, hatte sich lange gegen eine Mitgliedschaft in der NSDAP gewehrt. Schließlich aber war er gezwungen worden, in die Partei einzutreten, sonst hätten ihm Brot und Wasser in einem Gefängnis gedroht, vielleicht sogar Schlimmeres. Gebhard war Gutsbesitzer durch und durch. Er führte sein eigenes Landgut, half seit dem Tod des Vaters seiner Mutter bei der Bewirtschaftung ihres Gutes und hatte darüber hinaus noch den Vorhof seines Bruders Caspar gepachtet. Caspar war Diplomat gewesen – allerdings war auch er ein Gegner des Führers und hatte bei der Septemberverschwörung mitgewirkt. Als er verraten wurde, konnte er im letzten Moment fliehen und lebte seitdem in Amerika. Sie hatten nur wenig Kontakt, und dies auch nur über sehr verschlungene Pfade.
»Der Baron wird wiederkommen«, sagte Fräulein Berndt leise und legte Frederike eine Hand auf die Schulter. »Ganz sicher kommt er wieder.« Die Worte sollten trösten, doch Frederike stiegen die Tränen in die Augen. Sie wandte sich ab, ihr war nicht wohl dabei, vor Ursa zu weinen.
»Ich lasse Sie für einen Augenblick alleine«, sagte die Sekretärin jetzt erschrocken. »Falls Sie mich brauchen …«
»Ist gut, Ursa«, sagte Frederike. Sie biss sich auf die Lippe und seufzte erst laut auf, nachdem sich die Tür hinter Ursa wieder geschlossen hatte. Eigentlich ging sie nach der ersten Tasse Kaffee immer in die obere Etage zu den Kindern. Doch heute konnte sie das nicht. Wie sollte sie Fritzi, Mathilde und Klein Gebbi gegenübertreten? Was sollte sie auf ihre Fragen antworten? Die Kinder würden sich nach ihrem Vater erkundigen, würden wissen wollen, wann er und die Großmutter zurückkämen. Aber darauf hatte Frederike keine Antwort.
Sie spürte, dass Gebhard diesmal länger inhaftiert bleiben würde – bisher war er immer nach wenigen Tagen wieder entlassen worden. Und sie machte sich große Sorgen um Heide, ihre Schwiegermutter. Die aufrechte Dame aus altem preußischen Adel in einem Gestapogefängnis – das war einfach unvorstellbar.
Frederike nahm ihre Strickjacke, zog sie über und öffnete die Tür zur Veranda. Von hier aus führte eine Treppe in den hinter dem Haus gelegenen Park. Ein paar Kraniche stolzierten mit gemächlichem Schritt über die Wiese und schienen Frederike überhaupt nicht zu beachten.
Jedes Jahr im Frühjahr kamen Tausende Vögel in die Prignitz, um dann zu ihren Brutgebieten nach Skandinavien weiterzuziehen. Einige rasteten auch auf dem Rückweg im Herbst hier.
Eins der Männchen hob den Kopf, legte ihn in den Nacken und stieß seinen trompetenartigen Ruf aus. Frederike liebte die Vögel, aber nun schauderte sie – der Ruf klang wie ein Warnsignal.
Die Luft war feucht, aber noch nicht kalt. Es roch nach moderndem Laub, nach altem Gras, nach faulender Flora. Die wenigen Blumen, die noch im Garten wuchsen, waren fast alle verblüht. Nur die Heckenrose, die Frederike aus Sobotka mitgebracht hatte, blühte noch, so als wolle sie dem Herbst und drohenden Winter mit aller Macht trotzen.
Nachdenklich ging sie durch das mit kaltem Tau getränkte Gras bis zum Ufer der Stepenitz. Gebhard war inhaftiert, keiner wusste, wie lange die Gestapo ihn im Gefängnis behalten würde. Frederike drehte sich um, schaute auf das Gutshaus. 1936 hatte Gebhard den Witwensitz seiner verstorbenen Großmutter umbauen und renovieren lassen. Zwei Flügelanbauten hatte er hinzugefügt – genügend Platz für eine große Familie und die Leute. Am Wirtschaftsweg, der zum Betriebshof führte, lagen die Schnitterhäuser – die Gebäude für die Saisonarbeiter. Jetzt wohnten dort die Franzosen und einige Polen. In einer Scheune auf dem Wirtschaftshof waren Ostarbeiter untergebracht. Für sie galten andere, strengere Regeln als für die französischen Kriegsgefangenen.
Mit all diesen Dingen muss ich mich jetzt noch mehr beschäftigen, dachte Frederike seufzend. Jedenfalls so lange, bis Gebhard wieder aus der Haft entlassen werden würde.
Sie straffte die Schultern. Schon einmal hatte sie ein Gut alleine geführt – damals, als ihr erster Mann an Tuberkulose erkrankt war und dann starb. Es war ein großes Gut mit einer bedeutenden Pferdezucht in Polen gewesen. Dagegen war Mansfeld fast lächerlich klein. Aber es gab ja nicht nur Mansfeld, es gab auch noch Kleinwiesental und Leskow. Natürlich betreute Gebhard die Güter nicht ohne Hilfe – es gab ja die Verwalter. Fritz Dannemann auf Leskow und Nikolaus Pirow hier auf Mansfeld. Von nun an würde sie sich jeden Morgen erst mit den Verwaltern treffen und mit ihnen die Gutsbelange durchsprechen müssen, bevor sie den Haushalt regeln konnte.
Mit langsamen Schritten ging sie zurück zum Haus. Das nasse Gras quietschte unter ihren Schuhsohlen. Die Kraniche stolzierten ungerührt über die Wiese, pickten hin und wieder nach Weichtieren und kleinen Säugern und benahmen sich so, als wären sie hier die Herren. Ihr Anblick, das musste Frederike zugeben, war majestätisch und erhaben. Sie wünschte sich einen Hauch davon für sich selbst. Dann gab sie sich einen Ruck und beschleunigte ihre Schritte. Sie musste sich mit den Gutsbüchern vertraut machen, mit den Verwaltern sprechen und die Güter weiterführen. Den Kopf in den Sand zu stecken, war keine Alternative. Noch einmal sog sie die süße und frische Herbstluft ein, dann stieg sie die Stufen wieder empor.
Nikolaus Pirow, der Verwalter, stand schon in der Diele. Seit Jahren wohnte er mit seiner Familie im Verwalterhaus auf dem Betriebshof des Gutes und war mittlerweile ein Freund der Familie geworden. Er verstand sich fast blind mit Gebhard. Nun drehte er seine Mütze in den Händen, ohne Frederike anzusehen.
»Pirow«, sagte sie unsicher. »Sollen wir in das Büro meines Mannes gehen? Dort sind die Bücher. Ich habe sie noch nicht durchgesehen, und ich fürchte, ohne Ihre Hilfe wird das auch nichts.« Sie versuchte zu lächeln, was ihr gründlich misslang.
Pirow schüttelte den Kopf. »Das geht nicht«, sagte er mit brüchiger Stimme. Dann zog er ein Schreiben aus seiner Jackentasche und reichte es Frederike. »Ich bin eingezogen worden … an die Front …« Seine Worte waren kaum zu verstehen.
»Was?« Entsetzt nahm Frederike den Brief entgegen, hielt ihn in den zitternden Händen, strich ihn glatt, versuchte erneut, die Buchstaben zu fokussieren. Es gelang ihr nicht. »Bitte? Was soll das?«, flüsterte sie verstört.
»Es ist eine Generalstrafe für uns alle. Ich werde nicht ins Gefängnis geworfen, so wie Ihr Mann, Gnädigste, aber ich muss an die Front.« Er räusperte sich. »Es ist kein Geheimnis, dass ich die Einstellungen Ihres Mannes teile. Wir sind beide keine Nationalsozialisten und werden es auch nie sein. Wir behandeln die Zwangsarbeiter zu gut, nun, so gut es eben geht, was eigentlich nicht reicht.« Er schüttelte den Kopf. »Aber wir gehen nicht konform mit der Obrigkeit.«
»Und jetzt?« Frederike schwindelte es, sie hatte das Gefühl, gleich das Bewusstsein zu verlieren. »Was … was mache ich jetzt?«
Pirow holte tief Luft. »Ich muss mich morgen auf der Dienststelle melden. Den heutigen Tag brauche ich, damit ich alles für meine Familie richten kann – sie werden ja nicht im Verwalterhaus bleiben können.«
»Wieso nicht?«
»Weil ich kein Verwalter mehr sein werde.«
»Moment … das Verwalterhaus hat Ihnen mein Mann vermietet. Es gibt einen Mietvertrag, der nicht an den Verwaltervertrag gebunden ist … oder?« Fragend sah sie ihn an.
»Ja, das stimmt. Der Mietvertrag ist nicht an die Tätigkeit gebunden.«
»Dann wird Ihre Familie dort wohnen bleiben können.«
»Ich weiß nicht, ob ich die Miete …«
»Grundgütiger, Pirow«, unterbrach sie ihn. »Wer fragt in diesen Zeiten und bei einer solchen Situation noch nach Miete? Ich sicherlich nicht.«
Pirow sah sie nachdenklich an. »Es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen sollten.« Er schaute auf die Kaminuhr. »Ich habe nicht viel Zeit … aber ein wenig schon. Kommen Sie.« Er nahm ihren Arm, führte sie in Gebhards Arbeitszimmer und nahm Bücher aus dem Schrank. »Das ist unsere zweite Buchhaltung«, erklärte er. »So etwas gibt es auch auf Kleinwiesental und auf Leskow. Davon wissen nur Ihr Mann, Dannemann und ich. Und vielleicht noch Fred Spitzner.«
»Der Schäfer?«
Pirow nickte. »Er hat es faustdick hinter den Ohren. Und das Gute ist, dass man es ihm nicht ansieht. Perfekt, um manche Obrigkeit zu täuschen. Ihm können Sie zu hundert Prozent vertrauen.« Er nahm Frederikes Arm, führte sie zum Schreibtisch ihres Mannes. »Passen Sie auf … es gibt einige Dinge, die das Reichswehramt und auch der Reichsnährstand nie erfahren sollten.«
Frederike sah ihn entsetzt an.
»Frieda zum Beispiel. Sie ist unsere Wiegesau. Sie ist bereits sechs Jahre alt. Sie bekommt genügend Futter, aber nicht so viel, dass sie fett wird. Diese Sau kommt immer zum Einsatz, wenn wir schlachten. Wir wiegen sie, stellen die Fettmasse fest und geben den Anteil an, den wir abgeben müssen. Und dann schlachten wir eine andere Sau – eine, die fetter ist, schwerer. Frieda wird nie dick, aber sie wird auch nicht geschlachtet. Und hungern muss sie auch nicht«, versicherte ihr Pirow. »Dann haben wir noch …« Auf die Schnelle verriet er ihr den einen und anderen Trick, wie die Güter die Vorgaben der Ämter bisher umgangen hatten. »Aber jetzt geht es um Ihre Haut und um die der Kinder. Ihrer Kinder und meiner auch«, sagte er eindringlich. »Setzen Sie nichts aufs Spiel, das ist es nicht wert.«
»Die Russen kommen doch sowieso«, sagte Frederike verzagt.
»Vermutlich. Aber sie werden nicht bleiben. Ihr Mann sagte immer: Wenn die Russen kommen, dann ist das wie ein großer Sturm, der viel vernichtet. Vielleicht die ganze Ernte, vielleicht zerstört er Häuser und mehr. Aber er zieht vorüber, und danach fangen wir wieder von vorne an. Alles, was wir brauchen, ist das Land. Und es ist unser Land.« Er senkte den Kopf. »Ich hoffe, Gebhard behält recht.«
»Das hoffe ich auch.« Frederike stand auf. »Sie müssen gehen, bestimmt haben Sie noch viel zu tun.« Auch Pirow erhob sich. Für einen Moment standen sie sich gegenüber, sahen sich nur an. Ihre Blicke tauchten ineinander und sagten mehr als tausend Worte – dort stand die Angst vor der Zukunft geschrieben, die Hoffnung, die Furcht vor Verfolgung und viele Dinge, die sich zu widersprechen schienen, aber so war es in der jetzigen Zeit, in der nichts mehr normal war und man nicht darüber sprechen durfte noch konnte, weil man sich nie sicher sein konnte, wer mithörte.
»Ich wünsche Ihnen alles Gute, Nikolaus«, sagte Frederike leise. »Bitte passen Sie auf sich auf.«
»Bitte … passen Sie auf meine Familie auf«, murmelte er und senkte den Kopf.
»Wer wird jetzt Verwalter?«, fragte Frederike. »Ich kann das nicht alleine.«
»Vielleicht Dannemann. Er ist ein guter Mann. Ein wenig herb, aber Sie können ihm vertrauen.«
»Dannemann – er müsste dann beide Güter verwalten.«
»Das schafft er.« Pirow sah sie an. »Alles Gute, Frau Baronin.«
»Freddy. Ich bin Freddy«, sagte sie und küsste ihn auf die Wange. »Alles Gute auch Ihnen. Bitte melden Sie sich, wenn es möglich ist.«
Noch eine Weile sah sie ihm nach, als er über den mit Kies belegten Vorplatz zum Wirtschaftspfad stapfte.
Ilse, das Hausmädchen, klingelte zum Essen. Verzagt sah Frederike zu den Gutsbüchern, die auf dem Schreibtisch ihres Mannes lagen. Sie würde sich damit beschäftigen müssen, die Last der Verantwortung drückte auf ihre Schultern, doch sie würde stark sein, das hatte sie Gebhard versprochen.
»Wann kommt Papa wieder?«, fragte die siebenjährige Fritzi.
»In ein paar Tagen ist er bestimmt wieder da«, meinte die sechsjährige Mathilde und strich sich Marmelade auf ihr Brot. Else, das Kindermädchen, das genau wie Fräulein Berndt mit ihnen speiste, warf Mathilde einen Blick zu.
»Nicht so viel, Thilde«, tadelte sie.
»Ach, lass sie nur«, seufzte Frederike. »Wer weiß, wie lange wir noch so gut essen können.«
Nach dem Frühstück machte sich Fritzi auf den Weg in die Schule. Frederike ging zurück in das Arbeitszimmer ihres Mannes und setzte sich an seinen Schreibtisch.
Vor acht Jahren hatte sie Gebhard Gans Edler zu Mansfeld geheiratet. Kennengelernt hatte sie ihn durch ihre beste Freundin Thea, die mit Gebhards Bruder Werner, von allen nur Skepti genannt, verheiratet war. Das Paar hatte inzwischen vier Kinder und lebte auf dem Gut Großwiesental, nicht weit entfernt von hier in der Prignitz.
Ungläubig schüttelte Frederike den Kopf. Es kam ihr wie ein Déjà-vu vor – nach Ax’s Erkrankung hatte sie, noch keine einundzwanzig Jahre alt, von jetzt auf gleich eines der größten Güter Polens führen müssen. Nur mit Hilfe ihres Stiefvaters Erik von Fennhusen hatte sie diese Klippe des Lebens gemeistert, und doch war sie froh gewesen, dass Sobotka, das große polnische Gut, nach dem Tod ihres Mannes wieder an seine Familie zurückfiel, da sie keine Kinder hatten.
Jetzt aber gab es Kinder – Kinder von ihrem geliebten zweiten Mann, Gebhard. Für diese Kinder würde sie wieder stark sein müssen, so schwer es ihr fiel. Wieder Güter leiten? Wieder Entscheidungen treffen? Frederike grauste es.
Es klopfte an der Tür, und Fräulein Berndt betrat das Arbeitszimmer. »Ich habe einige Dinge hier sortiert.«
»Sortiert?«
»Wir müssen damit rechnen, dass die Gestapo wiederkommt und das Haus durchsucht. Ich dachte, es sei besser, wenn sie einige Unterlagen nicht finden. Ich habe sie verschwinden lassen.« Sie räusperte sich. »Es gibt eine doppelte Buchführung.«
»Das hat mir Nikolaus Pirow gezeigt, bevor er gehen musste.« Auf einmal war Frederike unsagbar müde.
»Die Bücher habe ich versteckt. Keiner sollte sie finden. Vielleicht sollten wir sie verbrennen.«
»Grundgütiger, wo wird das alles nur hinführen? Es herrscht das reinste Chaos.«
»Es wird schon wieder. Irgendwann.« Fräulein Berndt setzte sich neben Frederike. »Wir müssen nur alle zusammenhalten.«
»Und wenn uns das nicht gelingt? Haben Sie einen Plan, Fräulein Berndt? Können Sie irgendwo hin, falls die Russen kommen?«
Ursa Berndt senkte den Kopf. »Ich stehe im Kontakt mit meinem Bruder in Lübeck. Dort könnte ich unterkommen.«
»Es steht Ihnen frei, ich weiß gar nicht, ob ich Sie noch weiter beschäftigen kann … ich weiß überhaupt nichts.« Ihre Stimme drohte zu ersticken, und Frederike schlug die Hände vor das Gesicht.
»So schnell schmeiße ich die Flinte nicht ins Korn, Frau Baronin.«
»Danke.«
»Aber wir müssen uns in Acht nehmen. Und wir haben ja immerhin noch die Franzosen, ohne sie wären wir verloren«, sagte Fräulein Berndt leise.
»Damit haben Sie recht.«
Schon früh nach Kriegsbeginn waren ihnen französische Kriegsgefangene als Zwangsarbeiter zugeteilt worden. Gebhard hatte die Schnitterhäuser umbauen lassen, so dass die Fremdarbeiter dort wohnen konnten. Statt der vorgeschriebenen Gitter hatte er nur Hasendraht vor die Fenster gespannt und war deshalb das erste Mal verhaftet worden. Das zweite Mal holte ihn die Gestapo, weil er die Zwangsarbeiter zu gut behandelte. Er wurde daraufhin gezwungen, in die Partei einzutreten und ein empfindliches Bußgeld an das Winterhilfswerk zu leisten. Zu den französischen Zwangsarbeitern, einige von ihnen lebten nun schon fast vier Jahre auf Mansfeld und gehörten beinahe zur Familie, waren im letzten Jahr noch russische Kriegsgefangene gekommen. Sie hausten in einer Scheune auf dem Betriebshof, der sich etwa einen Kilometer vom Gutshaus entfernt befand.
Auch bei ihnen hatte Gebhard immer versucht, mehr Gnade walten zu lassen, und hatte ihnen größere Essensrationen zugeteilt. Aber der Ortsgruppenführer aus Perleberg hatte ein strenges Auge auf die Führung der Russen, so dass Gebhard mehr und mehr die Hände gebunden gewesen waren.
Frederike würde alles zusammenhalten müssen – einmal mehr. Eine Aufgabe, die sie schaudern ließ.
»Der … der Volksempfänger«, flüsterte Fräulein Berndt nun und lehnte sich zu Frederike, »wo ist er?«
Verblüfft sah Frederike sie an. »Im Salon. Wieso?«
»Nein, nicht der. Ich weiß, dass Sie im Keller die Feindnachrichten verfolgt haben. Mit einer kleinen batteriebetriebenen Goebbelsschnauze. Ihr Mann hat es mir gesagt.«
Frederike wurde rot.
»Sie wissen, ich bin die Letzte, die Sie denunzieren würde, aber dieser Apparat, wo ist er nun?«
»Lore hat ihn verschwinden lassen«, wisperte Frederike. »Gestern schon. Bevor die Gestapo kam und meinen Mann mitnahm.«
»Gut. Er sollte auch verschwunden bleiben. Und keiner darf davon erfahren.«
»Aber wie kommen wir jetzt an zuverlässige Nachrichten? Es war der einzige Weg. Alles, was das Reich publiziert, ist doch gelogen und Propaganda.«
»Hier im Haus geht es nicht mehr«, sagte Fräulein Berndt nachdenklich. »Aber irgendwie werden wir eine Möglichkeit finden.«
»Sollte ich nicht nach Potsdam fahren? Um meinem Mann beizustehen? Was meinen Sie?«
»Nein. Ihr Platz ist jetzt hier. In Mansfeld. Die Leute brauchen Sie. Jetzt mehr denn je.«
Frederike nickte. »Sie haben recht. Mein Platz ist in Mansfeld.«
Nach dem Gespräch mit Fräulein Berndt eilte Frederike nach unten ins Souterrain, um sich mit der Köchin zu besprechen. Normalerweise kam Lore nach oben in den kleinen Salon, wo Frederike ihren Schreibtisch hatte und die Bücher führte, aber heute brauchte Frederike den Trubel der Küche, die Wärme, die Düfte und die Lautstärke, die dort immer herrschte.
»Non, non, non!«, rief Pierre. »Du darfst die Milch nicht kochen, ma chère. Sie muss nur leicht er’itzt werden, c’est compris?«
»Verflucht, Pierre, als ob wir nich hätten schon jenug Probleme«, fauchte ihn Lore an.
»Isch will nur machen guten Käsè, ma chère. Das weißt du doch.« Er stupste sie in die Seite. »Nun sei mir nischt bösè, Liebschen.«
»Böse bin ich dir nich, awwer schau einfach nacher Milch und lass mich ansonsten in Ruhe«, brummelte Lore und rührte in einem großen Topf. Dann tat sie den Deckel darauf und drehte sich um. »Ich muss jetzt nach oben zur Jnädigsten.«
»Musst du nicht«, sagte Frederike. »Ich bin hier.«
Lore wischte sich verlegen die Hände an der Schürze ab. »Jnädigste. Sie hier?«
»Kann ich eine Tasse Kaffee haben?« Frederike setzte sich in den Erker, wo der Tisch der Köchin stand, auf dem ihr Haushaltsbuch lag.
Lore sah sich um, dann nickte sie. »Ich hab noch Bohnenkaffee«, flüsterte sie. »Nicht viel. Habs aufjehoben für besondere Momente, schätze, jetzt is eener.« Sie ging zur Anrichte, wühlte in den Vorräten, nahm eine Packung heraus. Dann griff sie nach der Kaffeemühle, die auf dem Sims stand, füllte fast schon andächtig ein paar Bohnen hinein, setzte sich, presste die Mühle an ihren Busen und drehte den Hebel. Schon bald duftete es nach frisch gemahlenen Kaffeebohnen. Frederike schloss die Augen und ließ sich zurückfallen in die Erinnerungen an vergangene Jahre, als einfach alles erreichbar gewesen war.
In den zwanziger Jahren war alles möglich gewesen, und niemand hatte es in Frage gestellt – zumindest nicht in den großen Städten wie Hamburg oder Berlin. Dann würde nach und nach der Gürtel der Konventionen wieder enger geschnallt und zugezogen. Es war nicht mehr alles erwünscht gewesen und bald auch nicht mehr erlaubt.
Frederike hatte jung geheiratet, einen weitaus älteren Mann, und sie war jung Witwe geworden. Nur ganz selten hatte sie sich ausleben und ihre Jugend genießen können. Aber das vermisste sie nicht. Sie liebte ihr Leben als Gutsfrau, als Mutter, als Gefährtin eines sehr beschäftigten Mannes, auch wenn ihr manchmal die gemeinsame Zeit mit ihm fehlte.
Romantische Liebe hatte sie nur einmal erfahren, damals mit Rudolph von Hauptberge. Wenn sie jetzt daran dachte, trieb es ihr die Schamesröte in die Wangen. Aber damals hatte sie noch keine Kinder, war zwar mit Ax verheiratet, führte aber keine Ehe, weil er zu krank war.
»Is alles nich einfach für Sie«, sagte Lore und stellte ihr eine Tasse dampfenden und duftenden Kaffee hin. »Wat wird denn nu bloß?«
»Ich weiß es nicht, Lore, ich weiß es wirklich nicht.« Frederike nahm die Tasse mit beiden Händen und ließ sich ihr Gesicht von dem Dampf erwärmen. »Wir müssen aufpassen. Es wird ja immer schlimmer.«
»Der Jnädigste is immer schnell wieder aussen Jefängnis jekommen. Ei, is ja ooch nich dat erste Mal, datte ihn ham verhaftet.«
»Diesmal ist es anders. Und meine Schwiegermutter – wer verhaftet denn eine alte Frau?«
»Erbarmung, dat is ’ne schlimme Jeschichte.« Lore nickte heftig.
»Wie sieht es denn aus? Wir haben jetzt Oktober, der Winter kommt, und vielleicht wird es wieder ein kalter und bitterer Winter. Haben wir genügend Vorräte?«
Lore schaute sich um. Zwei der französischen Arbeiter waren in der Küche und halfen, ein Pole war vom Betriebshof gekommen, um Brot zu holen, und zwei Russen saßen im Gesindezimmer und warteten auf die Suppe, die sie zum Betriebshof bringen sollten. Ihre Essensration war deutlich kleiner, sie sollten fast nur Suppe und ein wenig hartes Brot bekommen. Die Lebensmittelvergabe unterlag strengen Kontrollen, nur manchmal gelang es Lore, etwas dazuzuschmuggeln – sie war durchaus einfallsreich. Dennoch ging es ihr wie allen anderen, sie konnte nicht mehr frei reden, denn man wusste nicht, wer zuhörte. Schon ein missverstandener Satz konnte eine Verhaftung nach sich ziehen. Dem Küchenpersonal vertraute sie eigentlich, den Franzosen auch. Aber trotzdem saß die Angst vor Verleumdung oder Denunziation in jedermanns Nacken, man wusste nicht mehr, wem man wirklich vertrauen konnte. Die Nationalsozialisten hatten alle Bevölkerungsschichten unterwandert. Ihre Herrschaft, ihr Gedankengut machten Angst. So manch einer verriet den Nachbarn nur aus Furcht, nicht aus Überzeugung. In Mansfeld war das bisher anders gewesen, aber die Verhaftung des Barons und seiner Mutter schien einiges in Frage zu stellen – denn sie waren verraten worden. Doch von wem?
»Erbarmung, is’n schöner Tach heute, wa?«, sagte Lore und schaute Frederike an. »Wollen wir da nich ein paar Schrittchen tun? ’n wenig zum Jemüsejarten gehen? Können uns ja den Kaffee mitnehmen.«
Frederike verstand sie sofort, nickte und stand auf. Schnell trank sie ihre Kaffeetasse leer. »Lieber heiß und drinnen«, sagte sie und lächelte.
»Wo Se recht ham, ham Se recht«, meinte Lore und tat es ihr nach. Dann gingen sie durch die Seitentür nach draußen. Vier Stufen führten in den Hof. Die Luft war klar, die Sonne schien, aber es wurde merklich kälter. Frederike zog ihre Strickjacke enger um sich, Lore hatte sich schnell das Umschlagtuch gegriffen, das immer neben der Tür hing.
Frederike atmete tief durch und sah zum blauen Himmel, ließ den Blick über die buntgefärbten Bäume wandern, alles wirkte so idyllisch, doch der Eindruck trog.
»Erbarmung, wat fürn herrliches Wetter«, sagte Lore und schnaubte. »Da werden se heute Nacht wieder fliegen, de Bomber.«
»Vermutlich.« Frederike ging mit ihr zum Hühnerstall. Sie hatten mehr Hühner, als erlaubt waren, das wusste sie jetzt. »Wir werden bestimmt noch genauer kontrolliert werden«, seufzte sie. »Und wir dürfen keinen Anlass zur Beanstandung geben. Gar keinen.«
»Weeß ich ooch«, sagte die Köchin. »Wird die Hiehner heute noch zählen und verteelen. Jibt jenuch Möglichkeeten, se unterzubringen. Praktisch isses nich, awwer wat will man machen?« Sie blieb stehen. »Wie jeht es weiter mitte Jüter?«
»Das weiß ich noch nicht.«
»Erbarmung, Jnädigste. Ham Se jeführt Sobotka aleene, und das hat jeklappt jut. Werden Se ooch hier schaffen. Un janz sicher wird der Jnädigste wiederkommen bald.«
»Ich hoffe es so sehr. Worauf müssen wir noch achten?«
»Ei, Kühje, Schafe, allet – wir ham falsche Zahlen. Awwer meen Kloot un de Pierr werden dat schon richten, hab se schon informiert.« Lore kniff ein Auge zu. »Dat sind Männers, kannste dich droof verlassen, wa?«
»Es sind unsere Feinde …«
»Nee, Jnädigste, dat sind se nich, nich unsere Franzosen. Die sind jejen Hitler, und wir sind es ooch. Ei, dat wissen die jenau. Und der Jnädigste hat sich immer einjesetzt für seene Leute, wa? Hat dafür jesorcht, dat se leben konnten inne Jefangenschaft, wa? Dat verjessen die nich so schnell, wa?«
Frederike nickte. Ein Wagen kam die Straße entlang, und sie hob den Kopf. Sollte Gebhard vielleicht wirklich schon wieder entlassen worden sein? War das alles ein großes Missverständnis gewesen? Sie hoffte es so sehr. Das Automobil fuhr auf den Hof und hielt vor dem Haus.
»Ei, wer mach dat jetzt seen?«, fragte Lore.
Frederike antwortete nicht, sondern lief um die Hausecke. Dort blieb sie stehen. Es war nicht Gebhard, der aus dem Wagen stieg, sondern Hegemann, der Ortsgruppenführer aus Perleberg, und Hittlopp, der Vorarbeiter, den der Reichsnährstand eingesetzt hatte und mit dem Gebhard noch nie klargekommen war. Hittlopp war ein Nationalsozialist der ersten Stunde. Immer wieder quälte er die Zwangsarbeiter und hatte sichtlich Freude daran. Angeekelt verzog Frederike das Gesicht.
»Was will der denn hier?«, murmelte sie. Am liebsten wäre sie wieder zurück in den Hof gegangen, aber sie war die Gutsbesitzerin und musste Gebhard nun vertreten.
»Guten Morgen«, begrüßte sie die beiden Männer, die sich gerade anschickten, die Treppe zur Haustür hochzusteigen.
»Heil Hitler«, rief Hittlopp stramm, und auch der Ortsgruppenführer hob den rechten Arm.
»Kann ich Ihnen weiterhelfen?«, fragte Frederike.
»Wir brauchen die Gutsbücher«, sagte Hegemann und grinste böse.
»Wozu?«
»Der Reichsnährstand hat mich als Verwalter eingesetzt«, sagte nun Hittlopp. »Ich führe ab jetzt das Gut, und deshalb brauche ich die Bücher.«
»Was?« Frederike konnte es kaum glauben.
Wortlos zog der Ortsgruppenführer ein Schreiben aus der Tasche und reichte es ihr.
»Ihr Mann und Ihre Schwiegermutter sind wegen staatsfeindlicher Einstellung angeklagt, deshalb wird Ihrem Mann die Führung des Gutes entzogen. Wir halten Herrn Hittlopp für sehr geeignet, die Verwaltung von Mansfeld und Kleinwiesental zu übernehmen, schließlich ist er seit Jahren hier Vorarbeiter, kennt die Güter und ist ein treuer Parteigenosse.«
Frederike nahm das Schreiben entgegen. Dort stand es schwarz auf weiß.
»Ich kann das Gut leiten«, wandte sie ein, aber der Ortsgruppenführer warf ihr nur einen mitleidigen Blick zu.
»Auch wenn wir im Osten wichtige Anbaugebiete erobert haben, ist doch die heimische Landwirtschaft fast ebenso wichtig wie die Industrie. Deshalb müssen wir in sensiblen Situationen schnell reagieren. Sie wissen, was Ihrem Mann vorgeworfen wird. Und wahrscheinlich haben Sie sich auch daran beteiligt, Baronin. Deshalb sollten Sie lieber die Füße ruhig halten und Hittlopp alle Unterlagen geben. Sie haben doch kleine Kinder, nicht wahr? Und Sie wollen doch sicherlich nicht auch unter Verdacht geraten?«, fragte er hämisch.
»Auch wenn meinem Mann etwas vorgeworfen wurde, ist das noch lange kein Beweis, dass er und seine Mutter diese Taten wirklich begangen haben«, antwortete Frederike und streckte das Kinn vor. »Noch ist er nicht verurteilt, oder?« Sie ging die Treppe nach oben und öffnete die Haustür. »Aber natürlich werde ich mich den Anweisungen nicht widersetzen.« An der Tür drehte sie sich um, die beiden Männer waren ihr gefolgt. »Bitte warten Sie«, sagte Frederike und schloss die Tür vor ihren Nasen. In das Haus würde sie diese unerträglichen Männer ganz sicher nicht bitten. Sie lehnte sich mit dem Rücken gegen die Tür, schaute die Diele entlang und holte tief Luft. Lore war, als sie die beiden Männer erkannt hatte, schnell zurück zum Hintereingang gelaufen. Viel gab es nicht, was sie jetzt noch tun konnten.
Frederike ging in Gebhards Arbeitszimmer und griff nach dem offiziellen Gutsbuch. Wieder war sie froh, dass Fräulein Berndt so umsichtig gehandelt hatte.
Langsam ging Frederike zurück zum Eingang, öffnete die Tür und reichte Hittlopp das dicke Buch.
»Ich hoffe«, sagte sie, »Sie gehen behutsam damit um, damit es mein Mann unversehrt wieder in Empfang nehmen kann.«
Hittlopp lachte auf. »Na, das werden wir ja sehen. Im Moment glaube ich nicht daran, dass der Baron schnell wieder zurückkommen wird.« Er nickte ihr zu, drehte sich um und ging die Treppe nach unten.
»Wie wird es jetzt ablaufen?«, fragte Frederike. »Was ist mit den Franzosen? Und was ist mit uns?«
Hittlopp sah sie an. »Ich werde mir die Bücher anschauen. Morgen komme ich wieder, dann besprechen wir alles Nötige. Aber Sie können dessen gewiss sein, dass von nun an eine andere Musik gespielt wird«, sagte er.
Frederike blieb im Eingang stehen, bis der Wagen den Hof verlassen hatte. Erst dann schloss sie die Tür und ging in den kleinen Salon. Sie setzte sich an den Kamin und bedeckte ihr Gesicht mit den Händen. Was sollte sie nun tun? Hittlopp würde alles vernichten, was Gebhard wichtig gewesen war. Dem Vorarbeiter lag nicht das Gut am Herzen, ihm ging es nur um Macht – und nun besaß er viel Macht. Auch die über ihr Leben und das der Kinder.
Das Telefon im Flur klingelte, ein hässliches, drohendes Klingeln. Die letzten Male hatte es nur unheilvolle Nachrichten überbracht. Seufzend stand Frederike auf, ging in den Flur und nahm ab.
»Freddy?« Es war Thea, ihre Schwägerin. Ihre Stimme klang nervös. »Bist du zu Hause? Wir müssen reden«, flüsterte Thea. »Ich komme vorbei.«
Man konnte sich nie sicher sein, wer alles die Telefongespräche mithörte.
»Hast du Neuigkeiten?«
»Ich komme jetzt, Freddy.«
»Du machst mir Angst.«
»Ich habe nichts aus Potsdam gehört«, sagte Thea. »Keine Nachrichten sind manchmal gute Nachrichten. Bis gleich.«
Eine Stunde später fuhr Thea auf den Burghof der zu Mansfelds. Sie bremste so abrupt, dass der Kies in alle Richtungen flog.
Bange hatte Frederike auf die Ankunft ihrer Schwägerin gewartet, sie lief die Treppe hinunter, sobald der Wagen stand. Thea war ihre Jugendfreundin, sie kannten sich schon aus dem Sandkasten in Potsdam, wo sie beide aufgewachsen waren. Schon ihre Mütter waren Busenfreundinnen gewesen. Und ohne Thea hätte sie Gebhard nie kennen- und lieben gelernt. Thea, die früher das Nachtleben in Berlin unsicher gemacht hatte, war nun fast zu einer Matrone geworden. Sie hatte inzwischen vier Kinder und schien immer steifer zu werden, nicht nur, was die Gegebenheiten anging.
»Thea!« Herzlich umarmte Frederike sie. »Komm hinein.« Sie führte sie zur Eingangstür, blieb dann stehen, fasste Thea an den Schultern und sah sie an. »Wie schrecklich ist das, was du mir mitteilen willst? Ich fürchte Arges.«
»Hab dich nicht so, Freddy«, sagte Thea und lachte auf. »Es geht um Strategien und Kontakte. Weder mein Mann noch deiner sind bisher gestorben.«
Erleichtert seufzte Frederike auf. »Weshalb bist du hier?«
»Skepti ist in Gefangenschaft in Italien, wie du weißt«, sagte Thea und ging in den großen Salon. Vor der Bar blieb sie stehen, überlegte. »Habt ihr Eis? Bitter Lemon?«
»Es ist noch keine zwölf«, sagte Frederike entsetzt.
»Na und? Vielleicht haben wir nur noch wenige Tage, an denen wir das Glockengeläut um zwölf erleben werden.« Sie sah Frederike an und lachte bitter auf. »Ich bin am Rande meiner Nerven, liebste Freddy. Natürlich trinke ich nicht jeden Tag Alkohol um diese Zeit. Eigentlich trinke ich überhaupt nicht mehr. Wann auch und wozu?« Sie schüttelte den Kopf.
Frederike betätigte die Klingel, und schon bald stand Ilse im Salon. »Wir möchten Gin-Fizz. Beide«, sagte sie.
»Um diese Zeit? Wirklich?«, fragte Ilse nach.
»An manchen Tagen muss man Dinge machen, die nicht nach dem Kalender oder der Uhrzeit gehen. Heute ist so ein Tag, Ilse.« Frederike klang entschieden. Sie wartete, bis das Mädchen den Raum verlassen hatte. »Warum bist du hier?«, fragte sie dann ihre Schwägerin. »Ist etwas mit Skepti?«
»Ihm geht es gut«, seufzte Thea. »Soweit ich weiß. Viel darf er ja nicht schreiben, aber ich bekomme jede Woche eine Postkarte von ihm über das Rote Kreuz.«
»Immerhin«, sagte Frederike. »Aber … warum bist du dann hier?«
Es klopfte, und Ilse brachte Gläser mit zerstoßenem Eis, Zitronensaft, aufgefüllt mit Soda. Nur der Gin fehlte noch. Frederike nahm die Flasche aus der Anrichte. »Danke, Ilse«, sagte sie und wartete, bis das Mädchen hinausgegangen war. Dann füllte Frederike die Gläser auf. »Cheers.«
»Ja«, sagte Thea und nahm einen großen Schluck. »Prost.«
»Weshalb bist du hier?«
»Ich habe Kontakt zu Graf Gustrow. Kennst du ihn?«
»Nein, Thea.«
Thea trank noch einen Schluck. »Er kann uns vielleicht helfen«, sagte sie und kicherte leise.
»Helfen? Inwiefern?«
»Er ist ein Nazi durch und durch.« Thea räusperte sich. »Aber er ist auch nicht die hellste Kerze am Weihnachtsbaum, wenn du verstehst, was ich meine?«
»Nein, ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. Komm auf den Punkt, Thea.«
»Er ist ein begeisterter Jäger. Und ein Goldfasan.« Thea sah Frederike an. »Ein echter Goldfasan, Freddy.«
»Ein was?«
»Grundgütiger, du kannst doch nicht wirklich so provinziell sein, wie du immer tust?«
»Ich versteh das nicht«, sagte Frederike ehrlich.
»Gute Güte, Goldfasan nennt man einen dieser Ordensträger, die aber von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Sie haben Geld und spenden dies der Partei, der einzigen Partei, die es heute noch gibt.« Thea zog eine silberne Schatulle aus ihrer Tasche, nahm eine Zigarette heraus, bot sie Frederike an. »Willst du?«
Frederike schüttelte nur stumm mit dem Kopf.
Thea zündete die Zigarette an und inhalierte tief. »Wir haben Vierzehnender im Gehölz, unser Jäger schwört, wir hätten auch noch Trappen. Trappen sind selten geworden. Wild haben wir aber reichlich. Skepti hat es in den letzten Jahren anfüttern lassen, es steht gut im Wald, und damit kann ich den Goldfasan bezirzen.«
»Bitte was?«, fragte Frederike verwirrt.
»Nun tu nicht so doof. Man muss die Nazis bestechen. Das weiß ich, und du weißt es auch. Und mit Graf Gustrow haben wir ein hochrangiges Parteimitglied an der Hand, das uns helfen kann. Ich werde ihn zur Jagd einladen, ich werde ihm eine Trappe zum Schuss anbieten und auch das Rotwild.«
»Und dann?«
»Freddy! Grundgütiger, du weißt doch, was wir wollen, oder nicht? Wir beide haben zu Mansfelds geheiratet. Skepti ist in Gefangenschaft in Italien, Gebhard und Heide sind in Potsdam inhaftiert. Der Reichsnährstand übernimmt unsere Güter. Wir müssen schauen, dass wir zumindest Heide aus der Haft holen. Und dabei wird uns der Graf helfen.«
»Was wird werden, Thea?«
Thea seufzte. »Wir können nur hoffen, dass die Alliierten diesen Krieg schnell beenden. Und dann sollten wir hoffen, dass die Amerikaner hierherkommen und nicht die Russen. Vor denen habe ich nämlich richtig Angst.«
»Nicht nur du«, gestand Frederike. »Nun gut«, sagte sie dann. »Falls du diesen Goldfasan wirklich dazu bekommst, etwas für Heide und Gebhard zu tun, dann wäre das einfach wundervoll. Hittlopp, der neue Verwalter, wird hier schrecklich wüten. Er wurde uns als Vorarbeiter zugeteilt und hat sich nie mit Gebhard verstanden. Und jetzt wird er sich rächen, vor allen an den Fremdarbeitern. Er hat sich immer schon darüber moniert, dass wir sie zu gut behandeln.«
»Wir können nicht die ganze Welt retten«, sagte Thea und trank ihren Drink aus. Dann stand sie auf. »Wenn ich etwas Positives erfahre, rufe ich dich an und sage: ›Wir haben eine Trappe gesehen.‹ Man weiß ja nie, wer so mithört am Telefon.«
»Und was sagst du, wenn es negative Nachrichten gibt?«
»Die Trappe ist tot.«
Die beiden Frauen sahen sich an.
»Ich hoffe, ich werde diesen Satz nie von dir hören müssen.« Frederike umarmte Thea zum Abschied fest. Endlich spürte sie die alte Verbindung zu ihrer Freundin wieder, die in den letzten Jahren ein wenig verlorengegangen war.
Kapitel 2
Die Herbsttage wurden lang, obwohl das Licht immer mehr abnahm. Der Wind heulte im Hof, riss die Blätter von den Bäumen, spielte mit ihnen Fangen. Nicht nur die Temperaturen sanken, das ganze Klima auf dem Hof verschlechterte sich. Hittlopp ging grob mit den Fremdarbeitern um, und Frederike war nicht in der Lage, irgendetwas dagegen zu tun. Er kontrollierte die Gutsküche, den Bestand und die Arbeiten. Herzlos und mit Gewalt ging er vor, es war schier unerträglich.
Lore konnte immer noch manchmal heimlich Lebensmittel für die Fremdarbeiter zur Seite schaffen, aber es waren nur kleine Mengen und der Aufwand ungleich höher als früher. Außerdem saß ihnen allen die ständige Angst vor Hittlopps Spionen im Nacken.
Anfang November entschied sich Frederike, nach Potsdam zu fahren. Trotz der vergleichsweise kurzen Strecke ein schwieriges Unterfangen, da die Bombenangriffe zunahmen und auf den Zugstrecken das Militär immer Vorrang hatte. Auch die Fahrt selbst war äußerst beschwerlich – die Züge waren voll und hielten oft ohne einen ersichtlichen Grund. Frederike hielt die Teppichtasche und den Korb, den ihr Lore gepackt hatte, eng umklammert. In einfachen Leinentaschen hatte sie warme Kleidung für ihre Schwiegermutter und für ihren Mann eingepackt: Wollsocken, wollene Unterwäsche und Leibchen, dicke Schwubber – wie man nun die Pullover nennen musste, da ausländische Begriffe verboten waren. Sie hatte zwei Tweedhosen für Gebhard dabei und eine Hose und zwei Röcke für Heide. In die dickeren Sachen hatten sie und Lore Schokolade und Speck eingenäht. Außerdem hatte sie Zigaretten versteckt.
Im Korb befand sich nicht nur ein Reiseessenspaket, sondern auch diverse andere Lebensmittel – geräucherter Speck, Fisch, eingemachte Wurst, Butter und mancherlei mehr. Frederike war bewusst, dass sie wahrscheinlich kaum etwas davon bis zu ihren Lieben bringen würde, aber vielleicht könnte sie damit den einen oder anderen Weg ebnen.
Die Fahrt nach Berlin hatte früher nur vier Stunden gedauert, nun war sie aber schon über sechs Stunden unterwegs. Der Zug war voll, eine Menge Menschen waren jetzt nach der Ernte aufs Land gefahren, um die Äcker abzusuchen. Das war natürlich verboten, aber darum scherte man sich nicht. Die Gesichter der Mitreisenden um sie herum waren grau und eingefallen, ihre Augen ohne Hoffnung. Je näher sie Berlin kamen, desto entsetzter wurde Frederike. Natürlich hatten sie in der Prignitz immer wieder Fliegeralarm, aber selten ging eine Bombe in der Provinz nieder. Perleberg war betroffen gewesen, genauso wie Wittenberge. Aber es war nur zu vereinzelten Abwürfen gekommen. Doch nun sah sie das Ausmaß der Zerstörung. Alles war grau und staubig, von den meisten Häusern standen nur noch Ruinen, und es wurde immer schlimmer, je näher sie der Innenstadt kamen. Zu ihrer Überraschung stand der Bahnhof noch. Sie musste hier umsteigen, um nach Potsdam zu kommen, doch die Auskünfte waren spärlich und nicht zuverlässig. Schließlich fand sie jemanden von der Reichsbahn, der ihr versicherte, dass der Zug nach Potsdam in einer Stunde fahren würde. Kurz trat sie vor den Bahnhof und konnte ihren Augen kaum trauen. Die meisten Häuser lagen in Trümmern, aber die Straßen waren frei. Trupps von Fremdarbeitern räumten den zum Teil noch qualmenden Schutt beiseite.
»Dit machen se jeden Tach«, sagte eine Frau, die mit ihr nach der Verbindung nach Potsdam gefragt hatte. »Icke frach mich, warum se dit tun? Die Bomber kommen ja eh wieder.«
»Damit die Straßen frei sind«, murmelte Frederike. »Für den Führer.«
»Jaja, der Führer«, sagte die Frau abschätzig. »Als ob der noch auffe Straße jehn würde. Uns Kleene machen se kaputt, die Stadt is zerstört – aber Heel Hitler. Nee, danke.« Sie spuckte aus. Dann musterte sie Frederike. »Sind nich von hier, wa?«
»Ich komme aus der Prignitz und will nach Potsdam«, sagte Frederike unsicher. Sie kannte die Frau nicht, und ihre Provokationen könnten auch eine Falle sein.
»Prignitz? Uffm Land?« Die Frau schielte nach Frederikes Korb. »Da habt ihrt jut, wa? Jibt immer noch jenuch zu essen und keene Bomben.«
»Sie wollen auch nach Potsdam?«, versuchte Frederike das Gespräch so harmlos wie möglich fortzusetzen.
»Jau. Meen Mann is dort in ’nem Jefängnis. Die Schweine haben ihn einfach abjeholt. Dabei hatter nüscht jemacht, außer wat er imma macht.« Sie lachte bitter auf. »Hab ihm immer schon jesacht, dass er uffpassen muss. Aber bald isses ja ejal. Bald is der Krieg vorbei. Zeit wird’s ooch.«
»Ihr Mann wurde verhaftet? Weshalb denn?«
Nun musterte die Frau sie nachdenklich von oben bis unten. »Na, weeß nich, ob Sie dit wat anjeht? Wat wollen Se denn in Potsdam?«
»Mein Mann und meine Schwiegermutter wurden auch inhaftiert«, gestand Frederike, unsicher, ob sie einen Fehler machte. Sie schaute sich um. In der Bahnhofshalle standen noch einige Bänke. »Sollen wir reingehen und uns hinsetzen?«
»Warum nich? Jemütlicher wird es hier draußen ooch nich.«
Sie fanden ein Plätzchen in der Hektik der Bahnhofshalle, und Frederike holte ein in Papier eingeschlagenes Paket aus dem Korb. Sie wickelte das Papier ab, legte es zurück in den Korb und reichte der Frau ein Butterbrot, das dick mit Speck belegt war.
Die Frau sah sie mit großen Augen an. »Is dit für mich? Ick gloobs nich.« Hastig nahm sie das Brot, biss hinein, kaute.
»Sie hungern«, sagte Frederike entsetzt.
Die Frau nickte nur, biss wieder in das Brot, verschlang es geradezu. Frederike nahm auch einen Bissen, doch das Brot schien ihr fast im Halse stecken zu bleiben. Sie hatte zwar gewusst, dass die Städte bombardiert wurden und dass es den Leuten schlechtging, aber die Realität übertraf ihre schlimmsten Vorstellungen. Nach dem zweiten Bissen gab sie der Frau ihre Hälfte. »Nehmen Sie«, sagte Frederike. »Sie haben es nötiger als ich. Ich wusste nicht, wie es hier ist.«
»Na, da müssen Se schon janz weit inne Provinz wohnen.« Es dauerte nicht lange, da war auch das zweite Brot verschwunden. »Dit warn mal jute Stullen«, sagte die Frau zufrieden und leckte sich über die Lippen.
»Wo wohnen Sie denn?«
»Wir sind ausjebombt. Ick schlaf mal hier, mal da. Wie et eben so kommt.«
»Gibt es denn keine Notunterkünfte?«, fragte Frederike entsetzt.
»Na klar jibts die. Aber vor den Bomben sind die ooch nich sicher.« Die Frau schaute auf die Bahnhofsuhr. »Ach du meine Jüte. Gleich kommt der Zug, wir müssen zum Gleis.« Sie packte ihre Sachen und eilte los, ohne sich noch nach Frederike umzuschauen, und schon bald hatte Frederike sie aus den Augen verloren.
* * *
Der Zug nach Potsdam war gerammelt voll, und Frederike war froh, überhaupt noch hineinzukommen. In Potsdam auf dem Bahnhof hielt sie Ausschau nach der Frau, entdeckte sie aber nicht mehr. Frederike zog die Jacke enger um die Schultern und das Kopftuch tief in die Stirn und machte sich auf zur Lindenstraße, wo das Gestapogefängnis war.
Vor dem rotverklinkerten Gebäude blieb sie stehen. Sie war nicht die Einzige, die um Einlass bat. Eine ganze Schlange Frauen, mehr alte als junge, hatte sich davor versammelt. Das barocke Stadtpalais wirkte imposant, gar nicht wie ein Gefängnis, sondern eher wie ein großes Wohnhaus mit zugehörigen Stallungen.
Eine zahnlose alte Frau, die vor Frederike in der Reihe stand, wandte sich zu ihr um.
»Erste Mal hier?«, fragte sie.
Frederike nickte nur.
»Hab ich an deinem Blick jesehen. Is’n schönes Haus, wa?« Die Alte kicherte, und Frederike wurde bewusst, dass das vermeintliche Mütterlein nicht viel älter als sie sein mochte.
»Sie waren schon öfter hier?«, fragte Frederike verzagt.
»Ja, seit mein Willie verhaftet wurde. Is mittlerweile schon een Jahr her, man mach et kaum jlauben«, murmelte die Frau und schüttelte den Kopf.
»Und … und Sie können Ihren Willie sehen? Mit ihm sprechen?«, fragte Frederike hoffnungsfroh.
»Nee. Meistens nich.« Die Frau lachte bitter auf. »Zweemal durfte ich zu ihm, aber sonst jeb ick nur Sachen ab.«
»Sachen? Hoffnung?«
Die Frau musterte Frederike. »Zu wem willste denn?«
»Zu meiner Schwiegermutter und meinem Mann …«
»Haste ’ne Besuchserlaubnis?«
Wieder nickte Frederike.
»Heeßt nüscht. Hatte ick ooch so oft, aber sehen durfte ick meinen Willie trotzdem nich.« Sie zuckte mit den Schultern. »Hab die Sachen abjejeben. Essen, Kleidung und so. Hatter sicher nich bekommen, außer, vielleicht hamse ihn besser behandelt.«
»Aber … aber ich dachte, wenn man eine Besuchserlaubnis hat …«, sagte Frederike hilflos.
»Was biste naiv«, lachte die Frau. »Als ob die jemals Versprechen einhalten würden.«
Frederike schluckte. Sie dachte an die Briefe, die sie mit sich führte, an das Schreiben von Graf Gustrow, das Schreiben des Bürgermeisters von Mansfeld und noch andere Dokumente, die Gebhard und Heide ihre Loyalität bestätigen sollten. War das alles umsonst? Thea hatte den Goldfasan von hinten bis vorne betört. Er hatte eine der letzten Trappen geschossen, war glückselig wieder abgereist und hatte versprochen, Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, damit wenigstens Heide freikäme. Und nun? Sollten dies alles leere Versprechungen gewesen sein?
»Nu mach nich ’n Jesicht wie sieben Tage Regenwetter«, sagte die Frau und stieß sie in die Seite. »Ich bin die Gisela, und du?«
»Freddy«, brachte Frederike hervor.
»Bist nich von hier, wa?«, fragte sie wieder.
»Aus der Prignitz.«
»Da isses noch friedlich, wa?«
»Nun ja, wie man es nimmt«, stammelte Frederike. »Einfach ist es nicht, aber Bomben … nein, Bomben so wie in Berlin …« Sie stockte.
»Na, aber Probleme haben wir, ejal wo wir wohnen?« Wieder drückte die Frau Frederikes Arm. »Wat haste denn im Korb? Wat zu essen?« Plötzlich klang sie gierig.
»Das ist für meinen Mann«, sagte Frederike und hob den Korb, der an ihren Füßen gestanden hatte, hoch und drückte ihn an sich.
»Ob er dat zu sehen kriecht?« Der Blick wurde gieriger.
Frederike schaute sich um. Bisher standen sie immer noch in einer langen Reihe. Es ging nur langsam vorwärts. Verstohlen sah sie in die Gesichter der Wartenden. Die meisten hatten die Augen geschlossen oder starrten dumpf zu Boden. Hier und dort gab es Gespräche zwischen den Wartenden, immer leise, fast zischelnd, so als würde man Geheimnisse austauschen. Aber das war es nicht – das Gegenteil war der Fall. Man mochte dem Feind nichts offenbaren, und hier war der Feind die Obrigkeit. In diesem Gefängnis saßen Männer und Frauen, die gegen die Gesetze der Nazis verstoßen hatten – manchmal hatten sie noch nicht einmal gegen Gesetze verstoßen, sondern hatten nur eine andere Meinung als die Machthabenden. Heide und Gebhard hatten gegen die Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen verstoßen, sie hatten Feindsender gehört. So wie Frederike auch.
Und bestimmt, dachte sie, während sie den Blick über die lange Reihe schweifen ließ, wie die meisten anderen hier. Wer die Gelegenheit hatte, hörte Feindsender – und sei es nur, um zu wissen, ob Bomber kamen.
Die Parole, die alle paar Stunden über die Goebbelsschnauze verkündet wurde: »Das Reichsgebiet ist feindfrei«, war so falsch wie alle anderen Behauptungen von ganz oben.
Frederike holte tief Luft, griff dann in den Korb und holte ein Butterbrot, dick mit Speck belegt und in Papier gewickelt, heraus.
»Hier, Gisela«, flüsterte sie und gab der Frau das Brot. Diese ließ es geschwind in ihrer Jackentasche verschwinden.
»Willst du es … nicht essen?«, stotterte Frederike verwundert.
»Doch. Aber sicher nich hier. Dann wolln alle wat. Danke, Kleene, ick weeß dat zu schätzen, wirklich.« Sie zwinkerte Frederike zu. »Musste doof tun, gleich, wenn wir zu de Wachen kommen. Musst so tun, als hätteste keenen Zweifel, dassde deinen Mann siehst. Mach einfach auf blöd.«
»Danke.«
»Na ja, noch haste nichts zu danken.«
Langsam ging es voran. Manche Frau wurde schnell eingelassen, das konnte Frederike erkennen, bei anderen dauerte es länger. Einige wurden in einen Nebenraum geführt, weshalb, wusste sie nicht. Sie suchte die Frau, die sie in Berlin am Bahnhof getroffen hatte, aber sie sah sie nicht.
»Was ist in der Stube, wo sie manche hinführen?«, wisperte Frederike Gisela zu.
»Na, da is ’n Verhörzimmer.« Gisela zog die Nase hoch.
»Was passiert da drin?«
»Dit willste jar nich wissen.«
Frederike schluckte, das Herz schlug ihr bis zum Hals, und ihr Mund war staubtrocken. Im Gänsemarsch ging es weiter. Schließlich war Gisela dran und zeigte ihren Besucherschein vor. Sie wurde durchgewunken. Schnell drehte sie sich zu Frederike um. »Viel Jlück und danke.«
Nun war Frederike an der Reihe. Der uniformierte Wachmann sah Frederike streng an.
»Schein?«
»Ja, Moment.« Obwohl Frederike das Schreiben schon vor einiger Zeit herausgenommen hatte, war sie nun so nervös, dass es ihr schwerfiel, es vorzulegen.
»Mach hinne, Frau«, herrschte der Mann sie an. Er trug die hellgrüne Uniform der Stapo, der Staatspolizei, sein Blick war streng, und er wirkte enerviert.
»Hier, bitte.« Frederike zog das Schreiben aus dem Korb. »Ich habe hier auch noch ein Schreiben …«
»Moment.« Langsam öffnete der Mann das Kuvert, nahm das zusammengefaltete Blatt heraus und las es. Dann sah er Frederike an, schaute wieder auf das Schreiben. »Sie sind die Baronin Mansfeld?«
Frederike nickte.
»Ich habe nichts gehört«, schnauzte er. »Was haben Sie gesagt?«
»Ja, ich bin Frederike zu Mansfeld«, sagte Frederike.
»Und zu wem wollen Sie?«
»Zu meinem Mann, Gebhard zu Mansfeld, und zu meiner Schwiegermutter, Adelheid zu Mansfeld.«
»Lauter Adlige?« Er lachte. »Na, Dreckspack seid ihr, trotz eurer Namen. Habt den Führer verraten.«
»Nein, das haben wir nicht.« Nun hob Frederike das Kinn. Es war unverschämt, wie dieser Mann sie behandelte, und sie würde sich das nicht gefallen lassen.
»Dorthin«, sagte er und lachte höhnisch, zeigte auf die kleine Stube neben dem Eingang.
»Warum?«
»Fragen? Sie stellen Fragen? Das ist ja unerhört. Wollen Sie etwas von uns? Oder wir von Ihnen, gnädige Frau?« Die letzten beiden Worte spuckte er aus, sein Speichel benetzte Frederikes Gesicht. Sie zwang sich, ihn nicht abzuwischen und seinem Blick standzuhalten.
»Nun gut.« Frederike nahm all ihren Mut zusammen und ging in den angrenzenden Raum. Dort stand ein Schreibtisch, hinter dem ein ranghöherer Stapo saß. Er nahm das Schreiben entgegen, nickte seinem Kollegen zu, der dann den Raum verließ.
Der Offizier ließ sich Zeit, das Schreiben zu lesen, musterte dann Frederike ausgiebig.
»Baronin Mansfeld?«
»Ja!« Diesmal sagte sie es laut und deutlich. »Ich habe die Erlaubnis, meine Schwiegermutter und meinen Mann zu besuchen.«
»Das steht hier, richtig«, sagte der Stapo-Hauptmann. Er lächelte. »Möchten Sie sich setzen?«
»Ich möchte meine Angehörigen sehen«, entgegnete Frederike.
»Nun, so einfach ist das nicht. Sie gehören zum Adel, und Sie wissen … Ihr Mann und Ihre Schwiegermutter sind ja nicht einfach so verurteilt worden.«
»Es steht doch in dem Schreiben«, sagte Frederike. »Sie sind angeklagt, gegen die Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen verstoßen zu haben. Beweise dafür gibt es nicht, nur Denunziationen. Es gab auch, soweit ich weiß, noch keine Gerichtsverhandlung und dementsprechend kein Urteil.«
»Hm.« Nachdenklich drehte sich der Hauptmann um und öffnete den Aktenschrank, der hinter ihm stand. Es dauerte eine Weile, dann zog er zwei Aktendeckel hervor, legte sie auf den Schreibtisch und öffnete sie. Dann las er. Zwischendurch schaute er auf, lächelte Frederike an. »Möchten Sie sich nicht doch setzen? Es kostet nichts.«
Frederike seufzte und nahm auf der Stuhlkante Platz. Sie fühlte sich zermürbt, und die Angst saß immer noch wie ein großer Klumpen in ihrem Magen. Der Hauptmann war freundlich, aber waren das nicht die Schlimmsten? Die, die sich zuerst nett gaben und nachher umso unbarmherziger wurden? Trauen konnte man niemandem, egal wie er sich benahm. Was wusste man schon vom anderen?
Schließlich sah der Hauptmann in seiner blassgrünen Uniform mit den diversen Abzeichen, die Frederike nicht kannte, sie an.
»Baronin Mansfeld, ich fürchte, ich kann Ihrem Ersuchen nicht stattgeben«, sagte er und lehnte sich zurück.
»Es ist kein Ersuchen«, konterte Frederike. »Es ist eine Besuchserlaubnis. Und ich habe noch mehr.« Nun holte sie die anderen Schreiben hervor. Zuerst das von dem Goldfasan. Sie legte die Briefe fächerförmig auf den Schreibtisch, so als würden sie Karten spielen.
Der Hauptmann sah die Schreiben an, strich sich über das Kinn, schaute zu Frederike.
»Ich bin mir sicher, das sind alles gutgläubige Bescheinigungen, wie rechtschaffen Ihre Angehörigen doch sind. Allerdings habe ich nicht darüber zu urteilen. Ich kann die Schreiben gerne an das Gericht weiterleiten, aber hier … hier hilft Ihnen das nicht.«
»Bitte«, sagte Frederike, und nun brach ihre Stimme. »Lesen Sie wenigstens dies.« Sie reichte ihm das Schreiben von Graf Gustrow.
Nur zögernd nahm der Hauptmann den Brief aus dem dicken, handgeschöpften Papier, öffnete und las ihn. Dann biss er sich auf die Lippe, nickte.
»Nun gut. Ich muss das mit meinem Vorgesetzten besprechen. Kommen Sie morgen wieder.«
»Aber … aber … Nein!«, widersprach Frederike. »Ich bin heute hier. Ich komme aus der Prignitz, ich kann nicht mal eben so nach Potsdam fahren. Sie wissen doch, wie es ist … die Verbindungen sind bescheiden. Ich weiß noch nicht mal, ob ich heute nach Hause zurückkomme, geschweige denn, ob …«
»Es tut mir leid. Ich kann das nicht selbst entscheiden. Die Lage ist angespannt und der Name Ihrer Familie kein unbeschriebenes Blatt. Sie haben einen Schwager …«
»Caspar«, hauchte Frederike entsetzt.
Der Hauptmann nickte. »Ihr Schwager war in einige Verschwörungen verstrickt, er ist zum Tode verurteilt – in Abwesenheit.« Er kniff die Augen zusammen. »Wissen Sie, wo er ist?«
Frederike schüttelte den Kopf. Das letzte Mal hatten sie vor einem Jahr von Caspar gehört, da war er auf Jamaika.
»Aber was Caspar gemacht hat – das ist doch schon Jahre her, und was hat das mit uns zu tun?«
»Baronin, es liegt nicht an mir, darüber zu urteilen. Deshalb muss ich mit meinem Vorgesetzten sprechen.« Der Hauptmann hob den Brief hoch, wedelte damit. »Was ein Graf Gustrow schreibt, wiegt natürlich einiges.«
»Dann darf ich meinen Mann sehen?«
»Nein. Ihr Mann ist gar nicht hier. Er wurde verlegt.«
»Was?«
Der Hauptmann nahm noch mal eine Akte hervor, las darin, schloss sie dann wieder. »Er wurde verlegt. In das Gefängnis in der Priesterstraße.«
»Warum?«
»Das kann ich Ihnen nicht sagen.«
»Weil Sie es nicht wissen?«
Er lächelte süffisant.
»Weil Sie es nicht wollen«, stellte Frederike resigniert fest.
»Es ist eine geschlossene Akte. Sie können sich einen Anwalt nehmen und Akteneinsicht verlangen.«
»Wir haben einen Anwalt.«
»Nun, er hat bisher keine Akteneinsicht für Angehörige beantragt. Vermutlich, weil er weiß, dass dem fast nie stattgegeben wird.«
»Und meine Schwiegermutter?«
»Das kläre ich. Kommen Sie morgen wieder.«
»Wo ist das Gefängnis, wo mein Mann ist?«
Der Hauptmann schüttelte den Kopf. »Sparen Sie sich die Suche, Sie werden ihn nicht sehen können. Er liegt dort auf der Krankenstation.«
»Oh!« Frederike sank in sich zusammen. »Warum?«
Der Hauptmann zuckte mit den Schultern. »Ein Infekt.«
Sie wollte nachfragen, sah ihm aber an, dass er ihr keine weiteren Informationen geben würde.
»Kommen Sie einfach morgen wieder«, sagte er und stand auf. Frederike verstand den Wink.
»Nun gut«, sagte sie und nahm den Korb. Sie dachte einen Moment nach, griff dann nach einer Speckschwarte, die Lore in Papier eingewickelt hatte, und nach einem Laib Brot. »Vielleicht können Sie das meiner Schwiegermutter zukommen lassen?«
Er überlegte einen Augenblick. »Ich werde es weitergeben«, sagte er dann nur knapp, aber Frederike sah das Glänzen in seinen Augen und wie er sich über die Lippen leckte. »Sie können sich morgen direkt hier bei mir melden und brauchen nicht zu warten.«
»Danke.«
Frederike verließ den Raum, trotz der niedrigen Temperaturen war sie schweißgebadet. Im Hof blieb sie einen Moment stehen und holte tief Luft.
Gebhard war also krank und noch nicht einmal mehr hier in diesem Gefängnis. Frederike schaute nach oben zu den vergitterten Fenstern. Dort irgendwo aber war noch ihre Schwiegermutter. Wenigstens Heide wollte sie sehen. Aber was musste sie dafür tun? Sie wusste ja noch nicht einmal, ob sie es heute noch zurück nach Mansfeld schaffen würde. Langsam ging sie wieder zum Bahnhof. Der nächste Zug, erfuhr sie, würde erst in einer Stunde fahren. Wenn sie jetzt nach Hause fuhr, könnte sie sich sofort wieder auf den Weg zurück nach Berlin machen.
Vielleicht, dachte Frederike erschöpft, bleibe ich einfach hier auf dem Bahnhof. Gerade als sie sich mit diesem Gedanken angefreundet hatte, kam ein Zug, und sie stieg ein. Auf dem Weg nach Berlin fand sie keinen Sitzplatz. Das machte aber nichts, denn es war so voll, dass sie nicht umfallen konnte. Ihren Korb hielt sie fest an sich gedrückt, und zweimal musste sie gierige Hände wegschlagen. Dennoch war sie sich ziemlich sicher, dass das ein oder andere Stück einen neuen Besitzer gefunden hatte – gierige Hände waren flink.
Lore hatte den Korb so gepackt, dass unten die in dieser Zeit wertvollen warmen Kleidungsstücke lagen und auch der gute Speck. Brot und etwas Butter, ein paar Eier – das war zu verschmerzen. Und Frederike konnte nur ahnen, in welcher Misere die Menschen steckten, die Lebensmittel klauten.