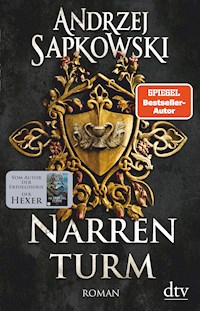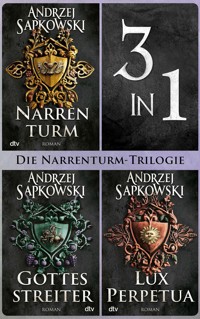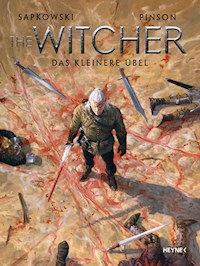14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Hexer - mit Gutscheinpunkten lesen!
- Sprache: Deutsch
Die Bücher zur NETFLIX-Serie – Die Witcher-Saga 2 in der opulenten Fan-Edition Die größte Fantasy-Saga aller Zeiten Krieg kündigt sich an. Ein Konvent der Zauberer soll klären, wie sie sich in dem bevorstehenden Konflikt verhalten werden. Geralt, der Hexer, sieht sich einem Dickicht undurchsichtiger Intrigen und Bündnisse gegenüber. Derweil wird Ciri, die Prinzessin von Cintra, von allen Seiten gejagt. Auch Geralt kann sie nur noch mit Mühe schützen. Bei einer blutigen Konfrontation wird er selbst schwer verwundet. »Das ist die Fantasy des 21. Jahrhunderts.« Nautilus Ciri gelingt die Flucht, doch dann findet sie sich in einer entsetzlichen Wüste wieder. Ein verirrtes Einhorn ist ihr einziger Gefährte. Lesen Sie auch »Kreuzweg der Raben«, das neue, große Prequel zur Witcher-Saga.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2009
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
»Die Gefahr — die Gefahr ist leise. Du wirst sie nicht hören, wenn sie auf grauen Federn geflogen kommt ...
Krieg kündigt sich an. Ein Konvent der Zauberer soll klären, wie sie sich in dem bevorstehenden Konflikt verhalten werden. Am Vorabend der Besprechungen sieht sich Geralt, der Hexer, einem Dickicht undurchsichtiger Intrigen und Bündnisse gegenüber. Der geheimnisvolle Rience, sein alter Gegenspieler, verfolgt Ciri, die Prinzessin von Cintra, die unter Geralts Schutz steht. Es kommt zu einer blutigen Konfrontation. Ciri gelingt die Flucht, doch dann findet sie sich in einer entsetzlichen Wüste wieder. Ein verirrtes Einhorn ist ihr einziger Gefährte.
Von Andrzej Sapkowski sind bei dtv erschienen:
Die Abenteuer des jungen Witchers
Der letzte Wunsch
Zeit des Sturms
Das Schwert der Vorsehung
Die Witcher-Saga
Das Erbe der Elfen
Zeit der Verachtung
Feuertaufe
Der Schwalbenturm
Die Dame vom See
Kreuzweg der Raben
Geschichten aus der Welt des Witchers
Etwas endet, etwas beginnt
Das Universum des Andrzej Sapkowski
Alain T. Puysségur: The Witcher. Der Codex
Die Narrenturm-Trilogie
Narrenturm
Gottesstreiter
Lux perpetua
Andrzej Sapkowski
Die Zeit der Verachtung
Die Witcher-Saga 2
Roman
Aus dem Polnischen von Erik Simon
Blut an deinen Händen, Falka,
Blut dort überall.
Brenn für dein Verbrechen, Falka,
und verbrenn voll Qual!
Henkscher, bei den Nordlingen (s.d.) auch Hexer, geheime und elitäre Kaste von Priesterkriegern, wahrscheinlich Abspaltung der Druiden (s.d.). In der Vorstellung des Volkes mit magischer Kraft oder übermenschlichen Fähigkeiten ausgestattet, sollten die H. zum Kampf gegen böse Geister, Ungeheuer und alle finsteren Mächte antreten. Tatsächlich wurden sie als Meister des Waffenhandwerks von den Herrschern des Nordens in den Stammeskriegen eingesetzt, die jene gegeneinander führten. Im Kampfe fielen die H. in Trance, vermutlich durch Autohypnose oder Rauschdrogen, kämpften mit blinder Energie, völlig unempfindlich für Schmerz und sogar schwere Verwundungen, was den Aberglauben an ihre übernatürlichen Kräfte bestärkte. Die Theorie, der zufolge die H. durch Mutationen oder genetische Anpassungen entstanden, hat keine Bestätigung gefunden. Die H. sind die Helden zahlreicher Überlieferungen der Nordlinge (vgl. F. Delannoy: Mythen und Legenden des Nordens).
Effenberg und Talbot,
Encyclopaedia Maxima Mundi, Bd. XV
DASERSTEKAPITEL
Um sich den Lebensunterhalt als reitender Bote zu verdienen, pflegte Aplegatt den frisch eingestellten jungen Männern zu sagen, braucht man zweierlei: einen hellen Kopf und einen eisernen Hintern.
Der helle Kopf ist unerlässlich, belehrte Aplegatt die jungen Boten, denn unter der Kleidung, in dem flachen, auf der blanken Haut liegenden Lederbeutel trägt der Bote nur Nachrichten von geringerer Bedeutung, die man ohne zu zögern dem verräterischen Papier oder Pergament anvertrauen kann. Die wirklich wichtigen, geheimen Botschaften, diejenigen, von denen vieles abhängt, muss er sich merken und dem Empfänger aufsagen. Wort für Wort, und manchmal sind das schwierige Wörter. Man kann sie schlecht aussprechen und noch schlechter behalten. Um sie sich zu merken, um sich beim Aufsagen nicht zu irren, braucht man einen wahrlich hellen Kopf.
Was aber den eisernen Hintern angeht, oho, das merkt jeder Bote sehr schnell selber, wenn er drei Tage und drei Nächte im Sattel sitzen muss, hundert oder zweihundert Meilen auf der Landstraße zurücklegen, gelegentlich auch über Stock und Stein. Freilich, man sitzt nicht ständig im Sattel, manchmal steigt man ab, macht eine Erholungspause. Denn der Mensch hält viel aus, das Pferd aber weniger. Doch wenn man nach der Rast wieder aufsteigen muss, ist es, als riefe der Hintern: »Zu Hilfe, man bringt mich um!«
Aber wer braucht denn noch reitende Boten, Herr Aplegatt, wunderten sich die jungen Leute mitunter. Von Vengerberg nach Wyzima beispielsweise schafft es niemand schneller als in vier oder gar fünf Tagen, selbst wenn er auf dem schnellsten Renner galoppiert. Und wie lange braucht ein Zauberer in Vengerberg, um einem Zauberer in Wyzima eine magische Botschaft zukommen zu lassen? Eine halbe Stunde vielleicht oder nicht einmal das. Dem Boten kann das Pferd lahm werden. Ihn können Räuber oder die Eichhörnchen ermorden, Wölfe oder Greifen können ihn zerreißen. Und schon ist er weg, der Bote. Aber eine Zauberbotschaft kommt immer an, die verirrt sich nicht, verspätet sich nicht, geht nicht verloren. Wozu Boten, wenn es überall Zauberer gibt, an jedem Königshof? Boten werden nicht mehr gebraucht, Herr Aplegatt.
Eine Zeit lang hatte auch Aplegatt geglaubt, niemand bedürfe seiner mehr. Er war sechsunddreißig Jahre alt, klein, aber stark und sehnig, er scheute keine Arbeit und hatte, versteht sich, einen hellen Kopf. Er hätte eine andere Arbeit finden können, um sich und seine Frau zu ernähren, um ein paar Groschen für die Mitgift der beiden noch ledigen Töchter beiseitezulegen, um die verheiratete weiterhin zu unterstützen, deren Mann, ein hoffnungsloser Schlemihl, partout auf keinen grünen Zweig kam. Doch Aplegatt wollte keine andere Arbeit und konnte sich keine andere vorstellen. Er war königlicher berittener Bote.
Und plötzlich, nach einer langen Zeit der Vergessenheit und bedrückenden Untätigkeit, wurde Aplegatt wieder gebraucht. Die Landstraßen und Waldwege hallten abermals vom Hufschlag wider. Wie in alter Zeit durchmaßen Boten das Land, brachten Nachrichten von Stadt zu Stadt.
Aplegatt kannte den Grund. Er wusste vieles, und noch mehr hörte er. Von ihm wurde erwartet, dass er den Inhalt der übermittelten Botschaft sofort aus dem Gedächtnis löschte, ihn vergaß, damit er sich nicht einmal unter der Folter daran erinnern könnte. Doch Aplegatt erinnerte sich. Und er wusste, warum die Könige plötzlich aufgehört hatten, mithilfe von Magie und Magiern zu kommunizieren. Die Mitteilungen, die die Boten überbrachten, sollten vor den Zauberern geheim gehalten werden. Die Könige trauten auf einmal den Zauberern nicht mehr, vertrauten ihnen ihre Geheimnisse nicht mehr an.
Was diese plötzliche Abkühlung der Freundschaft zwischen Königen und Zauberern ausgelöst hatte, wusste Aplegatt nicht, und es kümmerte ihn auch nicht besonders. Wie die Könige waren auch die Magier seiner Ansicht nach unverständliche Wesen, unberechenbar in ihren Taten – insbesondere, wenn schwere Zeiten kamen. Und dass schwere Zeiten heraufzogen, war unmöglich zu übersehen, wenn man das Land von Stadt zu Stadt, von Schloss zu Schloss, von Königreich zu Königreich durchmaß.
Die Straßen waren voller Soldaten. Auf Schritt und Tritt traf man auf Infanterie- oder Kavalleriekolonnen, und jeder Befehlshaber, dem man begegnete, war nervös, ängstlich, aufbrausend und tat so wichtig, als hinge das Schicksal der ganzen Welt nur von ihm ab. Auch die Städte und Schlösser waren voll von Bewaffneten, Tag und Nacht herrschte dort ein fieberhaftes Treiben. Die für gewöhnlich unsichtbaren Burggrafen und Kastellane schwärmten jetzt unablässig auf den Mauern und Burghöfen umher, wütend wie Wespen vor einem Gewitter, schrien, fluchten, erteilten Befehle, verteilten Fußtritte. Tag und Nacht waren Kolonnen schwer beladener Wagen zu Festungen und Garnisonen unterwegs, wichen den Kolonnen aus, die, auf dem Rückweg, ihnen schnell, leicht und leer entgegenkamen. Herden von ausgelassenen dreijährigen Pferden, die man direkt von den Weiden herantrieb, wirbelten auf den Landstraßen Staubwolken auf. Die weder an Geschirr noch an einen gepanzerten Reiter gewöhnten Pferdchen genossen fröhlich die letzten Tage der Freiheit, machten den Pferdeknechten viel zusätzliche Arbeit und anderen Benutzern der Straßen viel Verdruss.
Kurzum, in der heißen, reglosen Luft lag Krieg.
Aplegatt richtete sich in den Steigbügeln auf, blickte um sich. Unten am Fuße der Anhöhe glitzerte ein Fluss, der sich in scharfen Wendungen zwischen Wiesen und Baumgruppen hinzog. Jenseits des Flusses, im Süden, erstreckten sich Wälder. Der Bote trieb das Pferd an. Die Zeit drängte.
Er war seit zwei Tagen unterwegs. Der königliche Befehl und die Post hatten ihn in Hagge erreicht, wo er sich nach der Rückkehr aus Dreiberg ausruhte. Er hatte die Festung nachts verlassen, war auf der Landstraße am linken Ufer des Pontar entlanggaloppiert, hatte vor Tagesanbruch die Grenze zu Temerien überquert und befand sich jetzt, am Mittag des folgendes Tages, schon am Ufer der Ismena. Wäre König Foltest in Wyzima gewesen, hätte ihm Aplegatt die Botschaft noch in der Nacht desselben Tages überbracht. Leider war der König nicht in der Hauptstadt – er weilte im Süden des Landes, in Maribor, das fast zweihundert Meilen von Wyzima entfernt lag. Aplegatt wusste das, deshalb hatte er in der Nähe von Weißbrücke die Landstraße nach Westen verlassen und war durch die Wälder geritten, in Richtung Ellander. Das war etwas riskant. In den Wäldern grassierten immer noch die aufständischen Elfen, die sich »Scioa’tael« nannten, »Eichhörnchen«; wehe dem, der ihnen in die Hände fiel oder vor den Bogen kam. Doch ein königlicher Bote musste etwas riskieren, das war seine Pflicht.
Er überquerte den Fluss ohne Mühe – seit Juni hatte es nicht geregnet, das Wasser in der Ismena war erheblich zurückgegangen. Er hielt sich am Waldrand und gelangte zu der Straße, die von Wyzima nach Südosten führte, in Richtung der Eisenhütten, Schmieden und Ansiedlungen der Zwerge im Mahakammassiv. Auf der Straße fuhren Wagen, oft von berittenen Einheiten gedeckt. Aplegatt atmete erleichtert auf. Wo sich viele Menschen befanden, gab es keine Scioa’tael. Die Kampagne gegen die mit den Menschen kämpfenden Elfen dauerte in Temerien schon ein Jahr; die Kommandos der Eichhörnchen, auf die in den Wäldern Jagd gemacht wurde, hatten sich in kleinere Gruppen geteilt, und die kleineren Gruppen hielten sich von stark frequentierten Straßen fern und legten dort keine Hinterhalte.
Noch ehe es Abend wurde, hatte er die Westgrenze des Fürstentums Ellander erreicht, die Weggabelung unweit des Dörfchens Zavada, von wo aus ein einfacher und sicherer Weg nach Maribor vor ihm lag – zweiundvierzig Meilen auf gepflasterter, verkehrsreicher Straße. An der Wegscheide lag eine Schenke. Er beschloss, dem Pferd und sich eine Rast zu gönnen. Er wusste, dass er, wenn er im Morgengrauen aufbrach, das Pferd nicht einmal besonders anzutreiben brauchte, um noch vor Sonnenuntergang die schwarz-silbernen Fahnen auf den roten Dächern der Türme des Schlosses von Maribor zu erblicken.
Er sattelte die Stute ab und versorgte sie selbst, nachdem er dem Pferdeknecht gesagt hatte, er möge seiner Wege gehen. Er war ein königlicher Bote, und ein königlicher Bote erlaubt niemandem, sein Pferd anzurühren. Er aß eine ordentliche Portion Rührei mit Wurst und ein Viertel Beutelbrot, trank ein Quart Bier. Er hörte sich Gerüchte an. Verschiedene. In der Schenke hatten Reisende aus allen Weltgegenden Einkehr gehalten.
In Dol Angra, erfuhr Aplegatt, war es wieder zu Zwischenfällen gekommen, wieder hatte sich eine Kavallerieeinheit aus Lyrien mit einem Nilfgaarder Beritt geschlagen, wieder hatte Meve, die Königin von Lyrien, lauthals Nilfgaard der Provokation bezichtigt und König Demawend von Aedirn zu Hilfe gerufen. In Dreiberg war ein redanischer Baron öffentlich hingerichtet worden, der in geheimem Kontakt zu Abgesandten des Nilfgaarder Kaisers Emhyr gestanden hatte. In Kaedwen hatten die zu einer großen Einheit vereinigten Kommandos der Scioa’tael ein Gemetzel im Fort Leyda verübt. Zur Vergeltung für dieses Massaker hatte die Bevölkerung von Ard Carraigh einen Pogrom veranstaltet und an die vierhundert in der Hauptstadt ansässige Nichtmenschen ermordet.
In Temerien, erzählten Kaufleute, die aus dem Süden kamen, herrschten Trauer und Wehklagen unter den Emigranten aus Cintra, die unter den Fahnen von Hofmarschall Vissegerd versammelt waren. Denn es hatte sich die schreckliche Nachricht vom Tode des Löwenjungen bestätigt, der Fürstentochter Cirilla, der letzten aus dem Blute von Königin Calanthe, die man die Löwin von Cintra nannte.
Es wurden noch allerlei schreckliche und unheilvolle Gerüchte erzählt. So hatten in mehreren Dörfern in der Umgebung von Aldersberg die Kühe plötzlich begonnen, aus dem Euter zu bluten, und im Morgengrauen hatte man im Nebel die Pestjungfer gesehen, deren Erscheinen Tod und Verderben kündet. In Brugge war unweit des Waldes Brokilon, des verbotenen Reiches der Walddryaden, die Wilde Jagd erschienen, ein am Himmel entlanggaloppierender Zug von Gespenstern, und die Wilde Jagd ist, wie jedermann weiß, immer ein Vorzeichen des Krieges. Vor der Halbinsel Bremervoord aber wurde ein Gespensterschiff gesichtet und auf seinem Deck ein Gespenst – ein schwarzer Ritter mit einem Helm, der mit den Flügeln eines Raubvogels verziert war …
Der Bote hörte nicht länger zu, er war zu müde. Er ging in die gemeinschaftliche Schlafkammer, warf sich aufs Strohlager und schlief wie ein Toter.
Im Morgengrauen stand er auf. Als er auf den Hof ging, wunderte er sich ein wenig – er war nicht der Erste, der sich auf den Weg machte, und das kam selten vor. Am Brunnen stand gesattelt ein Rappe, und neben ihm am Trog wusch sich eine Frau in Männerkleidung die Hände. Als sie Aplegatts Schritte hörte, wandte sie sich um, nahm mit den nassen Händen das üppige schwarze Haar zusammen und strich es nach hinten. Der Bote verbeugte sich. Die Frau neigte leicht den Kopf.
Als er in den Stall trat, wäre er beinahe mit dem zweiten Frühaufsteher zusammengestoßen, einem jungen Mädchen mit einer Samtkappe, das gerade eine Apfelschimmelstute auf den Hof führte. Das Mädchen rieb sich das Gesicht und gähnte, gegen die Flanke des Pferdes gelehnt.
»Oje«, murmelte sie und rieb sich die Augen. »Ich werde wohl im Sattel einschlafen … Im Handumdrehen einschlafen … Uaaaua …«
»Die Kälte wird dich munter machen, wenn du die Stute auf Trab bringst«, sagte Aplegatt höflich, während er den Sattel vom Balken zog. »Glück auf den Weg, Fräuleinchen.«
Das Mädchen drehte sich um und schaute ihn an, als habe sie ihn erst jetzt bemerkt. Ihre Augen waren groß und grün wie Smaragde. Aplegatt warf die Schabracke aufs Pferd.
»Glück auf den Weg habe ich gewünscht«, wiederholte er. Für gewöhnlich war er weder mitteilsam noch gesprächig, doch jetzt empfand er das Bedürfnis, mit einem Mitmenschen zu reden, auch wenn dieser Mitmensch eine gewöhnliche verschlafene Rotznase war. Vielleicht lag es an den vielen einsamen Tagen unterwegs, vielleicht auch daran, dass die Rotznase ihn ein wenig an seine mittlere Tochter erinnerte.
»Mögen die Götter euch behüten«, fügte er hinzu, »vor Unfall und schlechtem Wetter. Ihr seid ja nur zu zweit, noch dazu Weiber … Und die Zeiten sind schlecht. Überall lauern Gefahren auf den Landstraßen …«
Das Mädchen öffnete die grünen Augen ein Stück weiter. Der Bote fühlte, wie es ihm kalt den Rücken hinunterlief, und er erschauderte.
»Die Gefahr«, ließ sich das Mädchen plötzlich mit seltsamer, veränderter Stimme vernehmen. »Die Gefahr ist leise. Du wirst sie nicht hören, wenn sie auf grauen Federn geflogen kommt. Ich hatte einen Traum. Der Sand … Der Sand war heiß von der Sonne …«
»Was?« Aplegatt erstarrte, den Sattel gegen den Bauch gestemmt. »Was redest du, Fräuleinchen? Was für ein Sand?«
Das Mädchen zuckte heftig zusammen, rieb sich das Gesicht. Die Schimmelstute warf den Kopf hin und her.
»Ciri!«, rief die schwarzhaarige Frau vom Hofe her in scharfem Tonfall, während sie Zaumzeug und Satteltaschen des Rappen zurechtrückte. »Beeil dich!«
Das Mädchen gähnte, warf Aplegatt einen Blick zu, begann zu blinzeln, als wundere sie sich über seine Anwesenheit im Stall. Der Bote schwieg.
»Ciri«, wiederholte die Frau. »Bist du da eingeschlafen?«
»Ich komme schon, Frau Yennefer!«
Als Aplegatt schließlich das Pferd gesattelt hatte und es auf den Hof führte, waren die Frau und das Mädchen schon verschwunden. Ein Hahn fing langgezogen und heiser zu krähen an, der Hund begann zu kläffen, in den Bäumen rief ein Kuckuck. Der Bote sprang in den Sattel. Plötzlich fielen ihm die grünen Augen des Mädchens ein, ihre sonderbaren Worte. Eine stille Gefahr? Graue Federn? Heißer Sand? Das Mädchen war vielleicht nicht ganz bei Verstand, dachte er. Solche sieht man jetzt oft, wahnsinnig gewordene Mädchen, die während des Krieges von Marodeuren oder anderen Dreckskerlen misshandelt worden sind … Ja, sie war wohl verrückt. Oder vielleicht nur verschlafen, aus dem Schlaf gerissen, noch nicht richtig wach? Merkwürdig, was für Unsinn die Leute mitunter faseln, wenn sie bei Tagesanbruch immer noch zwischen Schlaf und Wachsein schwanken …
Abermals durchlief ihn ein Schauer, und zwischen den Schulterblättern tauchte ein Schmerz auf. Er rieb sich mit der Hand über den Rücken.
Sobald er sich auf der Straße nach Maribor befand, stieß er dem Pferd die Ferse in die Weichen und fiel in Galopp. Die Zeit drängte.
In Maribor erholte sich der Bote nicht lange – es verging kein Tag, und wieder pfiff ihm der Wind in den Ohren. Das neue Pferd, ein drosselgrauer Hengst aus einem Mariborer Gestüt, lief scharf, den Hals vorgereckt und mit dem Schweif schlagend. Die Weiden am Straßenrand huschten vorbei. Gegen Aplegatts Brust drückte der Beutel mit der Diplomatenpost. Der Hintern tat ihm weh.
»He, dass du dir den Hals brichst, Heckenreiter, verdammter!«, brüllte ihm ein Kutscher hinterher, während er das Gespann zügelte, das vom Vorbeihuschen des galoppierenden Grauen erschrocken war. »Guckt nur, wie der losrast, als ob ihm der Tod auf den Fersen ist! Aber mach nur, mach hin, Windbeutel, reitest dem Sensenmann ja doch nicht davon!«
Aplegatt rieb sich ein Auge, das vom Luftzug zu tränen begonnen hatte.
Tags zuvor hatte er König Foltest die Briefe übergeben und dann die geheime Botschaft König Demawends aufgesagt.
»Demawend an Foltest. In Dol Angra ist alles bereit. Die Kostümtruppe wartet auf den Befehl. Voraussichtlicher Zeitpunkt: zweite Julinacht nach Neumond. Die Boote müssen zwei Tage später am anderen Ufer landen.«
Über der Landstraße flogen laut krächzend Krähenschwärme. Sie flogen nach Osten, in Richtung Mahakam und Dol Angra, in Richtung Vengerberg. Beim Reiten wiederholte der Bote in Gedanken die Worte der geheimen Botschaft, die der König von Temerien durch ihn dem König von Aedirn übermitteln ließ.
»Foltest an Demawend. Erstens: Halte die Aktion an. Die Schlauberger haben eine Zusammenkunft einberufen, sie wollen sich auf der Insel Thanedd treffen und beraten. Diese Konferenz kann vieles ändern. Zweitens: Die Suche nach dem Löwenjungen kann eingestellt werden. Es hat sich bestätigt: Das Löwenjunge lebt nicht mehr.«
Aplegatt trieb den Grauen mit der Ferse an. Die Zeit drängte.
Die enge Waldstraße war von Wagen verstopft. Aplegatt zügelte das Pferd, ließ es ruhig zum letzten Fahrzeug in der langen Kolonne trotten. Ihm war sofort klar, dass er an dem Stau nicht vorbeikommen würde. Von Umkehr konnte überhaupt keine Rede sein, der Zeitverlust wäre zu groß gewesen. In das sumpfige Dickicht auszuweichen, um die Blockade zu umgehen, war auch nicht verlockend, zumal es schon dämmerte.
»Was ist hier passiert?«, fragte er die Kutscher des letzten Wagens in der Kolonne, zwei alte Männer, von denen der eine zu dösen und der andere leblos zu sein schien. »Ein Überfall? Eichhörnchen? So redet doch! Ich habe es eilig.«
Ehe einer der Alten antworten konnte, ertönten von der im Walde verborgenen Spitze der Kolonne Schreie. Die Kutscher sprangen eilends auf die Wagen, trieben Pferde und Ochsen mit Peitschenhieben und auserlesenen Flüchen voran. Die Kolonne kam träge in Fahrt. Der dösende Greis wachte auf, wackelte mit dem Bart, schnalzte den Maultieren zu und hieb ihnen die Zügel auf die Hintern. Der leblos aussehende Greis erwachte zum Leben, schob die Strohmütze aus den Augen und schaute Aplegatt an.
»Guckt euch den an«, sagte er. »Eilig hat er’s. He, Söhnchen, du hast Glück. Bist grade rechtzeitig rangaloppiert.«
»Nu.« Der andere Greis wackelte mit dem Bart und trieb die Maultiere an. »Grade rechtzeitig. Wenn du um Mittag rum gekommen wärst, hättst du auf freie Fahrt warten müssen. Wir haben’s alle eilig, aber warten mussten wir. Wie soll man fahren, wenn die Straße zu ist?«
»Die Straße war geschlossen? Was ist denn das für eine Mode?«
»Hier ist ’n schlimmer Menschenfresser aufgetaucht, Söhnchen. Hat ’nen Ritter angefallen, der allein mit dem Knappen die Straße langgeritten ist. Das Ungeheuer soll dem Ritter den Kopf mitsamt Helm abgerissen haben, dem Pferd den Bauch aufgeschlitzt. Der Knappe konnte abhaun, hat andauernd gequatscht, wie fürchterlich es war, dass die ganze Straße im Blut schwamm …«
»Was war das für ein Monstrum?«, fragte Aplegatt und zügelte das Pferd, um weiter mit den Kutschern des einherzuckelnden Wagens reden zu können. »Ein Drache?«
»Nein, kein Drache«, sagte der zweite Greis, der mit der Strohmütze. »’s heißt, ’ne Mandigora oder so. Der Knappe hat gesagt, ’s war ’ne fliegende Bestie, mächtig gewaltig. Und hartnäckig! Ich hab mir gedacht, die frisst den Ritter und fliegt weg, aber keine Spur! Hat sich da auf die Straße gesetzt, das Mistvieh, und sitzt da, zischt, bleckt die Zähne … Na, und das hat die Straße zugemacht wie’n Korken die Flasche, denn wenn wer gekommen ist und das Vieh gesehen hat, der hat den Wagen stehenlassen und ist weg, was das Zeug hält. Da standen dann die Wagen ’ne halbe Meile lang, und rundrum ist, wie du ja selber siehst, Söhnchen, bloß Dickicht und Morast, da kommt man nicht rum und nicht zurück.«
»So viele Leute!«, sagte der Bote abfällig. »Und stehen da wie angewurzelt! Sie hätten sich Äxte und Spieße greifen müssen und das Biest von der Straße vertreiben oder erschlagen.«
»Nu, ’n paar haben’s versucht«, sagte der Alte, der die Zügel in der Hand hielt, und trieb die Maultiere an, denn die Kolonne kam in Fahrt. »Drei Zwerge von der Wachmannschaft eines Kaufmanns und mit ihnen vier Rekruten, die nach Carreras zur Festung unterwegs waren, zu den Truppen. Die Zwerge hat die Bestie grässlich zugerichtet, und die Rekruten …«
»… haben Fersengeld gegeben«, beendete der andere Greis den Satz, worauf er saftig und weit ausspuckte und zielsicher die Lücke zwischen den Hinterteilen der Maultiere traf. »Fersengeld gegeben, kaum dass sie die Mandigora gesehn haben. Einer hat sich wohl sogar eingemacht. Oh, schau, schau, Söhnchen, das ist er! Dort!«
»Was soll das«, sagte Aplegatt leicht entnervt, »wollt ihr mir den Hosenscheißer zeigen? Der ist mir egal …«
»Nicht doch! Der Kadaver! Der Kadaver von dem Ungeheuer! Die Soldaten legen ihn auf einen Wagen! Seht ihr?«
Aplegatt richtete sich in den Steigbügeln auf. Trotz der hereinbrechenden Dunkelheit und den sich drängenden Gaffern sah er, wie Soldaten einen riesigen fahlgelben Körper trugen. Die Fledermausflügel und der Skorpionschwanz schleiften über den Boden. Mit Hau-ruck-Rufen hoben die Soldaten den Kadaver höher und wälzten ihn auf den Wagen. Die vorgespannten Pferde, offensichtlich vom Gestank nach Blut und Aas beunruhigt, tänzelten, ruckten an der Deichsel.
»Nicht stehenbleiben!«, schrie der Berittführer, der die Soldaten befehligte, die beiden Alten an. »Weiterfahren! Nicht die Durchfahrt versperren!«
Der Kutscher trieb die Maultiere vorwärts, der Wagen sprang in den Radspuren. Aplegatt stieß das Pferd mit der Ferse, zog gleichauf.
»Die Soldaten haben die Bestie wohl erlegt?«
»Woher denn«, widersprach einer der Alten. »Die Soldaten, wie sie gekommen sind, haben bloß die Leute angeschnauzt. Mal ›bleib stehn‹, mal ›fahr zurück‹, mal so, mal so. Mit dem Ungeheuer hatten sie’s nicht eilig. Sie haben einen Hexer kommen lassen.«
»Einen Hexer?«
»So war’s«, versicherte ihm der zweite Greis. »Jemandem ist eingefallen, dass er im Dorf einen Hexer gesehen hatte, da haben sie ihn geholt. Der hatte weiße Haare, ’ne widerwärtige Visage und ’n mächtig gewaltiges Schwert auf’m Rücken. Und ’s ist keine Stunde vergangen, da hat vorn jemand geschrien, dass wir gleich weiterfahrn können, weil der Hexer die Bestie erledigt hat. Da ging’s endlich weiter, und grad da bist du, Söhnchen, aufgekreuzt.«
»Ha«, sagte Aplegatt nachdenklich. »So viele Jahre bin ich schon auf den Straßen unterwegs, aber einen Hexer habe ich noch nicht getroffen. Hat jemand gesehen, wie er dieses Ungeheuer erledigt hat?«
»Ich hab’s gesehen!«, rief ein junger Mann mit wirrem Haarschopf, der auf der anderen Seite des Wagens herangeritten kam. Er ritt ohne Sattel und lenkte die dürre falbe Mähre mit der Kandare. »Alles hab ich gesehen! Weil ich bei den Soldaten war, ganz vorn!«
»Seht ihn euch an, die Rotznase«, sagte der Alte, der kutschierte. »Noch grün hinter den Ohren, und spuckt große Töne. Willst’n paar übergezogen kriegen?«
»Lasst ihn, Vater«, schaltete sich Aplegatt ein. »Gleich kommt die Weggabelung, da reite ich nach Carreras, aber vorher möchte ich noch wissen, wie das mit diesem Hexer war. Red, Kleiner.«
»Also das war so«, begann der junge Mann rasch, während er im Schritt neben dem Wagen ritt, »dass dieser Hexer zum Befehlshaber der Soldaten kam. Er sagte, er heißt Gerant. Der Befehlshaber darauf, er kann heißen, wie er will, er soll sich lieber an die Arbeit machen. Und zeigte ihm, wo das Ungeheuer saß. Der Hexer ging näher ran, schaute ein bisschen. Bis zu dem Ungeheuer waren es gut hundert Schritt, vielleicht sogar mehr, aber er schaute bloß von Weitem und sagte gleich, dass das eine selten große Mantikora ist und er sie umbringt, wenn man ihm zweihundert Kronen bezahlt.«
»Zweihundert Kronen?« Dem zweiten Greis blieb die Luft weg. »Was denn, war der denn ganz bescheuert?«
»Das hat der Herr Befehlshaber auch gesagt, bloß etwas hässlicher. Drauf der Hexer, dass es so viel kosten muss und dass es ihm gleich ist, soll doch das Ungeheuer ruhig bis zum jüngsten Tag auf der Straße sitzen. Drauf der Befehlshaber, dass er so viel nicht rausrücken wird, da wartet er lieber, bis das Geschöpf von selber wegfliegt. Der Hexer aber drauf, dass es nicht wegfliegen wird, weil es hungrig und wütend ist. Und wenn es wegfliegt, kommt es gleich wieder, weil das sein Jagdterro… terret… terretor…«
»Fasel nicht, du Rotznase!«, sagte der Alte, der kutschierte, ärgerlich und versuchte ohne ersichtlichen Erfolg, sich in die Finger zu schneuzen, in denen er gleichzeitig die Zügel hielt. »Sag nur, was war!«
»Sag ich doch! Der Hexer also hat gesagt: Das Ungeheuer wird nicht wegfliegen, sondern die ganze Nacht lang den toten Ritter fressen, langsam, weil der Ritter ’ne Rüstung anhat und schwer rauszuklauben ist. Da kamen die Kaufleute und fingen an, den Hexer zu bereden, so und so, dass sie sammeln wollen und ihm hundert Kronen geben. Aber der Hexer sagt ihnen darauf, dass die Bestie nämlich Mantikora heißt und sehr gefährlich ist, also können sie sich diese hundert Kronen in den Hintern stecken, dafür riskiert er nicht seinen Hals. Da wurde nun der Befehlshaber wütend und sagte, dass das nun mal Sache eines Hundes und eines Hexers ist, den Hals zu riskieren, und dass der Hexer genau dazu da ist wie der Arsch zum Scheißen. Aber die Kaufleute hatten, scheint’s, Angst, dass der Hexer böse wird und seiner Wege geht, denn sie gingen auf hundertfünfzig hoch. Und der Hexer zog sein Schwert und ging die Straße lang zu der Stelle, wo das Untier saß. Und der Befehlshaber machte hinter ihm her ein Zeichen gegen das Böse und spuckte aus und sagte, dass er nicht versteht, wieso die Erde solche abartige Teufelsbrut trägt. Drauf sagte einer von den Kaufleuten zu ihm, dass das Militär ja wohl, statt im Wald auf Elfen Jagd zu machen, die Straßen von Ungeheuern säubern könnte, und dann bräuchte es keine Hexer zu geben und …«
»Schweif nicht ab«, unterbrach ihn einer der Alten, »sondern erzähl, was du gesehen hast.«
»Ich«, brüstete sich der junge Mann, »habe auf das Pferd des Hexers aufgepasst, eine Fuchsstute mit einer weißen Blesse.«
»Zum Kuckuck mit der Stute! Aber wie der Hexer das Ungeheuer erschlagen hat, hast du das gesehen?«
»Ähm …«, druckste der junge Mann. »Hab ich nicht … Ich wurde nach hinten gedrängt. Alle brüllten laut und machten die Pferde scheu, da …«
»Ich hab’s ja gesagt« – der Alte spuckte verächtlich aus –, »dass er einen Scheißdreck gesehen hat, der Rotzlöffel.«
»Aber ich habe den Hexer gesehen, wie er zurückgekommen ist!«, plusterte sich der Bursche auf. »Und der Befehlshaber, der alles mitangesehen hatte, war ganz weiß im Gesicht und sagte leise zu den Soldaten, dass das magische Zauberei ist oder Elfentricks, denn ein gewöhnlicher Mensch kann nicht so schnell mit dem Schwert sein … Der Hexer aber, der nahm das Geld von den Kaufleuten, stieg auf seine Stute und ritt davon.«
»Hmm …«, murmelte Aplegatt. »Wo ist er denn langgeritten? Auf der Straße nach Carreras? Wenn ja, hole ich ihn vielleicht ein, ich möchte ihn mir anschauen …«
»Nein«, sagte der junge Mann. »Er ist an der Weggabelung nach Dorian abgebogen. Er hatte es eilig.«
Der Hexer träumte selten etwas, und sogar an diese seltenen Träume konnte er sich nach dem Erwachen nie erinnern. Nicht einmal, wenn es Albträume waren – und für gewöhnlich waren es Albträume.
Auch diesmal war es einer, doch diesmal erinnerte sich der Hexer zumindest an ein Bruchstück davon. Aus einem zusammengeballten Wirbel irgendwelcher unklarer, aber beunruhigender Gestalten, sonderbarer, aber feindseliger Szenen und unverständlicher, aber bedrohlicher Worte und Geräusche hob sich plötzlich ein deutliches und sauberes Bild hervor. Ciri. Eine andere als die, die er von Kaer Morhen in Erinnerung hatte. Ihre aschblonden Haare, die im Galopp wehten, waren länger – so, wie sie sie getragen hatte, als er ihr zum ersten Mal begegnet war, im Brokilon. Als sie an ihm vorbeiritt, wollte er schreien, doch er brachte keinen Ton heraus. Er wollte ihr nachlaufen, doch ihm war, als sei er bis zur Mitte der Schenkel in erstarrendem Teer versunken. Ciri aber schien ihn nicht zu sehen, galoppierte weiter, in die Nacht hinein, zwischen die missgestalteten Erlen und Weiden, die wie lebendig ihre Kronen bewegten. Und er sah, dass sie verfolgt wurde. Dass ein Rappe hinter ihr hersprengte und darauf ein Reiter in schwarzer Rüstung, den Helm mit den Flügeln eines Raubvogels verziert.
Er konnte sich nicht rühren, nicht schreien. Er konnte nur zuschauen, wie der geflügelte Ritter Ciri einholte, sie bei den Haaren packte, vom Sattel riss und weitergaloppierte, sie hinter sich herschleifte. Er konnte nur zuschauen, wie Ciris Gesicht vor Schmerz blau anlief und ein stummer Schrei sich ihrem Munde entrang. Aufwachen, befahl er sich, außerstande, den Albtraum zu ertragen. Aufwachen! Sofort aufwachen!
Er erwachte.
Lange blieb er reglos liegen, in Gedanken bei dem Traum. Dann stand er auf. Er holte den Beutel unter dem Kopfkissen hervor, zählte rasch die Zehnkronenstücke durch. Hundertfünfzig von der Mantikora gestern. Fünfzig für den Nebling, den er auf Geheiß eines Dorfschulzen in der Gegend von Carreras getötet hatte. Und fünfzig für den Werwolf, für den ihn die Siedler aus Burdorff bezahlt hatten.
Fünfzig für den Werwolf. Viel, denn es war eine leichte Arbeit gewesen. Der Werwolf hatte sich nicht verteidigt. In eine Höhle gejagt, aus der es keinen Ausweg gab, war er auf die Knie gesunken und hatte den Schwerthieb erwartet. Er hatte dem Hexer leidgetan.
Doch er brauchte das Geld.
Es verging keine Stunde, und schon schritt er durch die Straßen der Stadt Dorian, suchte die bekannte Gasse und das bekannte Schild.
Die Aufschrift auf dem Schild lautete: »Codringher und Fenn, Rechtskonsultation und -beistand«. Geralt wusste jedoch nur zu gut, dass das, was Codringher und Fenn taten, in der Regel ausgesprochen wenig mit Recht zu tun hatte, während die beiden Teilhaber selbst zahlreiche Gründe hatten, jeglichen Kontakt sowohl mit dem Recht als auch mit seinen Vertretern zu vermeiden. Er hegte auch ernste Zweifel, ob jemand von den Klienten, die in das Büro kamen, wusste, was das Wort »Konsultation« bedeutet.
Im unteren Teil des kleinen Gebäudes gab es keinen Eingang – nur ein solide verriegeltes Tor, das wohl in eine Remise oder einen Stall führte. Um zur Eingangstür zu gelangen, musste man sich hinter das Haus begeben, den morastigen Hof voller Enten und Hühner betreten, von dort aus eine Treppe hinauf und dann über eine enge Galerie und durch einen dunklen Korridor gehen. Erst dann stand man vor der soliden Mahagonitür mit den Eisenbeschlägen und dem Türklopfer aus Messing in Form eines Löwenkopfes.
Geralt klopfte an, worauf er rasch zurückwich. Er wusste, dass der in die Tür eingebaute Mechanismus durch in den Beschlägen verborgene Löcher zwanzig Zoll lange Stahlnadeln verschießen konnte. Theoretisch schossen die Nadeln nur hervor, wenn sich jemand am Schloss zu schaffen machte beziehungsweise wenn Codringher oder Fenn auf die Auslösevorrichtung drückte, doch Geralt hatte sich schon vielfach davon überzeugen können, dass es keine unfehlbaren Mechanismen gibt und dass ein jeder manchmal sogar dann in Aktion tritt, wenn er es nicht soll. Und umgekehrt.
In der Tür befand sich sicherlich irgendeine Vorrichtung, die die Besucher identifizierte, wahrscheinlich eine magische. Nach dem Klopfen fragte nie jemand von innen nach dem Namen. Die Tür ging auf, und Codringher stand darin. Immer Codringher, niemals Fenn.
»Grüß dich, Geralt«, sagte Codringher. »Komm herein. Du brauchst dich nicht so an den Rahmen zu drücken, die Vorrichtung habe ich abgebaut. Vor ein paar Tagen ist etwas darin kaputtgegangen. Sie ist mir nichts, dir nichts losgegangen und hat einen Hausierer durchlöchert. Nur herein. Willst du etwas von mir?«
»Nein.« Der Hexer trat in das geräumige, düstere Vorzimmer, wo es wie üblich leicht nach Kater stank. »Nicht von dir. Von Fenn.«
Codringher lachte laut auf und bestätigte damit den Verdacht des Hexers, dass Fenn eine hundertprozentig mythische Gestalt war, die dazu diente, Büttel, Gerichtsvollzieher, Steuereintreiber und andere Codringher verhasste Personen irrezuführen.
Sie kamen ins Büro, wo es heller war, denn es war ein Giebelzimmer – die gut vergitterten Fenster hatten den größten Teil des Tages Sonne. Geralt nahm in dem für Besucher vorgesehenen Sessel Platz. Gegenüber, hinter dem Schreibtisch aus Eichenholz, machte Codringher es sich in einem Polstersessel bequem, der Mann, der sich »Advokat« nennen ließ und dem nichts unmöglich war. Wenn jemand Schwierigkeiten, Sorgen, Probleme hatte – ging er zu Codringher. Und sogleich erhielt dieser Jemand Beweise für Betrügereien und Unterschlagungen seines Kompagnons auf die Hand. Oder einen Bankkredit ohne Sicherheiten und Bürgschaften. Als Einziger auf einer langen Liste von Gläubigern bekam er sein Eigentum von einer Firma, die Konkurs angemeldet hatte. Er trat ein Erbe an, obwohl der reiche Onkel gedroht hatte, ihm keinen roten Heller zu vermachen. Er gewann einen Erbschaftsprozess, weil selbst die nächsten Verwandten plötzlich auf ihre Ansprüche verzichteten. Sein Sohn kam aus dem Knast, freigesprochen entweder wegen erwiesener Unschuld oder aus Mangel an Beweisen, denn wenn es Beweise gegeben hatte, waren sie auf rätselhafte Weise verschwunden, und die Zeugen übertrafen einander im Widerruf ihrer früheren Aussagen. Der Mitgiftjäger, der sich die Tochter zu angeln versuchte, wandte seine Zuneigung plötzlich einer anderen zu. Der Geliebte der Ehefrau oder der Entführer der Tochter zog sich bei einem Unfall komplizierte Brüche dreier Extremitäten zu, darunter mindestens einer oberen. Und ein geschworener Feind oder sonst eine unleidliche Person hörte auf zu schaden – in der Regel verschwand er spurlos. Ja, wenn jemand Probleme hatte, fuhr er nach Dorian, lief hurtig zur Firma »Codringher und Fenn« und klopfte an die Mahagonitür. In der Tür stand immer der »Advokat« Codringher, klein, schmächtig und grauhaarig, mit dem ungesunden Teint eines Menschen, der selten an die frische Luft kommt. Codringher führte den Besucher ins Büro, setzte sich in den Sessel, nahm einen großen schwarz-weißen Kater auf den Schoß und streichelte ihn. Beide – Codringher und der Kater – musterten den Klienten mit unangenehmen, beunruhigenden Blicken aus gelblichgrünen Augen.
»Ich habe deinen Brief erhalten.« Codringher und der Kater musterten Geralt mit gelblichgrünem Blick. »Außerdem hat mich auch Rittersporn besucht. Er ist vor ein paar Wochen durch Dorian gekommen. Er hat mir einiges von deinen Misshelligkeiten erzählt. Aber er hat sehr wenig gesagt. Zu wenig.«
»Wirklich? Du überraschst mich. Das wäre der erste mir bekannte Fall, wo Rittersporn nicht zu viel gesagt hätte.«
»Rittersporn« – Codringher lächelte nicht – »hat nicht viel gesagt, weil er auch nicht viel wusste. Aber er hat weniger gesagt, als er wusste, weil du ihm verboten hast, über bestimmte Dinge zu reden. Woher dieses Misstrauen? Und das gegenüber einem Berufskollegen?«
Geralt war leicht indigniert. Codringher hätte vorgegeben, es nicht zu bemerken, doch das konnte er nicht, denn der Kater hatte es bemerkt. Er riss die Augen auf, entblößte die weißen Eckzähne und fauchte fast lautlos.
»Reiz meinen Kater nicht«, sagte der Advokat und streichelte den Kater, um ihn zu beruhigen. »Dich irritiert die Bezeichnung Kollege? Aber es stimmt ja. Ich bin auch ein Hexer. Ich befreie die Leute auch von Ungeheuern und von ungeheuren Schwierigkeiten. Und ich tue es auch für Geld.«
»Es gibt gewisse Unterschiede«, murmelte Geralt, noch immer unter dem feindseligen Blick des Katers.
»Gibt es«, gab Codringher zu. »Du bist ein anachronistischer Hexer, und ich bin ein moderner, der mit der Zeit geht. Darum wirst du bald arbeitslos sein, und ich werde gedeihen. Striegen, Wyverns, Endriagen und Werwölfe wird es auf der Welt bald nicht mehr geben. Aber Hundsfötte gibt es immer.«
»Aber du befreist ja größtenteils gerade die Hundsfötte von den Schwierigkeiten, Codringher. Arme Leute in Schwierigkeiten können sich deine Dienste nicht leisten.«
»Deine Dienste können sich arme Leute ebenso wenig leisten. Arme Leute können sich nie irgendwas leisten, darum sind sie ja arm.«
»Das ist unerhört logisch. Und so neu, dass einem die Luft wegbleibt.«
»Das hat die Wahrheit so an sich. Und wahr ist nun mal, dass unsere Berufe mit der Hundsfötterei stehen und fallen. Wobei deiner schon fast ausgestorben ist, meiner aber reell und immer kräftiger gedeiht.«
»Gut, gut. Kommen wir zur Sache.«
»Höchste Zeit.« Codringher nickte, wobei er den Kater streichelte, der sich anspannte und laut zu miauen begann, während er ihm die Krallen ins Knie hieb. »Und wir wollen diese Angelegenheiten in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit erledigen. Erstens: Mein Honorar, Kollege Hexer, beträgt zweihundertfünfzig Nowigrader Kronen. Verfügst du über solch eine Summe? Oder zählst du dich vielleicht auch zu den armen Schluckern, die Schwierigkeiten haben?«
»Zuerst wollen wir uns überzeugen, ob du dir diese Summe verdient hast.«
»Die Überzeugung«, sagte der Advokat kalt, »musst du ausschließlich auf die eigene Person beschränken und dich damit sehr beeilen. Wenn du dich aber überzeugt hast, leg das Geld auf den Tisch. Dann gehen wir zu den folgenden, weniger wichtigen Fragen über.«
Geralt band den Beutel vom Gürtel los und warf ihn klirrend auf den Schreibtisch. Der Kater sprang mit einem jähen Satz von Codringhers Schoß und schoss davon. Der Advokat steckte den Geldbeutel in die Schublade, ohne den Inhalt zu überprüfen. »Du hast meinen Kater erschreckt«, sagte er mit echtem Vorwurf.
»Entschuldige. Ich dachte, das Klingen von Münzen ist das Letzte, was deinen Kater erschrecken kann. Sag, was du herausgefunden hast.«
»Dieser Rience«, begann Codringher, »der dich so sehr interessiert, ist eine ziemlich geheimnisvolle Gestalt. Ich konnte nur feststellen, dass er zwei Jahre an der Zauberschule in Ban Ard studiert hat. Dort wurde er hinausgeworfen, nachdem man ihn bei kleineren Diebstählen erwischt hatte. Unweit der Schule warteten wie üblich die Werber des Nachrichtendienstes von Kaedwen. Rience ließ sich anwerben. Was er für den Geheimdienst von Kaedwen getan hat, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Aber aus der Schule ausgestoßene Zauberer werden für gewöhnlich als Mörder ausgebildet. Passt das?«
»Wie die Faust aufs Auge. Red weiter.«
»Die nächste Information stammt aus Cintra. Herr Rience hat dort im Knast gesessen. Auf Anordnung von Königin Calanthe.«
»Wofür hat er gesessen?«
»Stell dir vor: wegen Schulden. Er hat nicht lange gebrummt, weil jemand ihn freigekauft hat, die Schulden mitsamt Zinsen bezahlt. Die Transaktion wurde durch Vermittlung einer Bank abgewickelt, die Anonymität des Wohltäters gewahrt. Ich habe versucht, zu verfolgen, von wem das Geld kam, habe aber nach der vierten Bank in Folge aufgegeben. Wer Rience freigekauft hat, war ein Profi. Und ihm war sehr daran gelegen, anonym zu bleiben.«
Codringher verstummte, begann heftig zu husten, wobei er ein Taschentuch vor den Mund hielt.
»Und plötzlich, gleich nach dem Krieg, tauchte Herr Rience in Sodden, in Angren und in Brugge auf«, fuhr er fort, nachdem er sich den Mund abgewischt und einen Blick auf das Taschentuch geworfen hatte. »Bis zur Unkenntlichkeit verändert, zumindest, was sein Verhalten angeht und die Menge an Bargeld, über das er verfügte und mit dem er um sich warf. Denn was den Namen betrifft, hat sich der sorglose Hundesohn keine Mühe gemacht – er nannte sich weiterhin Rience. Und als Rience begann er, intensiv nach einer bestimmten Person zu suchen, genauer gesagt, einem Persönchen. Er suchte die Druiden vom angrenischen Kreis auf, diejenigen, die sich der Kriegswaisen angenommen hatten. Die Leiche eines der Druiden wurde etwas später in einem Wald nahebei gefunden, massakriert und mit Spuren von Folterungen. Dann tauchte Rience im Flussland auf …«
»Ich weiß«, warf Geralt ein. »Ich weiß, was er mit der Bauernfamilie im Flussland gemacht hat. Für zweihundertfünfzig Kronen hatte ich mehr erwartet. Neu war für mich bisher nur die Information über die Zauberschule und den Geheimdienst von Kaedwen. Den Rest kenne ich. Ich weiß, dass Rience ein rücksichtsloser Mörder ist. Ich weiß, dass er ein arroganter Fatzke ist, der sich nicht die Mühe macht, falsche Namen anzunehmen. Ich weiß, dass er in jemandes Auftrag arbeitet. In wessen, Codringher?«
»Im Auftrag irgendeines Zauberers. Es war ein Zauberer, der ihn damals aus dem Knast freikaufte. Du hast mir selber mitgeteilt und Rittersporn hat bestätigt, dass Rience Magie verwendet. Echte Magie, nicht die Kunststückchen, die ein von der Akademie geworfener Schüler kennen mag. Also unterstützt ihn jemand, rüstet ihn mit Amuletten aus, gibt ihm wahrscheinlich insgeheim Unterricht. Manche von den offiziell praktizierenden Magiern haben solche geheimen Schüler und Faktoten, um illegale oder schmutzige Dinge zu erledigen. Im Jargon der Zauberer wird derlei als ›an der Leine agieren‹ bezeichnet.«
»An der Leine eines Zauberers würde Rience Tarnmagie einsetzen. Er aber verändert weder Namen noch Erscheinungsbild. Er hat sich nicht einmal der Hautverfärbung entledigt, nachdem ihn Yennefer verbrannt hatte.«
»Gerade das spricht dafür, dass er an der Leine agiert.« Codringher hustete, wischte sich den Mund mit dem Tuch ab. »Denn eine magische Tarnung ist keine Tarnung, nur Dilettanten benutzen so was. Wenn sich Rience unter einem magischen Schirm oder einer Illusionsmaske verbergen würde, würde das jeder magische Alarm sofort melden, und solche Alarme sind gegenwärtig praktisch in jedem Stadttor eingerichtet. Und Zauberer spüren Illusionsmasken unfehlbar. In der größten Menschenmenge, im größten Gedränge würde Rience die Aufmerksamkeit jedes Zauberers auf sich ziehen, als ob ihm aus dem Munde Flammen schlügen und aus dem Hintern Rauchwolken. Ich wiederhole: Rience handelt im Auftrag eines Zauberers, und zwar so, dass er nicht die Aufmerksamkeit anderer Zauberer auf sich zieht.«
»Manche halten ihn für einen Nilfgaarder Spion.«
»Das weiß ich. Das glaubt zum Beispiel Dijkstra, der Chef des redanischen Geheimdienstes. Dijkstra irrt sich selten, man kann also annehmen, dass er auch diesmal recht hat. Doch das eine schließt das andere nicht aus. Das Faktotum eines Zauberers kann gleichzeitig Nilfgaarder Spion sein.«
»Was bedeuten würde, dass irgendein offiziell praktizierender Zauberer mithilfe eines geheimen Faktotums für Nilfgaard spioniert.«
»Unsinn.« Codringher hustete, betrachtete aufmerksam das Taschentuch. »Ein Zauberer sollte für Nilfgaard spionieren? Wie käme er dazu? Für Geld? Lächerlich. Weil er auf große Macht unter der Regierung des siegreichen Kaisers Emhyr hofft? Noch lächerlicher. Es ist kein Geheimnis, dass Emhyr var Emreis die ihm untertanen Zauberer kurzhält. Zauberer werden in Nilfgaard genauso funktionell betrachtet wie, sagen wir, Stallburschen. Und sie haben nicht mehr Macht als Stallburschen. Würde einer von unseren übermütigen Magiern beschließen, für den Sieg des Kaisers zu kämpfen, bei dem er zum Stallburschen würde? Philippa Eilhart, die Wisimir von Redanien die königlichen Erlasse diktiert? Sabrina Glevissig, die den König Henselt beim Reden unterbricht, mit der Faust auf den Tisch schlägt und sagt, er solle den Mund halten und zuhören? Vilgefortz von Roggeveen, der unlängst Demawend von Aedirn wissen ließ, er habe momentan keine Zeit für ihn?«
»Kürzer, Codringher. Wie ist das also mit Rience?«
»Wie üblich. Der Nilfgaarder Geheimdienst versucht an den Zauberer heranzukommen, indem er das Faktotum zur Mitarbeit anheuert. Nach allem, was ich weiß, würde Rience die Nilfgaarder Florins nicht verachten und seinen Meister ohne zu zögern verraten.«
»Jetzt bist du es, der Unsinn redet. Sogar unsere übermütigen Zauberer würden auf der Stelle merken, dass man sie verrät, und der entlarvte Rience würde am Galgen baumeln. Wenn er Glück hätte.«
»Du bist ein Kind, Geralt. Entlarvte Spione hängt man nicht, sondern benutzt sie. Man füttert sie mit Falschinformationen, versucht, Doppelagenten aus ihnen zu machen …«
»Langweile das Kind nicht, Codringher. Mich interessiert nicht, was in Geheimdiensten oder in der Politik hinter den Kulissen abläuft. Rience ist mir auf den Fersen, ich will wissen, warum und in wessen Auftrag. Wie sich zeigt, im Auftrag irgendeines Zauberers. Wer ist dieser Zauberer?«
»Das weiß ich noch nicht. Aber in Kürze werde ich es wissen.«
»In Kürze«, stieß der Hexer hervor, »ist für mich zu spät.«
»Das kann ich keineswegs ausschließen«, sagte Codringher in ernstem Ton. »Du bist in eine ekelhafte Bredouille hineingeraten, Geralt. Gut, dass du dich an mich gewandt hast, ich kann Leute aus Bredouillen herausholen. Im Grunde habe ich dich schon herausgeholt.«
»Wirklich?«
»Wirklich.« Der Advokat legte das Tuch an den Mund und begann zu husten. »Denn weißt du, Kollege, außer dem Zauberer und vielleicht Nilfgaard ist noch eine dritte Partei im Spiel. Es haben mich, stell dir vor, Agenten der Geheimdienste von König Foltest aufgesucht. Sie hatten Probleme. Der König hat ihnen befohlen, eine gewisse verschwundene Fürstentochter zu suchen. Als sie merkten, dass das ziemlich schwierig ist, beschlossen die Agenten, einen Spezialisten für schwierige Fälle hinzuzuziehen. Nachdem sie das Problem umrissen hatten, deuteten sie dem Spezialisten an, dass ein gewisser Hexer allerlei über die gesuchte Fürstentochter wissen könne. Ja, vielleicht wisse er sogar, wo sie sich befindet.«
»Und was tat der Spezialist?«
»Anfangs drückte er seine Verwunderung aus. Er wunderte sich nämlich, dass man besagten Hexer nicht eingelocht hatte, um dann auf herkömmliche Weise alles zu erfahren, was er weiß, und sogar eine Menge, was er nicht weiß, sondern sich ausdenkt, um die Fragenden zufriedenzustellen. Die Agenten erwiderten, das habe ihnen ihr Chef verboten. Hexer, erläuterten die Agenten, haben ein so empfindliches Nervensystem, dass sie unter der Folter augenblicklich sterben oder, wie sie sich bildlich ausdrückten, sie der Schlag trifft. Weshalb ihnen aufgetragen sei, den Hexer aufzuspüren, doch auch das habe sich als schwierig erwiesen. Der Spezialist lobte die Agenten, dass sie so vernünftig waren, und sagte, sie sollten in zwei Wochen wiederkommen.«
»Kamen sie?«
»Klar doch. Und da hat der Spezialist, der dich schon als seinen Klienten betrachtete, den Agenten unwiderlegliche Beweise präsentiert, dass der Hexer Geralt nichts mit der Suche nach der Fürstentochter zu tun hatte, nicht hat und nicht haben kann. Der Spezialist hatte nämlich Augenzeugen für den Tod der Fürstentochter Cirilla gefunden, der Enkelin von Königin Calanthe, der Tochter von Prinzessin Pavetta. Cirilla ist vor drei Jahren in einem Flüchtlingslager in Angren gestorben. An Diphtherie. Das Kind hat vor dem Tode schrecklich gelitten. Du wirst es nicht glauben, aber die temerischen Agenten hatten Tränen in den Augen, als sie sich die Berichte meiner Augenzeugen anhörten.«
»Ich habe auch Tränen in den Augen. Die temerischen Agenten, wie ich annehme, konnten oder wollten dir nicht mehr als zweihundertfünfzig Kronen bieten?«
»Dein Sarkasmus tut mir im Herzen weh, Hexer. Ich habe dich aus der Bredouille geholt, und du, statt mir zu danken, verletzt mich.«
»Ich danke und bitte um Entschuldigung. Warum hat König Foltest den Agenten aufgetragen, Ciri zu suchen, Codringher? Was sollen sie tun, wenn sie sie finden?«
»Du bist vielleicht beschränkt. Sie umbringen, versteht sich. Sie gilt als Prätendentin auf den Thron von Cintra, aber bezüglich dieses Thrones hat man andere Pläne.«
»Das geht nicht zusammen, Codringher. Der Thron von Cintra ist mitsamt dem königlichen Palast, der Stadt und dem ganzen Land verbrannt. Jetzt herrscht dort Nilfgaard. Foltest weiß das genau, die anderen Könige auch. Auf welche Weise kann Ciri Anspruch auf einen Thron erheben, den es nicht gibt?«
»Komm.« Codringher stand auf. »Wir wollen gemeinsam versuchen, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Bei der Gelegenheit werde ich dir einen Vertrauensbeweis geben … Was interessiert dich so an diesem Porträt, wenn ich fragen darf?«
»Dass es durchlöchert ist, als ob ein Specht mehrere Jahre darauf herumgehackt hätte«, sagte Geralt, während er das Bild in dem vergoldeten Rahmen betrachtete, das an der Wand gegenüber dem Schreibtisch des Advokaten hing. »Und dass es einen Ausbund von einem Idioten darstellt.«
»Das ist mein dahingegangener Vater.« Codringher verzog leicht das Gesicht. »Ein Ausbund von einem Idioten. Ich habe das Porträt hier aufgehängt, um ihn immer vor Augen zu haben. Als Warnung. Komm, Hexer.«
Sie gingen ins Vorzimmer. Der Kater, der mitten auf dem Sofa lag und selbstvergessen eine in seltsamem Winkel vorgereckte Hinterpfote leckte, verschwand beim Anblick des Hexers sofort im Dunkel des Korridors.
»Warum können dich Katzen so gar nicht leiden, Geralt? Hat es etwas zu tun mit …«
»Ja«, fiel der Hexer ihm ins Wort. »Hat es.«
Eine Platte der Mahagonitäfelung glitt lautlos zur Seite und gab einen geheimen Durchgang frei. Codringher ging voran. Die Täfelung, zweifellos magisch in Bewegung gesetzt, schloss sich hinter ihnen, hüllte sie aber nicht in Dunkelheit. Aus der Tiefe des Geheimgangs drang Licht.
In dem Zimmer am Ende des Ganges war es kalt und trocken, und in der Luft hing ein schwerer, stickiger Geruch von Staub und Kerzen.
»Du wirst meinen Mitarbeiter kennenlernen, Geralt.«
»Fenn?« Der Hexer lächelte. »Nicht möglich.«
»Doch. Gib zu, du hast vermutet, dass Fenn nicht existiert.«
»Woher denn.«
Zwischen der bis an die niedrige Decke reichenden Ansammlung von Bücherschränken und -regalen ertönte ein Quietschen, und einen Augenblick später kam ein sonderbares Vehikel hervorgerollt. Es war ein hoher, mit Rädern versehener Sessel. Darin saß ein zwergwüchsiger Mann mit riesigem Kopf, der – unter Auslassung eines Halses – auf unproportional schmalen Schultern saß. Dem Mann fehlten beide Beine.
»Macht euch bekannt«, sagte Codringher. »Jakob Fenn, Rechtsgelehrter, mein Teilhaber und unschätzbarer Mitarbeiter. Und das ist unser Gast und Klient …«
»Der Hexer Geralt von Riva«, vollendete der Krüppel den Satz lächelnd. »Das konnte ich mir ohne allzu viel Mühe denken. Ich arbeite seit etlichen Monaten an dem Auftrag. Folgt mir, meine Herren.«
Sie gingen dem quietschenden Sessel nach in das Labyrinth zwischen den Regalen, die sich unter der Last von Bänden bogen, derer sich die Universitätsbibliothek in Oxenfurt nicht geschämt hätte. Die Inkunabeln mussten, wie Geralt vermutete, über mehrere Generationen von Codringhers und Fenns angehäuft worden sein. Er war froh über den erbrachten Vertrauensbeweis, freute sich, endlich Fenn kennenlernen zu können. Er zweifelte jedoch nicht daran, dass die Gestalt, wenngleich hundertprozentig real, teilweise auch mythisch war. Der mythische Fenn, zweifellos ein Alter Ego Codringhers, war in der Gegend oft gesehen worden; der an den Sessel gefesselte Rechtsgelehrte jedoch verließ wahrscheinlich niemals das Gebäude.
Die Mitte des Raumes war besonders gut beleuchtet, dort stand ein niedriges, von dem Rollsessel aus zu erreichendes Pult, auf dem sich Bücher türmten, Packen von Pergament und Velinpapier, Zettel, Tinten- und Tuscheflaschen, Federbüschel und Tausende von rätselhaften Utensilien. Freilich waren nicht alle rätselhaft. Geralt erkannte Formen zum Fälschen von Siegeln und einen Diamantschaber zum Entfernen von Schrift auf amtlichen Dokumenten. Mitten auf dem Pult lag eine kleine Repetier-Kugelarmbrust, und daneben schauten unter Samtgewebe große Vergrößerungsgläser hervor, angefertigt aus geschliffenem Bergkristall. Solche Gläser waren selten und kosteten ein Vermögen.
»Hast du etwas Neues gefunden, Fenn?«
»Nicht viel.« Der Krüppel lächelte. Sein Lächeln war nett und sehr einnehmend. »Ich habe die Liste von Riences potentiellen Auftraggebern auf achtundzwanzig Zauberer reduziert …«
»Das lassen wir vorerst ruhen«, unterbrach ihn Codringher rasch. »Zunächst interessiert uns etwas anderes. Erkläre Geralt die Gründe, aus denen die Agenten der Vier Königreiche ausgedehnte Suchaktionen nach der verschwundenen Fürstentochter von Cintra unternehmen.«
»In den Adern des Mädchens fließt das Blut von Königin Calanthe«, sagte Fenn, als sei er überrascht, etwas derart Offensichtliches erläutern zu müssen. »Sie ist die Letzte aus der königlichen Linie. Cintra hat große strategische und politische Bedeutung. Eine verschwundene, außerhalb der Einflusssphären befindliche Kronprätendentin ist ungünstig und vielleicht sogar bedrohlich, wenn sie unter falsche Einflüsse gerät. Zum Beispiel unter den Einfluss Nilfgaards.«
»Soweit ich mich erinnere«, sagte Geralt, »sind in Cintra Frauen von der erblichen Thronfolge ausgeschlossen.«
»Das ist wahr«, bestätigte Fenn und lächelte abermals. »Aber eine Frau kann allemal jemandes Gemahlin und Mutter eines männlichen Nachkommen werden. Die Nachrichtendienste der Vier Königreiche haben von Riences fieberhafter Suche nach der Fürstentochter erfahren und waren überzeugt, dass es genau darum geht. Also wurde beschlossen, die Fürstentochter daran zu hindern, Ehefrau und Mutter zu werden. Auf eine einfache, aber wirksame Weise.«
»Aber die Fürstentochter lebt nicht«, sagte Codringher rasch und beobachtete die Veränderungen, die die Worte des lächelnden Krüppels auf Geralts Gesicht hervorriefen. »Die Agenten haben davon erfahren und die Suche eingestellt.«
»Vorerst eingestellt.« Der Hexer zwang sich sichtlich zu Ruhe und einem kalten Ton. »Fälschungen haben es an sich, dass sie auffliegen. Außerdem sind die königlichen Agenten nur eine der Parteien in diesem Spiel. Die Agenten, wie ihr selber sagt, haben Ciri nachgespürt, um die Pläne anderer Nachforscher zu durchkreuzen. Jene anderen sind vielleicht weniger anfällig für Falschinformationen. Ich habe euch angeheuert, damit ihr eine Möglichkeit findet, die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten. Was schlagt ihr vor?«
»Ich habe eine bestimmte Konzeption.« Fenn warf seinem Teilhaber einen Blick zu, fand in dessen Gesicht aber keine Anweisung zu schweigen. »Wir wollen diskret, aber weithin die Ansicht verbreiten, dass nicht nur die Fürstentochter Cirilla, sondern sogar ihre möglichen männlichen Nachkommen keinerlei Anspruch auf den Thron von Cintra haben.«
»In Cintra erbt die Kunkel nicht«, erklärte Codringher und kämpfte einen neuerlichen Hustenanfall nieder. »Ausschließlich das Schwert.«
»Genau«, bestätigte der Rechtsgelehrte. »Geralt hat das gerade selbst gesagt. Das ist uraltes Recht, nicht einmal diese Teuflin Calanthe konnte es aufheben, obwohl sie sich bemüht hat.«
»Sie hat versucht, dieses Recht mit einer Intrige zu umgehen«, sagte Codringher im Brustton der Überzeugung, worauf er sich den Mund mit dem Taschentuch abwischte. »Einer illegalen Intrige. Erklär es ihm, Fenn.«
»Calanthe war die einzige Tochter von König Dagorad und Königin Adalia. Nach dem Tode der Eltern widersetzte sie sich der Aristokratie, die in ihr ausschließlich die Frau für einen neuen König sah. Sie wollte ungeteilt herrschen und war höchstens pro forma und um des Erhalts der Dynastie willen bereit, einen Prinzgemahl zu akzeptieren, der neben ihr auf dem Thron sitzen, aber nicht mehr als ein Strohmann sein würde. Die alten Geschlechter sperrten sich dagegen. Calanthe hatte die Wahl zwischen einem Bürgerkrieg, der Abdankung zugunsten einer anderen Linie oder der Heirat mit Roegner, dem Prinzen von Ebbing. Sie wählte die dritte Lösung. Sie regierte das Land, aber an der Seite von Roegner. Klar, dass sie sich nicht zähmen oder in die Frauengemächer abschieben ließ. Sie war die Löwin von Cintra. Der Herrscher jedoch war Roegner, obwohl niemand ihn den Löwen von Cintra nannte.«
»Calanthe aber«, fügte Codringher hinzu, »tat alles Mögliche, um schwanger zu werden und einen Sohn zu gebären. Es wurde nichts draus. Sie brachte die Tochter Pavetta zur Welt, hatte dann zweimal eine Fehlgeburt, und es wurde klar, dass sie keine Kinder mehr bekommen würde. Alle Pläne gingen den Bach hinunter. Nun ja, Weiberschicksal. Eine ruinierte Gebärmutter durchkreuzt alle Ambitionen.«
Geralt verzog das Gesicht. »Du bist ekelhaft trivial, Codringher.«
»Ich weiß. Die Wahrheit war auch trivial. Denn Roegner fing an, sich nach einer jungen Königin mit entsprechend breiten Hüften umzuschauen, am besten aus einer Familie mit erwiesener Fruchtbarkeit bis zurück zur Urgroßmutter. Und Calanthe begann, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Jede Speise, jeder Kelch Wein konnte den Tod bringen, jede Jagd mit einem Unfall enden. Es spricht vieles dafür, dass die Löwin von Cintra damals die Initiative ergriffen hat. Roegner starb. Im Lande gingen gerade die Pocken um, und niemand wunderte sich über den Tod des Königs.«
»Ich verstehe allmählich«, sagte der Hexer scheinbar gleichmütig, »worauf sich die Mitteilungen stützen werden, die ihr diskret, aber weithin auszustreuen gedenkt. Ciri wird zur Enkelin einer Giftmischerin und Gattenmörderin?«
»Greif den Fakten nicht vor, Geralt. Sprich weiter, Fenn.«
»Calanthe« – der Krüppel lächelte – »rettete ihr Leben, aber von der Krone war sie nun noch weiter entfernt. Als sie nach dem Tode Roegners nach der absoluten Macht griff, widersetzte sich die Aristokratie abermals gegen die Verletzung von Recht und Herkommen. Auf dem Thron Cintras sollte ein König sitzen, keine Königin. Es wurde unmissverständlich festgelegt: Sobald die kleine Pavetta anfängt, auch nur ein wenig einer Frau zu ähneln, muss sie mit jemandem verheiratet werden, der der neue König wird. Eine neue Ehe der unfruchtbaren Königin stand nicht zur Debatte. Die Löwin von Cintra begriff, dass sie höchstens auf die Rolle der Königinmutter hoffen durfte. Zu allem Unglück konnte auch noch jemand Pavettas Mann werden, der die Schwiegermutter völlig von der Regierung verdrängt hätte.«
»Ich werde wieder trivial sein«, warnte Codringher. »Calanthe schob die Verheiratung Pavettas hinaus. Sie ließ das erste Eheprojekt scheitern, als das Mädchen zehn Jahre alt war, und das zweite mit dreizehn. Die Aristokratie durchschaute die Pläne und forderte, dass der fünfzehnte Geburtstag Pavettas ihr letzter im Jungfernstand sein müsse. Calanthe musste ihre Zustimmung geben. Doch vorher erreichte sie, worauf sie spekuliert hatte. Pavetta war zu lange Jungfrau geblieben. Schließlich begann es sie derart zu jucken, dass sie mit dem erstbesten Dahergelaufenen ins Bett ging, noch dazu einem, der in ein Ungeheuer verwunschen war. Es gab dabei gewisse übernatürliche Umstände, gewisse Weissagungen, Zauber, Gelübde … Ein gewisses Recht der Überraschung? Nicht wahr, Geralt? Was danach geschah, weißt du sicherlich noch. Calanthe holte einen Hexer nach Cintra, und der Hexer machte Bewegung. Ohne zu wissen, dass er gelenkt wurde, löste er den Fluch von dem Ungeheuer namens Igel und ermöglichte ihm die Heirat mit Pavetta. Damit erleichterte es der Hexer Calanthe, sich auf dem Thron zu halten. Die Verbindung Pavettas mit dem entzauberten Ungeheuer war für die Magnaten ein derart großer Schock, dass sie die plötzliche Heirat der Löwin mit Eist Tuirseach akzeptierten. Der Jarl von den Skellige-Inseln schien ihnen besser als der dahergelaufene Igel. Auf diese Weise regierte Calanthe weiterhin das Land. Wie alle Männer von den Inseln begegnete Eist der Löwin von Cintra mit zu viel Hochachtung, als dass er sich ihr irgendwie widersetzt hätte, und die Krönung langweilte ihn bloß. Er legte die Regierung ganz und gar in ihre Hände. Calanthe aber, die sich mit Arzneien und Elixieren vollstopfte, holte den Gatten Tag und Nacht zu sich ins Bett. Sie wollte bis ans Ende ihrer Tage regieren. Und wenn nicht als Königinmutter, dann als Mutter eines eigenen Sohnes. Aber, wie ich schon sagte, wollen ist eins, doch …«
»Du sagtest es schon. Wiederhol dich nicht.«
»Hingegen hatte Prinzessin Pavetta, die Frau des sonderbaren Igels, schon während der Hochzeitszeremonie ein verdächtig weites Kleid an. Calanthe, die resigniert hatte, änderte die Pläne. Wenn nicht ihr Sohn, dachte sie, dann sollte es der Sohn Pavettas sein. Aber Pavetta brachte eine Tochter zur Welt. Der reinste Fluch, nicht wahr? Die Prinzessin konnte jedoch noch mehr Kinder bekommen. Das heißt, sie hätte welche bekommen können. Doch es ereignete sich ein rätselhafter Unfall. Sie und dieser merkwürdige Igel kamen bei einem nicht geklärten Seeunglück ums Leben.«
»Unterstellst du nicht zu viel, Codringher?«
»Ich versuche die Situation zu klären, weiter nichts. Nach Pavettas Tod war Calanthe gebrochen, aber nicht lange. Ihre letzte Hoffnung war die Enkelin. Pavettas Tochter Cirilla. Ciri, ein leibhaftiges Teufelchen, das durch die königliche Burg tobte. Für manche ein Herzchen, weil sie so an Calanthe erinnerte, als diese ein Kind war. Für andere … ein Wechselbalg, die Tochter eines Ungeheuers namens Igel, auf die zudem noch irgendein Hexer ein Recht zu haben meinte. Und jetzt kommen wir zum Kern der Sache: Calanthes Mündel, offensichtlich zur Nachfolgerin ausersehen, geradezu als ihre zweite Verkörperung betrachtet, das Löwenjunge vom Blute der Löwin, war schon damals nach Ansicht einiger von der Thronfolge ausgeschlossen. Cirilla war nicht wohlgeboren. Pavetta war eine Mesalliance eingegangen. Sie hatte das königliche Blut mit dem niederen Blute eines Dahergelaufenen von unbekannter Herkunft vermischt.«
»Schlau, Codringher. Aber so ist es nicht. Ciris Vater war keineswegs von niederer Herkunft. Er war ein Kronprinz.«
»Was sagst du da? Davon wusste ich nichts. Von welchem Königreich?«
»Von irgendeinem im Süden … Von Maecht … Ja, es war Maecht.«
»Interessant«, murmelte Codringher. »Maecht ist seit Langem eine Mark von Nilfgaard. Es gehört zur Provinz Metinna.«
»Aber es ist ein Königreich«, warf Fenn ein. »Dort herrscht ein König.«
»Dort herrscht Emhyr var Emreis«, schnitt ihm Codringher das Wort ab. »Wer immer dort auf dem Thron sitzt, tut es von Emhyrs Gnaden und nach seinem Willen. Aber wenn wir schon einmal dabei sind, dann schau nach, wen Emhyr dort zum König gemacht hat. Ich hab’s vergessen.«
»Ich suche schon.« Der Krüppel drehte die Räder seines Sessels, fuhr quietschend auf ein Regal zu, nahm ein dickes Pergamentbündel heraus und begann es durchzusehen, wobei er die gelesenen Seiten auf den Fußboden warf. »Hmm … Aha. Königreich Maecht. Im Wappen silberne Fische und Kronen im Wechsel im blau und rot gevierten Feld …«
»Pfeif auf die Heraldik, Fenn. Der König, wer ist dort König?«
»Hoët, genannt der Gerechte. Erwählt durch Abstimmung …«
»… Emhyrs von Nilfgaard«, vermutete Codringher in kaltem Ton.
»… vor neun Jahren.«
»Das ist der Falsche«, kalkulierte der Advokat rasch. »Der interessiert uns nicht. Wer war vor ihm?«
»Momentchen. Aha. Akerspaark. Er ist verstorben …«
»Verstorben an einer schweren Lungenentzündung, nachdem in der Lunge das Stilett eines Häschers von Emhyr oder dieses Gerechten steckte.« Abermals glänzte Codringher mit Scharfsinn. »Geralt, weckt besagter Akerspaark bei dir irgendwelche Assoziationen? Könnte das der Papa von diesem Igel sein?«
»Ja«, sagte der Hexer nach kurzer Überlegung. »Akerspaark. Ich entsinne mich, so hat Duny seinen Vater genannt.«
»Duny?«
»So hieß er. Er war ein Prinz, Sohn dieses Akerspaarks …«
»Nein«, unterbrach ihn Fenn, den Blick auf die Pergamente geheftet. »Hier sind alle aufgezählt. Rechtmäßige Söhne: Orm, Gorm, Torm, Horm und González. Rechtmäßige Töchter: Alia, Valia, Nina, Paulina, Malvina und Argentina …«
»Ich nehme die Vorwürfe gegen Nilfgaard und den Gerechten Hoët zurück«, teilte Codringher gewichtig mit. »Dieser Akerspaark ist nicht ermordet worden. Er hat sich einfach zu Tode gebumst. Denn sicherlich hatte er auch noch Bankerte, nicht wahr, Fenn?«
»Hatte er. Jede Menge. Aber einen Duny sehe ich hier nicht.«