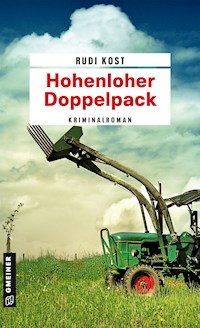Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Silberburg-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Rätselhaftes geschieht im Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen. Eine Leiche verschwindet, taucht aber putzmunter wieder auf – der Spürsinn von Versicherungsvertreter Dillinger ist herausgefordert. Seine Recherchen bringen ihn an seine Grenzen, er beginnt, an seinem Verstand zu zweifeln: Die jahrhundertealten Bauernhäuser fangen an, mit ihm zu sprechen! Oder träumt er? Im dramatischen Finale stellt die Realität alles Mysteriöse in den Schatten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rudi Kost, 1949 in Stuttgart geboren, ist gelernter Journalist und arbeitet seit langem als freier Autor und Herausgeber. Er hat Hörfunkfeatures und Hörspiele geschrieben, PC-Fachbücher, Reiseführer und vieles mehr. Er lebt bei Schwäbisch Hall, wo auch seine Krimiserie um den Versicherungsvertreter Dillinger spielt.
RUDI KOST
Dillinger sieht Gespenster
Hohenlohe-Krimi
Sollte dieses Werk Links auf WebseitenDritter enthalten, so machen wir unsdie Inhalte nicht zu eigen und übernehmenfür die Inhalte keine Haftung.
1. Auflage 2018
© 2018 by Silberburg-Verlag GmbH,
Schweickhardtstraße 5a, D-72072 Tübingen.
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung:
Christoph Wöhler, Tübingen.
Coverfoto: © Stocksnapper – Shutterstock.
Lektorat: Michael Raffel, Tübingen.
Druck: CPI books, Leck.
Printed in Germany.
ISBN 978-3-8425-2111-7
eISBN 978-3-8425-1816-2
Besuchen Sie uns im Internet
und entdecken Sie die Vielfalt
unseres Verlagsprogramms:
www.silberburg.de
Inhalt
Dillinger sieht Gespenster
Nachwort
Ich kam oft hierher. Wenn ich in der Gegend war und die Zeit nicht drängte, stellte ich meinen Porsche ab und schlenderte durchs Freilandmuseum Wackershofen. Neuerdings hatte es mir der Käshof angetan, ich wusste selbst nicht genau, warum. Vielleicht seiner bewegten Geschichte wegen?
Also stapfte ich auch heute den Hügel hoch und trotzte tapfer allen Widrigkeiten.
Ich betrat das mächtige Gebäude über die Außentreppe, die in den ersten Stock führte. Drunter waren die Ställe.
Draußen tobte der März. Aus dem Nieselregen war ein Platzregen geworden, der eklige Wind hatte sich zu einem Stürmchen emporgeschwungen, dass die alten Fensterläden klapperten.
Man nannte das Frühling.
März – das war mal der Monat gewesen, in dem der Bauer die Rösslein anspannte und sich, begleitet von des Frühlings holdem, belebendem Blick, frohgemut hinaus auf seinen Acker begab.
Tempora dingsbums, wie der Lateiner sagt, der ich nicht bin. Eine Erinnerung an längst vergangene Zeiten, wie alles hier im Freilandmuseum. Der Bauer von heute schaute mit sorgenvoller Miene hinaus in das Mistwetter und ließ seinen schweren Traktor im Stall, weil er in den aufgeweichten Äckern versunken wäre.
Ich zog meinen Mantel fröstelnd enger um mich. Was sich Frühling nannte, war heuer wieder mal nichts anderes als die Fortsetzung des Winters unter falschen Vorzeichen. Klimaerwärmung? Am Nordpol vielleicht, doch bis ins Hohenloher Land hatte sie sich noch nicht herumgesprochen.
Wetter! Ich könnte ganz gut ohne auskommen.
Im Haus war es kalt und düster. Es zog wie Hechtsuppe durch alle Ritzen, und davon gab es reichlich in dem Gemäuer. Ich hätte ja Licht machen können mit den altertümlichen Schaltern, aber das fahle Zwielicht kurz vor der Abenddämmerung passte gut zu dem alten Haus. Es erinnerte an die Zeiten, bevor der Strom auf die Dörfer kam. Gleich lugt ein Gespenst um die Ecke und erschreckt mich mit einem Huh!
Anscheinend war ich allein. Wenigstens hörte und sah ich niemanden.
Dafür sah ich etwas anderes.
Mitten auf dem Tisch in der ehemaligen Wohnstube.
DAS DING.
Ich starrte darauf, unfähig, mich zu rühren. Wie das Kaninchen vor dem Kochtopf. Ob das Ding wohl explodierte, wenn ich mich daran zu schaffen machte?
»Hallo? Ist da jemand?«, rief ich.
Kam tatsächlich ein »Nein« zurück? Blödsinn, meine Fantasie spielte mir einen Streich.
Ich ging hinaus in den Flur, stellte mich an die Treppe, die hinauf auf den Dachboden führte, und rief abermals.
Um mich nur Stille.
Im meinem Kopf beharkten sich die Gedanken. Zwar verkündet meine Geschäftspartnerin Sonja, wenn sie mit mir hadert, lauthals die Meinung, ich dächte ohnehin immer nur an das eine, doch das ist eine infame Unterstellung, unverhohlen sexistisch und zudem grottenfalsch. Nein, ich denke nicht immer nur ans Essen. Auch jetzt nicht, obwohl mein Magen knurrte, es war ein langer Tag gewesen. Selbst in einem solcherart geschwächten Zustand war ich in der Lage, mich mit existentiellen Fragen zu befassen.
DAS DING.
Es gab verschiedene Möglichkeiten, die der gesunde Menschenverstand, Anstand und Ritterlichkeit geboten hätten.
Doch ich konnte der Versuchung nicht widerstehen.
Es war eine einmalige Gelegenheit.
Ich war dabei, das letzte Mysterium der Menschheit zu lösen.
Das Geheimnis der Handtasche.
Der Frauenhandtasche wohlgemerkt. Man muss das betonen, seit auch immer mehr Männer mit Handtaschen zu sehen sind. Nicht diese Handgelenkschlenkerer, wie sie früher mal Mode gewesen waren, sondern die richtig großen Oschis, die man über der Schulter trug. War wohl so eine gendermäßige Angleichungsache.
Doch vor mir lag das weibliche Original.
Kein Logo, nur der Markenname klein am Metallschloss. Wenn das Teil echt war, dann war es nicht billig gewesen.
Erste Schlussfolgerung: Die Besitzerin war markenbewusst, hatte Geschmack und Geld.
Und sie war schusselig, vertrottelt oder in Gefahr. Entführt vielleicht von einer Bande krawallostanischer Mädchenhändler?
So eine Handtasche vergisst man nicht einfach so auf dem Esstisch eines alten Bauernhauses.
Etwas stimmte da nicht.
Noch einmal rief ich, nur der Form halber. Das Ergebnis war das gleiche. Die Bande war anscheinend schon über alle Berge.
Vorsichtig öffnete ich die Tasche.
Nichts geschah. Sie explodierte nicht, kein Springteufel kam herausgeschnellt und biss mich in die Nase.
Ich schaute hinein. Eine Ordnung war nicht zu erkennen, deshalb kippte ich den Inhalt kurz entschlossen aus.
Ich weiß, so etwas macht man nicht. Es war unentschuldbar. Die Handtasche einer Frau ist ein Heiligtum.
Aber wenn eine unschuldige Maid um ihr Leben bangen musste? Nicht auszudenken, was die Mädchenhändler mit ihr anstellen mochten!
So einiges polterte auf den Tisch. Ein Ding polterte ganz besonders.
Ich weiß nicht, was genau ich in der Handtasche einer Frau zu finden gehofft hatte. Eine Pistole gehörte definitiv nicht dazu.
Pistole. Knarre. Schießeisen. Ballermann. Bleispritze. Wumme.
Ich kenne mich nicht so gut aus mit diesen Sachen. Ich weiß, dass in Deutschland eine ganze Industrie gut davon lebt, so etwas zu produzieren und zu exportieren, und offenbar ohne schlechtes Gewissen. (Ja, ja, wenn wir’s nicht tun, dann die anderen, und weshalb sollen wir uns ein Geschäft entgehen lassen?) Ich weiß auch, dass diese Dinger ziemlichen Lärm machen und hässliche Folgen haben. Pfui! Ich regle Auseinandersetzungen lieber mit einem geschliffenen Dialog oder mit dem Kochlöffel. Und im allerschlimmsten Notfall war bisher immer Sonja mit ihren imposanten Kampfkünsten rechtzeitig zur Stelle gewesen.
Was einem so alles durch den Kopf geht!
Zum Beispiel: Wer war die Frau, der diese Handtasche gehörte? Und vor allem: Wo war sie?
Von irgendwoher meinte ich, ein Geräusch zu hören.
Das musste nichts zu bedeuten haben. Alte Häuser sind immer in Bewegung, Fachwerkhäuser zumal. Sie leben. Sie ächzen und stöhnen und knirschen. Manchmal schreien sie auch, als wären ihnen die Geschichten, die in ihren Mauern eingeschlossen sind, eine Last.
Die ganz banale Erklärung für uns aufgeklärte, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zugedröhnte Menschen des einundzwanzigsten Jahrhunderts ist natürlich, klar, dass das Holz arbeitet. Die Witterungseinflüsse – Kälte, Wärme, Feuchtigkeit – sorgen dafür, dass sich das Holz dehnt und wieder zusammenzieht.
Es war mehr so ein Ächzen, und es klang nicht hölzern.
Trieb da der Käshof-Geist sein Unwesen und wartete auf Besucher, die er erschrecken konnte?
Nicht mit mir, Freundchen! Ich wollte schon lange mal mit einem echten Geist plaudern.
Es war jetzt mehr so ein Stöhnen, und ich konnte nicht genau lokalisieren, woher es kam.
Vielleicht von dem Ofen, der gusseisern und kalt in der Ecke stand? Vielleicht bibberte der Geist und bettelte um ein kleines Feuerchen?
Ich hätte es ihm nicht verdenken können.
In dem alten Käshof gab es keine Wohlfühltemperaturen. Wie es früher gewesen war, von den wenigen Räumen abgesehen, die beheizt werden konnten, und das war immer die Küche und vielleicht auch noch die Wohnstube. Im Rest des Hauses fror man sich einen ab. Der arme Geist musste im Laufe der Jahrhunderte einiges ausgestanden haben.
Können Geister überhaupt frieren?
Jetzt war es mehr so etwas Unbestimmtes, und es kam eindeutig von oben.
Ich ging wieder aus dem Wohnzimmer in den Flur und stieg die Treppe hinauf auf den Dachboden. Hier konnte eigentlich niemand sein, ich hatte vorhin ja mehrmals gerufen.
Die Dämmerung war noch nicht vollständig angebrochen, trotzdem war es schummrig in dem großen Raum. Die wenigen Fenster konnten auch nur den trüben, trostlosen März hereinlassen.
Es war still.
»Na, du Gespenst?«, rief ich in die Stille hinein. »Jetzt hat’s dir wohl die Sprache verschlagen!«
Es war mehr so ein Wimmern nun, und es kam von noch weiter oben.
Eine Treppe aus grob behauenen Holzbohlen führte zum zweiten Stock des Dachbodens. Oben war der Zugang durch ein Gatter eher symbolisch verwehrt.
Vorsichtig setzte ich einen Fuß auf die unterste Stufe. Warum vorsichtig? Hier oben war doch niemand. Nicht einmal das Gespenst hatte mir geantwortet.
Ich stieg eine Stufe weiter. Die Bohlen knarzten. Die Treppe sprach mit mir, aber ich verstand nichts.
»Zeige dich, Gespenst«, rief ich, »und kämpfe wie ein Mensch.«
Hätte mich jemand gehört, er hätte mich für total meschugge halten müssen. Aber hier war ja niemand, sagte ich mir ein ums andere Mal. Bis auf das Gespenst natürlich.
Es war still. Kein Ächzen, kein Stöhnen, kein Wimmern. Gar nichts. Der Wind legte zu und ließ irgendwo irgendwas ganz heftig klappern. Schreckhafteren Naturen als ich konnte schon etwas mulmig werden, der Gruselfaktor war eindeutig gestiegen.
Konnte mich das beeindrucken? Nicht im mindesten, mich doch nicht!
Und dann geschah es.
Ich wusste nicht, wie lang ich unten an der Treppe im Regen lag, bis ich mühsam wieder auf die Beine kam. Ich wusste nicht, wie ich es zu meinem Auto schaffte. Ich erinnerte mich nur, dass ich mich zwischendurch verfluchte, weil ich mir ausgerechnet das Haus ausgesucht hatte, das am weitesten weg vom Eingang und mithin vom Parkplatz war.
Benommen versuchte ich mir zusammenzureimen, was geschehen war.
Der Käshof. Ein Geräusch. Vielleicht ein Schrei? Der Dachboden. Die Holzbohlentreppe zum zweiten Stock des Dachboden. Ich hatte gerufen, niemand da.
Eine voreilige Schlussfolgerung. Niemand hatte geantwortet.
Von dort oben, wo nichts war, kam etwas herabgestürzt und klatschte mir auf den Kopf. Es war nicht der kalte Hauch des Todes, der da nach mir griff, sondern etwas viel Handfesteres. Und Größeres. Und Schwereres. Groß und schwer genug, um mich aus dem Gleichgewicht zu bringen.
Die Treppe hatte nur auf ihrer rechten Seite eine Holzstange als Geländer. Die Stange war mal ein dünnes Bäumchen gewesen, das man aus dem Wald mitgenommen, entastet und entrindet hatte. Viele Hände aus vielen Jahrhunderten hatten die Stange glattgeschliffen.
Ich griff danach, aber ich griff daneben, und das Etwas warf mich von der Treppe und erst ärschlings, dann rücklings auf den Boden. Etwas lastete schwer auf mir.
Und dann kam aus dem Nirgendwo ein Schlag, traf mich irgendwo, und um mich wurde es schwarz.
Als ich wieder zu mir kam, war um mich das Nichts, die vollkommene Leere, so schwarz wie die Nacht. Nun ja, war wohl auch Nacht inzwischen. Über mir war ein Dach, folgerte ich messerscharf, denn ich hörte den Regen trommeln.
Ich versuchte mich zu sortieren. Was war geschehen? Wo war ich? Wer war ich?
Letzteres war eine Frage von so philosophischer Komplexität, dass sie mich eindeutig überforderte. Einem armen Versicherungsvertreter wie mir verursachte das Nachdenken darüber nur Kopfschmerzen. Rasende Kopfschmerzen.
Ich rappelte mich hoch, stöhnend und fluchend. Eine Welle von Schmerz durchflutete meinen Körper. Messerscharf.
Ein Indianer kennt vielleicht keinen Schmerz, aber ich schon. War ich denn Winnetou? Offensichtlich hatte ich eine intensive Begegnung mit Old Schmetterhand gehabt, die er eindeutig zu seinen Gunsten entschieden hatte.
Deduktion, Sherlock Holmes? Ich lebte noch, so halbwegs wenigstens. Also einer von denen, die ich war. Über die anderen von mir ließ ich mich besser nicht aus.
Das Epizentrum meiner Qual lag, soweit ich das feststellen konnte, an meinem linken Hinterkopf, am Hals, an der Schulter, am Arm … eigentlich überall, und es schickte seine Stacheln durch jeden meiner Muskeln. Böse Stacheln. Stacheln mit Widerhaken.
»Arschloch, hinterhältiges!«, schrie ich in die Dunkelheit. Es war nicht anzunehmen, dass mich jemand hörte. Ich konnte mir gefahrlos noch ein paar hübsche Beschimpfungen einfallen lassen, aber mir fehlte die Kraft dazu.
Irgendwo raschelte es.
Nur eine Maus, beruhigte ich mich.
Mein Smartphone protzte auch mit einer Taschenlampe, auf die ich durch Zufall mal gestoßen war. Ich wischte und drückte, mal hier, mal da, stieß auf hochinteressante Funktionen, die mir bisher verborgen geblieben waren, aber die Taschenlampe war nicht darunter. Der Zufall ließ sich nicht wiederholen. Einerlei, der Akku war ohnehin fast leer.
Ja, ja, im Dunkeln ist gut munkeln. Warum fiel mir ausgerechnet jetzt so ein dummer Sinnspruch ein, der in meiner derzeitigen Situation wenig hilfreich war? Hatte der Schlag etwas durcheinandergebracht in meinem Schädel?
Im bläulichen Schein des Displays schaute ich mich um.
Irgendwo hier musste eine Leiche liegen. Ich ging davon aus, dass es eine Leiche war, die aus der Höhe gestürzt war. Jedenfalls wäre es eine gewesen, als sie zu meinen Füßen aufschlug.
Na bitte, ein wenig logisches Denken war noch möglich.
Oder eine Puppe, um mich zu erschrecken. Was eindeutig gelungen war.
Aber um mich war: das Nichts. Keine Leiche, keine Puppe. Nichts außer dem kunstvoll gezimmerten Dachstuhl eines alten Bauernhauses.
Ich sah doch keine Gespenster!
Ich richtete mein Smartphone in die Höhe. Das fahle Licht verlor sich zwischen dem Gebälk.
»Zeige dich, Satan!«, brüllte ich in die Dunkelheit.
So ein bisschen infernalisches Gelächter hätte ich jetzt schon erwartet. Stattdessen: nichts. Selbst die Maus hatte sich anscheinend erschreckt verzogen. Ich würde mich vor mir auch fürchten.
Ich betastete meinen Hinterkopf. Ein Schlag auf den Schädel, und du bist eine Schönheit. Blut spürte ich keines, nur eine Beule. Sehr rücksichtsvoll von meinem Angreifer. Ein Profi, der genau gewusst hatte, wie er den Schlag führen musste? Oder der nicht viel Kraft gehabt hatte? War »der« vielleicht eine »die«? Warum ging ich automatisch davon aus, dass ein Mann mir eines übergezogen hatte? Angesichts der fitnessstudiogestählten jungen Frauen von heute war das ja eine schreckliche sexistische Diskriminierung!
Ich quälte mich die Treppe in den Flur hinunter und schleppte mich in Richtung Wohnstube. Irgendwas war dort gewesen, bloß was? Ich würde mich schon wieder erinnern, wenn ich dort war. Alter Trick: Wenn du etwas vergessen hast, gehe den Weg zurück, den du gekommen bist.
Kaum hatte ich die Stube betreten, ging meinem Smartphone der Saft aus, und ich stand in der stockschwarzen Nacht.
Nein, ich fürchtete mich nicht, nicht im Geringsten. Deduktion, Sherlock Holmes? Wenn ich nichts sehe, sieht auch mich niemand. Nicht einmal der Mensch, der mich niedergeschlagen hatte. Oder das Mensch?
Dennoch kam in mir Panik hoch. Ich hatte jegliche Orientierung verloren, in meinem Kopf war ein ganzes Bergwerk an arbeitswütigen Zwergen am Hämmern und Bohren, ich konnte nicht mehr klar denken.
Ich könnte ja Licht machen, doch dazu müsste ich die Lichtschalter erst einmal finden.
Ich tastete mich mit ausgestreckten Armen voran und stieß mit dem Oberschenkel gegen etwas. Der Tisch? Ich tastete weiter, verruckte etwas mit scharrendem Geräusch. Ein Stuhl? Ein Stuhl. Um den Tisch in der Wohnstube standen Stühle, daran erinnerte ich mich.
Der Tisch. Ich wischte darauf herum, um zur Orientierung eine Kante zu finden. Meine Finger ertasteten etwas. Was? Was war vorhin auf dem Tisch gewesen? Ein Schwindel überfiel mich, ich hielt mich krampfhaft fest, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Der Anfall ging vorüber. Ich versuchte, mich zu erinnern, wo ich war.
Also der Tisch. Also ganz einfach. Eine Kehrtwendung um 180 Grad, dann geradeaus weiter zur Tür in den Flur. Geradeaus? Oder leicht versetzt nach rechts? Oder links?
Ich weiß nicht, wie ich in den Flur gelangte. Ich war wie in Trance. Ein Teil von mir wollte nur raus aus diesem Haus, ein anderer Teil wollte nur seine Ruhe haben.
Im Flur. Die Eingangstür. Abgeschlossen, natürlich. Und der Museumsaufseher hatte sich nicht vergewissert, ob noch jemand im Haus war. Vielleicht hatte er gerufen und keine Antwort bekommen. Ich konnte nicht, und wer immer mir eins übergezogen hatte, wollte ganz bestimmt nicht.
Mit dem geeigneten Werkzeug und bei Licht wäre es vielleicht möglich gewesen, das alte Schloss zu knacken. Beides hatte ich nicht, ich gehörte nicht mehr zu der Generation, die immer ein Taschenmesser nebst Schnur und Angelhaken in der Hosentasche mitschleppte.
Neben der Eingangstür war ein Fenster. Ich tastete es ab. Bingo! Es ließ sich öffnen. Ich zwängte mich hindurch.
Was ich nicht bedacht hatte: Direkt unter dem Fenster befand sich die Außentreppe.
Ich fiel auf harten Stein und kullerte die Treppe hinunter. Wenn das die Schauspieler bei den Freilichtspielen auf der Großen Treppe vor St. Michael machten, sah das sehr viel eleganter aus. Und sie brüllten auch nicht wie am Spieß vor Schmerz.
Es waren nicht dreiundfünfzig Stufen wie bei der Freitreppe, aber mir reichten sie vollauf. Ich spürte jede einzelne.
Irgendwie kam ich nach Hause, und je größer der Abstand zu Wackershofen wurde, desto verwirrter war ich. War das tatsächlich alles geschehen, oder hatte ich mir das nur eingebildet?
Ich warf mich aufs Bett, wie ich war, mitsamt meinen nassen, verdreckten Kleidern. Wirre Alptraumfetzen überfielen mich, die kein klares Bild ergaben. Ich kämpfte gegen ein Gespenst, das standesgemäß ganz in Weiß gekleidet war. Ich machte einen Ausfallschritt, aber das Gespenst löste sich plötzlich auf und materialisierte sich hinter mir wieder und schlug zu. War das nicht gegen die Regeln? War es nicht so, dass Gespenster nur erschreckten und Schabernack trieben? Ich wollte protestieren, aber ich versank wieder im Dunst der Träume.
Am nächsten Morgen, gleich in der Frühe, schleppte ich mich mühsam zum Arzt meines Vertrauens. Der Drache an der Rezeption, Mitte fünfzig mit praktischer grauer Kurzhaarfrisur, hatte keinerlei Mitleid mit meinen Qualen, die ich doch ausdünsten musste wie ein Pennbruder seinen Alkohol, und wollte mir einen Termin ungefähr im nächsten Jahrtausend geben.
»So lange kann ich nicht warten«, sagte ich. »Es ist dringend.«
Ungerührt erwiderte sie: »Das sagen sie alle. Einer nach dem andern. Das Wartezimmer ist voll.«
»Es geht um ein neues Rezept für eine Lammkeule.«
Misstrauisch beäugte sie mich. »Lammkeule? Ich glaube nicht, dass die in unserem Leistungskatalog steht.«
»Kleiner Scherz. Irgendein Problem mit der Versicherung. Er hat’s eilig, nicht ich.«
Ihr Misstrauen blieb. Ich wusste, dass mein Charme bei ihr nicht verfing.
Ich schob nach. »Hat was mit einer zusätzlichen Altersversorgung für seine Angestellten zu tun, glaube ich.«
In der Not sind kleine Lügen erlaubt, der Herr würde es vergeben. Vor allem, wenn sie wirken.
Der Doktor saß an seinem Schreibtisch, vor sich eine Tasse mit Kaffee und einen Teller mit Kuchen, und las in einem Buch, das nicht nach Fachbuch aussah.
Ich schaute ihn vorwurfsvoll an. »Du sitzt hier gemütlich an deinem Schreibtisch, und draußen drängeln sich leidende Menschen in deinem Wartezimmer!«
Er biss genussvoll in seinen Kuchen, eine Nussrolle, wie es aussah.
»Ah!«, sagte er genießerisch. »Hat Gerlinde gebacken, die Sprechstundenhilfe mit der Stupsnase. So fängt der Tag gut an! Weißt du, das ist ein alter psychologischer Trick. Kennst du doch selber. Du hockst im Wartezimmer, blätterst in langweiligen Zeitschriften, und je länger du hockst, umso weniger Beschwerden hast du. Ich habe da so eine Theorie. Lass sie drei Tage hocken, und alle sind von alleine wieder gesund.«
»Es gibt auch den umgekehrten Fall«, gab ich zu bedenken. »Du gehst gesund zu deinem Arzt wegen einer harmlosen Vorsorgeuntersuchung und kommst todkrank wieder heraus.«
»Wenn das eine Spitze gegen meinen ehrenwerten Status als Halbgott in Weiß sein soll, dann prallt sie wirkungslos an meinem mit Liebe gepflegten Bauch ab.«
Er strich sich über die Kugel, die sich in seiner Leibesmitte wölbte, und schlürfte genießerisch seinen Kaffee. »Eine ganz seltene Sorte, schwer zu kriegen. Ein Excelsa, der beste von allen.«
»Abgesehen von einem Kopi Luwak.«
»Du meinst den, den die Schleichkatzen ausgeschissen haben? Tja, bloß, wo kriegt man den her? Hast du eine Quelle?«
»Warum frühstückst du eigentlich nicht zu Hause?«
»Zu Hause gibt es nur Müsli. Wegen der Kalorien und der Gesundheit. Meine Frau hat da etwas abseitige Vorstellungen und führt ein strenges Regiment.«
»Und dieses Regiment schließt auch den Drachen in deinem Vorzimmer mit ein? Früher war da eine ausnehmend hübsche und gut gebaute Blondine.«
»Das ist auch ein psychologischer Trick, aber den verrate ich dir nicht, du musst ja nicht alles über meine Ehe wissen. Aber Schluss mit dem Gequatsche, das Wartezimmer ist voll mit bemitleidenswerten Kranken, hast du gesagt, und du Hypochonder drängelst dich vor? Was willst du?«
Ich zeigte ihm meinen Hals und die angeschlossenen Partien. Also den Rest meines Körpers.
Er kniff die Augen zusammen und schüttelte ungläubig den Kopf. »Wie siehst du denn aus? Hat dich eine unbefriedigte Geliebte mit dem Wellholz davongejagt?«
»Mich wollte jemand mit einer Lammkeule erschlagen, weil ich dein Spezialrezept nicht verraten wollte.«
»Schmarrn! Das kennst du doch gar nicht.«
»Da siehst du mal, was du mit deiner Geheimniskrämerei anrichtest. Ich werde fast erschlagen für etwas, das ich gar nicht weiß. Könntest du mir nicht …?«
»Nie im Leben! Das Rezept nehme ich mit ins Grab, Kollateralschäden sind mir egal. Was ist wirklich passiert?«
»Das geht dich nichts an, und du würdest mir sowieso nicht glauben. Ich will nur, dass du das wieder wegmachst, aber pronto, die Schmerzen sind unerträglich.«
»Hast wieder einen Fall am Wickel, Dillinger, was? Nun ja, wer sich in Gefahr begibt, macht sich die Füße nass. Mach dich mal frei.«
»Ganz?«
»Die Unterhose kannst du anbehalten, es sei denn, diese Region ist auch in Mitleidenschaft gezogen.«
»Mein Steißbein.«
»Dann also alles.«
»Weißt du, was du mir damit antust?«
»Weißt du, was du mir damit antust?«
Mühevoll schälte ich mich aus meinen Kleidern, genauso mühevoll wie heute morgen, als ich erwacht war. Mein Bett hatte ausgesehen wie nach einer Schlammschlacht.
Es dauerte eine Weile, bis ich nackig vor ihm stand. Er ging um mich herum und betrachtete mich von allen Seiten wie einen Preisbullen.
»Mann, Mann, Mann, Dillinger, die haben dich aber zugerichtet! Was ich da sehe, lässt mein Medizinerherz hüpfen.«
Es klopfte, aber das Klopfen war nur symbolisch gemeint, denn im gleichen Moment wurde die Tür aufgerissen, und der Drache aus dem Vorzimmer kam herein. Sie legte etwas auf den Schreibtisch und würdigte mich keines Blickes. Die früher hier tätige ausnehmend hübsche und gut gebaute Blondine hätte bestimmt anders reagiert.
Dann stutzte der Drache jedoch, guckte mich verkniffen von oben bis unten an und sagte böse: »So sehen Versicherungsgeschäfte aus?«
Als sie sich zum Gehen wandte, hielt sie der Doktor zurück.
»Schauen Sie sich das mal an, Frau Krummbolz! Sind das nicht Hämatome wie aus dem Bilderbuch? Und diese Schürfwunden erst! Was meinen Sie, kriegen wir das wieder hin oder müssen wir ihn notschlachten? Dreh dich mal, Dillinger!«
Ich drehte mich nicht.
Sie schaute mir aufs Gemächt und dann ins Gesicht und sagte: »Notschlachten!« Und weg war sie.
Den subtilen Humor des medizinischen Personals hatte ich schon immer bewundert. Ich funkelte den Doktor wütend an: »Musste das sein? Kannst du dir vorstellen, dass mir das oberpeinlich war?«
»Nö«, sagte er ungerührt.
Er drückte an mir herum, mal hier, mal da, ich biss die Zähne so zusammen, dass ich als Nächstes unbedingt meinen Zahnarzt konsultieren sollte, und ich gebe zu, einige Male schrie ich auch auf. Es tat höllisch weh.
»Nun hab dich nicht so, Dillinger!«, sagte er und drückte weiter. »Dein wichtigstes Organ scheint noch intakt zu sein, und an den paar blauen Flecken wirst du nicht sterben. Allerdings werden sie deinen Astralkörper noch eine Weile verzieren. Bist du die Treppe hinuntergefallen oder was?«
Er drückte, und ich schrie auf.
»Tut weh, was? Wird noch eine ganze Zeit so bleiben. Ist doch schön, wenn man seinen Körper spürt.«
»Du hast das Gemüt eines Schlachters«, stöhnte ich.
»Es wäre in der Tat interessant, mal über die Gemeinsamkeiten beider Berufsstände zu diskutieren«, sagte er. »Aber das sollten wir bei anderer Gelegenheit tun, vielleicht bei der Lammkeule, die dich nicht getroffen hat. Jetzt nicht, ich möchte zum Mittagessen rechtzeitig zu Hause sein.«
Er drückte noch einmal irgendwo ganz kräftig, und ich sah mich nach einem Skalpell um, das ich in seinen Bauch rammen konnte.
»So, Dillinger, und jetzt zu deinem wunderschön verfärbten Nacken. Ich möchte dem Urteil der Gerichtsmedizin nicht vorgreifen, aber ich tippe auf einen stumpfen Gegenstand. Doch ein Wellholz? Hast du heute schon geduscht?«
»Unter Qualen.«
»Normalerweise begrüße ich es sehr, wenn meine Patienten nicht stinken wie ein Schweinestall, aber in diesem Fall ist das schlecht. Ganz schlecht. Sonst könnten wir anhand der Rückstände auf die Tatwaffe schließen. Vielleicht war es ja doch kein Wellholz. Vielleicht war es ein handbeschlagener Eichenbalken von 1585. Erstaunlich, was man heute alles feststellen kann. Die können dir sogar sagen, wie der Zimmermann hieß, der den Balken behauen hat, und dass er Linkshänder war. Und aus welchem Wald der Baum kommt. Können die alles herausfinden.«
Mein Misstrauen war geweckt. »Wie kommst du auf 1585?«, fragte ich. Das war das Jahr, auf das man den ältesten Kern des Käshofes datierte.
»War nur so dahergesagt«, meint er. »Könnte auch 1586 sein. Also, kommen wir zum Fazit. Die erste gute Nachricht: Du lebst noch, aber das hast du ja selbst schon gemerkt. Die zweite: Du wirst diese Attacke überleben, aber du wirst noch eine Zeitlang ein paar schöne Schmerzen haben. Sieht nach einer leichten Gehirnerschütterung aus, aber das steckt dein Dickschädel weg. Du hast wahrscheinlich einige Erinnerungslücken, aber freu dich nicht zu früh, die kommen wieder. Ehrlich, Dillinger, dich haben sie ganz schön fertiggemacht. Ich rate zur körperlichen Schonung. Keine heftigen Bewegungen, vor allem nicht in der Horizontalen. Das musst du der Dame mit dem Wellholz verklickern. Ansonsten ist mit dir körperlich alles in Ordnung, abgesehen von der Wampe, die du vor dir herschiebst. Aus purer Gehässigkeit sollte ich dir vegane Schonkost verschreiben. Du solltest in nächster Zeit weiterhin deinen Schal tragen, wenn du blöde Frage vermeiden willst. Als Knutschfleck geht das nicht mehr durch.«
»Mann, quasselst du alle deine Patienten so voll?«
»Nur die Privatpatienten.«
Während ich mich unter Qualen wieder anzog, fragte ich ihn: »Glaubst du an Gespenster?«
»Sicher. Mein Wartezimmer ist voll davon.«
»Du meinst die Siechen und Lahmen, die zu dir kommen in der Hoffnung auf Heilung?«
»Ach, Heilung! Weißt du, was die beste Medizin ist? Gute Ernährung, wobei es eigentlich egal ist, was du isst, Hauptsache, du tust es mit wirklichem Genuss – neueste Studien, mein Lieber –, außerdem viel Bewegung an der frischen Luft, viel Sex und eine gute Flasche Wein. Mehr brauchst du nicht, um gesund zu bleiben. Die paar Wehwechen, die dich ab und zu plagen, regelt dein Körper alleine. Sogar deine Hämatome.«
»Und das sagst du deinen Patienten genau so?«
»Bin ich blöd? Dann ist mein Wartezimmer schnell leer. Ich muss an die Miete denken, an die Gehälter für meine Angestellten und an meine Lammkeule.«
»Und an einen Porsche.«
»So ein Proletenauto wie du fahre ich nicht, das weißt du.«
»Aber du träumst davon, gib’s zu.«
»Ich träume von einem Bugatti Chiron. Sechzehn Zylinder. 1500 PS. Zweiter Zündschlüssel, damit du auf über 400 km/h kommst. Schluckt innerorts 35 Liter. Jedes Auto ein Unikat.«
»Ein total unnützes Auto.«
»Völlig. Nur ein Spielzeug. Deshalb träume ich davon, verstehst du?«
»Kostenpunkt?«
»Sagen wir mal so: Ich brauche jetzt haufenweise solche Privatpatienten wie dich. Ich rechne mal aus, wie oft du dich noch verprügeln lassen musst. Was glaubst du, weshalb ich mich so lange mit dir abgebe? Aus Freundschaft? Aus ärztlichem Verantwortungsgefühl? Quatsch! Dich kann ich nach Zeit abrechnen und ein bisschen schummeln dabei. Für die armen Kassenpatienten da draußen im Wartezimmer gibt’s im Quartal gerade mal zwanzig Euro. Ich verschreibe dir eine Salbe, die die Durchblutung fördert. Geht auch ohne, aber vom Onkel Doktor will man ja was mitnehmen, nicht wahr? Das hilft mir und der Pharmaindustrie erst recht und dir auch, wenn du daran glaubst. Regelmäßig einreiben.«
»Wie stellst du dir das vor? So hoch bringe ich meinen Arm derzeit nicht.«
»Lass das deine Liebste machen.«
»Gibt zur Zeit keine.«
»Schlecht. Was habe ich dir vorhin gesagt? Schnackseln hält gesund.«
»Keine heftigen Bewegungen, hast du gesagt.«
»Du wirst dir schon was einfallen lassen. Über den Rest meiner wohlgemeinten Ratschläge brauche ich mir bei dir ja keine Sorgen zu machen. Übrigens, das Angebot mit der Lammkeule steht. Und jetzt verpiss dich. Ich habe zu tun.«
Ach, ich liebte seine einfühlsame Art!
Beim Hinausgehen begegnete ich Gerlinde mit der Stupsnase, und was ich sah, ließ in mir die Hoffnung aufkeimen, dass an ihr nicht nur die Backkünste interessant sein könnten. Vielleicht könnte ich sie dazu überreden, mir regelmäßig meinen Nacken einzureiben?
Aber da war sie auch schon wieder verschwunden. Wie eine Geistererscheinung.
Unterwegs traf ich auf Padre Giorgio Baffini. Er war vor Urzeiten vom Vatikan als klerikaler Gastarbeiter nach Hohenlohe geschickt worden, fand allerdings an Maultaschen und Blooz mehr Gefallen als an Ravioli und Pizza, so dass er nicht mehr zurückwollte. Wie so viele, die das mit dem »Gast« nicht so wörtlich genommen hatten, wie es gemeint war. Und jetzt hatten wir den Multikulti-Salat.
Ich hatte mit seinem Verein nichts am Hut, genauso wenig wie mit den Kollegen von der Konkurrenz, aber man kann sich ja nicht aussuchen, wem man in unserem Städtchen über den Weg läuft.
Man kannte sich, grüßte höflich und machte Small Talk. Ich hatte den Eindruck, dass er auf meine Sticheleien und Gehässigkeiten durchaus lustvoll einstieg, doch wenn er sie leid war, verwickelte er mich in einen theologischen Disput, dem ich nicht gewachsen war und der mich jedes Mal schnell in die Flucht trieb. Er merkte, dass dieses Schaf nicht zurückzuholen war, und ich hielt fruchtlose Streitereien für Zeitverschwendung. Das Leben war so kurz, wie ich heute Nacht am eigenen Leib erfahren hatte.
Apropos.
»Was sagt Ihr Boss eigentlich zu Gespenstern?«, fragte ich.
»Vor Gott sind alle gleich, mein Sohn.«
»Im Ernst jetzt.«
»Im Ernst jetzt. Mit dem Namen des Herrn würde ich nie Scherze treiben.«
Mit dem Namen des Herrn vielleicht nicht, aber mit mir schon. Eigentlich war er ein netter Kerl, der Herr Pfarrer. Man sah ihm an, dass er von Askese nicht viel hielt, mir war bekannt, dass er einen guten Tropfen zu schätzen wusste, und das allein machte ihn sympathisch.
Er musterte mich aufmerksam. »Sie sehen ganz schön mitgenommen aus. Eine unliebsame Begegnung mit einem Gespenst?«
»Wie kommen Sie auf ein Gespenst?«
»Sie haben es ins Spiel gebracht. Brauchen Sie geistigen Beistand?«
»Ich weiß, ein Ave Maria hilft immer.«
»Besser wohl eine Maria«
Ich sah ihn verblüfft an. Das aus dem Munde eines Padre?
»Ich meine jemanden, der Sie pflegt und sich liebevoll um Sie kümmert«, erläuterte er. »Ihre Verletzungen werden verheilen. Doch es gibt Wunden, die tiefer gehen. In Ihnen gärt es, Sie sind mit sich selbst nicht im Reinen.«
»Und das lesen Sie aus meinen Blutergüssen?«
»In Ihren Augen. Wenn man Jahrzehnte seelsorgerisch tätig ist, lernt man viel über die Menschen.«
Manchmal gärte es in mir in der Tat, und ich ließ mich nur zu gern zu einer Provokation hinreißen, zumal wenn die nagenden Schmerzen mich alles andere als friedfertig machten.
»Maria also«, sagte ich. »Und wie kriegen wir das mit dem Zölibat auf die Reihe?«
»Das ist ein Problem, das nur mich betrifft.«
»Sagten Sie Problem?«
»Sagte ich, in der Tat. Aber das ist ein Thema, das Sie in Ihrem Zustand bestimmt nicht diskutieren möchten. Gott befohlen!«
Sprach’s und ging von dannen. Ich starrte ihm mit offenem Mund hinterher. Was war das denn?
Padre Giorgio Baffini war ein Mann Ende fünfzig, vielleicht auch etwas darüber, der, so hatte es den Anschein, zufrieden in sich oder was auch immer ruhte. Immer freundlich, von heiterer Gelassenheit und manchmal bissigem Humor. Jemand, der im Laufe seines Lebens, das glaubte ich ihm gern, schon alles gesehen und gehört hatte, den nichts mehr zu erschüttern vermochte. Ein treuer Diener seines Herrn, fest im Glauben und den Ritualen und den Einschränkungen, die sein Beruf mit sich brachten.
Den Eindruck jedenfalls hatte ich bisher von ihm gehabt. Schlichen sich bei ihm jetzt plötzlich Zweifel ein? Oder drängte nur nach oben, was verdrängt war? Bezog sich seine Feststellung, dass ich mit mir nicht im Reinen sei, vielleicht eher auf sich? Wenn ich so über ihn nachdachte, konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass er mir auf eine seltsame Art angespannt vorkam. Was gärte da in ihm?
Ich schubste die Gedanken auf die Seite. Ich hatte meine eigenen Sorgen.
Als ich endlich in unser Büro in der Gelbinger Gasse wankte, sah Sonja nicht auf und tat so, als wäre sie schwer beschäftigt. Das machte meine Partnerin immer so, wenn sie sauer auf mich war.
»Ist ja schön, dass du auch noch unter den Lebenden weilst«, sagte sie spitz. »Aber es ist noch nicht zu spät, es ist noch jede Menge Arbeit übrig für dich.«
Ich stöhnte.
»Ja, ich weiß, du magst diesen ganzen Papierkram überhaupt nicht«, sagte sie und schob den ganzen Papierkram auf ihrem Schreibtisch hin und her. »Aber du kannst das nicht alles mir allein überlassen, du musst auch deinen Teil dazu beitragen. Ich bin nicht deine Angestellte, ich bin Partnerin.«
Ich stöhnte.
»Ich bin dafür, dass wir jetzt gleich eine Gesellschafterversammlung abhalten, um dieses Problem ein für alle Mal zu lösen«, sagte sie.
Ich stöhnte noch lauter.
»Ich glaube, du weißt genau, was auf dich zukommt, also lass dieses alberne Gestöhne.«
Jetzt endlich drehte sie sich um. Ich nahm meinen Schal ab.
»Um Himmels willen, Dillinger! Wie siehst du denn aus! Bist du unter die Räder gekommen?«
»Du hältst mich für verrückt, wenn ich dir das erzähle.«
»Sowieso. Warst du schon beim Arzt?«
»Natürlich.«
»Und was sagt er?«
»Wird schon wieder, sagt er. Aber das sagen sie immer, selbst wenn Gevatter Tod schon seine Sense wetzt.«
»Erzähl!«
»Gestern Abend in Wackershofen. Im Käshof. Auf dem Dachboden. Eine Leiche ist auf mich gefallen, und jemand hat mich auf den Kopf gehauen oder in den Nacken oder beides, das weiß ich nicht mehr so genau, und als ich wieder zu mir gekommen bin, war die Leiche weg.«
Sonja schaute mich lange an, ohne etwas zu sagen.
»So, so«, sagte sie schließlich.
»Ich wusste doch, dass du mir nicht glaubst!«
»Eine Leiche. So, so. Warum meinst du, dass das eine Leiche war?«
»Weil ich immer über Leichen stolpere.«
»Diesmal nicht. Diesmal ist sie auf dich gefallen, wenn ich dich richtig verstanden habe, und dann davonspaziert.«
»Abwechslung muss sein. Aber danach bin gestolpert. Irgendwie.«
»Weil dich die Leiche k.o. geschlagen hat.«
»Das muss jemand anderes gewesen sein. Die Leiche hat mich nur umgeworfen.«
»Nun ja, manches haut auch den stärksten Mann um, wie man so schön sagt. Diesmal war’s eben eine Leiche. Aber sonst geht’s dir gut, oder?«
»Überhaupt nicht! Diese Schmerzen! Bis in den kleinen Zeh! Ich bin dann nämlich hinterher auch noch die Treppe hinuntergefallen.«
»Die Treppe. So, so. Allmählich kommen wir der Sache näher.«
»Vom Käshof. Weil ich aus dem Fenster klettern musste.«
»Aus dem Fenster. So, so.«
»Glaubst du, ich bilde mir das alles nur ein?«
»Du hast etwas wahrgenommen, und du interpretierst es nach deinem Erfahrungshorizont. Meinetwegen auch nach deinen Erwartungen. Deine Interpretation wiederum verändert retrospektiv deine Wahrnehmung.«
Das hatte Sonja sehr schön gesagt, aber ihr Gesichtsausdruck dabei gefiel mir gar nicht. Er war irgendwie … skeptisch. Oder mitleidig?
»Mit anderen Worten«, sagte ich, »du denkst, ich sehe Gespenster.«
»Durchaus möglich. Im übertragenen Sinne zumindest.«
»Hm. Da ist noch etwas Mysteriöses. Was hast du in deiner Handtasche?«
»Was hat das mit deiner angeblichen Leiche zu tun?«
Aha! Jetzt redete sie schon von einer »angeblichen« Leiche. Ich sagte: »Wirst du gleich sehen. Jetzt sag!«
»Vorsicht, Dillinger, ganz heikles Thema! Die Handtasche ist ungefähr das Intimste, was eine Frau hat! Genauso gut könntest du mich fragen, welche Unterwäsche ich trage.«
»Und welche trägst du?«
»Idiot!«
»Interessiert mich ja auch gar nicht. Deine Handtasche schon. Es ist nämlich so. Als ich in den Käshof gekommen bin, lag eine Handtasche auf dem Tisch, aber niemand war da.«
»Sicher. Das machen Handtaschen so. Liegen frauenlos auf einem Tisch herum.«
»Ich habe gerufen, und niemand hat geantwortet. Und dann habe ich hineingeschaut.«
Sonja sah mich empört an. »Dillinger, das macht man nicht! Unter keinen Umständen!«
»Ich weiß. Ich bin auch schwer bestraft worden dafür. Du weißt schon, die Leiche, mein Kopf und so.«
»Wo ist da der Zusammenhang?«
»Weiß ich noch nicht.«
»Was war das für eine Handtasche?«
»Eine Handtasche halt. Ist doch eine wie die andere.«
»Kannst du sie beschreiben?«
»Ich kann sie dir sogar zeigen. Ich habe sie oben in meiner Wohnung. Ich hole sie schnell.«
Schnell allerdings ging gar nicht. Meine Schmerzen hatten sich metastasenartig über den ganzen Körper verbreitet. Ich sah den Zeitpunkt kommen, da ich mich nur mit einem Rollator vorwärts bewegen konnte. Vielleicht gar mit einem Rollstuhl.
Als ich unser Büro wieder betrat, die Handtasche im Arm, fragte Sonja: »Du hast sie einfach so mitgenommen?«
»Muss ich wohl«, erwiderte ich. »Ich kann mich nicht mehr erinnern, ich war wohl ziemlich durcheinander. Heute Morgen lag sie jedenfalls in meiner Wohnung. Hier!«
Ich warf Sonja schwungvoll die Handtasche zu, aber das mit dem Schwung war momentan auch so eine Sache. Das Ding landete auf dem Boden zu Sonjas Füßen.
Sie starrte genauso hypnotisiert darauf wie ich gestern in Wackershofen und sagte nur: »Uff!«
Dann schaute sie mich mit großen Augen an. »Weißt du, was das für eine Handtasche ist?«
»Eine Handtasche halt. Wie jede andere. Nur von Hermès, steht wenigstens drauf. Teuer wahrscheinlich. Na und? In diesem weiblichen Intimbereich kenne ich mich nicht aus. Handtaschen sind für mich seit jeher ein Rätsel. Wie kann man nur freiwillig ständig so ein Monstrum mit sich herumschleppen?«
»Wo soll ich sonst alles unterbringen, was ich brauche?«
»Die Männer haben dafür Taschen. Viele Taschen. In der Hose und im Jackett.«
»Frauen nicht.«
»Ja, ja, das Überleben im Kleinstadtdschungel ist schwierig, da muss man für alles gewappnet sein, für Hungersnöte genauso wie für einen Schneesturm im Hochsommer, und deshalb braucht man so ein Riesending von Handtasche. «
»Genau dafür wurde diese Handtasche entworfen. Das ist eine Birkin Bag.«
»Aha.«
»Das sagt dir nichts?«
Ich schüttelte sehr vorsichtig den Kopf, um meine Halsmuskeln nicht allzu sehr zu strapazieren. »Nein.«