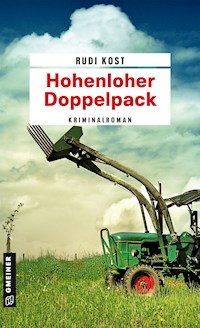Dillingers vierter Fall: Dillinger, Versicherungsvertreter und Hobbydetektiv aus Schwäbisch Hall, steht vor einem Rätsel: Vor kurzem kam die elegante Susanne Eulert zu ihm, um ihren Mann beschatten zu lassen. Doch jetzt ist sie mausetot. Bei seinen Ermittlungen stößt Dillinger auf das Unternehmen ihres Gatten, das eine abstrus anmutende Geschäftsidee verfolgt – die Zucht von Meeresfischen mitten im Hohenloher Land. Kann das gut gehen? Unversehens findet sich Dillinger in der Jauchegrube des Bauern Buchholz wieder, auf dessen Gelände längst die Fischfarm stünde, würde sich der Schweinezüchter nicht mit Händen und Füßen gegen den Verkauf seines Hofes wehren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rudi Kost
Fisch oder stirb
Ein Hohenlohe-Krimi
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
Die Lady ist ein Vamp
Ein Porträt des Unternehmers als junger Mann
Augenschmaus
Ein Tag wirft seinen Schatten voraus
Brühe mit Einlage
Im Tal der Erinnerungen
Argusaugen
Zwei Frauen
Kommen und gehen
Der Duft der Frauen
Wer andern eine Grube gräbt
Schlafwandler
Eine Frau geht ihren Weg
Wem die Stunde schlägt
Die Polizei, dein Freund und Helfer
Haus ohne Hüter
Persona non grata
Charme City
Fisch muss schwimmen
Feuchtgebiete
Die Stunde der Komödianten
Eine Art Held
Das Püppchen und der Drache
Und ewig lockt das Weib
Bekannte Gesichter, gemischte Gefühle
Jenseits der Liebe
Selbstgemacht
Kleiner Mann, was nun?
Was nach der Liebe kommt
Ansichten
Eine Reise wegwohin
Eine Frage der Ehre
Das Gewicht der Welt
Gedanken. Träume. Albträume.
Und ist der Ruf erst ruiniert …
Delegieren
Wenn’s der Wahrheitsfindung dient
No risk, no fun
Karriere eines Betrügers
Marikultur
Berichte meiner Informanten
Feuerwasser
Helden wie wir
Es muss nicht immer Kaviar sein
Kinder, Kinder!
Die Welt, von oben betrachtet
Alte Liebe rostet nicht
Früher begann der Tag mit einer Schusswunde
Ich sehe was, was du nicht siehst
Häschen in der Grube
Das Gespräch der drei Gehenden
Bauernkrieg
Nachwort
Mehr von Rudi Kost
Der Autor
Impressum neobooks
Prolog
Ich rudere und strample und halte die Luft an und schlage wild mit den Armen um mich. Kein Grund zur Panik, ich kämpfe ja nur um mein Leben, und ich gebe mir noch ungefähr fünf Sekunden.
Die ganze Geschichte ist von Anfang an dumm gelaufen, und nun sitze ich in der Patsche. Genauer gesagt: bis zum Hals in der Scheiße. Denn ich plansche in der Jauchegrube von Bauer Buchholz in Knittinghausen.
Ich weiß, dass mir nicht mehr viel Zeit bleibt. Über einer Jauchegrube stehen giftige Gase, die einem schnell das Bewusstsein nehmen. Und dann ist es aus.
Irgendwie schaffe ich es, den Rand der Grube zu packen und mich hochzuziehen. Ich liege auf dem Boden im Dreck und japse nach Luft. Mein Herz pumpt literweise Adrenalin. Mir ist schwindlig und kotzübel.
Vorsichtig hebe ich den Kopf und schaue auf zwei Paar mistverschmierte Gummistiefel, ein größeres Paar und ein kleineres. Und ich sehe den Lauf einer Schrotflinte, der genau auf meine Nase zielt. Der Lauf bewegt sich hin und her, was ich als Aufforderung deute, mich zu erheben.
Mühsam rapple ich mich hoch und sehe vor mir den Bauern und seine Frau. Keiner sagt ein Wort. Ich sowieso nicht, ich keuche noch immer.
Der Bauer wartet, bis ich mich etwas beruhigt habe, dann fragt er: »Wer bist du?«
»Dillinger«, bringe ich mühsam hervor. »Dieter Dillinger.«
»So, so.«
Der Bauer starrt mich finster an, drückt der Frau die Flinte in die Hand und geht davon.
Als er wiederkommt, zieht er einen Gartenschlauch hinter sich her und dreht auf. Das Wasser ist eiskalt und trifft mich wie ein Hammer. Ich zucke zusammen und schnappe nach Luft. Die kalte Dusche bringt mich wieder halbwegs zur Besinnung.
»Ausziehen!«, sagt der Bauer.
»Ausziehen? Hier? Mitten auf dem Hof?«
»Ausziehen!«, befiehlt der Bauer erneut. »Wird dir schon keiner was weggucken.«
Von wegen! Die Bäuerin, die kurz verschwunden war, steht wieder neben ihm, in der einen Hand einen Müllsack, in der anderen ein Handtuch.
Ich bin heute ganz besonders aufgebrezelt. Ich trage einen Anzug von Brioni, dazu eine Krawatte und ein maßgefertigtes Seidenhemd. Meine Unterhose allerdings ist von Schießer, Feinripp, und das ist peinlich. Ich hätte ja auch nicht gedacht, dass sie heute jemand zu Gesicht bekommt. Hätte ich nur auf meine Mutter gehört! Bub, hat stets sie gesagt, zieh immer eine saubere Unterhose an, man weiß nie, was kommt.
Sauber wenigstens war sie gewesen. Bis jetzt.
Für den Anzug war ich seinerzeit in einem Anfall von Verschwendungssucht extra nach Mailand gejettet, weil ich auch einmal so elegant aussehen wollte wie unser damaliger Kanzler. Und jetzt? Schöne Scheiße!
Ich ziehe mich also aus, bibbernd vor Kälte, während der Bauer weiter mit dem Schlauch auf mich zielt. Die Bäuerin guckt nicht weg. Im Gegenteil. Sie guckt interessiert hin. Sie mustert mich von Kopf bis Fuß, langsam und genau. Um ihre Mundwinkel sehe ich einen spöttischen Zug.
Kein Wunder. Alles an mir ist bis zur Nichtigkeit geschrumpft. Wegen des kalten Wassers. Vielleicht auch aus Verlegenheit. Oder wegen der Unterhose.
Der Bauer hört nicht auf mit dem Wassergespritze. Will seiner Frau wohl was gönnen. Sie ist Anfang Fünfzig, nicht hübsch, aber rassig. Ihn schätze ich auf Mitte Sechzig. Uralt also im Vergleich zu mir.
Endlich dreht er den Hahn zu. Schlotternd stehe ich da.
Die Bäuerin reicht mir den Müllsack.
»Stopfen Sie Ihre Kleider hinein«, sagt sie. »Ich werfe sie gleich in den Müll.«
Ich will protestieren, aber ich weiß, sie hat recht. Gegen eine Jauchegrube kommt keine Reinigung an. Besonders, wenn der Bauer Schweine hält. So schnell also wird aus meinem schönen Brioni Abfall.
Die Bäuerin reicht mir das Handtuch. Es ist bestimmt nicht ihr bestes.
»Damit Sie mir nicht alles nassmachen«, sagt sie. »Und jetzt ab unter die Dusche.«
Ich trotte hinter ihr her. Die heiße Dusche ist das Paradies. Ich stinke immer noch erbärmlich.
»Ich bringe Ihnen alte Kleider von meinem Mann«, sagt sie und geht.
Bald darauf kommt sie wieder. Und guckt. Guckt zu, wie ich dusche. Guckt zu, wie ich mich abtrockne. Guckt zu, wie ich in die alten Kleider steige. Sie hat immer noch diesen spöttischen Zug um den Mund. Das macht mich verlegen. Schließlich hat die heiße Dusche mittlerweile meine Lebensgeister wieder geweckt und anderes auch.
Sie reicht mir eine Hose. Der Bauer, schätze ich, hat ungefähr meine Statur, Idealmaße also, aber es gibt eine bestimmte Person, die bemängelt bei mir einen Bauchansatz. Von wegen! Ich muss die Hose festhalten, damit sie nicht rutscht. Wenigstens ein Lichtblick an diesem absolut beschissenen Tag.
»Die Kleider können Sie behalten», sagt die Bäuerin. »Seit mein Mann auf Diät ist, passen sie ihm nicht mehr.»
Sie hat eine feinfühlige Art, mich aufzurichten.
Ich tapse mit ihr in die Küche. Die Bäuerin stellt mir einen heißen Tee hin, dem Bauern eine Flasche Bier. Sie guckt weiterhin spöttisch. Mir dämmert, dass sie immer so guckt.
Auf dem Tisch liegt die Schrotflinte, und sie zeigt genau in die Richtung, in der ich sitze.
»So, mein Junge«, sagt der Bauer gemütlich, »und jetzt erklär mir mal, was du in meiner Jauchegrube zu suchen hattest.»
Die Lady ist ein Vamp
Es begann an einem Dienstag Ende März kurz nach zwei Uhr. Die ersten lauen Lüftchen ließen den Frühling erahnen und hatten die Schneeberge weggeschmolzen, die uns den ganzen Winter begleitet hatten.
Ich saß in meinem Büro und war angenehm gesättigt und leicht schläfrig nach einem ausgedehnten Lunch in Rebers »Pflug«, zu dem ich einen Kunden eingeladen hatte. Der Aufwand war nötig gewesen, weil der Kunde sich etwas geziert hatte. Komischerweise gibt es immer noch Menschen, die standhaft glauben, ein Versicherungsvertreter wolle ihnen nur überflüssige Policen aufquatschen.
Nach einem Damhirschrücken mit Gänseleber und Holunderjus und einer Flasche Burgunder unterschrieb er endlich. Die Rechnung ging natürlich auf mich, doch angesichts der Provision, die ich mir eben verdient hatte, konnte ich das schon verkraften.
Ich hatte also eigentlich keinen Grund, unzufrieden zu sein. Und trotzdem saß ich in meinem Büro, hatte die Füße auf den Schreibtisch gelegt und langweilte mich.
Sicher, wenn ich auf meinen Schreibtisch schaute, was ich im Moment zu vermeiden suchte, hätte der Eindruck entstehen können, dass es genügend zu tun gab. Doch nicht jeder ist für Schreibkram geeignet. Ich war es definitiv nicht. Sonja schon.
Nachdem dieser Punkt geklärt war, lehnte ich mich befriedigt zurück und langweilte mich weiter.
Sonja, meine Geschäftspartnerin, hatte mit langer Verzögerung Feng Shui für sich entdeckt und unser Büro neu eingerichtet. Feng Shui war ziemlich blöd. Es zwang mich, zur Türe zu starren, was ausnehmend trist war. Viel lieber hätte ich zum Fenster hinausgeschaut, in den frühlingsblauen Himmel und auf die kleinen Wölkchen, die vorbeizogen. Das war wenigstens ein inspirierender Anblick und vermittelte die Illusion von gutem Wetter.
Ich hätte meinen Stuhl ja auch herumdrehen können. Aber worauf sollte ich dann meine Füße legen? Das war ein Punkt, den die Feng-Shui-Experten noch mal diskutieren mussten. Bis dahin starrte ich unverdrossen die Türe an und verlor mich in meinen Gedanken.
Jetzt, dachte ich, müsste die Tür aufgehen und eine berückend schöne Frau hereinkommen.
Und was sage ich? Die Tür ging auf, und eine berückend schöne Frau kam herein.
Schnell nahm ich die Füße vom Schreibtisch und setzte mich ordentlich hin.
Das blassblaue Kostüm mit dem sehr kurzen Rock war so eindeutig Chanel, dass sogar ich das erkannte, und der leise Duft, der von ihr ausging, war dann wohl No. 5. Ich dachte natürlich sofort an Marilyn Monroe, an wen auch sonst, aber im Vergleich zu der Dame in Blassblau war die gute Marilyn ein rechter Pummel gewesen. Perfekt ausgemergelt war die Dame, könnte man sagen, dabei machte sie nicht den Eindruck, als sei sie der knochige Typ. Aber Fettabsaugen war ja ein Routineeingriff heutzutage.
Berückend schön, in der Tat. Wenn man auf ältere Semester stand. Die Dame verstand es blendend zu kaschieren, dass sie die Vierzig überschritten hatte. Ein ebenmäßiges Gesicht, von einem kunstvoll modellierten Blondschopf umrahmt, gerade Nase, volle Lippen. Und reichlicher Gebrauch von Make-up. Bei genauerem Hinsehen würde man sicher ein paar Narben hinterm Ohr finden. Wenigsten konnte sie noch lächeln, was für mäßigen Botox-Einsatz sprach.
Vielleicht bin ich gehässig. Aber mit allem jenseits der, sagen wir mal, neununddreißig hatte ich derzeit meine Probleme.
Ich tippte auf eine Lebensversicherung für ihren überzüchteten Rassehund.
»Sind Sie der Privatdetektiv?«, hauchte sie mit sanfter Stimme. »Unten am Haus ist jedenfalls ein Schild.«
Ich konnte mir den dummen Spruch nicht verkneifen: »Sehen Sie außer mir noch jemanden?«
Sie lachte. Sympathisch, diese Frau. Es war diese Art keckerndes Lachen, die man lange üben muss, damit es seine erotisierende Wirkung entfaltet.
Es kommt nicht eben häufig vor, dass mich ein Klient in meiner Eigenschaft als Privatdetektiv aufsucht. Normalerweise stolpere ich eher zufällig über Leichen und muss dann sehen, wie ich damit zurecht komme.
Das war so ein Fall.
Genauer gesagt war es der erste Fall. Mein erster richtiger Klient! Und dann noch eine Klientin! Und eine, die man nicht von der Bettkante schubsen würde! In Asien spricht man dem ersten Kunden des Tages eine große Bedeutung zu. So ein bisschen Aberglauben war vielleicht nicht schlecht. Was immer diese Frau von mir wollte, sie würde es bekommen. Alles.
Ich deutete auf den Besuchersessel, ein ältliches Ding aus rotem Leder, das ich vor langer Zeit bestens erhalten aus dem Sperrmüll gezogen hatte. Aus einem Grund, den ich nicht verstanden hatte, harmonierte er nicht mit Feng Shui, aber in diesem Punkt hatte ich mich durchgesetzt. Der Sessel blieb, basta! Man saß gut in dem alten Möbel, wenn auch manche Frauen ihre Probleme damit hatten, weil die Sitzfläche nach hinten leicht abfiel. Vor allem Frauen mit kurzem Rock.
Diese Frau meisterte das Problem souverän. Sie hatte auch die passenden Beine dazu.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte ich ganz professionell.
»Ich möchte, dass Sie meinen Mann beschatten.«
»Ich mache keine Ehegeschichten«, erklärte ich bestimmt.
»Wieso Ehegeschichte?«
»Wenn eine Frau ihren Mann beschatten lässt, steckt eine andere Frau dahinter.«
»Mein Mann hat keine Freundin, ganz sicher nicht. Ich glaube, mein Mann wird erpresst.«
»Und warum?«
»Das sollen Sie herausfinden.«
»Warum fragen Sie ihn nicht einfach?«
»Das habe ich schon getan.«
»Wohl mit keinem durchschlagenden Erfolg.«
»Woher wollen Sie das wissen?«
»Sonst säßen Sie nicht hier.«
Von mir aus konnte sie gerne noch eine Weile so sitzen bleiben. Sie saß nämlich keineswegs so sittsam da, wie es sich für eine Dame der besseren Gesellschaft geziemt, sondern gab den Blick frei auf viel ansehnliche Oberschenkel. Wenn ich das richtig beobachtet hatte, dann hatte sie nicht, wie das die meisten Frauen automatisch tun, den Rock nach unten gestrichen, als sie sich auf dem Sessel niederließ, sondern ein wenig hochgezogen.
Mein Blick wanderte nach oben. Was ihr knappes Jäckchen zum Schwellen brachte, war ein Wunderwerk der Natur oder höhere Chirurgenkunst. Jedenfalls zeigte die Dame reichlich von dem, was sie hatte. Ältere Frauen haben auch ihre Reize, musste ich eingestehen.
»Sie haben recht«, räumte sie ein. »Er hat gesagt, dass ich mir das einbilde. Aber ich weiß, dass etwas nicht stimmt. Als Ehefrau hat man ein Gespür dafür. Ich mache mir Sorgen.«
Sie schaute mich mit kummervoller Miene an, wühlte in ihrer Handtasche und kramte ein weißes Taschentuch hervor, mit dem sie vorsichtig ihre Augen betupfte. Vorsichtig genug, damit die Schminke nicht verrutschte.
»Entschuldigung«, sagte sie, »ich habe mich noch gar nicht vorgestellt.«
Ein weiterer Griff in das Monstrum von Tasche, das unübersehbar von Dolce & Gabbana stammte, förderte eine Visitenkarte zutage. Susanne Eulert stand darauf. Und eine Adresse.
»Esslingen?«, rief ich entgeistert. »Was soll ich denn in diesem Kaff? Da kenne ich doch niemanden!«
»Eben drum«, lächelte sie. »Deshalb kennt auch Sie niemand.«
»Wie kommen Sie gerade auf mich?«
»Eine Freundin hat mich auf Sie aufmerksam gemacht. Sybille Schneider.«
»Sagt mir nichts.«
»Ich glaube, sie ist eine Bekannte Ihrer Sekretärin.«
»Sekretärin! Lassen Sie das nicht Sonja hören! Sie ist meine Partnerin.«
»Ich sollte eigentlich Grüße ausrichten, aber Ihre ... Partnerin scheint nicht da zu sein. Ihre ... Partnerin hat Sybille viel von Ihnen erzählt. Sie scheinen mir der richtige Mann für diese Sache zu sein. Sie machen das professionell und vor allem diskret. Also? Nehmen Sie den Auftrag an?«
»Dazu muss ich erst mehr wissen. Wer ist Ihr Mann?«
»Mein Mann ist Helmut Eulert, er hat die Firma Eula gegründet.«
»Muss ich die kennen?«
»Die Eula ist Weltmarktführer im Bereich Pumpentechnologie. In Ihrer Waschmaschine, in Ihrer Kaffeemaschine, in Ihrem Auto sind garantiert Teile von uns.«
»Aha, das nächste Mal werde ich darauf achten. Erzählen Sie von Ihrem Mann.«
»Ich glaube, um meinen Mann verstehen zu können, muss man wissen, woher er kommt.«
Ein Porträt des Unternehmers als junger Mann
Helmut Eulert war nicht an der Wiege gesungen, dass aus ihm einmal ein schwerreicher Unternehmer werden sollte. Denn er kam, wie man das so nennt, aus einfachen Verhältnissen. Er war Jahrgang 1950 und stammte aus Stuttgart, genauer: aus dem Stadtteil Bad Cannstatt, wo sich die Eltern auf dem Hallschlag niedergelassen hatten, einem nicht sonderlich gut beleumundeten Viertel. Doch im zerbombten Stuttgart der Nachkriegszeit war man froh, wenn man überhaupt eine Wohnung zugewiesen bekam.
Helmuts Vater war mehrfach verwundet aus dem Krieg heimgekehrt, ein verschlossener, verbitterter, zu Jähzorn neigender Mann, der nie darüber sprach, was er in Polen, in Frankreich, auf dem Balkan, in Russland erlebt hatte. Die sechs Jahre Krieg und die sechs Jahre davor waren ein absolutes Tabu im Hause Eulert.
Auch die aktuelle Politik war nie ein Thema. »Alles Verbrecher«, spuckte Eulert senior allenfalls verächtlich aus, wenn er einen über den Durst getrunken hatte. Dann war er allerdings schon gefährlich nahe am Vollsuff, und da war es ohnehin besser, ihm aus dem Weg zu gehen, denn er wurde gern ausfallend. Der junge Helmut lernte, die Anzeichen zu deuten und sich rechtzeitig aus dem Staub zu machen.
Als gelernter Schlosser versuchte sich Eulert senior zunächst mit einem Fahrradgeschäft. Es war eine gute Geschäftsidee, allerdings nicht in dieser Gegend und nicht in dieser Zeit, und so war er froh, als er schließlich beim Daimler unterkam.
Damit war auch der Lebensweg des Sohnes vorgezeichnet. Gymnasium? Abitur? Die Mutter erträumte sich ein besseres Leben für ihren Jungen.
»Kommt nicht in Frage«, beschied der Vater, als seine Frau das Thema einmal zaghaft zur Sprache brachte. »Der Junge soll was Ordentliches lernen und Geld nach Hause bringen.«
Geld war knapp in der Familie, denn zu Helmut hatten sich im Laufe der Jahre drei Geschwister gesellt. Und wer beim Daimler schaffte, der hatte ausgesorgt fürs Leben, dem konnte nichts mehr passieren. Als sei man beim Staat untergekommen. Damals war das noch so.
So begann der vierzehnjährige Helmut gleich nach der Volksschule seine Lehre beim Autobauer in Untertürkheim. Die Beatles standen mit fünf Singles in den amerikanischen Charts, darunter »I Want to Hold Your Hand« und »Can’t Buy Me Love«, die Rolling Stones debütierten eben mit ihrem erstes Album, die so hieß wie die Band. Wer die Platten wohl kaufte? Helmut jedenfalls nicht, dafür war kein Geld übrig. Überdies besaß die Familie Eulert nicht mal einen Plattenspieler. Das ist das Erste, was ich mir kaufe, wenn ich etwas Geld übrig habe, schwor er sich.
Helmut war trotzdem gut informiert, weil er AFN hörte, den amerikanischen Soldatensender. Heimlich, denn wenn das der Vater mitbekam, setzte es Prügel. Er war nicht gut zu sprechen auf die Amerikaner, die sich in der ehemaligen Reiterkaserne auf dem Burgholzhof niedergelassen hatten. Er war auf überhaupt niemanden gut zu sprechen. Im Herbst, wenn sich auf dem Cannstatter Wasen das Volksfest drehte, trieb sich Helmut bei den Boxautos herum. Da waren immer die aktuellsten Hits zu hören, kostenlos.
Dem Beschluss des Vaters, ihn zum Daimler zu schicken, setzte Helmut keinen ernsthaften Widerstand entgegen. Die Schule langweilte ihn sowieso, er war keiner, der über Büchern hockte, er wusste nicht, was er anderes tun sollte, und außerdem war es sinnlos, dem Vater zu widersprechen, wenn der etwas entschieden hatte. Immer mehr war der Vater in seinem brütenden Schweigen gefangen, immer häufiger waren seine despotischen Anfälle. Der Sohn war zu jung, um auch nur zu erahnen, was das für ein Wrack war, das ihn drangsalierte.
Der Lehrling Helmut erwies sich als geschickter Handwerker, der schnell lernte, korrekt arbeitete und überhaupt recht anstellig war. Die Situation zu Hause hatte ihn gelehrt, Konflikten aus dem Weg zu gehen und Widerspruch hinunterzuschlucken. So einen konnten sie gebrauchen beim Daimler.
Er war aber auch einer, der genau beobachtete und sich seine Gedanken machte.
Am 12. April 1968, dem Karfreitag, kurz nach seinem achtzehnten Geburtstag, saß Helmut Eulert auf einer Bank am Aussichtsturm auf dem Burgholzhof und schaute hinab ins Neckartal. Die Beatles hatten »Lady Madonna« herausgebracht und die Rolling Stones »Jumpin’ Jack Flash«, in Berlin hatte gestern irgendein Verrückter Rudi Dutschke niedergeschossen (geschieht ihm recht, diesem Kommunisten, sollten seine Arbeitskollegen später sagen, soll er doch rübermachen, wenn es ihm hier nicht passt, wobei die wenigsten wussten, dass er von »drüben« in den Westen gemacht hatte), ein paar Tage zuvor war in Memphis Martin Luther King ermordet worden (ist ja nur ein Neger, hatten seine Arbeitskollegen gesagt), in Esslingen und sonstwo noch hatten Demonstranten die Auslieferung der »Bild«-Zeitung blockiert, Autos brannten.
Helmut Eulert wusste nicht so recht, wovon die Studenten redeten, die Worte waren ihm fremd, aber zwei Dinge zumindest hatte er verstanden: Eine neue Zeit war angebrochen, und er hatte die Absicht, auf seine Weise daran teilzuhaben. Und die autoritären alten Säcke, wie sein Vater einer war, hatten ausgedient. Helmut Eulert fasste einen Entschluss. Genauer gesagt zwei Entschlüsse.
Mit einundzwanzig, sobald er volljährig war und ihm niemand mehr dreinreden konnte, würde er sich eine Frau suchen und seine eigene Firma gründen. Die richtige Reihenfolge musste sich noch zeigen.
Er war es leid, beim Daimler das machen zu müssen, was andere ihm anwiesen. Außerdem hatte er eine Idee. Mehr noch, eine Vision.
Das mit der Heirat hatte rein praktische Gründe. Er hatte es satt, Zeit und Geld in zickige Weiber zu investieren und dafür nicht mehr zu bekommen als ein bisschen Fummelei. Die sexuelle Revolution, musste er immer wieder erbittert feststellen, hatte den Cannstatter Burgholzhof bisher noch nicht erreicht. Vielleicht war er auch nur zu schüchtern.
Er verlor sich in seinen Träumen und merkte erst gar nicht, dass sich jemand neben ihn gesetzt hatte.
»Wovon träumst du? Von einer scharfen Braut?«
Es war Horst Kieninger, sein alter Kumpel. Üblicherweise begann nach der vierten Klasse das Kastendenken. Wer aufs Gymnasium ging, wollte nichts mehr zu tun haben mit den Volksschülern, auch wenn man sich im Viertel ständig über den Weg lief. Doch Horst war anders. Sie waren nach wie vor Freunde, stiegen den Mädels nach und gingen gelegentlich einen saufen.
»Ich mache meine eigene Firma«, sagte Helmut.
»Träum weiter.«
»Und wenn du deinen Ingenieur hast, kommst du zu mir.«
Horst seufzte. »Erst muss ich mal dieses Scheißabitur hinter mich bringen.«
»Das schaffst du. Dann der Bund, vier Jahre Studium, das heißt, in ungefähr sechs Jahren fängst du bei mir an als mein Chefkonstrukteur. Dann bin ich aus dem Gröbsten raus.«
»Sechs Jahre! Eine Ewigkeit! Weiß nicht, ob ich das noch erlebe. Übrigens gehe ich nicht zum Bund, ich verweigere. Du etwa nicht?«
Helmut schüttelte den Kopf. »Was die für Fragen stellen! Sie sind also gegen Gewalt? Und wenn jemand Ihre Freundin bedroht, was machen Sie dann? Die legen mich aufs Kreuz. Verweigern ist nur was für Intelligenzbolzen wie dich.«
Er würde die achtzehn Monate beim Bund runterreißen und sich durch nichts, aber auch gar nichts provozieren lassen. Wer am eigenen Leib erfahren hatte, dass Lehrjahre keine Herrenjahre sind, dem konnte kein dumpfer Feldwebel etwas anhaben.
»Gehst du mit zur Demo?«, fragte Horst.
»Gegen was?«
»Gegen die Kapitalistenschweine, gegen den Imperialismus, gegen den Faschismus, was weiß ich, das Übliche halt. Aber sag mal, wenn du deine Firma hast, bist du selber doch auch ein Kapitalistenschwein, oder?«
»Wir nicht. Wir machen das anders. Also beeil dich mit dem Studium.«
»Jetzt geh ich erst mal zur Demo. Komm mit, das wird ein Mordsspaß.«
Aber Helmut blieb sitzen und feilte an seinen Träumen.
Wir machen das anders: Helmut war es ernst damit. Klar wollte er Geld verdienen, viel Geld nach Möglichkeit, aber nicht auf dem Rücken seiner Leute. Niemals, schwor er sich, würde er sie so drangsalieren und ausbeuten, wie er das tagtäglich am eigenen Leib erfuhr. Niemals sollte das Streben nach Gewinn über den Anstand triumphieren.
Pünktlich am 23. April 1971, Helmuts einundzwanzigstem Geburtstag, eröffnete die »Eula – Eulert Motoren- und Apparatebau« in einer aufgelassenen Fabrikhalle in Bad Cannstatt. Helmut hatte sich in den vergangenen drei Jahren kaum etwas gegönnt und jeden Groschen auf die Seite gelegt, den er erübrigen konnte. Am selben Tag kam das Rolling-Stones-Album »Sticky Finger« auf den Markt.
Einen Plattenspieler besaß er immer noch nicht.
Dafür seine eigene Firma.
Wenn die auch aus nicht viel mehr bestand als aus veralteten Maschinen, die er bei Betriebsauflösungen zusammengekauft hatte, und der vagen Hoffnung auf ein paar Aufträge.
Er stand in der halb verfallenen Halle und schaute hoch zum Dach, durch das der Regen tropfte. Zur Feier des Tages hatte er sich eine Flasche Sekt geleistet, die er zusammen mit Horst leerte.
»Du musst verrückt sein, Helmut. Wie willst du das schaffen? Bevor du produzieren kannst, musst du erst mal renovieren.«
»Im Winter wird’s kalt werden, die Heizung ist kaputt. Aber ich krieg das hin.«
»Die Halle ist doch viel zu groß für deine Ein-Mann-Klitsche. Eine Garage hätte es für den Anfang auch getan.«
»Eines Tages werden wir den Platz brauchen. Also mach hin mit deinem Studium.«
Horst seufzte. »Wenn’s nicht so viel Ablenkungen gäbe.«
»Lass halt die Politisiererei bleiben. Hast du auch was mit dieser Baader-Meinhof-Geschichte zu tun?«
»Politik, ach was! Die Weiber, Helmut, die Weiber und der Wein. Bloß nicht der Gesang, das wäre abschreckend.«
»Ich brauch dich, Horst.«
»Wozu? Für mich gibt es doch nichts zu tun bei dir. Ich steh nicht an der Drehbank, das sage ich dir.«
»Wart ab. Ich habe ein paar Ideen, dafür brauche ich dich.«
»Hier für dich zum Einstand. Was von deinen Lieblingen«, sagte Horst und reichte seinem Freund die brandneue Platte der Rolling Stones.
Zum ersten Mal sah Helmut das Logo mit der herausgestreckten Zunge. Er verstand den Hintersinn dieses Geschenkes. Es war Horsts Art, ihm zu sagen, dass er an ihn glaubte. Er wusste, dass er keinen Plattenspieler hatte.
Zwei Tage später starb Helmuts Vater, zermürbt von den Wunden, die das Leben ihm beigebracht hatte. Plötzlich fielen Helmut die vielen Fragen ein, die er zu dessen Lebzeiten nie gestellt hatte, aber nun war es zu spät. Er tröstete sich damit, dass er ohnehin keine Antworten erhalten hätte. Wenigstens war es jetzt zu Hause etwas ruhiger. Er wohnte noch immer in seinem alten Kinderzimmer, um Geld zu sparen, und gönnte sich weiterhin nichts.
Helmut Eulert war zweiundzwanzig, als er defloriert wurde. Es geschah bei einer Studentenfete, zu der ihn Horst Kieninger mitgeschleppt hatte. Aus den Lautsprechern ertönten die sphärischen Klänge einer Band, deren Namen er nicht kannte.
Er war längst nicht mehr auf dem Laufenden, er hatte anderes zu tun. Bis spät in die Nacht war er in seiner Firma, und wenn er nicht an einem Auftrag arbeitete, flickte er das Dach, wechselte zerbrochene Fensterscheiben aus und werkelte an der Heizung, die er im nächsten Winter ganz bestimmt zum Laufen bringen würde.
Auf der Studentenfete herrschte eine eigenartige Atmosphäre. Die Luft war erfüllt von schweren Düften, die Stimmung von heiterer Gelassenheit, über allem schien ein friedvoller, ein liebevoller Geist zu schweben.
Ein Mädchen mit verträumtem Lächeln, in ein buntes Batikkleid gehüllt, nahm ihn einfach an der Hand und zog ihn mit sich. Es war vorbei, bevor er recht wusste, was geschah. Dem Mädchen schien es gefallen zu haben. Aber sie war auch zugedröhnt bis zur Halskrause. Mit demselben verträumten Lächeln ging sie zurück zu den anderen, als sei nichts gewesen.
So war das also. Und es war nicht schlecht. Auf einmal beneidete er diese Studenten. So ließ es sich leben. Er musste am nächsten Tag wieder früh aus den Federn, sehr früh, er hatte einen Auftrag, der termingerecht fertig werden musste und der ihn fast überforderte, er hätte gut noch zwei Leute brauchen können, die er aber nicht bezahlen konnte.
Ob er etwas falsch machte? Ob das Leben an ihm vorüberzog, während er für eine Firma malochte, die zwar seine eigene war, deren Erfolg aber in den Sternen stand?
An manchen Tagen kamen ihm Zweifel.
Bis er die Frau zum Heiraten gefunden hatte, sollte es noch einige Zeit dauern.
Augenschmaus
»Und diese Frau sind Sie?«, fragte ich.
»Ich bin die zweite Ehe. Er hat sich meinetwegen scheiden lassen. Wir sind seit vierzehn Jahren miteinander verheiratet.«
Da hatte sich der Herr Unternehmer ja seinerzeit ein junges Hascherl ins Bett geholt, Respekt, dachte ich und sagte diplomatisch: »Auch eine lange Zeit.«
»Deshalb spürt man, wenn etwas nicht in Ordnung ist.«
»Ihre Gefühle in Ehren, aber gibt es auch konkrete Anhaltspunkte?«
Sie zog ein Blatt Papier aus ihrer Handtasche. Es war die beliebte Schnipselarbeit aus Einzelbuchstaben verschiedener Größen und Typen: »Finger wek vom Schweinestall.« Ein »g« stand offenbar nicht zur Verfügung, oder der Schnipsler war Legastheniker.
»Was hat Ihr Mann mit einem Schweinestall zu tun?«
»Sie finden das heraus, nicht wahr?«
Ich weiß nicht, wie, aber ihr Rock schien schon wieder etwas höher gerutscht zu sein. Was ich sah, gefiel mir.
»Ist das der einzige Drohbrief?«
»Bisher ja.«
»Hat Ihr Mann das der Polizei gezeigt?«
»Er weiß gar nichts davon.«
»Bitte?«
»Die Drohung war in seiner Post, aber ich habe sie ihm nicht gezeigt. Er soll sich nicht aufregen. Ich weiß nicht, ob das sein Herz aushält.«
»Hm. Das wirkt eigentlich eher wie ein schlechter Scherz, aber wenn nicht, schwebt Ihr Mann möglicherweise in einer Gefahr, von der er gar nichts weiß.«
»Das macht mir ja solche Sorgen. Aber Sie werden uns beschützen.«
»Mit Erpressern ist nicht zu spaßen. Sie sollten die Polizei einschalten.«
»Nein!« Ihre Reaktion kam so heftig, dass ich zusammenzuckte. »Keine Polizei! Wenn erst mal die Polizei im Haus ist, weiß es bald die ganze Stadt, und das darf unter keinen Umständen geschehen. Was glauben Sie denn, warum ich zu Ihnen gekommen bin?«
Ihre Stimme verlor an Schärfe, und sie hauchte wieder: »Niemand darf von Ihrem Auftrag erfahren, das müssen Sie mir versprechen, sonst sind wir erledigt. Ich kann mich doch auf Sie verlassen?«
»Seien Sie unbesorgt, Diskretion ist schließlich mein Kapital. Haben Sie sonst noch etwas, das mir weiterhelfen könnte?«
»Es muss irgendein ›Projekt Goldhamster‹ geben. Ich habe ein Telefongespräch belauscht, da ist der Name gefallen.«
»Und Sie haben natürlich keine Ahnung, worum es da geht.«
»Nicht die geringste. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang.«
Schweinestall und Goldhamster? Das wurde ja immer verrückter. Verrückt genug, dass es mich reizen könnte? Oder zu verrückt, weil aussichtslos? Ich hatte mir geschworen, dass meine erste Klientin alles von mir haben konnte. Vor allem eine Klientin wie diese. Andererseits musste man ja nicht an Grundsätzen kleben.
Jetzt erst fielen mir ihre Augen auf, ich war bislang von anderen Blickfängen abgelenkt gewesen. Groß waren sie und grün. Augen wie ein Bergsee. Augen, in denen man versinken konnte.
Doch, ja, sie schmachtete mich an.
Nun rutschte sie auf dem Sessel nach vorne, ich wagte gar nicht, auf ihre Oberschenkel zu schauen, und legte ihre warme, sorgfältig manikürte Hand auf meinen Arm.
»Bitte, Sie müssen mir helfen, ich habe Angst. Ich fürchte, mein Mann hat sich da auf etwas ganz Schreckliches eingelassen.«
Sie beugte sich weit vor dabei. Das Dekolleté ihres Chanel-Jäckchens tat, wofür es geschaffen worden war, und gab den Blick frei. Bis zum Bauchnabel, mindestens. Und was darinnen war, folgte den Gesetzen der Schwerkraft. Egal, ob sie echt waren oder nicht, es waren Prachtstücke, und ich würde diesen Anblick noch öfter genießen können. Denn ich gedachte, meiner Klientin sehr häufig persönlich Bericht zu erstatten. Kundenpflege ist schließlich wichtig.
»Klingt nicht uninteressant«, sagte ich und handelte mir dafür ein strahlendes Lächeln ein, gefolgt von einem Scheck aus den unergründlichen Tiefen ihrer Handtasche.
»Das sollte für den Anfang reichen«, erklärte sie.
Ich schaute auf den Scheck und bemühte mich, meine Überraschung nicht allzu sehr zu zeigen. Privatdetektiv schien ein einträgliches Geschäft zu sein.
Ich stimmte schließlich zu, und es hätte nicht viel gefehlt, und sie wäre mir um den Hals gefallen. Was sie zu meinem größten Bedauern nicht tat.
Ein Tag wirft seinen Schatten voraus
»Elf Tage noch«, sagte Sonja. Ich tat, als hätte ich nichts gehört, konzentrierte mich auf die Papiere vor mir und sann auf eine Fluchtmöglichkeit. Es gab nur die Tür, und in der stand meine Partnerin.
Soll sie doch reden, mich ging das nichts an.
»Wir müssen allmählich mal überlegen«, fuhr sie fort, »wie wir das mit der Feier machen. Ich habe mir gedacht, wir ...«
»Es gibt keine Feier«, unterbrach ich sie.
»Aber du wirst vierzig!«
»Ich bin neununddreißig.«
»Deinen Neununddreißigsten hast du im letzten Jahr gefeiert.«
»In diesem Jahr feiere ich ihn wieder. Und im nächsten Jahr sehen wir weiter. Keine Feier. Gar nichts. Und wer gratuliert, kriegt eins hinter die Löffel. Außerdem werde ich sowieso nicht da sein.«
»Das kannst du uns nicht antun!«
»Ich hasse Geburtstage. Erinnern immer an die Endlichkeit des Seins.«
»Was hast du denn? Ist doch nur eine Feier unter Freunden.«
»Verstehst du denn nicht? Vierzig ist der Rubikon! Hast du dir mit achtzehn vorstellen können, dass du mal vierzig wirst? Und wie du dann bist? Mit vierzig bist du alt. Das ist die Schwelle zum Rentenalter.«
»Mit vierzig werden die Schwaben g’scheit, sagt man.«
»Ich bin frühreif. Ich habe dieses Problem schon mit neununddreißig erledigt.«
»Dein Problem ist eher, dass du auch mit achtzig noch nicht gescheit wirst.«
»Woraus logisch folgt, dass der Vierzigste keinerlei Bedeutung hat. Wenigstens nicht für uns Männer. Ihr Frauen habt ja einen Grund. Mit vierzig kommt ihr in die zweite Pubertät.«
»Du mit deinen Machosprüchen!«
»Habe ich in einer Frauenzeitschrift gelesen.«
Sonja erwiderte nichts, sondern kümmerte sich intensiv um den Ficus im Bonsai-Format, der seit kurzem ein klägliches Dasein auf der Fensterbank fristete. Ob der zum Feng Shui passte?
»Sonst hast du keine Probleme?«, sagte sie schließlich giftig.
»Doch. Du kennst eine Sybille Schneider?«
»Klar. Wir haben uns mal bei einem Indienseminar getroffen. Du kennst übrigens ihren Mann. Der ist bei der Kripo irgendwo im Remstal.«
»Ach, der!« Ich hatte ihn tatsächlich mal getroffen, und obschon er sich anmaßte, einen gelben Porsche zu fahren, schien er ein sympathischer Kerl zu sein.
»Was ist mit ihr?«, fragte Sonja.
»Anscheinend hat sie mich jemandem empfohlen. Woher weiß sie nur von mir? Tratschweiber!« Und ich erzählte ihr von dem Besuch und meinem Auftrag.
Sonja schaltete schnell. »Ich soll mich wohl nach der Dame erkundigen.«
»Kluges Mädchen! Die richtige Sekretärin für einen harten Kerl wie mich.«
»Sekretärin!«
»So hat sie dich genannt. Außerdem möchte ich wissen, was du dieser Sybille über mich erzählt hast.«
»Dass du dich jetzt Privatdetektiv nennst, nichts weiter. Wirklich. So interessant bist du auch nicht, Dillinger, dass man stundenlang über dich reden möchte.«
»Eigenartig, wieso sie dann ausgerechnet auf mich gekommen ist.«
»Sie hat dich nicht gekannt. Das erklärt den Irrtum. Du willst diesen bescheuerten Auftrag doch nicht etwa annehmen?«
»Warum nicht?«
»Schweinestall, Goldhamster und ein Pumpenfabrikant. Das klingt reichlich mysteriös.«
»Eben drum.«
»Darf ich raten? Deine Klientin ist eine Schönheit mit viel Holz vor der Hütte.«
»Exakt.«
»Männer!«
»Es geht um die intellektuelle Herausforderung. Aber das versteht ihr Frauen nicht. Außerdem ist sie viel zu alt für mich. Und ich bin in festen Händen. Und ich habe schon zugesagt. Und einen Scheck bekommen. Und gleich morgen trete ich in die Pedale.«
»Und wer macht dann die Arbeit im Büro?«
»Du natürlich, mein Schatz. Wer kann das besser als du?«
»Manchmal hasse ich dich, Dillinger!«
»Das geht schon in Ordnung. Artikuliere deine Gefühle. Lass es raus.«
»Du wirst dich mit dieser Sache ganz schön in die Nesseln setzen, glaub es mir!«
Brühe mit Einlage
Letztlich waren es nicht die Nesseln, sondern die Jauchegrube. Ich habe das Gefühl, dass ich diesen Gestank mein Leben lang nicht mehr wegkriegen werde. Er sitzt in jeder Pore.
Vor mir steht inzwischen ein Teller Hühnersuppe und dampft verführerisch vor sich hin.
»Greifen Sie zu«, sagt die Bäuerin, »es gibt nichts Besseres, wenn man sich aufwärmen will.« Was sie auf ihr Gesicht zaubert, könnte man vielleicht sogar als ein Lächeln interpretieren.
In der Tat, das Aufwärmen habe ich nötig, die heiße Dusche hat nicht lange vorgehalten. Vielleicht sind es auch die Nerven. Mir wird immer klarer, dass ich dem Tod gerade noch mal von der Schippe gesprungen bin.
Meine Hände zittern, als ich den Löffel zum Mund führe, und ich verschütte etwas von der Suppe. Große Fettaugen dümpeln auf der Brühe, reichlich Fleisch und Gemüse warten auf mich. Das ist keine Suppe aus dem Päckchen.
Die Schrotflinte liegt immer noch auf dem Tisch, zeigt auf mich und macht mich nervös.
»War wohl schon ziemlich morsch, die Abdeckung von Ihrer Jauchegrube«, sage ich.
Der Bauer schüttelt den Kopf.
»Die Bretter sind alt, aber nicht morsch. Sie waren angesägt.«
Er sagt das ganz gelassen, dabei liegt es glasklar auf der Hand, was diese Entdeckung bedeutet. Niemand konnte damit rechnen, dass ich um den Hof schleiche.
»Gehen Sie oft da lang?«, frage ich.
»Regelmäßig. Da geht’s zum Hühnerstall.«
»Haben Sie eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte?«
Der Bauer wiegt den Kopf. »In letzter Zeit ist einiges Seltsame passiert hier.«
Ich weiß. An einigem davon bin ich nicht ganz unschuldig.
Im Tal der Erinnerungen
Viele Wege führen von Schwäbisch Hall nach Esslingen. Ich nahm die Schlängelstraße durch den Schwäbischen Wald.
Mein Auto war denkbar schlecht geeignet für eine Beschattung, und deshalb hatte ich es gegen Sonjas Wagen getauscht, was nicht ohne nervige Diskussionen gegangen war.
»Du bist wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der nicht wild darauf ist, Porsche zu fahren«, sagte ich. »Ich habe eine Idee. Fahr nach Aalen, mach einen gemütlichen Shoppingbummel mit Nele ...«
»Shopping! In Aalen!«
»… und tausch meinen Porsche gegen ihren Wagen. Nele weiß mein Prachtstück wenigstens zu würdigen.«
»Geht’s noch aufwendiger? Warum machst du das nicht selber?«
»Nele kommt erst heute morgen von einem Termin zurück. Zu spät für mich.«
»Nein! Mein Auto kriegst du nicht! Schaff dir einen Zweitwagen an! Obwohl ... Da könnte ich mit Nele deine Geburtstagsfeier besprechen.«
»Es gibt keine Feier!«
»Du hast da gar nichts mitzureden. Hier sind meine Schlüssel.«
Sonjas gemütlicher alter Golf war der Schrottprämie zum Opfer gefallen und gegen einen Fiesta eingewechselt worden. Sie nannten es Auto, ich bezeichnete es als Blechbüchse auf Rädern. Wie sollte man damit die Kurven genussvoll ausfahren?
Mein Navi, nagelneu mit 3D-Darstellung und allerlei sonstigem Schnickschnack, aber mit der gleichen, wenn nicht gar derselben Stimme wie bei meinem alten Gerät, das ich kürzlich entsorgt hatte, führte mich zielsicher übers Remstal ins Neckartal.
Erinnerungen kamen auf. Die Nacht in Schnait, die romantisch gedacht gewesen war und in der mich urplötzlich eine so heftige Erkältung überfiel, dass ich zu nichts zu gebrauchen war. In Stetten im »Ochsen« hatten wir mal ein halbgares Kalbsbries gegessen, als das Halbgare gerade Mode war. Glücklicherweise war es zeitgeistgemäß nur eine winzige Portion gewesen. In den Streuobstwiesen über Strümpfelbach hatten wir einen Riesenkrach, wegen einer Nichtigkeit. Keine Ahnung mehr, worum es da ging. Es ging ja immer nur um Nichtigkeiten.
Wann war ich zum letzten Mal in Esslingen gewesen? Ewig her. Roswitha und ich hatten ein neues Restaurant ausprobiert, über das man redete. Wir selber redeten nicht viel an diesem Abend, es gab nicht mehr viel zu sagen, außer dem einen, was keiner von uns laut auszusprechen wagte.
Das war das letzte Mal gewesen, dass wir zusammen ausgingen. Am Essen konnte es nicht gelegen haben. Von da an ging es nur noch bergab. Bis zur Einsicht, dass Roswitha und ich uns besser trennten. Mein erstes Auto, mein erster Job, meine erste Scheidung. So hatte ich mir das vorgestellt, genau so.