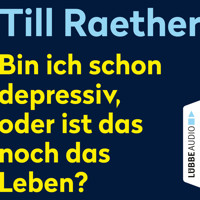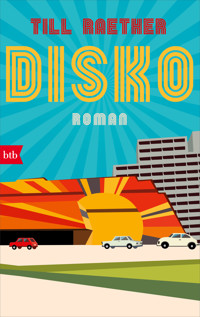
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1975 in der norddeutschen Provinz: Nach dem Tod ihrer Mutter hält die 14-jährige Beeke nichts mehr auf dem tristen Hof ihrer Eltern, sie flüchtet mit dem Zug nach München. Hier soll ihr älterer Bruder seit Jahren ein wildes, freies Leben führen - und zwar als Disko-Produzent. Was das genau ist, weiß Beeke nur vage. »Du hast damals geschrieben, dass in München ein ganz neuer Sound entsteht, Munich Sound. Das sei das ganz große Ding.« In München spürt sie die fiebrige Aufbruchstimmung, tagsüber schläft sie, nachts sucht sie in Diskotheken nach ihrem Bruder. Doch als sie ihn endlich findet, ist die Situation ganz anders, als sie es sich vorgestellt hat. Und dann erfährt Beeke, warum sich ihr Bruder gezwungen fühlte, seinen Heimatort Hals über Kopf zu verlassen. Empathisch, humorvoll und mit viel Zeitkolorit lässt Till Raether eine einzigartige Zeit aufleben - die musikalische Avantgarde der 70er Jahre in München - und beschreibt ein Lebensgefühl zwischen gesellschaftlichem Aufbruch und Auseinandersetzung mit den Lebenslügen der Eltern-Generation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch
1975 in der norddeutschen Provinz: Nach dem Tod ihrer Mutter hält die 14-jährige Beeke nichts mehr auf dem tristen Hof ihrer Eltern, sie flüchtet mit dem Zug nach München. Hier soll ihr älterer Bruder seit Jahren ein wildes, freies Leben führen – und zwar als Disko-Produzent. Was das genau ist, weiß Beeke nur vage. »Du hast damals geschrieben, dass in München ein ganz neuer Sound entsteht, Munich Sound. Das sei das ganz große Ding.« In München spürt sie die fiebrige Aufbruchstimmung, tagsüber schläft sie, nachts sucht sie in Diskotheken nach ihrem Bruder. Doch als sie ihn endlich findet, ist die Situation ganz anders, als sie es sich vorgestellt hat. Und dann erfährt Beeke, warum sich ihr Bruder gezwungen fühlte, seinen Heimatort Hals über Kopf zu verlassen. Empathisch, humorvoll und mit viel Zeitkolorit lässt Till Raether eine einzigartige Zeit aufleben – die musikalische Avantgarde der 70er Jahre in München – und beschreibt ein Lebensgefühl zwischen gesellschaftlichem Aufbruch und Auseinandersetzung mit den Lebenslügen der Eltern-Generation.
Zum Autor
Till Raether, geboren 1969, aufgewachsen in Berlin, lebt in Hamburg. Er besuchte die Deutsche Journalistenschule in München, studierte Amerikanistik und Geschichte in Berlin und New Orleans und war stellvertretender Chefredakteur von Brigitte. Sein Roman Die Architektin (btb) wurde 2023 mit dem Hamburger Literaturpreis als Buch des Jahres ausgezeichnet. Seine Romane über den hochsensiblen Kommissar Adam Danowski werden mit Milan Peschel fürs ZDF verfilmt. Mit Alena Schröder spricht er in ihrem gemeinsamen Podcast »sexy und bodenständig« über das Schreiben.
Till Raether
DISKO
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalveröffentlichung 2025
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © 2025 Till Raether
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR)Umschlaggestaltung: semper smile, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-27772-7V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Für Diana, Robert und Katharina
Seite A
1
Alle paar Monate ändern sie im Oldie-Radio die Songauswahl, damit ab und zu was neues Altes läuft. Manche Sachen spielen sie immer, andere verschwinden nach ein paar Monaten wieder und kommen erst Jahre später zurück. »Daddy Cool« wird immer dabei sein, solange es Oldie-Radio gibt, oder »Live Is Life«. Aber sowas wie »Never Say You’re Sorry« taucht nur alle Jubeljahre auf. Die zweite, nicht ganz so erfolgreiche Single eines One-Hit-Wonders. Was dich vielleicht zu einem Anderthalb-Hit-Wonder macht. Diese Bezeichnung nimmst du mir hoffentlich nicht übel, nur eine harmlose Stichelei von der kleinen Schwester an den großen Bruder. Denn das waren wir damals, inzwischen sind wir so gut wie gleichaltrig, fünfundsechzig und siebzig.
Heute in der Morgendämmerung bin ich also in meinem kleinen Auto von der mobilen Pflege übers Land gefahren, und im Radio kam das Übliche, »Living Next Door To Alice« und so weiter. Einerseits beruhigt mich diese Vertrautheit, andererseits ist es ein leichter Nervenkitzel, ein Risiko: ob ich es zufällig mitkriege, wenn alle paar Tage »Dance Into My Love« auf diesem Sender gespielt wird, dein einer großer Hit. Ich erkenne deinen Synthesizer am Anfang sofort, und dann verwandeln sich die eingeregneten Hügel und Felder vor meinen Augen in die Landschaften unserer Kindheit.
»Never Say You’re Sorry (For the Good Times That We Had)« hatte ich aber nun so lange nicht mehr gehört, dass aus der Nostalgie ein regelrechter Sehnsuchtsschock wurde und ich auf der Landstraße rechts ranfahren musste. Du legst sicher Wert auf den vollständigen Titel, mit Klammer. Ich habe wenig Zeit zwischen meinen Patienten. Wobei, wir sagen Kunden. Sie warten darauf, von mir gepflegt zu werden. Ich machte das Radio aus, bevor Stella D. anfing zu singen, starrte ins Land und dachte daran, wie schön es mal war, deine Schwester zu sein.
Ich glaube, ich muss dir das alles endlich erklären. Und mir selber auch. Und heute Abend habe ich Zeit. Bitte wundere dich nicht, dass diese Nachricht von der gemeinsamen E-Mail-Adresse von Tim und mir kommt, die er eingerichtet hat, als wir zum ersten Mal T-Online bekommen haben. Ich schreibe so gut wie keine E-Mails, aber diese Ehepaar-Adresse gehört trotzdem zu den Dingen, die ich seit vielen Jahren endlich angehen will.
Es wäre heute undenkbar, dass eine Vierzehnjährige ohne Wissen ihrer Eltern von Ostholstein nach München fährt und dann dort unbehelligt fast eine Woche verbringt, tagsüber schläft und nachts ihren Bruder sucht. Aber auch 1975 war es zumindest ungewöhnlich. Das merke ich aber erst jetzt, wenn ich darüber nachdenke.
Wir haben damals in Seutendorf gewohnt, zwanzig Minuten zu Fuß von der Bundesstraße 430, ungefähr auf halbem Weg zwischen Lütjenburg und Plön. Ich weiß nicht, wie gut du dich an die Landschaft erinnerst. Du warst lange nicht hier, du bist damals gegangen, um nicht wiederzukommen. Du hast mich im Stich gelassen. Unsere Schwestern und mich. Viele Seen, das Wild frisst die Knospen von den Sträuchern, und die haushohen Hecken zwischen den Feldern und an den Straßenrändern heißen immer noch Knicks, ein Wort, das man in München niemals braucht, stelle ich mir vor. Störche landen ungeschickt, sie brauchen viel Platz dafür. Es hat sich in dieser Hinsicht nichts bei uns verändert seit fünfzig Jahren.
Das mit dem Im-Stich-Lassen lösche ich später vielleicht wieder. Aber jetzt steht es da, und es scheint mir für den Augenblick die richtige Formulierung.
Morgens um halb fünf bin ich aufgestanden an diesem 1. oder 2. November 1975. Es bestand keine Gefahr, dass unser Vater mich hören und aufwachen würde. Er lag im Wohnzimmer auf der Übereckcouch, die leeren braunen Flaschen auf dem Fliesentisch sahen aus wie ein Zaun. Und keine Gefahr, dass unsere Mutter mich hörte und aufwachte, denn sie lag tot auf dem Bett wie am Tag davor.
Ab fünf Uhr morgens saß Oma Großkordt immer mit ihrem Kaffee am Fenster, so nah, dass die Scheibe vor ihrem Gesicht pilzförmig beschlug. Sie hat damals schon im Altenteil gewohnt, eine Weile war sie ja noch mit bei uns im Haus, schrecklicherweise. Aber in diesem November Mitte der 70er Jahre war sie mit ihrem ganzen Kram schon im Nebengebäude, wo vor hundert Jahren die Knechte und Mägde gewohnt haben. Unsere Schwestern und ich hatten Oma Großkordt am Abend zuvor nur mit Mühe und Not aus unserem Haus bekommen. Die Rolle der Schwestern bei diesem Vorgang war entscheidend: ihre beiden Gesichter wie ein einziges, traurig bis zum Gehtnichtmehr. Es passierte nicht so viel in Seutendorf. Wenn jemand starb, war es eine große Sache. Oma Großkordt konnte nicht genug bekommen vom Ableben unserer Mutter. Vielleicht wollte Oma Großkordt uns auch nicht mit unserem Vater allein lassen. Der ganze Hof war aufgeteilt worden, als Urgroßvater Großkordt starb, jeder hatte nur noch ein Fitzelchen seitdem. Inzwischen ist alles weg. Wir werden nicht umhinkommen, das auseinanderzuklamüsern. Eines Tages. Demnächst. So, wie es bei uns immer etwas auseinanderzuklamüsern gab. Oma Großkordt war nicht die richtige Mutter unseres Vaters, also war unsere Mutter auch nicht ihre richtige Schwiegertochter. Wir haben Oma Großkordt trotzdem Oma genannt. Der Hof und seine Reste kamen aus ihrer Familie, die Eltern unserer Mutter hatten einen Supermarkt. Kaufleute, sagte Oma Großkordt abfällig, obwohl sie auch erst nach dem Krieg hier aufs Land gezogen war und vorher in Hamburg selbst bei Hertie gearbeitet hatte.
Oma Großkordt war immer groß in Spökenkiekerei, erinnerst du dich? Sie erzählte uns von den weißen Frauen, die in ihren Steingräbern keine Ruhe finden, prähistorische Schlafwandlerinnen. Einmal, als klar war, dass du in München warst, erzählte sie mir, dass sie gesehen hätte, wie du ins Licht gehst. Sie kam morgens zu uns in die Küche, als wäre es ihre, setzte sich neben mich, legte mir die Hand auf den Arm, mit dem ich gerade den Kaffeebecher anheben wollte, und sagte: Ich habe gesehen, wie Gerald ins Licht geht. Ich schwieg, weil ich mich gar nicht so gern mit ihr unterhielt, vor allem nicht über sowas. Nach einer Weile nickte sie, als hätte sie mich beeindruckt, dann stand sie auf und ging. Ich denke, sie hat eine Diskokugel gesehen, aber das konnte sie natürlich nicht wissen.
Erst als ich an diesem Abend vor meinem Aufbruch nach München zu ihr sagte, dass ich noch in Ruhe mit meiner toten Mutter sprechen müsste, und dass es mich genierte, wenn jemand mir dabei zuhörte, ging sie über den Sandweg und verschwand hinter ihrer Butzenglastür. Sie wirkte ein bisschen enttäuscht, so, als hätte sie gern zugehört, was ich unserer Mutter zu sagen hatte. Wer selbst viel zu verbergen hat, denkt immer, dass er in den Geheimnissen der anderen vorkommt. Aber das ist mir erst später klar geworden.
Ich ging mit dem Rucksack ins Zimmer unserer toten Mutter und stellte mich an ihr Bett. Ich konnte nur ihre Haare auf dem Kissen sehen, nicht ihr Gesicht. Ich traute mich nicht, das Licht anzumachen. Eigentlich wäre es die Aufgabe unseres Vaters gewesen, Totenwache zu halten, aber er kam nicht mehr so gut die Treppe hoch. Vor Trauer und wegen der Bandscheibe und den Bieren. Unsere Schwestern huschten tagsüber an der Schlafzimmertür vorbei mit abgewandtem Gesicht. Damals fand ich das ein bisschen zimperlich. Heute habe ich so viel Verständnis dafür.
Nach und nach hatte ich im Zimmer unserer Mutter über den ganzen Tag meine Sachen für München bereitgelegt, weil das der einzige Raum im Haus war, den gerade niemand außer mir betrat. Unsere Mutter lag ja nur, sie würde die Tage abgeholt werden, hatte Oma Großkordt gesagt. Jetzt stand ich da, dachte an das Lied »Der Mond ist aufgegangen«, weil es im Zimmer nur diese Art von Licht gab. Es schien so ein wichtiger Moment, aber ich hatte unserer Mutter gar nichts zu sagen. Nach einer Weile fing ich an, den Rucksack vollzustopfen, chaotisch und unvollständig, wegen dem Mondlicht, und weil man immer etwas vergisst, wenn man über den Tag Einzelteile zusammensammelt. Dann ging ich schlafen. Kurz und unruhig, weil ich wusste, um halb fünf würde ich aufbrechen, um dich nach Hause zu holen.
Am Morgen, als ich nach München aufbrach, war es in den Zimmern ganz kalt, Anfang November. Unsere Schwestern waren trotzdem verschwitzt, weil sie zusammen unter einer Decke lagen. Ich beugte mich über sie und dachte: Sie blickte zärtlich auf sie hinab. Dann nahm ich deinen Bundeswehrrucksack und ging leise die Stiege hinunter und aus dem Haus. Unsere Schwestern sollten schlafen, so lange wie sie konnten. Die Zwillinge. Ich glaube, wir haben alle immer gedacht: Die beiden haben ja sich.
Ich ging den Umweg außen ums Dorf, und dann bei der Bushaltestelle auf die Landstraße zur 430. Ich wusste, dass niemand um diese Uhrzeit auf der Straße war, denn es war nicht Erntezeit, und die Melker fingen erst um sechs an. Das war ein hartes Geschäft und gefährlich, viele von den Melkern hatten nicht mehr alle Finger. Unser Vater sagte, das sei trotzdem ein guter Beruf für dich, die Molkerei sucht immer, und mit Extraschichten und Wochenendzulage kommst du bald auf vierstellig, und dann kannst du ein Häuschen anzahlen. Und dann kommt die EG und macht die Molkerei zu, und dann kriegst du eine Abfindung, und zwar richtig.
Erinnerst du das? Die wirren Pläne unseres Vaters?
Unser Vater wusste wirklich gar nichts von der Landwirtschaft, er kam aus Hamburg, Lehrer für Deutsch und Geschichte. Aber er kannte sich aus damit, Ratschläge zu geben. Und er sagte immer, erinnern sei ein reflexives Verb, und so wie wir es benutzen, sei das eine norddeutsche Unart.
Nach seinem Melkervortrag hörtest du auf zu kauen und dann, weil du wusstest, es regt unseren Vater auf, erzähltest du von Tanzmusik. Das Wort hast du am Anfang benutzt, damit unser Vater nicht sofort an die Decke geht, sondern damit seine Zündschnur langsam brennt. Aber nach einer Weile sprachst du wieder von Diskotheken. Vom Starfish am Rand von Lütjenburg. Von der Hitscheune in Neumünster. Vom Lady Joker in Malente. Und davon, dass es da einen ganz neuen Sound gibt, und ob unser Vater sich überhaupt ein Bild davon macht.
Wenn das ein sogenannter Klang ist, schrie unser Vater, und nichts anderes bedeutete ja wohl Sound, wie sollte er sich dann ein Bild davon machen, er sei ja kein, und hier schlug er mit dem Handballen zu jeder Silbe auf den Tisch, Syn-äs-the-ti-ker.
Synästhetiker, Synthesizer – da war er schon mit einer Silbe im Innersten deines Lieblingsthemas. Man konnte richtig sehen, wie du die Ohren spitztest, als diese Silbe kam, und wie gern du von deinen selbstgebauten Instrumenten und davon erzählt hättest, was du mit ihnen vorhattest. Aber unser Vater wollte nichts davon hören, er wollte dich, glaube ich im Nachhinein, nur wegtreiben. In die Elektrolehre nach Plön, in die Molkerei ins Nachbardorf, nach München – Hauptsache, vom Hof.
Das mit der Elektrolehre wäre gar nicht so abwegig gewesen. Du hättest stundenlang über Oszillatoren, Modulationseffekte, Hüllkurven, Tiefpassfilter, spannungsgetriebene Kontrollkomponenten und Frequenzen reden können, wenn unser Vater dich gelassen hätte. Wozu das alles, Gerald?, aber das war eine rhetorische Frage, auf die du mit geduldiger Provokation geantwortet hast. Wie man mit nur vier Wellen-Formen, Sinus-, Rechteck-, Dreiecks- und Sägezahn-Wellen, ganz neue Soundwelten erschaffen könnte. Also, immer nur eine zur Zeit, weil der Klang ja anders als beim Klavier oder bei der Gitarre monophon wäre, es sei denn, und hier, das war noch zu Schulzeiten, käme dann, so du weiter, das Thema Taschengeld ins Spiel: es sei denn, so du weiter, man würde mit Hilfe von sogenannten Patchkabeln verschiedene Module miteinander verbinden, aber dafür müsste man natürlich erstmal verschiedene Module haben, oder überhaupt eins.
Mit Taschengeld allein wäre da nicht viel zu machen gewesen. Oma Großkordt besorgte dir eine Aushilfsarbeit im Lager vom Horten in Kiel, sie hat allen davon erzählt und dabei in deine Richtung geblickt, damit du jedes Mal Danke sagst. Dein Zimmer war vollgestopft mit Tasteninstrumenten. Das fing an mit dem Schifferklavier, dann das normale Klavier von Oma Großkordt, dann eine Heimorgel, und dann Tonbandgeräte, mit denen du, was du auf der Heimorgel spieltest, neu zusammenklebtest. Dein Traum waren ein Minimoog oder ein ARP 2600, das weiß ich, weil du die Schriftzüge dieser Fabrikate sorgfältig auf kariertes Papier gemalt und außen an deine Zimmertür gehängt hast, vor der ich oft stand, nachdem du weg warst. Deine Sachen waren Marke Eigenbau, für mehr reichte der Horten-Job dann doch nicht.
So ging das jedenfalls hin und her. Unser Vater sagte, Musikmachen sei kein Beruf, sondern ein Steckenpferd, siehe Spielmannszug. Du sagtest, Lehrer sei auch kein Beruf, zumindest nicht, wenn man ihn so ausübe wie unser Vater, als Zeit- und Menschenvertreib.
In meiner Erinnerung sagte unsere Mutter, ihr bringt mich noch ins Grab. Aber je mehr Zeit vergeht, desto mehr Sachen könnten die Leute gesagt haben, die im Nachhinein vielleicht ein bisschen zu gut passen würden.
Es war stockdunkel an diesem Morgen. Ich blieb stehen und holte meine Taschenlampe heraus. Ich machte sie ein paarmal an und aus und leuchtete in den Graben neben der Landstraße, dann stopfte ich sie wieder in den Rucksack. Es machte mir Freude, mich zu vergewissern, wie viele Sachen im Rucksack waren. Zum Beispiel die paar Briefe von dir. Ich hatte mir vorgenommen, hin und wieder darin zu lesen, um mich davon zu überzeugen, dass alle meine Probleme gelöst werden würden, sobald ich dich in München fand.
Leider habe ich die Briefe inzwischen verloren, also, ich weiß nicht, wo sie sind. Rechts vom Weg lag der Truppenübungsplatz, wo wir als Kinder auf den ausrangierten Panzern spielten. Bis ich anfing, Angst vorm Grab der weißen Witwen zu haben. Heimatkunde, vierte Klasse. Einige der ältesten Steingräber in ganz Schleswig-Holstein, direkt in unserer Gegend. Und wie Leute wie Oma Großkordt seit Jahrhunderten sagten, nachts kämen die weißen Witwen aus ihren Gräbern und schwebten über die Felder. Aber das waren wohl die weißen Hirschkühe, die es hier in der Gegend ab und zu gibt. Rund um die Steingräber haben sie den Truppenübungsplatz gebaut, aber unser Vater hatte eine Sondergenehmigung für Besuche am Steingrab, als Lehrer.
Als ich an die B 430 kam, war ich durchgefroren. Es regnete auch ein bisschen. Aber ich hatte keine Lust, meinen gelben Regenanorak anzuziehen, weil ich dann aussah wie ein Kind, und wer würde um diese Tageszeit ein Kind mitnehmen. Erst hatte ich überlegt, die erste Etappe zu laufen, aber es dauert etwa anderthalb Stunden von Seutendorf nach Plön, wenn man die Bundesstraße entlanggeht. Und bis dahin wären längst alle bei uns wach und die Schwestern hätten längst erzählt, was ich vorhatte, und außerdem sollte unser Vater um acht mit dem Bestatter über die Einäscherung reden. Spätestens dann würde auffallen, dass ich nicht da war, denn bei solchen Terminen verließ unser Vater sich auf unsere Mutter, oder, wenn sie nicht da oder tot war, auf mich. Er nickte dann immer nur, als hätte er genau meine Fragen stellen und meine Antworten geben wollen, aber ich wäre schneller gewesen, vorlaut. So war das bei uns, seit du weg warst. Das Gespräch musste jetzt unser Vater alleine führen, vielleicht mit Oma Großkordt.
Wenn Oma Großkordt ihre Finger im Spiel hatte, würde die Beerdigung kirchlicher werden, als unsere Mutter das gewollt hätte. Oma Großkordt war unter den Nationalsozialistinnen eine der frommsten, sagte unser Vater gern. Du weißt ja, die beiden beharkten sich immer, Oma Großkordt und unser Vater. Sie nannte ihn die Enttäuschung ihres Lebens, und er hackte darauf herum, dass sie fromm und Nazi war, und ob eins allein nicht schon schlimm genug gewesen wäre. Es ist schwer, miteinander auszukommen, wenn man einander viel zu verdanken und viel zu verzeihen hat. Das trifft womöglich auch auf uns beide zu, dich und mich.
Oma Großkordt ist 1932 in die NSDAP eingetreten, und manchmal fuhr sie auch 1975 noch mit dem Mofa nach Malente, weil es da an einem Kiosk die National-Zeitung gab. So eine Oma war das. Um möglichst schnell voranzukommen, hatte ich beschlossen, Autostopp zu machen. Um kurz nach vier kam auf Fehmarn die erste Fähre aus Dänemark an, und dann fuhren so gegen fünf die ersten Lkw auf dem Weg nach Hamburg hier bei uns vorbei. Die Zeit konnte ich gut im Blick behalten, weil ich deine alte Uhr hatte, mit dem zerschlissenen Jeans-Armband. Du hast sie mir gegeben, bevor du gegangen bist. Du hast ein bisschen theatralisch sowas gesagt wie: In der Disko steht die Zeit still, da braucht man keine Uhr.
Ich setzte mich an die Schulbushaltestelle, weil es da einen Holzunterstand gegen den Regen gab. Ich dachte länger darüber nach, was ich heute in der Schule verpasste, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, welche Fächer das waren. Ich bekam Hunger und Durst und holte mir eine Schinkenstulle und die Thermoskanne aus dem Rucksack. Der Tee war von gestern Abend, aber diese Kanne hielt gut warm, der Tee dampfte hell in der Dunkelheit, vom Morgen noch keine Spur. Das Schinkenbrot war schwer zu kauen, weil ich aus schlechtem Gewissen die angetrocknete erste Scheibe nicht beiseitegelegt hatte. Ich wollte nicht, dass die anderen die dann fanden und sagten: Aha, Beeke haut ab und lässt uns die trockene Scheibe hier, und wer soll die ins Rührei schnippeln, wenn Mama tot ist. Mit dem Tee zusammen bekam ich das Brot aber runter.
2
Du merkst, so schnell ist das alles nicht erzählt. Ich habe meine Fähigkeit, mich kurzzufassen, überschätzt. Bei mir, in der Welt, in der ich alt bin, ist schon der nächste Abend. Früher habe ich dir gern lange Briefe geschrieben. Deine Antworten sind dann im Laufe der Monate immer kürzer geworden. Du hattest so viel zu tun in München. Als ich losging, um dich zurückzuholen, hatte ich, glaube ich, bestimmt ein halbes Jahr nichts von dir gehört. Aus dieser Mail jedenfalls wird ein Anhang werden, ich habe mir diesen Text in ein Dokument kopiert. Mein Mann fragt, was ich so lange und so spät am Rechner mache. Ich sage, Patientenverfügung, ich regele meine letzten Dinge.
Nach einer Weile sah ich die ersten Scheinwerfer, Löcher im Morgengrauen. Die 430 ist ja schnurgerade an dieser Stelle, man weiß auf einen Kilometer oder mehr, wenn um diese Zeit jemand von Norden kommt. Weil die Lkw alle die gleiche Fähre genommen hatten, fuhren sie Kolonne. Jetzt wurde mir klar: Wenn ich den ersten anhielt, mussten die anderen auch alle bremsen, und dann hätte ich hier, wo unsere Landstraße zwischen den Knicks abbog zu unserem Hof-Fitzelchen, einen ganzen Lkw-Stau verursacht, und wenn die wieder anfuhren, wahrscheinlich mit Hupen, wäre die ganze Gegend wach.
Das Geräusch von den Lkw, als sie näher kamen, war militärisch oder wie von Dinosauriern, und kurz hatte ich Sehnsucht nach meinem Bett. Aber dann dachte ich an unsere Mutter im Nebenzimmer und unseren Vater auf der Couch, und dann ging es wieder. Das traurige Gesicht, das sich unsere Schwestern teilten.
Ich schätzte, dass ungefähr zwanzig Lkw auf die Fähre passten. Ich hatte davon natürlich keine Ahnung, aber das wusste ich noch nicht. Das merke ich eigentlich jetzt erst so richtig. Ich bin inzwischen wie gesagt fünfundsechzig. Stell dir vor, du wärst zu meinem Geburtstag gekommen. Wären wir beide verlegen gewesen, weil wir so alt sind? Ich stelle mir dich ohne Haare vor, wie irgendein x-beliebiger Mann um die siebzig, vielleicht mit Bauch.
Ich blieb im Schutz der Haltestellenhütte stehen und zählte, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, und dann sprang ich raus und winkte wild.
Der siebzehnte Lkw war der letzte, er rauschte an mir vorbei, bestimmt schon vierzig, fünfzig Meter hinter der Kolonne. Ich stellte mich auf die Straße und winkte ihm mit beiden Armen hinterher, weil mir nichts Besseres einfiel.
Ich sah, wie die Bremslichter vom Lkw angingen, sie leuchteten nach rechts und links rot die kahlen Knicks hinauf, sodass sie aussahen wie ein roter Tunnel im Nebel. Es gab ein großes Ächzen und Schnaufen, als der Lkw hielt. Ich hakte meine Daumen links und rechts fest unter die Ledergurte des Rucksacks und rannte los. Erst zur Beifahrertür, weil ich das so gewohnt war vom Autostopp. Aber die schien mir meterhoch, und natürlich konnte der Lkw-Fahrer mich vom Fahrersitz aus gar nicht sehen. Ich ging in den Scheinwerferkegeln des Lastwagens an seiner Schnauze vorbei, und als ich genau in der Mitte war, hupte der Fahrer. Ich glaube, dass ich mir ein bisschen in die Hose gepinkelt habe, aber vielleicht ist das später dazugekommen. Ich trug eine Wollstrumpfhose unter der Jeans. Der Wind war kalt.
Aus dem Fenster auf der Fahrerseite lehnte sich ein Typ, der so jung war, dass ich erst dachte, er wäre vielleicht ausgerissen mit dem Lkw, und was das dann wohl für eine Geschichte werden würde, mit uns beiden. Aber man konnte einfach mit einundzwanzig schon fertiger Lkw-Fahrer sein, vor allem, wenn man beim Bund den Führerschein gemacht hatte, und manche sahen mit einundzwanzig aus wie sechzehn.
Er fragte mich, ob ich spinne, und dann, was ich wolle. Ich hätte ein Riesenglück, dass er nochmal in den Rückspiegel geschaut hätte, denn er könnte einfach nicht fassen, dass er wieder als Letzter von der Fähre gekommen sei. Das Schlimmste sei, beim Entladen nicht rechtzeitig an die Rampen zu kommen, ab der vierten Position musste man beim Futtermittelgroßhandel ewig warten, bis die Kollegen vor einem fertig waren.
Damals kam ich nicht so gut klar mit Erwachsenen, die viel redeten. Dazu gehörte zum Beispiel unser Vater. Ich ließ nun auch diesen Redeschwall über mich ergehen und sagte in die erste kurze Atempause: Ich will nach Plön zum Bahnhof. Er fragte, warum. Ich sagte, um den Zug nach Hamburg zu nehmen. Er schüttelte den Kopf und sagte, er würde doch sowieso nach Hamburg fahren, da könnte ich mir die fünf Mark für die Zugfahrkarte sparen. Er machte eine Handbewegung, die bedeutete, dass ich rumgehen und auf der anderen Seite wieder einsteigen sollte. Als ich vorm Lkw war, hupte er nochmal. Das war ein richtiger Scherzkeks. Schade, dass du nicht bei unserer Hochzeit warst. Es war schwierig, die Tür aufzubekommen, weil mich der Rucksack auf dieser dreisprossigen Leiter ganz schön nach hinten zog, und weil meine Finger klamm waren. Außerdem war ich klein, ich habe meinen Schub ja erst mit siebzehn, achtzehn gemacht.
Als ich mich auf dem Beifahrersitz installiert hatte, fragte er mich, was ich überhaupt sei, Männlein oder Weiblein. Diese Frage ärgerte mich so sehr, dass ich ihm sagte, das würde ihn gar nichts angehen. Er lachte, er machte einen recht gutmütigen Eindruck auf mich. Das hat sich bis heute nicht geändert. Er sagte, ich sollte ihn mal ein bisschen wachhalten, weil er seit gestern Abend unterwegs sei, und die paar Stunden auf der Fähre hätte er kein Auge zugekriegt, immer dieser Dieselgestank. Er bot mir eine Zigarette an. Zum Beispiel könnte ich ihm mal erzählen, was ich in Hamburg wollte. Ich nahm die Zigarette und schob sie mir hinters Ohr, so wie du das immer gemacht hast.
Umsteigen will ich in Hamburg, sagte ich. Und dann nach München.
Warum das denn? Eine halbe Weltreise!
Meine Mutter ist gestern gestorben, mein Vater trinkt, und meine Schwestern sind zu klein, darum hole ich meinen Bruder aus München, der muss sich um alles kümmern – diese Sätze kamen aus mir raus, als hätte ich sie mir zurechtgelegt, und ich kann mich so gut daran erinnern, weil ich sie danach noch häufiger gesagt habe.
Ich sah ihm an, dass er nicht wusste, was er zu der Todesnachricht sagen sollte. Er hatte unsere Mutter ja auch nicht gekannt. Weil ihm nichts einfiel, fragte er mich, ob ich schon von Telefonen gehört hätte.
Ich erklärte ihm, dass ich deine Telefonnummer nicht hätte, und dass ich nicht einmal wüsste, ob du überhaupt ein Telefon hast.
Ein Brief oder eine Postkarte wären jetzt auch nicht langsamer in München als ich, erklärte er mir. Er war von Anfang an ein richtiger Schlauberger. Die Scheibenwischer quietschten, als würden sie nicht mehr lange durchhalten.
Ich sagte ihm, dass ich auch keine Adresse von meinem Bruder hätte, und ob er schwer von Kapee wäre.
Er nickte. Ich mochte Leute, die sich nicht so leicht beleidigen ließen. Vielleicht hält unsere Ehe deshalb schon so lange. Was denn dann mein Plan wäre?, fragte er. Mich mit einem Plakat auf den Marienplatz stellen, wo draufstand: Hallo Bruderherz, wo bist du?
Ich wusste nicht, was der Marienplatz war, darum ging ich gar nicht darauf ein. Aber ich merkte mir den Ortsnamen, für später. Ich sammelte einfach erstmal alle Informationen, man wusste nie, wann man die nochmal brauchen konnte.
Ich sagte, ich würde einfach die Diskotheken abklappern. Weil mein Bruder nach einem großen Streit mit meinem Vater nach München gegangen sei, um dort Disko-Produzent zu werden.
Eigentlich hätte er jetzt fragen müssen, was ein Disko-Produzent ist. Ich hatte es nicht gewusst, bevor du es mir erklärtest, es hätte mich auch gar nicht interessiert, wenn es nicht dein Thema gewesen wäre. In der Bravo stand immer mal was über Disko, nicht so viel wie über Rock und Pop, aber die ganzen Hintergründe, also: wie diese Musik hergestellt wurde, das war schon eher was für Fachleute. Und dieser Lkw-Fahrer war kein Fachmann, da war ich mir sicher.
Stattdessen fragte er nämlich, ob mein Bruder schwul sei. Das war das Erste, was ihm zum Thema Disko einfiel. Ich fand es ganz schön unverschämt. Nicht, dass ich wüsste, sagte ich und schaute aus dem Fenster. In der Schule bedeutete das: Wohl kaum, du Vollidiot.
Er fragte, was man denn da so machen würde, als Disko-Produzent. An dieser Stelle war ich froh, dass ich einfach in meinen Rucksack greifen konnte. Ich fand, dass es mir eine gewisse Autorität verlieh, wenn ich direkt aus einem Brief von dir zitierte, statt das in meinen eigenen Worten wiederzugeben. Man musste immer an die Quelle gehen, was ist die Quelle!, pflegte unser Vater zu schreien, wenn ihm nicht passte, dass man irgendein Gerücht vom Nachbarhof oder aus der Feuerwehrjugend weitererzählte. Oder im letzten Streit mit dir, den ich die Stiege rauf nur als Sound wahrnahm. Worum es dabei ging, habe ich erst in München begriffen.
Du hast damals geschrieben, dass in München ein ganz neuer Sound entsteht, der München-Sound, und du hättest eine Sängerin getroffen, die dafür extra aus Berlin gekommen sei, die Tochter von einem amerikanischen Soldaten, und die würdest du nun produzieren. Das würde bedeuten, dass du die Musik für sie aufnimmst und mit ihr beratschlagst, was sie singen soll und wie. Am Ende entschied sie zwar über den Gesang, über den Klang aber du. Und du hättest jetzt endlich auch die neuesten Synthesizer. Erstmal nur geliehen, aber na gut.
Munich Sound.
Das sei, an diese Formulierung erinnere ich mich genau, das ganz große Ding. Wir durften zu Hause eigentlich nicht Ding sagen. Wenn es ein Gegenstand war, sagte man Sache, aber nur, wenn man wirklich gar nicht wusste, was das war. Denn eigentlich hatte alles einen Namen, eine Bezeichnung, und dann verwendete man die. Und wenn es etwas Abstraktes war, sagte man erst recht nicht Ding. Unser Vater sagte, alles, was man nicht anfassen kann, ist abstrakt.
Man durfte paradoxerweise aber sagen: Das ist ja ein Ding, wenn einem etwas komisch vorkam, egal, wie abstrakt es war.
Falls man das, daran erinnerte ich mich noch aus deinem Brief, überhaupt singen nennen konnte, was die Sängerin dort machte. Du hast damals lustige Briefe geschrieben, leider zu selten. Schöne Briefe. Traurig auch. Aber immer überschwänglich. Sie gurrt!, Sie zirpt!, Sie knurrt!, schriebst du über den Gesangsstil der Sängerin.
Ich wurde den Verdacht nicht los, dass du diese ganzen Tiervergleiche verwendetest, weil du dachtest, ich würde das dann besser verstehen. Schließlich war ich gern im Wald. Im Moor. Am See. Am Meer. Auf dem Feld. Wegen der Vögel. Und der Fische. Als du weggingst, war ich fast dreizehn. Du hattest mir vorher Bescheid gesagt, weil du wusstest, dass auf mich Verlass ist. Und dann kamst du nachts nochmal und hast angeklopft, ganz leise, wie Mäusefüße, die über Holz huschten, und hast dich auf meine Bettkante gesetzt und gesagt, du müsstest jetzt los, und, wie abgemacht: Du würdest dann aus München anrufen und alles erklären.
Erinnerst du dich?
Angerufen hast du nur ganz selten, und wenn, dann wolltest du immer schnell mit Papa, und irgendwann nur noch mit Mama sprechen. Ferngespräche waren teuer, und du führtest sie immer nur, wenn du Geld brauchtest, das war paradox. Unser Vater redete irgendwann nicht mehr mit dir. Das ist mir alles zu abstrakt, sagte er. Erklärt hast du mir nichts. Erst in München dann, und da war es wohl für uns alle zu spät.
Das klingt alles vorwurfsvoll, stelle ich fest. Ich kann es gerade nicht ändern.
3
Der Lkw-Fahrer sah mich von der Seite an und sagte, Disko sei doch scheiße. Ich hatte dazu keine Meinung. Wenn du mir was vorspieltest in deinem Zimmer, bedeutete das, dass du mich nicht rauswarfst. Das mochte ich an der Musik. Die Musik klang sehr groß und dramatisch, aber für meine Begriffe auch etwas gleichförmig. Süßlich. Wie eine Sahnetorte, die nach wer weiß was aussah, aber am Ende, wenn man sie auf dem Teller hatte, schmeckte alles gleich, eindimensional. Ich zuckte also die Schultern, seine Meinung über Disko interessierte mich nicht. Und ob ich denn überhaupt genug Geld dabeihätte, um von Hamburg nach München mit dem Zug zu fahren, das würde gut und gern dreißig bis fünfzig Mark kosten, obwohl, ich würde ja wohl noch auf Kinderermäßigung fahren.
Heute wundert mich, dass der Lkw-Fahrer nicht sofort angehalten und gesagt hat, Alles aussteigen, ich kutschiere doch nicht irgendwelche Minderjährigen durch die Gegend, die von zu Hause abgehauen sind. Damals war es den Leuten völlig egal, was Kinder und Jugendliche machten. Entweder, weil die Leute älter waren und sich noch nie dafür interessiert hatten, von denen aus hätten wir alle weiter im Bergwerk oder in der Fischkonservenfabrik arbeiten können. Oder, weil sie jung waren und fanden, dass Kinder die gleichen Rechte haben sollten wie Erwachsene. In der Hinsicht habe ich dann auch noch einiges erlebt, davon mal ganz abgesehen.
Mit der Frage nach dem Geld hatte ich gerechnet, ich hatte mitgedacht und vorausgeplant. Ich klopfte auf meine Brusttasche und sagte, dreißig bis fünfzig Mark wären nun wirklich gar kein Problem.
Er fragte mich, warum meine Mutter gestorben sei. Das werde ich nie vergessen: warum, nicht woran. Ich verlor langsam die Geduld mit ihm, aber bis Hamburg waren es noch gut und gern zwei Stunden.
Ich sagte ihm, sie sei ermordet worden. Das stimmte nicht. Aber ich sollte ihn ja wachhalten.
Ich sollte keinen Scheiß erzählen, sagte er. Ich zuckte die Achseln.
Er wollte wissen, von wem.
Ich zuckte gleich nochmal die Achseln. Das sollte doch mein Bruder rausfinden, das war doch der Sinn der Sache. Der hatte die besten Kontakte, der kannte jeden zwischen Malente und Plön.
Also zweihundert Leute, sagte der Lkw-Fahrer, lachte und hörte dann gleich wieder damit auf, denn es ging ja um den Tod unserer Mutter.
Ich sollte, sagte er zu mir, jetzt mal im Ernst sagen, was mit meiner Mutter passiert sei.
Ich dachte nach und hoffte, dass es aussah, als würde ich um Fassung ringen. Ich wollte mir was ausdenken, aber mir fielen immer nur Sachen mit Hochsitz ein, und das war mir zu real.
Weißt du, dass unsere Mutter rückwärts vom Hochsitz gefallen ist? Haben wir darüber je so detailliert gesprochen, in München oder beim letzten Mal, als wir uns gesehen haben? Jedenfalls lag sie am unteren Ende der Leiter, viereinhalb Meter tief. Sie ist mit dem Kopf auf einen Stein geknallt und war sofort tot.
Sie hatte einfach richtig Pech, hat Doktor Kossendey gesagt. Er musste es ja wissen. Kannst du dich an Kossendey erinnern? Ich hoffe es.
Ein paar Zentimeter weiter links oder rechts und sie wäre auf Moos gefallen. Kossendey hat das mit dem Pech zu mir gesagt, weil er mich trösten wollte, denke ich. Ich fand und finde es nicht tröstlich, einfach Pech gehabt zu haben: Schädel-Hirn-Trauma, was für ein Pech.
Ich konnte mich in diesem Wort verlieren wie in einer Landschaft: Trauma. Es klang für mich, als würde sich ein Traum ins Unendliche dehnen, wie der Tod. Unsere Mutter ist vor ihrem Tod nie auf einen Hochsitz gegangen. Auch nachdem du weg warst, war das keine Gewohnheit, die sie entwickelt hätte. Aber irgendwann ist für alles das erste und das letzte Mal.
Mama hat doch so gern in die Weite geguckt, habe ich unseren Schwestern gesagt. Ich war mir sicher, unsere Mutter wäre auf den Hochsitz gegangen, um den Goldregenpfeifer vor seiner Wanderung nach Süden zu sehen. Unsere Mutter und ich waren beide überzeugt, dass sich ein Paar davon im Moor hinterm Hof angesiedelt hatte. Jede von uns wollte der anderen gern erzählen, sie hätte den Goldregenpfeifer gesehen, oder vielleicht sogar das Pärchen. Sie wollte meinetwegen Ausschau halten danach. Aber diesen Gedanken wollte ich für mich allein haben. Ungerecht, vielleicht. Auch der am stärksten ausgeprägte Gerechtigkeitssinn braucht mal eine Pause.