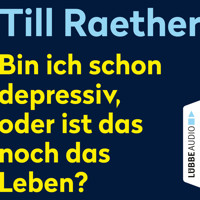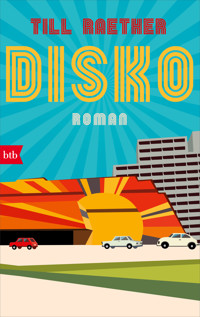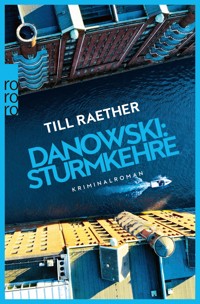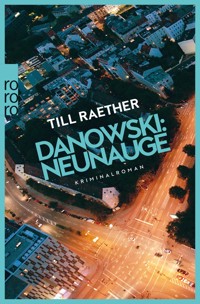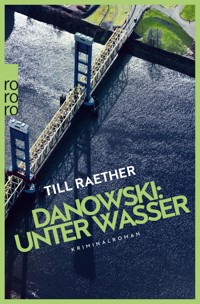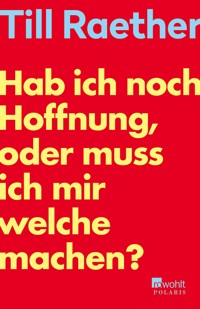
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Angesichts der derzeitigen Weltlage − Krieg, Klima und Corona − fällt es zunehmend schwer, hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Doch wie können wir in diesen Zeiten für uns selbst Zuversicht entwickeln und damit auch für unsere Kinder? Wie schaffen wir es, den Kopf angesichts eher düsterer Perspektiven über Wasser zu halten? Und ist es wirklich schlimm, wenn wir daran einmal scheitern? Till Raether denkt über all diese Fragen nach und trifft damit den Nerv der Zeit. In dem für ihn so typischen Ton − sehr persönlich, reflektiert und mit Humor − macht er auf nachdenkliche Weise Mut und regt an, Zuversicht auch auf ungewöhnlichen Wegen zu finden. Ein leichtes Buch über ein schweres Thema, das in der heutigen Zeit wichtiger ist als je zuvor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Till Raether
Hab ich noch Hoffnung, oder muss ich mir welche machen?
Über dieses Buch
Angesichts der derzeitigen Weltlage − Krieg, Klima und Corona − fällt es zunehmend schwer, hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Doch wie können wir in diesen Zeiten für uns selbst Zuversicht entwickeln und damit auch für unsere Kinder? Wie schaffen wir es, den Kopf angesichts eher düsterer Perspektiven über Wasser zu halten? Und ist es wirklich schlimm, wenn wir daran einmal scheitern? Till Raether denkt über all diese Fragen nach und trifft damit den Nerv der Zeit. In dem für ihn so typischen Ton − sehr persönlich, reflektiert und mit Humor − macht er auf nachdenkliche Weise Mut und regt an, Zuversicht auch auf ungewöhnlichen Wegen zu finden. Ein leichtes Buch über ein schweres Thema, das in der heutigen Zeit wichtiger ist als je zuvor.
Vita
Till Raether, geboren 1969 in Koblenz, arbeitet als freier Autor in Hamburg, u.a. für das SZ-Magazin. Er wuchs in Berlin auf, besuchte die Deutsche Journalistenschule in München, studierte Amerikanistik und Geschichte in Berlin und New Orleans und war stellvertretender Chefredakteur von Brigitte. Till Raether ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Sein Sachbuch «Bin ich schon depressiv, oder ist das noch das Leben?» stand 2021 wochenlang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Seine Romane «Treibland» und «Unter Wasser» wurden 2015 und 2019 für den Friedrich-Glauser-Preis nominiert, alle Bände um den hypersensiblen Hauptkommissar Danowski begeisterten Presse und Leser. «Blutapfel» wurde vom ZDF mit Milan Peschel in der Hauptrolle verfilmt, weitere Danowski-Fernsehkrimis sind in Vorbereitung.
Impressum
Die Arbeit des Autors wurde gefördert durch ein Zukunftsstipendium der Behörde für Kultur und Medien Hamburg.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg Copyright © 2023 by Till Raether
Covergestaltung HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich
Coverabbildung ###
ISBN 978-3-644-01655-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
«Woran denken Sie?», fragte er, hatte keine Hoffnung, nur die Sehnsucht nach einer Hoffnung, und verlor sie, als sie ihn mit einem langsamen, zärtlichen Lächeln ansah. «Ich? An nichts», sagte Franziska.
Brigitte Reimann: «Franziska Linkerhand»
1. Wichtigtuerei und Überheblichkeit
Wir saßen vor dem Fernseher, als das Telefon klingelte. Meine Mutter ging ran und kam kurz danach zurück: «Für dich.» Ich begab mich zur Schrankwandecke, wo das Telefon stand, und setzte mich auf den Stuhl mit dem geflochtenen Polster. Das musste man bei uns, um bequem telefonieren zu können, das Telefonkabel war so kurz, dass man den Apparat kaum anheben, geschweige denn woandershin mitnehmen konnte. Durch die offene Zimmertür konnte ich weiter auf den Fernseher schauen. Ich war noch recht gefesselt von dem Film, der da lief. Aber das änderte sich schlagartig, als ich durchs Telefon hörte: Die Amerikaner fliegen einen Angriff. Wir müssen etwas tun.
Ich bin nicht in einem Kriegsgebiet aufgewachsen, mein Leben war nie durch Hunger, Gewalt, Armut oder Naturkatastrophen bedroht. Die Umstände in diesem April 1986 waren vergleichsweise undramatisch. Neun Tage zuvor hatte es in West-Berlin, wo ich lebte, einen Anschlag auf eine Diskothek gegeben, das La Belle. Drei Menschen starben, 229 wurden verletzt. Menschen, die meinem Alter und meiner Lebenswirklichkeit nah waren: Ich war siebzehn. Allerdings ging ich nur selten in Discos. Meine Themen waren Bücher, Zeitungen, Mädchen und Angst vor dem Atomkrieg, ein bisschen auch vor dem Waldsterben und dem sauren Regen. Ich erinnere mich, dass das Attentat aufs La Belle in der Zeitung stand und dass wir zu Hause darüber sprachen. Ich erinnere mich, dass ich schockiert war und dass ich mir die Situation mit Entsetzen ausmalte. Aber ich war nicht besonders alarmiert.
Das lag einerseits daran, dass ich mir mehr Sorgen über das atomare Wettrüsten machte als darüber, ich könnte Opfer eines Anschlags werden. Terrorismus gehörte zu unserer Lebenswirklichkeit. Drei Jahre zuvor hatte mein Vater aus seinem Büro an der Uhlandstraße angerufen, um uns zu sagen, dass gegenüber im Maison de France eine Bombe explodiert sei, im Hintergrund hörte ich Sirenen. Wir, und damit meine ich Kinder und Jugendliche in meinem Alter, arrangierten uns damit: Wenn wir auf Kursfahrt in London waren, waren die Mülleimer zugeschweißt, damit die IRA keine Bomben darin verstecken konnte. Also steckten wir uns den Müll in die Jackentaschen. Seit dem Anschlag auf das Münchner Oktoberfest 1980 ging ich nicht mehr auf den Rummel. Fast eine Art Kaltblütigkeit, die sich auch in meiner Reaktion auf die Toten und Verletzten vom La Belle zeigte: Es war schlimm, und manchmal kam es näher, aber es war Teil unseres Lebens. Es fühlte sich an, als könnte man nichts dagegen tun, außer sich zu arrangieren.
Wie aber sollte man sich arrangieren mit der Gefahr eines Krieges? Der unweigerlich zu einer atomaren Auseinandersetzung führen und uns alle auslöschen würde?
Am Telefon war jemand von der SV, der Schülervertretung. Die nicht nur aus den Klassensprechern bestand und den Schulsprechern und ihren Stellvertretern[1], sondern die sich vor allem auch als politisches Gremium verstand. Die SV wurde aktiv, wenn es darum ging, dass es auf den Schul-Toiletten kein Klopapier gab oder dass einige unserer Lehrkräfte noch sehr geprägt durch die Nazizeit waren und sich entsprechend äußerten. Vor allem aber wurde die SV aktiv, um Demonstrationen zu organisieren. Für Hausbesetzungen, gegen Polizeigewalt, gegen den NATO-Doppelbeschluss.
Die USA hatten den libyschen Diktator Gaddafi als Urheber des Attentats aufs La Belle ausgemacht. Die Disco war beliebt bei in Berlin stationierten US-Soldaten, daher galt der Anschlag als Angriff auf die USA. Präsident Ronald Reagan ließ nun von Kampfjets Ziele in Libyen bombardieren. Vergeltungsschlag nannte und nennt man das. Fünfzehn Zivilist*innen starben. Die SV hatte über den Berliner Schülerrat, die Vertretung aller Schulsprecher, eine Telefonkette organisiert: Die Schulsprecher riefen die Klassensprecher an, die jetzt die Telefonliste ihrer Klasse abtelefonierten. Oder zumindest jene anriefen, von denen sie glaubten, sich politisch auf sie verlassen zu können. Denn es ging darum, einen Schulstreik zu organisieren, aus Protest gegen die, wie man damals sagte, Kriegstreiberei der US-Amerikaner. Der Schülerrat hatte eine Demo für den nächsten Vormittag angemeldet, während der Schulzeit. Als Zeichen für den Frieden. Weil man mit Gewalt nicht auf Gewalt antworten durfte.
Ich weiß nicht mehr, ob ich den Anruf bekam, weil ich Klassensprecher war oder weil ich als politisch engagiert galt. Jedenfalls war ich bald mit ein paar anderen Leuten aus meiner Klasse am Telefon. Meine Mutter wunderte sich, warum ich aus unserem Fernsehabend ausgestiegen war, aber ich war aufgeregt, fast euphorisch, ich hatte jedes Interesse an irgendeinem Filmklassiker im dritten Fernsehprogramm verloren. Ich versuchte, ihr die Situation zwischen zwei Telefonaten möglichst knapp und eindringlich zu umreißen. Was Unerhörtes passiert war, was wir dagegen tun mussten, wie wenig Zeit wir nur noch hatten, bis die Ersten schon im Bett liegen und nicht mehr ans Telefon gehen würden. Es gelang mir nicht, ihr diese Dringlichkeit zu vermitteln. Wie wichtig sich das für mich anfühlte. Wichtigtuerei, das ist uns und mir kurz darauf vorgeworfen worden, unter anderem. Ich sagte Schulstreik, meine Mutter war nicht begeistert.
Am nächsten Tag gingen wir demonstrieren statt zur Schule, gegen die US-Angriffe auf Libyen.[2] Anders gesagt, wir schwänzten, um auf der Straße rumzubrüllen. Ich weiß nicht mehr, wie viele aus unserer Schule dabei waren, als wir in Schöneberg in der Nähe des West-Berliner Rathauses demonstrierten. Aus meiner Klasse, denke ich, waren wir sechs oder sieben Leute. Ich erinnere mich auch hier an ein Gefühl von Wichtigkeit, von Bedeutung: Was wir taten, hatte einen Sinn. Meine Freundin hatte ein paar Äpfel und Brote in ihrem selbst genähten Rucksack, zu trinken hatte man damals irgendwie nie dabei. Ich sehe diesen gestreiften Rucksack noch vor mir. Und ich erinnere mich deutlich, dass ich es, wie bei anderen Demos davor und danach, unangenehm und peinlich fand, mich an Sprechchören zu beteiligen. Unweigerlich mündete jede USA-kritische Demonstration damals in ein skandiertes «U-S-A, In-ter-na-tio-naaale Völker-mord-zen-traaale». Erstens ein seltsames Wortbild, zweitens und vor allem: absurd und geschichtsvergessen, von deutschem Boden aus andere Länder zu «Völkermordzentralen» zu erklären.
Aber davon abgesehen war ich froh. Das änderte sich auch nicht, als wir am nächsten Tag zum stellvertretenden Schulleiter zitiert und von ihm offiziell, mündlich und schriftlich, getadelt und zum Nachsitzen und zu einem Besinnungsaufsatz verdonnert wurden. Er hielt uns eine Standpauke (verdonnern und Standpauke, Fachbegriffe aus der damaligen Zeit), an die ich mich besonders deshalb erinnere, weil das Wort «Hybris» darin vorkam, und weil mein Freund Andreas tat, was ich mich nicht traute. Nämlich zu fragen, was «Hybris» bedeutet.
«Arroganz und Überheblichkeit», erklärte Herr M. «Es ist überheblich von euch zu glauben, ihr könntet mit so einer Schüleraktion die Weltpolitik beeinflussen.» So ungefähr. Und: Es sei überheblich, dass wir glauben würden, wir könnten die Situation besser durchblicken und beurteilen als die Politiker.[3]
Mein Vater, ein unverbrüchlicher Atlantiker, war wütend und verständnislos. Er fragte, warum wir nicht gegen Libyen demonstriert hätten, warum wir nie gegen die Menschenrechtsverletzungen in der Sowjetunion und in der DDR protestierten, immer nur gegen unsere Verbündeten.
Mir schien die Antwort klar: Eben gerade, weil es unsere Verbündeten waren. Weil wir die, deren Werte wir zu teilen meinten, doch als Erste kritisieren mussten. Weil wir, wenn wir gemeinsame Maßstäbe haben wollten, doch besonders streng sein mussten. Es klang für meine Ohren recht clever, vielleicht sogar ein bisschen klug. Aber stimmte es?
Leider habe ich den Aufsatz nicht mehr, den wir in der Woche darauf beim Nachsitzen schreiben mussten. Es war so eine «Breakfast Club»-Situation, oder ihr näher, als ich sonst je wieder gekommen wäre. Die Frage, die wir beantworten sollten, lautete in etwa, ob wir Schüler über Recht und Gesetz stünden, und warum nicht.
Die eigentliche Frage war doch aber: Warum hatten wir das gemacht, warum hatte es sich so wichtig und so richtig angefühlt, warum ging es mir so gut dabei?
Ich habe in den letzten dreißig, fünfunddreißig Jahren immer wieder mal darüber nachgedacht. Man kann sich leider nicht aussuchen, welche Lebensereignisse einem noch Jahrzehnte später merkwürdig präsent sind. Aber ich glaube, die unwillkürliche Auswahl bedeutet etwas. Meist habe ich in der Erinnerung an meinen Bomben-auf-Libyen-Protest ein besonders schillerndes Beispiel für den Rausch jugendlicher Überheblichkeit, für im Nachhinein unfreiwillig komische Wichtigtuerei und Selbstgerechtigkeit gefunden. Und gestaunt, wie sicher ich mir meiner Sache damals war.
Dann, als meine Kinder anfingen, mit unserer Erlaubnis und manchmal sogar mit Erlaubnis der Schule, freitagvormittags für ihre Zukunft und gegen die Klimakrise zu demonstrieren, habe ich mich daran erinnert, wie ich mich damals gefühlt habe, und ich habe die Hingabe und die Dringlichkeit meiner Kinder damit in Verbindung gebracht. Der Gedanken, ihnen nun meinerseits, wie mir selbst im Nachhinein, Wichtigtuerei und Überheblichkeit zu unterstellen, erschien mir von Anfang an völlig abwegig. Ich sehe ja, wie ernst es ihnen und den anderen ist. Vielleicht kann ich deshalb seitdem besser würdigen, wie ernst es mir selber 1986 war. Denn seit ein paar Jahren merke ich, dass es mir nicht reicht, das Ereignis von damals als eine Anekdote über ein paar Spinnerinnen und Spinner zu erzählen, die dem US-Präsidenten ihre Werte und die Welt erklären wollten, indem sie diesen Vormittag nicht zu Reli, Geschi und Mathe gingen. Es ist vielmehr eine Geschichte über Hoffnung.
Die Achtzigerjahre habe ich als eine Zeit geradezu absurder Hoffnungslosigkeit empfunden. Die Angst eines Kindes und Jugendlichen vor dem Atomkrieg war so real wie die heutige Angst vor der Klimakrise. In meiner Erinnerung und meiner damaligen Wahrnehmung gab es im Gegensatz zu heute keinerlei Beschwichtigungsversuche. Die Botschaft, die ich aus der Politik empfing, lautete: Wenn es passiert, sind die anderen schuld. Zum Arsenal der nuklearen Abschreckung gehörte, die Gefahr eines Atomkrieges auch rhetorisch immer am Köcheln zu halten: Du kannst niemanden abschrecken, indem du versicherst, es würde schon alles nicht so schlimm kommen.
Die Botschaft, die ich zeitgleich aus der Popkultur bekam, waren Top-Ten-Hits über den Atomkrieg, einer nach dem anderen, «99 Luftballons», «Vamos a la playa», «Dancing with Tears in My Eyes». Atomkriegs-Horror-Porn von Gudrun Pausewang und anderen. Im BALI-Jugendfilmclub, wo man jeden Donnerstag für drei Mark einen neuen Kino-Blockbuster schauen durfte, lief unvermittelt die Vorschau des Atomkriegs-Schockers «The Day After», und auf dem Nachhauseweg, die nächste Woche, die nächsten Monate hatte ich die drastischen Bilder sterbender, schreiender, weinender Menschen im Kopf. So wird das also.
Es ist fast nicht mehr zu vermitteln, wie real das war, aber ich habe unter Menschen meines Alters noch niemanden gefunden, der mir deutlich widersprochen hätte. Das liegt vielleicht an meinem Bekanntenkreis. Oder daran, dass wir damals in Westdeutschland und West-Berlin in einer Atmosphäre politisch forcierter Hoffnungslosigkeit aufwuchsen.
Wenn ich nun heute an unseren Streik und unsere Demo nach den Angriffen auf Libyen im April 1986 denke, dann wird mir klar: Das gute Gefühl auf dem Flechtstuhl in Zehlendorf-Mitte und auf der Straße in Schöneberg und im Konrektoren-Büro war nicht Arroganz oder Selbstbesoffenheit, sondern Hoffnung. Es waren Augenblicke von Selbstermächtigung, von Selbstwirksamkeit: In diesen Momenten fühlte es sich an, als könnte man eben doch etwas tun und als wäre das, was man tat, nicht wirkungslos. Eine Strafe und Widerspruch sind auch Wirkungen. Sicher sind wir nicht gehört worden, aber wir haben gesprochen, und es war berauschend zu spüren, wie daraus Zuversicht entstand.
Ehrlich gesagt wird es im Folgenden immer wieder darum gehen, dass Hoffnung ein Gefühl, aber eben auch eine Handlung ist. Manchmal habe ich den Verdacht, dass es, wenn es um Hoffnung geht, vielleicht doch so einfach ist, wie es Erich Kästner in seinem Gedicht «Moral» schreibt: «Es gibt nichts Gutes. Außer man tut es.» Dass also Hoffnung auch in schwierigen oder hoffnungslosen Zeiten daher kommt, dass man handelt. Sich wehrt, was sagt.
Man kann aber nicht immer etwas tun. Oft kommt es einem auch sinnlos vor, etwas zu tun, und dann wird die Sinnlosigkeit überwältigend, sie verbindet sich mit der Hoffnungslosigkeit wie zwei Blobs in einer sehr düsteren Lavalampe. Sich Hoffnung machen ist nicht so einfach, wie sich ein Käsebrot, einen Kaffee oder sich Sorgen zu machen. Die Zutaten, um sich Hoffnung zu machen, sind viel schwieriger zu finden als die, die man braucht, um sich Sorgen zu machen.
Darum möchte ich versuchen, das Tun und Machen zu ehren, aber auch, einen oder zwei oder drei Schritte zurückzugehen und überhaupt erst mal zu schauen, was man braucht fürs Gutes-Tun und Hoffnung-Machen. Schon damals brauchte ich einen Anruf und die feste Überzeugung, das Richtige zu tun, um Hoffnung erfahren zu können. Nicht die konkrete Hoffnung, eine mögliche Eskalation zwischen den USA und der Sowjetunion, vertreten durch Libyen und dessen Verbündeten Syrien, zu verhindern, indem wir Äpfel aus gestreiften Stoffrucksäcken aßen. Sondern die unkonkrete Hoffnung, in Wut und Angst nicht allein zu sein. Wenigstens in sich selbst was zu verhindern, indem man nicht tatenlos zusieht. Andere vielleicht auch ein bisschen zu ärgern, Autoritätspersonen, Stellvertreter.
Das heißt, es geht im Folgenden auch darum, etwas womöglich in manchen Situationen Unkonkretes durch konkrete Beispiele greifbarer, handfester, machbarer werden zu lassen.
Außerdem, wer sagt, es hätte nichts gebracht, und wir wären einfach nur überheblich gewesen. Diese Einschätzung mag stimmen, aber was vor allem stimmt und was sich im Gegensatz zu dieser Überheblichkeits-Hypothese unwiderlegbar nachweisen lässt: Der Atomkrieg hat damals nicht stattgefunden.
2. Das Ding mit Federn
Eine ganze Zeit lang habe ich recherchiert, um aufzulisten, warum es so schwierig, vielleicht sogar unmöglich ist, sich und, falls vorhanden, den eigenen Kindern Hoffnung zu machen. Also, die Gesamtsituation betreffend. Stichwort Klima. Von der Pandemie mal abgesehen. Und den näher an Mitteleuropa rückenden Kriegen. Dem Angriff auf politische Grundrechte in westlichen Staaten. So stellte ich mir das vor: am Anfang des Buches kurz dieses düstere Panorama, falls es jemand vergessen haben sollte. Und dann vor diesem dunklen Hintergrund langsam die Hoffnung hochziehen.
Ich habe mich dagegen entschieden.
Die Recherchetage waren deprimierend.[4] Wie viel Grad sind noch erreichbar, wie viel wären das Ende. Was ist realistisch, was ist nicht mehr zu retten. Welche Küstenlinien. Was für Wetterveränderungen. Zahlen von Menschen. Andere Zahlen von Menschen. Was müssten wir jetzt tun. Was tun wir nicht. Wieder einmal drohte mir über das, was sich abzeichnet, die Hoffnung komplett verloren zu gehen. Ich setze daher im Folgenden die elementare Bedrohung von allen und allem durch die Klimakrise voraus, ohne sie auszuschmücken.[5]
Das Problem ist: Die Kinder setzen diese Bedrohung auch längst voraus. Meine eigenen waren achtzehn und fünfzehn, als ich anfing, dieses Buch zu schreiben. Das Thema begleitet sie seit ungefähr vier, fünf Jahren. Vielleicht, seit Greta Thunbergs Schulstreik zum ersten Mal in den Kindernachrichten bei KiKA auftauchte, im Herbst 2018. Das Jahr 2019 war für sie das Jahr, in dem sie anfingen zu begreifen, was eigentlich los ist. Und auszuloten, wo noch Hoffnung ist. Dann kam etwas dazwischen. Kein Hoffnungsschimmer, sondern Corona. Dann der russische Angriff auf die Ukraine.
Die Kinder sind jetzt eigentlich in einem Alter, in dem sie, wenn alles gut laufen würde, langsam von der Hoffnung auf die Zukunft befeuert werden müssten, einer Art Lebensvorfreude. Sobald man sich als Kind der eigenen Vergangenheit und des Verstreichens der Zeit bewusst wird, beginnt die Erwartung, dass es in der Zukunft besser oder noch besser werden wird. Mehr Geschenke, ein eigenes Zimmer, Freunde in der neuen Schule, eine Lehrstelle oder ein Studienplatz, Ziele. Nur, dass das alles sich in der Erwartung viel größer und weniger banal anhört als in dieser Aufzählung. Die Jugend hat Heimweh nach der Zukunft, wie es im vom vielen Zitieren mattgegriffenen Satz von Sartre heißt. Ich glaube, Heimweh nach der Zukunft ist ein anderer Ausdruck für Hoffnung. Und worauf haben Kinder und Jugendliche ein Recht, wenn nicht auf Hoffnung?
Das ist kein abstrakter philosophischer oder theologischer Begriff, sondern – hoffentlich – eine Alltagserfahrung, ein Lebensgefühl. Hoffnung ist seit den 1980er-Jahren ein beliebter Forschungsgegenstand, lese ich in «Psychologie Heute». Vielleicht nicht ohne Grund seit einer Zeit, als die Welt am Dauerrand der atomaren Vernichtung zu stehen schien. Der Psychologe Charles Snyder glaubte damals, die Hoffnung von Menschen auf der «hope scale» erfassen zu können. Ich möchte, dass meine Kinder bei zehn sind auf meiner nach oben offenen Raether-Skala der Hoffnung. Aber ich fürchte, sie fragen sich hin und wieder, warum und wie viel Hoffnung sie überhaupt haben können.