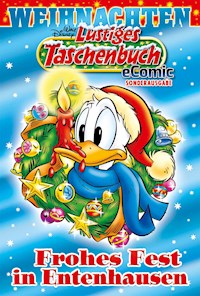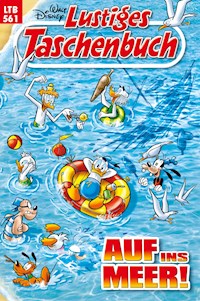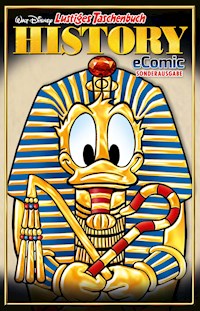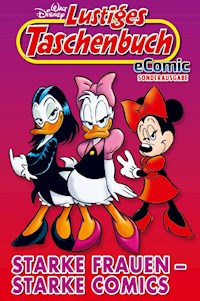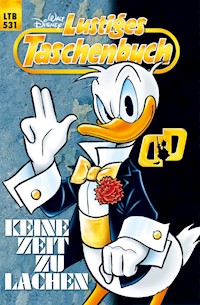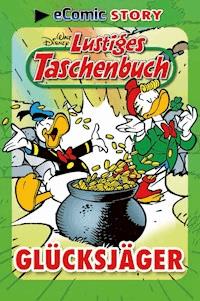Disney – Dangerous Secrets 2: Belle und DAS ENDLOSE BUCH (Die Schöne und das Biest) E-Book
Walt Disney
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Ein Buch über die Magie des Lesens: Im Schloss des Biests gefangen, freundet sich die büchervernarrte Belle mit den verzauberten Bewohnern an und erkundet die Bibliothek. Als sie das verzauberte Buch Nevermore entdeckt, zieht es sie wie magisch in die Seiten des Buches und eine unglaubliche Reise beginnt. Eine Reise in Welten voller Glanz und Intrigen. All ihre Träume von Abenteuern, die sie begraben musste, seit sie im Schloss ist, erstehen wieder auf. Doch Belle muss die Wahrheit über Nevermore herausfinden, bevor sie sich für immer in dem Buch verliert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Für alle Mädchen, die ihre eigene Geschichte schreiben wollen
PROLOG
VOR EWIGEN ZEITEN in einem alten, verfallenen Palast spielten die zwei Schwestern Liebe und Tod ihr ewiges Spiel.
Tod war die Herrin des Palastes, und jeder Sterbliche, der zu seinen rostigen Toren reiste, kehrte nie zurück. Ihr Gesicht war so bleich wie ein Leichentuch, ihr Haar so dunkel wie Mitternacht. Sie trug ein schwarzes Gewand und die Kette einer Jägerin mit Zähnen, Krallen und Klauen als Anhängern. Ihre smaragdgrünen Augen verengten sich, als sie das Schachbrett vor sich betrachtete.
„Du bist am Zug“, sagte Liebe.
„Dessen bin ich mir bewusst“, sagte Tod.
„Tick-tack“, sagte Liebe.
„Nur Narren hetzen den Tod“, sagte Tod.
Seufzend erhob sich Liebe von dem Tisch, an dem Tod und sie saßen. Ihre Augen waren von demselben tiefen Grün wie die ihrer Schwester. Silberblondes Haar fiel ihr den Rücken hinunter. Ihr weißes Gewand hob sich leuchtend von ihrer dunklen Haut ab. Ihr einziger Schmuck war eine Halskette aus verschlungenen Weidenzweigen. Schimmernde Käfer, helle Schmetterlinge und düstere Spinnen hingen daran, jedes Tier ein lebendes Juwel.
In der Halle, wo die Schwestern spielten, stand ein großen Spiegel an der Wand, sein silberner Rahmen war fleckig und angelaufen. Liebe wischte mit der Hand über sein Glas, und ein Bild erschien. Es zeigte einen Speisesaal – einst prächtig, jetzt verfallen. Draußen vor den Rundbogenfenstern fiel Schnee. Drinnen ging eine gequälte Kreatur – halb Mensch, halb Tier – umher. Hin und her ging sie und warf dabei sehnsüchtige Blicke zur Tür. Ihre Augen waren grimmig, aber in ihrer Tiefe voller Qual.
Tod blickte auf. „Wie geht es deinem Biest in letzter Zeit?“, fragte sie schelmisch. „Zerschlägt es immer noch Möbel? Essteller? Die Fenster?“
„Ich habe Hoffnung für ihn“, erwiderte Liebe und berührte das Glas. „Zum ersten Mal.“
„Ich weiß nicht, warum“, sagte Tod. „Einmal ein Biest, immer ein Biest.“
„Du suchst immer das Schlimmste in jedem“, warf Liebe ihr vor.
„Und ich finde es immer“, erwiderte Tod und richtete ihren Blick zurück auf das Schachbrett. Sie runzelte die Stirn und trommelte mit ihren purpurroten Fingern auf den Tisch. Dann, mit einem verstohlenen Blick auf den Rücken ihrer Schwester, machte sie ihren Zug.
„Armer kleiner Bauer. So ein Pech“, murmelte sie und stupste ihren Springer über das Brett.
Die Schachfiguren aus Porzellan waren so bemalt, dass sie Höflingen bei einer Maskerade ähnelten. Das Gesicht des Ritters war durch einen Eisenhelm verborgen. Der Bauer war als Harlekin kostümiert. Obwohl sie aus Porzellan waren, lebten und atmeten sie.
Der Ritter rückte vor. Der Bauer hob die Hände und bettelte um sein Leben, aber der Ritter, unempfänglich für sein Flehen, schwang sein Schwert und schlug ihm den Kopf ab. Porzellansplitter flogen über Spielbrett und Tisch. Der hübsche Kopf rollte über das Brett, die Augen blinzelten noch.
Aufgeschreckt durch das Geräusch von zerbrechendem Porzellan, drehte Liebe sich um. Ihre Augen blitzten vor Wut, als sie das Brett betrachtete. „Du hast geschummelt, Schwester!“, rief sie. „Dieser Springer stand nicht einmal in der Nähe meines Bauern!“
Tod presste eine juwelenbesetzte Hand auf ihre Brust. „Das habe ich nicht“, log sie.
Liebe warf ihr einen vernichtenden Blick zu. „Es ist meine eigene Schuld“, meinte sie und setzte sich wieder. „Ich hätte dich nicht eine Sekunde aus den Augen lassen dürfen. Du hasst es zu verlieren.“
Tod lehnte sich in ihrem Stuhl zurück, schlängelte ihre Finger durch ihre Halskette und unterdrückte ein Grinsen. Während sie darauf wartete, dass ihre Schwester etwas tat, ließ sie ihre Augen durch den Raum schweifen. Ein Geweih hingen über dem steinernen Kaminsims. Die Köpfe von Wildschweinen und Wölfen schmückten die Wände, das Feuerlicht tanzte in ihren Glasaugen.
Eine plötzliche Bewegung im Spiegel erregte Tods Aufmerksamkeit. Der Spiegel zeigte nun eine prächtige Bibliothek – und darin eine junge Frau. Sie trug das schlichte blaue Kleid eines Dorfmädchens. Ihre dicken dunklen Locken waren mit einem Band zusammengebunden, und ihre warmen braunen Augen funkelten vor Humor und Intelligenz.
Tods Blick schärfte sich beim Anblick des Mädchens, so wie der eines Löwen beim Anblick einer Gazelle. „Belle“, flüsterte sie. „So schön, genau wie dein Name.“
Auch Liebe warf einen Blick in den Spiegel. „Du kennst das Mädchen?“, fragte sie.
„Ich kenne sie schon eine ganze Weile. Sie war ein Baby in den Armen ihrer Mutter, als wir uns kennenlernten.“
Während Tod zusah, zog Belle ein Buch aus einem Regal und hielt es lächelnd hoch. Das Biest schielte darauf, um den Titel zu entziffern. Belle schlug das Buch auf und las die erste Seite. Da sie den Kopf senkte, sah sie nicht, wie sich die Traurigkeit in den Augen des Biestes in Glück verwandelte.
Liebe, deren Finger jetzt über dem Schachbrett schwebten, sagte: „Dieses Mädchen wird die Richtige sein, lass dir das gesagt sein. Sie ist mutig, stur – sogar noch sturer als das Biest –, und sie hat ein Herz aus Gold.“
„Mm, aber es ist nicht das Herz des Mädchens, um das es geht. Oder etwa doch?“, grübelte Tod.
Liebe, die ihre Stirn in Konzentration runzelte, hörte ihre Schwester kaum. Sie bemerkte auch nicht, wie ein gehörnter Käfer von ihrer Halskette flog und auf dem Spiegel landete.
„Es ist das Herz des Biestes, um das wir uns sorgen“, fuhr Tod fort. „Hast du vergessen, wie er sich verhielt, als er noch ein Prinz war? An dem Tag, an dem er verzaubert wurde, bezahlte er mit Almosen für die Armen eine neue Kutsche, machte sich über das Stottern eines Küchenjungen lustig und jagte einen Hirsch mit seinen Hunden zu Tode. Ich hätte den Narren in einen Wurm verwandelt und ihn unter meinem Stiefel zerquetscht, aber das hast du nicht getan. Warum, werde ich nie erfahren.“
„Weil er eine zweite Chance verdient“, erklärte Liebe. „Das tut jeder. Meine Zauberin verwandelte den äußeren Menschen, um den inneren zu verwandeln. Sein Leiden wird ihn Güte und Mitgefühl lehren. Er wird sein Herz wiederfinden.“
Tod stöhnte vor Verzweiflung. „Er hat kein Herz, Schwester! Man kann nicht finden, was nie existiert hat!“
Liebes Blick, voll von Emotionen, traf den von Tod. „Du irrst dich“, widersprach sie. „Ich beobachte ihn, seit er ein Kind war. Ich habe gesehen, was mit ihm geschah, wie grausam sein Vater ihn behandelte. Er musste sein Herz panzern. Das war die einzige Möglichkeit zu überleben.“
Tod winkte ab, aber Liebe gab nicht auf. Aufzugeben lag nicht in ihrer Natur. „Hast du jemals einen Bären gesehen, der auf einem Dorfplatz zum Vergnügen der Menschen gegen Hunde kämpft?“, fragte sie. „Hast du gesehen, wie er die Zähne fletscht und schnappt? Schmerz, Angst … sie können dich in etwas verwandeln, was du nie sein solltest. Das Biest kann sich ändern.“
„Dann sollte es sich besser beeilen. Deine Rose sieht nicht allzu gesund aus“, warf Tod ein und nickte in Richtung des Spiegels.
Nun zeigte er einen Tisch im Schloss des Biestes. Kerzenlicht fiel darauf und beleuchtete eine einzelne rote Rose unter einer Glasglocke. Ihr Kopf hing herab. Verwelkte Blütenblätter lagen unter ihr. Während Tod und Liebe zusahen, fiel ein weiteres auf die Tischplatte.
„Wenn es dem Biest nicht gelingt, Belles Liebe zu gewinnen, bis das letzte Blütenblatt fällt, muss der Prinz für immer ein Biest bleiben.“ Tod sah zu ihrer Schwester. „Du hast auf das menschliche Herz gewettet, liebe Schwester – eine Narrenwette, wenn es so etwas gibt. Und ich? Ich würde eine Million Goldmünzen darauf wetten, dass das Biest scheitert.“
Liebe hob eine Augenbraue. „Eine Million Goldmünzen? Du musst reich sein, wenn du es dir leisten kannst, eine solche Summe zu verlieren“, entgegnete sie und widmete ihre Aufmerksamkeit wieder dem Schachbrett.
Tod lächelte herablassend. Mit einer Stimme voller falscher Sympathie sagte sie: „Ich verstehe das. Du willst nicht wetten. Es ist zu viel Geld. Du hast Angst …“
„Vor nichts und am allerwenigsten vor dir“, erwiderte Liebe. „Machen wir daraus zwei Millionen.“
Tods Augen leuchteten auf. Es gab nichts, was sie mehr liebte als Glücksspiele. Erst gestern hatte sie eine junge Baronin auf einem Pferd sagen hören: „Ich wette, ich kann über den Zaun springen!“, und einen Bauernjungen: „Ich wette, ich kann über diesen Fluss schwimmen!“ Sie hatte beide Wetten mit Leichtigkeit gewonnen.
Liebe war genauso. Je höher die Einsätze, je unmöglicher die Chancen, desto eifriger erhöhte sie den Einsatz. Es war das Einzige, was die beiden Schwestern gemeinsam hatten.
„Das Gold ist so gut wie meins“, behauptete Tod. „Die Menschen sind selbstsüchtige Kreaturen. Man kann sich immer darauf verlassen, dass sie das Falsche tun. Soll ich dir erzählen, wie die Geschichte ausgeht? Das Biest ist grausam zu Belle, sie verlässt ihn, das letzte Blütenblatt fällt. Ende.“
Liebe hob ihr Kinn. „Du hast keine Ahnung, wie die Geschichte endet. Du bist nicht ihr Autor. Manchmal siegen Freundlichkeit und Sanftmut.“
„Und manchmal galoppieren Einhörner über Regenbögen“, schnaubte Tod abfällig.
Liebe sah sie an. „Drei Millionen.“
„Einverstanden!“, krähte Tod. „Ich werde die Wette gewinnen, liebste Schwester. Warte es nur ab.“
„Nun, aber dieses Spiel hast du nicht gewonnen“, erklärte Liebe und schob ihre Dame über das Brett. „Schachmatt.“
Tods Lächeln erlosch. Sie schaute auf das Brett hinunter und sah Liebes Dame vor ihrem eigenen König stehen. „Was?“, rief sie schockiert. „Das kann nicht sein!“
Liebe und Tod sahen zu, wie die Königin dem König einen Kuss zuwarf. Überrascht von dieser süßen Gnade, umarmte der König die Königin. Eine Sekunde später sackte er auf dem Brett zusammen, und ein Dolch ragte ihm aus dem Rücken.
„Und da heißt es, ich wäre skrupellos!“, fauchte Tod empört.
Mit einem triumphierenden Lächeln erhob sich Liebe von ihrem Stuhl. Sie küsste ihre Schwester auf die kalte Wange und sagte: „Bemüh dich nicht. Ich finde selbst hinaus.“
Tod saß vollkommen still und starrte auf die Schachfiguren. Ihr Läufer sah zu ihr auf und begann zu zittern. Seine Knie schmerzten. Ein Riss erschien auf seinem bemalten Gesicht. Wütend fegte Tod die Figuren vom Brett. Sie zersprangen auf dem Steinboden. Dann stand sie auf und ging zum Spiegel. Ihr bereits zorniger Gesichtsausdruck stockte, als sie das Biest und Belle beobachtete – immer noch ihre Bücher und die Gesellschaft des anderen genießend.
Das Mädchen hatte anfangs Angst vor ihm, dachte Tod, und wer hätte das nicht?Aber jetzt fürchtet sie das Biest nicht mehr. Dieses Mädchen ist die seltenste aller Kreaturen. Ein Wesen, das mit dem Herzen sieht. Meine Schwester hat recht. Sie könnte die Richtige sein. Und das wird nicht reichen.
Tod drehte sich auf dem Absatz um, ihre Röcke wirbelten hinter ihr her wie ein böser Wind. Sie ging zu einem hoch aufragenden Schrank, öffnete ihn und fuhr mit einem Finger über die Bücher in den Regalen.
„Da bist du ja!“, flüsterte sie und zog eines heraus.
Das in schwarzes Leder gebundene Buch war staubig und alt. Der Buchrücken hatte einen Riss, aber der Titel war noch zu lesen: NEVERMORE.
„Mouchard! Truqué!“, bellte Tod. „Kommt!“
Zwei Geier verließen ihren Schlafplatz auf dem Kaminsims und flogen zu ihr. Es waren riesige Vögel mit kohlschwarzen Federn und grausamen Schnäbeln. Ein Dutzend weiterer solcher Vögel hockte im Zimmer herum.
„Bringt dieses Buch zum Schloss des Biestes. Legt es in die Bibliothek“, befahl Tod. „Passt auf, dass euch niemand sieht.“
Einer der Geier stieß ein raues Krächzen aus.
„Nein, Mouchard, du unverschämte Kreatur, das ist kein Betrug“, verwehrte sich Tod. „Es ist nur eine kleine Ablenkung. Glaubst du, meine Schwester würde das nicht auch tun? Du weißt doch, wie sie ist. Sie tut, als wäre sie aus Tautropfen und Mondstrahlen gemacht, aber sie ist grausam. Eine kleine Wilde mit einem süßen Gesicht. Sie wird vor nichts haltmachen. um die Wette zu gewinnen.“
Der zweite Geier krächzte. Er schüttelte erst den Kopf und dann seine Flügel. Tods blasse Wangen erröteten vor Empörung.
„Ich weiß, dass es Regeln gibt, Truqué! Ich weiß, dass ich nicht zu dem Mädchen gehen kann, bevor ihre Zeit gekommen ist. Aber was ist, wenn sie zu mir kommt? Was ist, wenn ich sie an das hier binden kann? Das ändert die Dinge, nicht wahr?“
Der Geier dachte über die Worte seiner Herrin nach, dann senkte er seinen Kopf und packte das Buch mit seinen scharfen Krallen. Tod öffnete ein Fenster, und die beiden Vögel stürzten in die Nacht hinaus. Als sie ihnen nachsah, fielen ihr die Worte ihrer Schwester wieder ein.
Du hast keine Ahnung, wie die Geschichte endet.
Tods blutrote Lippen verzogen sich zu einem grimmigen, entschlossenen Lächeln.
„Oh, aber ich weiß es“, schnurrte sie. „Denn ich habe vor, sie zu schreiben.“
KAPITEL EINS
BELLE STAND VOR DER TÜR ZUR BIBLIOTHEK mit einem Wischmopp in der einen und einem Eimer in der anderen Hand. Auf ihrem Gesicht erstrahlte ein breites und aufgeregtes Lächeln.
Um sie herum waren mehrere Objekte auf dem Boden angeordnet: ein schimmernder goldener Kerzenleuchter in Form eines Mannes, eine stämmige bronzene Kaminuhr, eine gedrungene Teekanne aus Porzellan, eine kleine Teetasse mit einem Riss im Rand, ein Staubwedel mit pfauenförmigem Stiel und ein vierbeiniger Schemel mit Fransen.
Der Kerzenleuchter sprach zuerst.
„Mein liebes Mädchen, du hältst den Wischmopp, als wäre er ein Schwert“, stichelte er. „Du siehst aus, als würdest du in die Schlacht ziehen!“ Er hatte brennende Kerzen statt Händen und schwenkte eine dramatisch, als würde er Belle zum Duell herausfordern.
„Ich ziehe in die Schlacht, Lumière, und du tust es auch. Du hast keine Ahnung, was dich hinter diesen Türen erwartet“, erwiderte Belle lachend.
Lumière schnitt eine Grimasse. „Doch, das weiß ich“, grummelte er. „Der Herr hat viele bewundernswerte Eigenschaften, aber Sauberkeit gehört nicht dazu.“
„Quatsch und Unsinn!“, erklärte die Kaminuhr und schob sich an ihnen vorbei. „Vergesst ihr, dass ich mit dem Comte de Rochambeau bei der Belagerung von Yorktown ritt?“
Lumière rollte mit den Augen. „Nicht eine Sekunde lang, mon ami“, beteuerte er.
„Wir besiegten die Rotröcke und schickten sie in die Flucht! Dieser alte Soldat ist mehr als nur ein paar Spinnweben gewachsen!“, erklärte Von Unruh und gab den massiven Türen einen Schubs. Sie schwangen auf. Ihre Scharniere ächzten. Während sie sich öffneten, verstummte der immer noch schimpfende Von Unruh plötzlich. Er machte ein paar Schritte in den höhlenartigen Raum. Die anderen Diener schlossen sich ihm an. Alle starrten entsetzt auf die Szene vor ihnen. Alle außer Belle.
KAPITEL ZWEI
MIT EINEM FREUDENSCHREI rannte Belle in die Mitte des Raumes, stellte ihren Wischmopp und Eimer ab und drehte sich staunend in einem weiten Kreis herum.
Es schien ihr, als ob jedes Buch, das jemals geschrieben wurde, hier in den Regalen stand. Es gab Romane und Theaterstücke, Liebesgedichte, Legenden und Volksmärchen, Bände über Philosophie, Geschichte, Wissenschaft, Mathematik. Am Morgen nach dem ersten Augenöffnen hatte sie befürchtet, dass sie von der Bibliothek und den Schätzen, die sie barg, nur geträumt hatte. Aber nein. Es war real. Die Bücher waren hier. Sie war hier.
„Ach, du meine Güte“, staunte die Teekanne zögernd.
„Ich weiß, Madame Pottine. Ist es nicht großartig?“, rief Belle begeistert.
„Mon Dieu“, murmelte der Staubwedel mit düsterem Tonfall. „Ich habe noch nie einen – einen solchen …“
„… wunderbaren, unglaublichen, erstaunlichen Ort gesehen!“, beendete Belle seinen Satz. „Ich stimme dir zu, Plumette!“
Bücher waren Belles Lieblingsdinge auf der Welt. Sie verschlang sie. Villeneuve, ihr Dorf, hatte eine Bibliothek … eigentlich. Aber im Grunde war es nur ein Regal in der Kirche von Père Robert. Sie hatte jedes Buch daraus gelesen. Zweimal. Aber diese Bibliothek hatte so viele Bücher, dass sie sie nie alle lesen könnte. Nicht einmal, wenn sie tausend Jahre alt würde.
Als sie sich weiter umsah, fiel ihr Blick auf den großen Marmorkamin. Sie stellte sich vor, wie sie davorsaß, mit einer Kanne Tee und Büchern, die sich um sie herum aufstapelten.
„Wo soll ich anfangen?“, fragte sie sich laut. „Mit den griechischen Epen? Den klassischen Tragödien?“
„Darf ich die Fenster vorschlagen?“, fragte Lumière und eilte mit über den Arm gehängten Putzlappen an ihr vorbei.
Belle lächelte verlegen. Seine Worte holten sie auf den Boden der Tatsachen zurück. Die Fenster waren hoch und anmutig, aber grau vor Schmutz. Die Vorhänge, die sie einrahmten, hingen in Fetzen herunter. Spinnweben saßen unter den Fensterbänken. Sie krempelte ihre Ärmel hoch, nahm ihren Mopp und den Eimer und ging auf sie zu. Der fransige Schemel rannte an ihr vorbei und wirbelte eine Staubwolke auf.
Die kleine Teetasse saß auf seinem Rücken. „Schneller, schneller!“, rief sie mit ihrer Kleiner-Junge-Stimme.
„Tassilo! Das reicht jetzt! Du machst alles nur noch schlimmer!“, schimpfte Madame Pottine. „Wie um alles in der Welt kann der Herr hier arbeiten?“, fügte sie hinzu und zeigte mit ihrer Tülle in eine Ecke. Eine dicke Schicht Staub bedeckte einen Großteil des Bibliothekbodens. Sie überzog den großen vergoldeten Tisch neben der Tür, die Stühle, den Kaminsims.
Von Unruh fuhr mit einem Finger über eine Fußleiste, inspizierte sie und erbleichte. „Staub? Keiner hat etwas von Staub gesagt! Ich habe empfindliche Innereien“, ärgerte er sich und tätschelte sein Gehäuse. „Schrauben, Stäbe, Zahnräder – ein kleines Körnchen im Uhrwerk, und alles kommt zum Stillstand!“
Lumière rümpfte die Nase. „Das ist so viel mehr, als wir wissen wollten.“
„Ich werde die Aufsicht übernehmen, soll ich?“, bot Von Unruh an. „Für mich ist Staub ein Schimpfwort.“
„Staub ist aber nicht für jeden ein Schimpfwort“, erwiderte Lumière.
„Arbeit ist auch ein Schimpfwort“, wisperte Plumette ganz leise. „Vielleicht ist das der Grund, warum Monsieur versucht, es zu vermeiden?“
Von Unruh richtete sich zu seiner vollen Größe auf – sämtliche dreißig Zentimeter. „Das habe ich gehört, Mademoiselle!“, donnerte er.
Plumette schüttelte ihre Federn und hüpfte davon, um einen Stuhl zu putzen.
Lumière legte einen Arm um den wütenden Von Unruh. „Sieh mal, alter Freund, ich weiß, dass die Bibliothek in einem schrecklichen Zustand ist, und ich weiß, dass die uns bevorstehende Aufgabe unmöglich scheint. Aber alles, was wir tun müssen, ist anzufangen. Der Rest wird sich von selbst regeln. Eine Reise von tausend Kilometern beginnt mit einem einzigen Schritt.“
„Stimmt genau!“, erklärte Von Unruh und stürmte auf die Tür zu. „Ich schlage vor, wir gehen zurück in die Küche, suchen uns einen gemütlichen Platz am Feuer und denken noch mal über die ganze Sache nach.“
Aber Lumière kam ihm in die Quere. Er hakte seinen Arm durch den von Von Unruh und drehte ihn um. „Belle schafft das nicht allein. Sie braucht unsere Hilfe. Die Bibliothek macht sie glücklich. Und wir wollen, dass sie glücklich ist“, erklärte er.
„Meine Federn werden nie mehr dieselben sein“, seufzte Von Unruh.
Belle, die ihren Austausch belauscht hatte, fühlte sich schuldig. Die Diener hatten sich beim Frühstück freiwillig gemeldet, um ihr zu helfen, aber sie hatten keine Ahnung, worauf sie sich einließen. Die Bibliothek war zwar nicht so baufällig wie der Rest des Schlosses, benötigte aber eine gründliche Reinigung – der Von Unruh nicht gewachsen zu sein schien. Seine Zahnräder blieben oft stecken, und er warf häufig sein Pendel ab.
Besorgt eilte Belle zu den beiden Dienern und kniete nieder. „Lumière, Von Unruh, ich komme allein zurecht. Ihr habt andere Dinge zu tun“, beteuerte sie.
Von Unruh, der bereits in eine neue Runde des Meckerns einsteigen wollte, hatte wenigstens den Anstand, beschämt auszusehen. Er versuchte schnell, es wiedergutzumachen. „Würde es dich glücklich machen, diesen Ort zu nutzen?“, fragte er.
Belle nickte. „Sehr“, sagte sie.
„So glücklich, wie du in deinem Dorf warst?“, fragte er hoffnungsvoll.
„Mein Dorf?“, wiederholte Belle, verblüfft über die Frage. Sie setzte sich auf den Boden. „Nun, ich habe nicht … Ich meine, ich war nicht …“
Wie konnte sie ihnen die Wahrheit sagen? Es war schwer genug, sie sich selbst einzugestehen.
„Was ist denn los, mein Kind?“, fragte Von Unruh besorgt.
Madame Pottine hörte ihn. „Stimmt etwas nicht?“, erkundigte sie sich und eilte herbei. Plumette folgte ihr mit raschelnden Federn. Sogar Tassilo und Der Schemel unterbrachen ihren Unsinn und rückten näher an Belle heran.
Belle überlegte, ob sie einen unschuldigen Schwindel erfinden oder die Besorgnis des Schlosspersonals lachend beiseiteschieben sollte, aber als sie die echte und tiefe Sorge in den vielen Augen sah, wusste sie, dass sie beides nicht tun konnte.
„Die Wahrheit ist, dass ich in meinem Dorf nicht glücklich war“, gestand sie. „Nicht wirklich. Ich war natürlich in meinem Zuhause mit meinem Vater glücklich, aber das war der einzige Ort, dem ich mich zugehörig fühlte. Unser Haus und die Seiten der Bücher, die ich las.“
„Warum, Belle?“, wollte Madame Pottine wissen.
Belle holte tief Luft. „Es war ein kleiner Ort. Und die Menschen … nun, viele von ihnen hatten kleine Hoffnungen und Träume. Es war schwer, dort einen Freund zu finden. Es gab so wenige Menschen, die mich verstanden. Mein Vater natürlich. Und Père Robert, der Geistliche mit all den Büchern. Und Agathe, eine Bettlerin. Aber alle anderen hielten mich für seltsam“, gab sie zu und errötete ein wenig.
„Du bist seltsam, Belle“, meldete sich Tassilo zu Wort. „Aber es macht uns nichts aus!“
Alle lachten, sogar Belle. Nur Madame Pottine nicht. Stattdessen hob sie eine aufgemalte Augenbraue.
„Aber Mama, das ist sie!“, beharrte Tassilo. „Sie trägt Stiefel zum Kleid. Sie liest Latein. Und reitet auf ihrem Pferd wie eine Räuberin!“
„Tassilo!“, mahnte Madame Pottine.
„Das ist nichts Schlimmes, Mama. Wir sind auch nicht normal, weißt du? Ich meine, ich bin eine sprechende Teetasse!“
Eine Dampfwolke stieg aus Madame Pottines Tülle.
„Ist schon gut, Madame Pottine“, sagte Belle. „Ich nehme an, für die Leute von Villeneuve war ich seltsam. Denn ich wollte weg. Ich wollte reisen und etwas von der Welt sehen.“ Sie lächelte reumütig. „Außerdem mochte ich Bücher lieber als Gaston.“
„Gaston?“, wiederholte Lumière mit einem verwirrten Ausdruck.
„Der Angeber des Dorfes“, antwortete Belle und schüttelte bei der Erinnerung an den gut aussehenden Angeber den Kopf, der quasi von ihr verlangt hatte, ihn zu heiraten, und fast hintenübergefallen war, als sie Nein gesagt hatte.
„Lesen wurde zu meinem Zufluchtsort“, fuhr Belle fort. „Ich fand so viel in den Büchern. Geschichten, die mich inspirierten. Gedichte, die mich erfreuten. Romane, die mich herausforderten …“ Belle hielt inne, plötzlich verunsichert. Sie sah auf ihre Hände hinab und sagte mit wehmütiger Stimme: „Was ich jedoch wirklich gefunden habe, war ich selbst.“
Von Unruh, der sich eben noch so beschwert hatte, trat vor und nahm Belles Hand. „Und du wirst dich wiederfinden, Kind, in dieser Bibliothek, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe!“, versicherte er und streckte die Brust heraus.
Belle war überrascht von der Inbrunst in seiner Stimme.
„Du hast den Kampfgeist dieses alten Soldaten geweckt! Wir werden die Bibliothek von den Spinnen und Mäusen zurückerobern! Noch einmal in die Bresche, liebe Freunde! Man soll nie sagen, dass Oberst Von Unruh vor einem Kampf zurückgeschreckt ist.“ Damit schnappte er sich einen Lappen von dem halben Dutzend, das über Lumières Arm hing, und marschierte hocherhobenen Hauptes los, um den Kampf mit den schmutzigen Fenstern aufzunehmen.
„Herr Oberst also jetzt?“, bemerkte Lumière ironisch. „Letzte Woche war er noch Hauptmann und die Woche davor Leutnant. Bald wird er sich zum Brigadegeneral befördern.“ Er wandte sich an Plumette. „Sollen wir, Chérie?“
Plumette schenkte ihm ein kokettes Lächeln, und gemeinsam nahmen sie die dunklen Ecken in Angriff, wobei Lumière mit seinem Kerzenlicht leuchtete und Plumette sie sauber fegte.
Madame Pottine gesellte sich zu Von Unruh. Als sie Dampf auf die Scheiben blies, wischte Von Unruh den Schmutz weg. Seine kleinen Messingarme arbeiteten wie wild. Sogar Der Schemel und Tassilo halfen mit. Auf Tassilos Bitte hin band Von Unruh Lappen an die vier Füße Des Schemels, und die beiden rannten wieder los und staubten die Dielen ab, während sie durch den Raum flitzten.
Als Belle ihnen zusah, stieg ihr ein Kloß in den Hals. Sie waren so gut zu ihr. So freundlich. Sie wollten ihr helfen. Sie wollten sie glücklich machen und ihre Freunde sein.
Und dann war da noch das Biest.
Ein Sturm widersprüchlicher Gefühle fegte durch sie, als sie an es dachte. Das Biest war der Grund, warum sie in diesem dunklen, abgelegenen Schloss gefangen war. Es war aber auch der Grund, warum sie hier in der unglaublichen Bibliothek stand.
Das Biest war nicht wie die anderen. Madame Pottine, Lumière, Plumette … sie waren warm und lustig, fröhlich und ausgelassen. Das Biest war schwierig, ruppig, rätselhaft und scheu. Und doch wollte es sie auf seine eigene seltsame Art auch glücklich machen. Das hatte es letzte Nacht bewiesen.
Wenn Belle daran dachte, was es getan hatte …
Es war unfassbar. Unmöglich. Selbst jetzt ließ es ihr Herz noch rasen.
Jeder andere hätte ihr einen Blick in seine Sammlung gewährt und ihr ein oder zwei wertvolle Bücher geliehen. Aber das Biest, so hatte Belle inzwischen gelernt, war nicht irgendjemand anderes.
Sie tauchte den Wischmopp in ihren Eimer, drückte ihn aus und begann, mit ernster Miene zu putzen. Im Gegensatz zum Biest konnte sie nicht mitten im Chaos lesen, arbeiten oder irgendetwas anderes tun.
Belle war es egal, ob sie erst um Mitternacht fertig war. Es war ihr egal, ob ihre Muskeln schmerzten, ihr Rücken stöhnte und ihre Beine taumelten, weil sie mit Eimern die Treppe herauf- und herunterlief. Sie dachte nur an das Glück, das sie erwartete, sobald sie ihre Aufgabe erledigt hatte.
Letzte Nacht hatte das Biest ihr ein unerwartetes Geschenk gemacht – ein Geschenk, das für sie wertvoller war als sein Schloss und all seine Ländereien, wertvoller als Juwelen oder Gold.
Letzte Nacht hatte das Biest ihr seine Bücher geschenkt.
KAPITEL DREI
ES WAR IN DER ABENDDÄMMERUNG GESCHEHEN.
Belle erinnerte sich noch genau daran.
„Ich habe eine Überraschung für dich“, hatte das Biest in seinem üblichen schroffen Ton gesagt.
Belle war gerade vom Füttern ihres Pferdes Philippe gekommen, stand an der Hintertür der Küche und schüttelte den Schnee aus ihrem Mantel. Sie hatte seinen finsteren Blick und seine verkrampften Pfoten gemustert und dankend abgelehnt.
Das Biest hatte verblüfft geblinzelt. Sein Blick war noch finsterer geworden. „Ich sagte, ich habe eine Überraschung für dich!“
„Und ich habe dich gehört“, hatte Belle geantwortet, „aber ich hatte schon genug Überraschungen für ein ganzes Leben. Einschließlich kalter dunkler Zellen, Wolfsrudeln und Wutanfällen.“
„Wutanfälle? Wutanfälle?“, hatte das Biest gezischt. „Ich fasse es nicht! Wie kannst du das sagen? Das war kein Wutanfall! Und es war nicht meine Schuld! Ich habe dir gesagt, du sollst nicht in den Westflügel gehen. Ich habe es dir gesagt …“
Belle hatte ihm einen Seitenblick zugeworfen. „Du hast recht. Was habe ich mir nur gedacht? Du würdest nie einen Wutanfall bekommen. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss meinen Umhang aufhängen.“
Die Lage zwischen dem Biest und Belle war angespannt, seit sie auf der Suche nach Antworten den Westflügel erkundet hatte. Eine einzige Rose hatte sie zur Gefangenen gemacht, und sie wollte wissen, warum. Wenn sie die Dienerschaft fragte, bekam sie nur ausweichende Antworten. Von dem Biest bekam sie gar nichts.
Gut, dachte sie. Wenn mir niemand eine Antwort gibt, muss ich sie eben selbst herausfinden.
Der Westflügel war der Privatbereich des Biestes. Es hatte Belle verboten, sich dorthin zu wagen. Ein dermaßen strenger Befehl von einer so imposanten Kreatur hätte die meisten Menschen bedingungslos gehorchen lassen.
Aber Belle war nicht wie die meisten Menschen. Sie hinterfragte alles und gehorchte nur einer Sache – ihrem Herzen.
Es war dunkel gewesen in den Gemächern des Biestes, aber Belles Augen hatten sich bald daran gewöhnt. Als sie durch die einst herrschaftlichen Zimmer gegangen war, hatte sie gesehen, dass all die schönen Möbel zerbrochen waren, die kostbaren Bettvorhänge zerfetzt, die vergoldeten Spiegel zertrümmert.
„Das war das Biest“, hatte sie geflüstert.
Sie kannte seine Wut und wusste, dass es mehr als in der Lage war, einen Tisch umzuwerfen oder einen Stuhl durch den Raum zu schleudern.
Ihre Augen sagten ihr, dass die schreckliche Zerstörung von dieser Wut herrührte. Ihr Herz jedoch sah die tiefere Ursache – Verzweiflung –, und das schmerzte sie.
Belle war weiter durch die Zimmer des Biestes gegangen, hatte Möbel zurechtgestellt, Glasscherben mit dem Fuß auf einen Haufen geschoben und nach Antworten gesucht.
Hier bin ich nun und lebe in einem abgelegenen Schloss, in einem Wald, in dem immer Winter ist, hatte sie gedacht. Ich spreche mit Uhren. Scherze mit Kerzenleuchtern. Spiele Fangen mit einem bellenden Schemel. Das ist es, was ich jetzt tue. Das ist mein Leben. Es muss einen Grund dafür geben, warum die Dinge hier so sind, wie sie sind. Wenn ich nur herausfinden könnte, was es ist.
An einer Wand hingen zerstörte Gemälde, darunter war auch das Portrait einer Familie: ein Mann mit einer kalten, herrischen Haltung, eine Frau mit einem warmen Lächeln und intelligenten blauen Augen und ein kleiner Junge, der genauso aussah wie die Frau.
Ein anderes Portrait zeigte einen hübschen jungen Mann – blauäugig, genau wie der Junge. Zumindest glaubte Belle, es zeige einen Mann. Denn das Portrait war so stark aufgeschlitzt, dass nur noch die Augen des Portraitierten zu sehen waren.
„Wer bist du?“, hatte Belle geflüstert.
Aber die gemalten Gesichter hatten ihr Schweigen bewahrt. Mit einem Seufzer der Enttäuschung hatte sie sich zum Gehen gewandt. Sie war nicht klüger gewesen als zuvor, als sie die Gemächer des Biestes betreten hatte.
Und dann hatte sie sie gesehen – eine einzelne rote Rose. Sie schwebte aufrecht auf einem Tisch, geschützt von einer zarten Glasglocke. Ihr Kopf hatte heruntergehangen, und einige ihrer Blütenblätter waren auf den Tisch gefallen. Belle hatte sich hinuntergebeugt und durch die Glocke gespäht. Ein weiteres Blütenblatt fiel herunter, während sie dort stand und zusah. Wie gebannt hatte sie das Glas angehoben, um die Blume besser sehen zu können.
Da hatte das Biest sie entdeckt.
„Was machst du hier? Was hast du mit ihr gemacht?“, hatte das Biest gebrüllt.
„Nichts“, hatte Belle geantwortet.
„Ist dir klar, was du hättest tun können? Du hättest uns alle verdammen können! Raus! Verschwinde!“
Das Biest hatte gewütet und die Rose mit seiner Gestalt verdeckt. Das hatte Belle so verärgert, dass sie vor dem Biest, dem Westflügel und dem Schloss geflohen war.
Sie war zu den Ställen gerannt, hatte Philippe einen Sattel übergeworfen und war in halsbrecherischem Tempo aus den Ställen galoppiert. Durch die Wälder – direkt in ein Rudel Wölfe. Die bösartigen Tiere hätten sie getötet, wäre das Biest nicht gewesen.
Sie hatte versucht, sie selbst abzuwehren, aber es waren zu viele gewesen. Gerade als sie überzeugt gewesen war, dass sie sie zerreißen würden, war das Biest aus dem Wald gekommen und hatte sie verscheucht. Aber die Wölfe hatten es schwer verwundet.
Mit der Hilfe von Philippe hatte Belle das Biest zurück ins Schloss gebracht, seine Wunden versorgt und ihm ins Bett geholfen. Sie war immer noch verärgert gewesen, und als das Biest geschlafen und sich unruhig hin und her gewälzt hatte, hatte sie Madame Pottine gefragt, wie sie und die anderen Diener dem Biest beistehen konnten, wenn es sich so schlecht benahm.
„Weil es ein gutes Herz hat“, hatte Madame Pottine geantwortet.
Belle hatte ihr einen ungläubigen Blick zugeworfen. „Reden wir von demselben Biest?“, hatte sie gefragt.
Madame Pottine hatte traurig gelächelt, sich zu Belle gesetzt und ihr die Geschichte des Biestes erzählt. Es war ein Prinz gewesen, der Sohn eines reichen und mächtigen Mannes. Seine Mutter, die gütig und sanft war, starb, als er noch ein Junge war.
„Sind das die Personen auf den Bildern? Im Westflügel?“, hatte Belle gefragt.
„Ja, das sind sie“, hatte Madame Pottine erwidert und weiter erklärt, dass der Vater des Biestes ein grausamer Mann gewesen war, der sein einziges Kind missbraucht hatte.
Belle war schockiert gewesen und voller Mitgefühl. Ihre Mutter war auch jung gestorben, als Belle noch ein Baby gewesen war, aber im Gegensatz zum Vater des Biestes war ihr Vater die Güte selbst.
„Wie verängstigt er gewesen sein muss … und einsam und traurig. Ein armer, mutterloser Junge in den Händen eines so brutalen Mannes“, hatte sie gewispert.
Madame Pottine hatte mit gesenktem Blick genickt. „Nach Jahren dieser schrecklichen Behandlung war der Prinz zu einem ebenso gefühllosen, rücksichtslosen und selbstsüchtigen Menschen herangewachsen wie sein Vater. Und dann, eines Tages, hatte er einen extravaganten Ball gegeben und die schönsten Damen des Reiches dazu eingeladen. Während alle tanzten, hatte eine Bettlerin den Ballsaal betreten und den Prinzen um Schutz vor Wind und Regen gebeten. Er hatte sie ausgelacht und seinen Wachen befohlen, sie hinauszuwerfen. Aber in Wirklichkeit war die alte Frau eine Zauberin. Sie hat den Prinzen verflucht und in ein Biest verwandelt. Uns, seine Diener, hat sie auch verflucht. Und seit diesem Tag sind wir so wie jetzt. Unfähig, zu unserem alten Selbst und unserem alten Leben zurückzukehren.“
„Es tut mir so leid, Madame Pottine“, hatte Belle voller Mitgefühl gesagt.
„Mir auch, mein Kind. Mir auch.“
„Kann man denn gar nichts tun?“
Da hatte Madame Pottine ihren Blick auf das Biest gerichtet. Als sie wieder sprach, hatte ihre Stimme wie aus weiter Ferne geklungen. „Du hast so viele Fragen, mein Kind. Und wer hätte die nicht? Lass mich wenigstens deine erste beantworten: Wir bleiben bei unserem Herrn, weil wir ihn nicht zweimal im Stich lassen werden.“
„Zweimal?“, hatte Belle wiederholt. „Das verstehe ich nicht.“
„Wir wussten, wie schrecklich sein Vater zu ihm war, und haben nichts getan. Dieser Mann war das wahre Biest, und wir waren zu verängstigt, um ihm die Stirn zu bieten. Unser Herr braucht uns jetzt genauso wie damals, und dieses Mal werden wir ihn nicht im Stich lassen.“
„Ich will euch helfen. Es muss doch einen Weg geben, den Fluch aufzuheben“, hatte Belle gedrängt.
Da hatte das Biest im Schlaf gestöhnt, und Madame Pottine war an seine Seite geeilt.
„Da musst du dir keine Sorgen machen, mein Schäfchen“, hatte Madame Pottine gesagt. „Wir haben es uns eingebrockt, und wir müssen es auch auslöffeln.“
In jener Nacht hatten das Biest und Belle sich einige scharfe Wortgefechte geliefert, sowohl vor als auch nach dem Wolfsangriff, und seitdem hatten sie nicht mehr viel miteinander geredet. Darum war Belle nicht in der Stimmung für seine Überraschung gewesen.
Nachdem sie ihn abgewiesen hatte, war sie auf der Suche nach Chapeau, dem Garderobenständer, durch die Küche gegangen. Sie wollte ihm ihren Mantel geben. Als sie das tat, hatten Von Unruh und Madame Pottine besorgte Blicke ausgetauscht. Cuisinier, der Kochherd, war so beunruhigt gewesen, dass er angefangen hatte zu qualmen.
Lumière war zum Biest hinübergeeilt. Er hatte sich eine Hand vor den Mund gehalten und gesagt: „Darf ich vorschlagen, Herr, dass Ihr mit einem Lächeln und einem freundlichen Tonfall zu verstehen gebt, dass dies eine freudige Überraschung ist und nicht, sagen wir, eine Reise zur Guillotine?“
Obwohl er geflüstert hatte, hatte Belle ihn trotzdem gehört. Der Schall wurde in der riesigen Küche mit ihren hohen, gewölbten Decken leicht weitergetragen.
Das Biest hatte sich geräuspert und ihr hinterhergerufen: „Belle, ich habe eine sehr schöne, prächtige, ziemlich wunderbare Überraschung für dich!“
Es hatte so fröhlich und enthusiastisch geklungen, ganz anders als sonst, dass Belle kurz innegehalten und sich umgedreht hatte, um sich zu vergewissern, dass es wirklich das Biest gewesen war, das gesprochen hatte.
Und tatsächlich. Es stand genau da, wo sie es verlassen hatte, und hatte sie angelächelt – oder es zumindest versucht. Der Ausdruck hatte eher einer Grimasse geglichen und es noch grimmiger aussehen lassen als sonst, obwohl das Biest auf sein Äußeres geachtet hatte und gut gekleidet gewesen war.
Es hatte ein Leinenhemd, eine gekräuselte Krawatte und einen Mantel aus Seide getragen. Ein Paar unheimliche schwarze Hörner standen ihm von den Schläfen ab. Fell bedeckte sein Gesicht und seinen Körper, und Haare wie eine Löwenmähne fielen ihm über den Rücken. Seine Pfoten waren riesig, seine Krallen lang und scharf. Es war groß und kraftvoll gebaut.
Aber das Beeindruckendste an dem Biest waren nicht seine Größe oder Stärke, sondern seine Augen. Sie waren nicht golden wie die eines Tigers oder tiefbraun wie die eines Bären. Die Augen des Biestes waren klar und durchdringend blau – so tief wie ein Bergsee und genauso unergründlich. Wie alle wilden Kreaturen hütete das Biest seinen Blick und war vorsichtig, um keinen Augenkontakt herzustellen, damit es nicht zu viel verriet.
„Es ist eine schöne Überraschung, Belle. Ich verspreche es“, hatte es gesagt. „Willst du sie dir nicht wenigstens ansehen?“
Etwas an seinem Ausdruck, hoffnungsvoll und hilflos zugleich, hatte Belle erweicht.
Er versucht es, hatte sie gedacht. Das tun sie alle hier. Soll ich?
„Kein Schreien oder Brüllen oder Knurren“, hatte sie gemahnt.
Das Biest hatte feierlich genickt und seine Pfote ausgestreckt. Belle hatte es angestarrt und überlegt – und dann mit einem Kopfnicken angenommen.
KAPITEL VIER
„SIND DEINE AUGEN GESCHLOSSEN?“
„Das hast du mich schon fünfmal gefragt.“
„Du kannst also nichts sehen?“
„Nicht mit einer Augenbinde.“
Belle hatte vor einem Paar hoher, anmutig gewölbter Türen gestanden. Das Biest hatte sie aus der Küche geführt, einen langen Korridor entlang und eine Steintreppe hinauf. Als sie angekommen waren, hatte es den Leuchter, den es trug, auf einem Tisch neben der Tür abgestellt und darauf bestanden, ihr seine Krawatte um die Augen zu binden.
„Warte hier“, hatte es gesagt, als es fertig war. „Geh nicht weg.“
Belle hatte gelacht. „Weggehen? In einem Treppenhaus? Mit einer Augenbinde?“
Das Biest hatte nicht geantwortet. Es war zu beschäftigt damit gewesen, an einem Messingschlüsselring herumzufummeln.
Warum braucht es so lange, um einen Schlüssel in ein Schloss zu stecken?, hatte sie sich gefragt. Es weiß dochsicher, wie es die Türen seines eigenen Schlosses öffnet.
Und dann begriff sie: Das Biest war nervös.
Es will, dass mir die Überraschung gefällt, hatte sie gedacht. Es will mir gefallen.