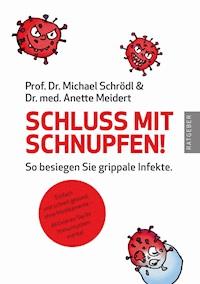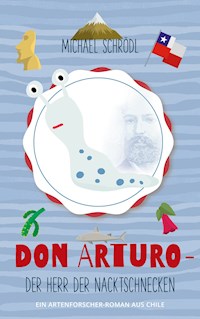
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Reise in einem verrosteten Schrottauto, immer auf der Suche nach neuen Meeresnacktschnecken, kulturellen Fettnäpfchen und dem Sinn des Lebens. Als Gott die Welt erschaffen hatte, war noch etwas Erde übrig: Er warf sie über die Anden, und daraus wurde Chile, so heißt es. 1991, ein Jahr nach Diktator Pinochets Abwahl aus der Politik, wirft er ein paar Münchener Biologiestudenten hinterher, für zwei Auslandssemester an der Uni Concepción. Dort, am Ufer des Flusses Bío Bío, erleben diese einen Kulturschock, der sich gewaschen hat. Sprachprobleme, Nässe, Dreck, Myriaden von Kleintieren, unberechenbare Nachttöpfe und eigenwillige Professoren. Gut, dass "Miguel" dem chilenischen Nationalhelden Arturo Prat so ähnlich sieht! Der Protagonist und seine Freunde bestehen auf ihrem Weg durch ein elend langes exotisches Land zahlreiche Abenteuer beim Tauchen im stürmischen Pazifik, auf Expedition in der blühenden Wüste und beim Gleitschirmfliegen an den Hängen mystischer Andenvulkane. Und beim Schneckensammeln auf der Osterinsel ist sogar der Weiße Hai dabei. Neue Arten, fiese Diebe, heiße Liebe? Chi chi chi, le le le, Chile!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Für Edda und Arnoldo
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1 : Der Herr der Nacktschnecken
Kein Land für Sonnenbrillen
Fahrt ans Meer
Gar nix Bio?
Todesbucht
Nudibranchier
Dichato
Meeresbio-Station
Wertarbeit
Tauchfahrt
Im Mar Chileno
Zweiter Versuch
Es gibt keine Freunde in der Wissenschaft
Das Seemonster Cai Cai
Todesspritzen
Halbzeitbilanz
Forschertraum
Kapitel 2 : Chi Chi Chi, le le le!
Als alles begann
Das Paradies
Zu Hause bei Oma
Die erste Nacht in Conce
Wechselbäder
Buenos días
Chile, de guhdda?
Lucky
Pololos
Die Schönen und der Nerd
Lomo a lo pobre
Graosam
Kapitel 3 : Vamos?
Asyl bei Elsbeth und Antonio
Ausflug zum Parque Lota
Campo Bío Bío
Copihue
Die Blonde, die Selbstbewusste und der Nationalheld
Tante Liesel
Drachen steigen lassen
Gute Aussichten
Geht doch
Camino para Tomé
Die Deutschchilenen
Wohnträume
Universidad de Concepción
Das Tribunal
El dieciocho
Chevy
In der Stadt
Blühende Wüste?
Arturo lebt
Reif für die Wüste?
Kapitel 4 : Der weite Weg
Neuland
De camino
Panamericana del norte
Der Kleine Norden
Der Große Norden
Burro Muerto
Camino para San Pedro
Pozo Tres
San Pedro de Atacama
Altiplano?
Geysire
Salar de Atacama
Blut
Schweiß
Und Tränen?
Echte Kerle
Der rote Vulkan
Und die Botanik?
Cachiyuyo
Bremsen verbinden
Kapitel 5 : Das Imperium schlägt zurück
Strafe muss sein
Wal und Qual
Totale Blockade
Toxikologische Essays
Gelegenheiten
Kapitel 6 : Der Faktor Mensch
Alltag in Conce
Besuch
Pololieren oder nicht pololieren?
Kapitel 7 : Großer Süden und zurück
Semester geschafft
Universitäres Feedback
Der Kleine Süden
La Pampa
Punta Arenas bei Nacht
Camino para Puerto Natales
Turismo im Torres del Paine
Das Böse ist immer und überall
Linda
WG-Vorstand in Panik
Kugeln am Kaktus
Wieder dahoam
Kapitel 8 : Der ganz Große Norden
Zwei Seelen
Zurück in die Atacama
In den hohen Norden
Chungará
Fenster zur Seele
Höhenkrank
Shopping in Parinacota
Im bolivianischen Winter
Droga!
Pech und Pannen
Profis
Höchste Höhen
Der Berg ruft
Owi muaß i
Kapitel 9 : Die Nudibranchier der Bahía de Coliumo
Tauchtag Nummer eins
Mala suerte
Nacktschnecken
Mucho trabajo
Südwind
Beine und Bauch
Hilfe für Fidel
Hai!
Lizenz zu duschen
Kolonialismus pur
Wannenwonnen
Liebe Kollegen
Al ataque
Falsche Beine
Schatten an den Tres Morros
Die allerletzte Schnecke
Meeresmonster
Die Tiefe
La mar
Schneckenrausch
Kapitel 10 : Aliens und Schneckensex
Der Wurm drin?
Paarbildung
Paula
Zustände
Mañana
Control
Kapitel 11 : Südseetraum
Osterinsel
La Cucaracha
Moais und Vogelmenschen
Sentimientos
Flammende Liebe
Vamos a la playa
Sandwich chileno
Anakena
Moaicito
Heimflug nach Conce
Kapitel 12 : Treffer versenkt
Schwacher Trost
Untergang
Reine Formsache
Abschlussberichte
Durchgefallen
Kapitel 13 : Abschied
Entscheidungen
Paulos Party
Chao Conce!
Verflixt und zugenäht
Alles für die Wissenschaft
Epilog
¡Muchas gracias!
Vorwort
Im Juli 2019 saß ich beim BR1-Moderator Thorsten Otto auf der „Blauen Couch“ und sollte eine gute halbe Stunde von meinen Abenteuern als Forschungsreisender plaudern – als unterhaltsamer Rahmen zu meinem ernsten Buch und Thema „Unsere Natur stirbt“. Ich erzählte die Geschichte, wie ich als vermeintlich auferstandener chilenischer Nationalheld „Arturo“ an meinem Gleitschirm vom Himmel schwebte. Und Thorsten Otto warf sich weg vor Lachen! „Eine der Top-5-Geschichten ever“, sagte er nachher, und er hatte als preisgekrönter Talker schon viel gehört.
Hat mich natürlich gefreut – es gab ja noch so viele andere schräge Erlebnisse aus aller Welt zu erzählen, spielerisch menschliche Untiefen und die Schönheit, Unkenntnis und Bedrohung der Natur zu schildern. Warum nicht in Romanform von meinen holprigen Anfängen als Schneckenforscher schreiben? „Novel for future“, sozusagen.
Hier also ein nicht ganz wahrer, aber auch nicht völlig erflunkerter Rückblick auf mein Studienjahr in Chile.
Ich wünsche Ihnen eine interessante und amüsante Reise in das ferne Land im Jahr eins nach Pinochet!
München, November 2020
Profe Michael Schrödl
Kapitel 1 Der Herr der Nacktschnecken
Kein Land für Sonnenbrillen
Er hasste kaltes Wasser. Vor allem, wenn es nicht da war, wo es hingehörte. Dicke Tropfen sammelten sich, verbanden sich zu Rinnsalen und liefen innen am zugigen Fenster hinunter. Zwischen den groben, rissigen Eiseneinfassungen sickerte ein Teil wieder nach draußen. Dort prasselte der Dauerregen an die Scheiben. Der innere Teil des Kondenswassers bahnte sich den Weg über das Pech der Fassung und tropfte auf den Betonsims. Dort wartete eine dunkle schimmlige Pfütze auf die Neuankömmlinge.
Seit Tagen ging das nun schon so. Michael, den man hier Mitschaél, Micky oder einfach auf Spanisch Miguel nannte, starrte auf die umliegenden Wohnblocks. Farbe, wo vorhanden, bröckelte großflächig ab und übrig blieb schmutzig veralgter Beton, unterbrochen von leeren, schmucklosen Scheiben. Auf der Wetterseite der Vorstadtsiedlung wuchsen dunkle Schleier aus Blaualgen und an manchen Stellen Flechten wie Bärte.
Das also ist das versprochene Mittelmeerklima, grübelte der fröstelnde Miguel zum zigsten Mal.
Ja, an der zentralchilenischen Pazifikküste war es auch im Winter meist frostfrei, aber die kalten Winde bliesen unendliche Feuchtigkeit ans Land. Und fischigen, mit Industrieabgasen durchsetzten Gestank. Alles versank im Dauerregen. Concepción, das zweitgrößte chilenische Stadtgebiet nach Santiago de Chile, war eine einzige schmutzige Pfütze, durchpflügt von lärmenden und kohlrabenschwarz rußenden Bussen, aus denen tropfnasse, modrig riechende Gestalten in Wollpullovern quollen, auf der Suche nach billigen Regenschirmen oder einem nicht ganz so nasskalten Plätzchen.
Concepción Anfang 1992: Heizungen gab es so gut wie nirgends, die eiskalte Nässe durchdrang die Häuser, die Menschen und die Gemüter. Eigentlich war schon Sommer, doch es regnete weiter. Vielleicht war schon wieder ein El-Niño-Jahr? Da war der Ozean etwas wärmer als sonst, und es regnete auch den Sommer über. Aus dem Radio trällerten blechern Textzeilen des gar nicht mehr so neuen Songs von Crowded House: Everywhere you go, always take the weather with you …
Mal wieder.
Das Wetter überall hin mitnehmen? Was, zum Kuckuck, blieb dem Wetter und den Leuten auch anderes übrig?
Klamm und missmutig schälte sich Miguel aus den flauschigen Plastikdecken. Sie wärmten auch noch leidlich, wenn sie feucht waren, und das waren sie in letzter Zeit eigentlich immer. Feinsäuberlich legte er nun die handgestrickten chilotischen Wollsocken unter die Decken. Auf diesen Trick war er stolz: Die Flöhe liebten den Geruch wolliger Füße und zwängten sich zwischen die duftenden Fasern. Von dort konnte man sie dann ganz einfach absammeln. Trotzdem musste man schnell sein. Waren die Flöhe erst einmal am Licht, flüchteten sie aus den Fasern und sprangen ruckzuck zurück in die Decken. Nur die größten Exemplare, die Chilenen nannten sie caballos, Pferde, waren halbwegs gut zu jagen. Gegen die kleinen hungrigen Jungbiester, die caballitos, war man weitgehend machtlos. Miguel hatte ein schwarzes hüpfendes Pünktchen entdeckt, schnappte es im Pinzettengriff, ging zum Waschbecken, öffnete ein Schnappdeckelglas und warf das Flöhchen hinein. Zu den anderen. In alkoholischer Lösung schwammen dort schon Dutzende seiner Artgenossen. Menschenflöhe, sehr anhänglich. Er stellte den Flohfriedhof zurück auf das aufgequollene Brettchen unter dem Spiegel neben die arbeitslose Sonnenbrille. Das Ziel war klar, das Gläschen musste sich füllen. Er hatte noch knapp sechs Monate Zeit, dann war das Jahr des Studentenaustauschs vorbei.
Miguel sah sich im Spiegel. Die Inkamütze aus Alpakawolle hielt die Ohren warm, und der Bommel am Faden sah recht niedlich aus. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht, wenigstens ein paar Südamerika-Klischees hatten sich erfüllt.
Die Badtür flog auf und Linda, eine verschlafene, bildhübsche Peruanerin mit langen, glatten pechschwarzen Haaren fragte: „Hola, Micky, te vas a bucear?“
„Sipu!“, na klar, antwortete er. „Ja, ich muss heute tauchen. Ich hoffe, es klappt. Bei dem Sauwetter will mich wahrscheinlich kein Fischer rausfahren. Ich muss Paulo überreden, das wird teuer!“
„Viel Glück!“ Sie beneidete ihn nicht. „Cuidate bién hermanito, pass auf dich auf, Brüderchen, es gibt Wind und Wellen! Und fahr nicht mit Paulo, wenn er betrunken ist. Der huevón hat doch meistens zu viel. Frag lieber den Bärtigen, der trinkt nur abends, kann sich keine tragos tagsüber leisten. Und darf ich jetzt bitte endlich ins Bad?“
So war das eben, wenn man mit zwei langhaarigen Mädels zusammenwohnte. Mit Körperpflege nahmen es die Südamerikanerinnen genau, das hatte Miguel längst bemerkt. Zweimal Duschen am Tag … Minimum. Und mit Haarpflege ganz besonders. Unter einer Stunde Badaufenthalt am Morgen ging es bei Linda nicht, und Yolanda war auch nicht viel schneller. Wollte Miguel morgens ins Bad, so musste er sich vor den Damen hineinmogeln. Er hatte sich angewöhnt, beim leisesten Aufwachgeräusch aus den anderen Zimmern ins Bad zu spurten. Miguel grinste. Eine Wohngemeinschaft eines muchachos mit zwei Mädels, noch dazu peruanischen Ausländerinnen, war in Chile absolut unüblich.
Es war Anfang 1992, das zweite Jahr nach der Entmachtung Pinochets. Er, der langjährige Diktator, hatte sich 1990 einem Volksentscheid stellen müssen und prompt verloren! Viele Chilenen waren dennoch verschüchtert. Würde Pinochet mithilfe des Militärs wieder an die Macht gelangen wollen? Zur Not mit Waffengewalt gegen sein eigenes Volk? Mal wieder? Pinochet war damals, bei seiner Machtergreifung am 9. September 1973, nicht gerade zimperlich gewesen …
Folter, Konzentrationslager, Massenexekutionen, Zigtausende desaparecidos, „verschwundene“ Menschen, in den Jahren danach.
Auch Miguel hatte „Das Geisterhaus“ von Isabel Allende gelesen. Angelesen, um genau zu sein, und das von hinten, denn das Buch war ihm zu dick und zu dramatisch. Immerhin wusste er: Concepción war ein Zentrum der sozialistischen Bewegung gewesen, die zur kurzen Regierungszeit Salvador Allendes geführt hatte. Nur drei Jahre, dann hatten Pinochets Bomben auf den Regierungspalast dem sozialistischen Spuk ein Ende gemacht. Concepción war wieder das geworden, was es immer gewesen war, ein übergroßes konservatives Provinznest. Und westliche Ausländer waren noch rar in Chile. Miguel, der stille Rebell, grinste noch breiter in den Spiegel. Teil der uniweit bekannten Skandal-WG zu sein, war die gelegentliche Warterei am Morgen allemal wert.
Fahrt ans Meer
Die alte Chevrolet Chevette, eine Art Opel Kadett mit exotischerem Namen, orgelte ihr morgendliches Lied. An sich war das ein gutes Zeichen, denn manchmal orgelte da gar nichts, und dann musste der Anlasser von unten durch ein freundliches Klopfen mit dem Hammer an seine Bestimmung erinnert werden. Das hieß für Miguel, sich auf nasser Straße unter das Auto zu zwängen und den Tag mit der wichtigsten Lektion zu beginnen: Das Leben ist hart. Also schlag zurück, aber mach’s mit Gefühl!
Ähnlich viel lateinamerikanisches Gefühl, sentimiento, verlangte der Gesamtmechanismus Chevette.
Die uralte Schrottkiste hatte eine Seele, da war sich Miguel sicher. Und diese war wankelmütig. Bei feuchter Witterung war der Wagen jedenfalls nur durch vorsichtiges Pumpen mit dem Gaspedal zum Anspringen zu überreden. Suavecito, nicht zu wenig und nicht zu viel.
Calma, immer mit der Ruhe? Despacito, schön langsam? Oder gar mañana, morgen ist auch noch ein Tag? Nix da! „Los, spring schon an, verdammt, ich muss zum Tauchen!“, schimpfte Miguel.
Es war sieben Uhr früh und er wollte um neun Uhr an der Meeresbiologischen Station in Dichato sein. Die etwa 50 Kilometer Küstenstraße waren eine einzige Geduldsprobe, erst recht für einen Europäer, der einen Job zu erledigen hatte. Endlose Baustellen mit Matschpfützen, groß genug, um mit dem Auto darin abzusaufen, sobald man etwas vom Gas ging. Im Schritttempo dahinzuckelnde Lastwagen mit bestialisch stinkenden Qualmwolken, ständige Unfälle, quälend langsame Trauerzüge mit Leichnam und Trompeten, was hatte er nicht schon alles an nervensägenden Verzögerungen erlebt.
„Bitte, bitte, amigo, lass mich nicht hängen!“
Da! Der Motor dröhnte, denn der Auspuff war nur notdürftig mit einem Stück Draht repariert, nachdem er mal an einem der vielen auf den Nebenstraßen herumliegenden Felsbrocken hängen geblieben war. Das Lenkrad war hartplastikbeige und klebrig, verziert mit einem Muster schwarzer Krusten. Das ganze Interieur war bedeckt mit feuchtem Staub, und auf dem Boden blühte ein blaugrüner Schimmelteppich. Miguel hatte vor nicht allzu langer Zeit sauber gemacht, doch das half nur für ein paar Tage. Vergebene Liebesmüh’. Die klamme Kälte und der Schimmel siegten sowieso. Mit leichtem Schaudern und viel Kraft drehte er die Vorderräder auf Kurs und nahm den kurzen Weg aus der Wohnblocksiedlung in San Pedro de la Paz auf die Schnellstraße Richtung Concepción.
Die neue Brücke führte über den Fluss Río Bío Bío.
Welch schöner Name, welch gutes Omen, um hier Biologie zu studieren, so hatte Miguel früher gedacht.
Na ja, die Brücke jedenfalls war beeindruckend, kilometerlang, einigermaßen eben und gut befahrbar. Gute Qualität, angeblich von den Chinesen gebaut. Bei gutem Wetter konnte man die Schlote der Erdölraffinerie, der Zementwerke und der Schwerindustrie im Westen dampfen sehen. Besonders faszinierend war ein außerirdisch anmutender, rostiger und kantiger Schlot nicht weit entfernt in der Bucht von San Vicente. Alle paar Minuten öffnete er seinen Schlund und stieß eine riesige orangebraune Wolke aus.
Falls die Hölle Blähungen hätte, so sähen sie wohl aus!
Gar nix Bio?
Der Fluss Bío Bío selbst war kilometerbreit und schlängelte sich in vielerlei Armen durch Sandbänke – ein wunderhübscher Anblick. Eigentlich. Schon bei der erstmaligen Ausschreibung des Studienjahres Biologie in Concepción am Río Bío Bío hatte Miguel an eine glückliche Fügung des Schicksals gedacht. Hätte man ihm nicht damals schon sagen können, wie übel verdreckt der Bío Bío war? Eine Kloake der Papierindustrie flussaufwärts, voll giftiger Säuren, Chlor und Phenole. Uneigentlich war der Fluss mit dem schönen Namen eine Katastrophe. Ein geplatztes Versprechen. Eine Zumutung, genauso wie die gesamte Uni Concepción.
Miguel studierte Biologie in München und war naturinteressiert. Ursprünglich hatte er für ein Jahr nach Costa Rica gehen wollen. Mit der Universität in San José hatte es ein etabliertes Austauschprogramm gegeben. Miguel war selbst schon in Costa Rica gewesen und kannte etliche der meist rundum zufriedenen deutschen Stipendiaten. Nur hätte er auf den nächsten freien Platz ein Jahr warten müssen, und da war das neue Programm mit Chile gerade recht gekommen. Chile, das hatte nach einem viele Tausende Kilometer langen Traum aus unendlicher Wüste im Norden und geheimnisvollen Urwäldern im Süden, eingerahmt vom wilden Pazifik im Westen und unberührten Andengipfeln im Osten geklungen. Wilde Wellen, heiße Quellen, feurige Vulkane: Platz für alle Abenteuer und Entdeckungen der Welt für den 24-Jährigen.
Die wichtigsten Fakten zu Geografie und Fauna zu lernen war ihm leichtgefallen, wie alles, was ihn wirklich interessierte. Das obligatorische Spanisch hatte ihn weniger interessiert, also hatte er es nicht gekonnt. Das Allernötigste hatte er sich erst in der Woche vor Abreise in einem Intensivkurs reingezogen. Alpha-Learning, nette, fitte Lehrerin, knapp 2000 Wörter in fünf Tagen ins Hirn gesäuselt. Ganz billig war das nicht gewesen, aber es hatte funktioniert und war effizient gewesen.
„Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“ – einer der Sprüche seines geliebten und reichlich chaotischen Opas. „Bua, geh raus in ’d Welt, schau di um, und lern wos“, ein anderer.
Todesbucht
Niemand behauptete, dass das Umschauen und Lernen in der fremden Welt immer erfreulich sein musste. Zwischen der Hafenstadt Talcahuano, Miguels Ansicht nach die schmutzigste und hässlichste Stadt auf dem Planeten, und der Universitätsstadt Concepción, die nur unwesentlich besser in seiner Bewertung davonkam, fuhr er auf Schleichwegen Richtung Penco. Zu viele Baustellen auf der Hauptstrecke. Schlaglöcher, in denen ganze Chevettes verschwanden. Und massenhaft micros, Kleinbusse, die fuhren wie die Irren. Der Größere hat Vorfahrt, so lautete die wichtigste Regel, und Miguel hatte einen gesunden Überlebenswillen, also gab er sich geduldig.
Die Stadt Penco lag an der Pazifikküste, geschützt in der großen Bucht von Concepción. Auch ohne Zutun des Bío Bío, der weiter südlich ins Meer mündete, leider eine der dreckigsten Buchten der Welt. Sie stank nach fauligem Fisch, gemischt mit Dieselruß und einem giftigen Duft – er erinnerte Miguel an das anorganische Chemiepraktikum –, der im ganzen Großraum Talcahuano vorherrschte. Vor lauter Belastung mit Schmutz und organischen Abfällen kippte die ganze riesige Bucht alle paar Jahre um.
„Schön wär’s, dann würden die Leute mal sehen, wie es da unten aussieht!“, ätzte Miguel verbittert. Aber Umkippen war nur der Fachausdruck für Sauerstoffmangel, der zum Absterben allen höheren Lebens in einem Gewässer führte.
Bahía de Concepción? Todesbucht sollte sie heißen: Bahía de la Muerte!
Die Leute aus Concepción, kurz Conce, wurden penquistas genannt, nach dem alten Fischerdorf Penco. Das hatte früher mal ein Tsunami ausradiert, und die Stadt war hinter dem schützenden Hügel am Bío Bío neu als Concepción aufgebaut worden, hieß es. Wobei das heutige Penco auch schon wieder 50.000 Einwohner hatte und an exakt derselben gefährdeten Küstenstelle auf den nächsten Tsunami wartete. Und der stand aller Wahrscheinlichkeit nach in Mittelchile kurz bevor. 1960 hatte es weiter im Süden, bei Valdivia, ordentlich gewackelt. Viele Häuser waren eingestürzt, riesige Landflächen wurden meterhoch angehoben oder abgesenkt.
Was, wenn hier jetzt … na ja, wer weiß schon, wann es vorbei ist, dachte Miguel.
Manche Dinge konnte man einfach nicht ändern. Das lernten die Chilenen wohl von klein auf: Du kannst dich noch so bemühen, das nächste Erdbeben kommt bestimmt und radiert alles aus. Also lieber entspannter an die Arbeit rangehen und den Tag genießen … Miguel sinnierte vor sich hin und stand wieder einmal eine gefühlte Ewigkeit im Stau, kein Genuss im Dieselqualm der Lastwagen, vermutlich ungesünder als zukünftige Tsunamis. Im billigsten aller Kassettenradios vom Trödlermarkt dudelten die Intis, besser bekannt als Inti Illimani, eine chilenische Andenmusikband. Eine salonfähige Institution in Chile und berühmte Protestler.
Einst begleiteten sie mit „El pueblo, unido, jamás será vencido“ – vereint kann uns niemand unterkriegen – Allendes Wahltriumph. Nach Pinochets Militärputsch mussten sie ins Exil. Nunmehr vereinte ihre schwermütige Panflöterei aus dem öden Andenhochland die aufrührerischen Massen. Miguel mochte die Intis und grölte die proletarischen Kampflieder mit: „Venceremos, venceremos …“, lasst uns kämpfen und siegen, die Unterdrückung und das Leid beenden.
Und auch wenn nicht, das nächste Erdbeben kommt bestimmt, schon klar.
Auf der Schlammpiste zuckelte er am „Mar Rico“ vorbei, dem weithin bekannten Spezialitätenrestaurant. Empfehlungen von Bekannten hatte Miguel leicht widerstehen können. Niemals, wirklich niemals würde er auch nur ein Stückchen Meeresgetier aus der Bahía de Concepción anrühren! Das hatte sich Miguel geschworen. Und die allseits bei den Einheimischen beliebten Seescheiden, die piure, erst recht nicht.
Einmal muss man alles probieren, hatte er sich in bester Opa-Manier gedacht, als er doch mal in dieses unappetitliche gelborange Stück lebendigen Meeresboden hineingebissen hatte. Auf einem Brocken metallischen Jods herumzukauen wäre auf dasselbe hinausgekommen. Allein beim Gedanken daran verzog Miguel sein Gesicht.
Er studierte Meeresbiologie und war Taucher seit früher Kindheit, als ihn die Spezl seines Vaters zum Langustenfüttern bis in 50 Meter Tiefe mitgenommen hatten. Einfach so, ohne Anzug und sonstigen Schnickschnack, die Wunderwelt unter Wasser und ein bisschen Pressluft hatte genügt. Er liebte das Meer, die schwerelose Ruhe und all das seltsame Getier. Aber Algen, Seeigel, Seescheiden und andere Meeresleckereien, die die Chilenen so gern als mariscos aßen, die schmeckten ihm nicht. Erst recht nicht, wenn sie aus der Bahía de Concepción kamen.
Nudibranchier
Im Meer hat alles seinen Platz in der Nahrungskette. Wer klein ist, versteckt sich, sonst wird er gefressen. Und wer fest angewachsen ist und sich nicht verstecken kann, dem passiert das eben. Außer Seescheiden, Schwämme und Nesseltiere, die sich vor Feinden schützen. Durch Nesselzellen und Gifte. Zumindest aber durch übel schmeckende Substanzen. Wie piure.
Wäre Miguel ein gefräßiger Krebs gewesen, er hätte keine Seescheiden angerührt. Nicht mal mit viel Zitrone. Diese benützten Chilenen neben Salz und Pfeffer als eins von drei zulässigen Gewürzen. Dazu kam nur noch Koriander. Dieser kräftige Petersilienbruder musste in die casuela, die chilenische Suppe. Doch am allerwenigsten würde Miguel Meeresnacktschnecken anbeißen, Nudibranchier. Die fraßen nämlich auf dem ganzen giftigen Getier, fühlten sich pudelwohl dabei und speicherten den Chemiecocktail in ihren Körpern.
Faszinierende Tiere, diese Nudibranchier! Im Mittelmeer hatte Miguel regelrecht Jagd auf die oft wunderschön bunten Tiere gemacht – im Rahmen von Studentenexkursionen oder auch bloß zum Spaß, um ein paar schöne Fotos zu machen.
Die erste selbst entdeckte chilenische Meeresnacktschnecke war groß, aber nicht besonders aufreizend gewesen. Flach wie eine Schuhsohle und hellbeige genoppt mit ein paar dunklen Flecken. Sie kroch scheinbar ziellos in einem flachen sandigen Gezeitentümpel beim Fischerdorf Cocholgue herum. Miguel fragte Professor Horazio Montano, einen hoch angesehenen Zoologen, was das sei.
„Un nudibranquio!“, antwortete der wissenschaftliche Kapazunder mit sonorer Gelehrtenstimme, gebieterisch abfallend am Satzende.
Eine Nacktschnecke? Aber das wusste Miguel ja bereits.
„Ich meine, welche Art ist das? Und welche anderen Arten gibt es hier sonst noch?“
Der Professor musste passen, was ihm vor den Studenten sichtlich ungelegen kam. Er zog die Augenbrauen nach oben und hob erneut an. „Mit den ökonomisch unrelevanten Arten arbeitet hier niemand“, meinte er, wieder sehr sonor und die „Rs“ am Wortanfang und am Ende sorgfältig gerollt.
Zu sehr gerollt, extra für die r…r…r…rollschwachen Deutschen, mutmaßte Miguel.
So wenig er in die Nacktschnecke, welcher Art auch immer sie angehören mochte, hineinbeißen wollte, so wenig vertraute Miguel den guten Absichten des chilenischen Lehrpersonals.
Soso, dachte sich Miguel, das weißt du also nicht und willst es vor den dummen Ausländern nicht zugeben. Oder kennt die Viecher wirklich niemand? Groß und häufig genug, um irgendjemandem mal aufzufallen, wären sie ja.
War das gerade wieder so ein zufälliger Moment, in dem das Leben Weichen stellte?
Weil Miguel grundsätzlich wenig für unmöglich hielt, was er nicht zumindest ernsthaft versucht hatte, war in ihm ein Gedanke herangewachsen: wirtschaftlich bedeutsam oder nicht. Wenn es sonst niemand machen will, dann werde ich eben die chilenischen Nacktschnecken erforschen!
Nach Penco schlängelte sich eine Passstraße durch Kiefernplantagen über einen Hügel nach Tomé. Die Fahrt konnte zehn Minuten dauern oder zwei Stunden. Heute war ein mittelmäßiger Tag. Die rotbraune Chevette kroch hinter einem hoffnungslos überladenen Holzlaster den Hügel hinauf und noch viel langsamer in bremsenzermürbender Schleichfahrt wieder hinunter. Die Bremsscheiben des Lkws glühten, es rauchte und stank beißend nach Asbest und vorzeitigem Tod. Der Hauch des baldigen Lungenkrebses zwängte sich durch die Löcher im Bodenblech, er musste sich nicht besonders anstrengen.
Aber das nächste Erdbeben kam bestimmt, und Sorgen machten das bisschen Restleben kaum besser, no cierto, nicht wahr?
Miguel nützte die Fahrt meistens, um nachzudenken. Nicht über das Leben oder den Tod, sondern über Nacktschnecken. Offenbar hatten das noch nicht viele Menschen vor ihm gemacht. Er sah den akademisch intellektuellen Bedarf. Und er machte es gern. Miguel hatte in der Universitätsbibliothek das einzig verfügbare Werk über chilenische Nacktschnecken entdeckt, die Berichte der Lund University Chile Expedition von Ernst Marcus aus dem Jahr 1959.
Professor Marcus war zusammen mit seiner Frau vor den Nazis nach Brasilien geflohen, wo er Zoologieprofessor an der Uni São Paulo geworden war und an hübsch bunten Plattwürmern und eben an Meeresnacktschnecken gearbeitet hatte. Er war der Schneckenpapst!
Die Marcus’sche Bibel über chilenische Nudibranchier war praktischerweise auf Deutsch verfasst, deshalb war das Buch auch nagelneu und der Inhalt den Einheimischen unbekannt. Schade!
Ma miassad so was mal updaten, auf Spanisch schreiben und hübsch illustrieren, dachte Miguel. Er kannte den langen Text mit den komplizierten anatomischen Beschreibungen vielerlei chilenischer Nacktschnecken inzwischen so gut wie auswendig. Eine deutsche Freundin, Doktorandin mit Zugang zu allerlei Archiven, hatte ihm von zu Hause weitere Schneckenliteratur geschickt. Über 40 Meeresnacktschneckenarten gab es in Chile, viele davon nur äußerlich von wenigen Individuen oder Fundorten bekannt. Miguel hatte schon etliche Arten davon gefunden, teils die ersten Lebendfotos überhaupt gemacht. Viele Arten fehlten aber noch. Und einige Tiere hatte er gefunden, die nicht in den Faunenlisten enthalten waren.
Waren dies Erstentdeckungen für Chile? Oder sogar ganz neue Arten, die noch nie jemand zuvor gefunden hatte?
Miguel war augenblicklich begeistert, die Holzlaster verloren ihre Bedeutung, und das kalte Pazifikwasser auch. Er war hier, um Nacktschnecken zu sammeln. Eso es! Ganz genau, er wollte bekannte Arten anatomisch beschreiben. Sipu! Und er wollte neue Arten entdeckten. Aber hallo! Holzlaster, Erdbeben und kaltes Wasser hin oder her.
Er war erst ein halbes Jahr in Chile und wurde von den Fischern schon „El señor de los caracoles sin concha “, wörtlich „Herr der Schnecken ohne Schale“, genannt. Zumindest in seinem Beisein. Sonst nannten sie ihn „den verrückten Deutschen“. Oder auch nur „El loco“, den Verrückten.
Dichato
Die letzten Kilometer vom Fischereistädtchen Tomé nach Dichato führten über eine schöne Hügellandschaft mit Wiesen und Forsten, und schließlich öffnete sich der Blick auf die Bucht von Coliumo, eine nach Norden zum Pazifik gerichtete Bucht, an deren weitem hellgelben Sandstrand das Fischerdorf Dichato lag. Im Sommer war Dichato auch als Ausflugsziel beliebt, es gab ein paar Pensionen, viele wilde Zelte am Strand und einige Kneipen. Am Ende des Strandes befand sich die meeresbiologische Station der Uni Concepción.
Als Miguel die Station zum ersten Mal gesehen hatte, war sein Eindruck eher gemischt gewesen. Eine lange, einstöckige Konstruktion mit Blechdach und vielen Fenstern hinter ein paar niedrigen Dünen war das Stationsgebäude. Dahinter erhoben sich riesige Betonmauern einer verfallenen Fischfabrik.
Was denn da passiert sei, hatte Miguel einmal gefragt.
Och, da sei mal ein kleiner Tsunami vorbeigekommen, war die Antwort gewesen.
Ein winziges Holzhäuschen im Windschatten der mächtigen Fabrikreste war das Gästequartier. Zudem wohnte Juan, der Verwalter, mit seiner Familie in einem ebenso winzigen Holzhäuschen am Eingang des Geländes. Juan war freundlich, klein und dünn. Und er war eigentlich Mapuche, ein Nachfahre der in Südchile ansässigen, stolzen und wehrhaften Araukaner. Die einzigen Stämme in Südamerika, die nie von den Europäern unterworfen werden konnten, hieß es. In einer Volkszählung hatten die Indigenen die Wahl gehabt, sich weiterhin als Mapuche oder als Chilenen zu bezeichnen. Raffinierter Schachzug, befand Miguel, denn der chilenische Nationalstolz war gewaltig. Außenseiterstolz. Eine Legende besagte, dass die Götter die Welt erschufen. Als sie fertig waren, war noch etwas Land übrig. Sie warfen es über die Anden, und das wurde das heutige Chile.
Bei den Nachbarn war Chile nicht sonderlich beliebt. Einst von preußischen Instruktoren gedrillt, war das chilenische Militär immer noch allseits gefürchtet. Im Pazifischen Krieg in den frühen 1880er- Jahren hatten die Chilenen einen großen Teil der salpeterreichen Atacama-Wüste erobert. Peru hatte Gebiete verloren und Bolivien sogar den direkten Zugang zum Meer. Bösen chilenischen Zungen zufolge schwamm seitdem die bolivianische Marine auf dem Titicacasee umher und wartete darauf zuzuschlagen. In der Tat sangen panflötige bolivianische Hochlandlieder noch heute vom verlorenen Meer. Diese klangen wie Inti, Miguel hörte und sang auch sie gern. Bei den klagenden Melodien dachte er an die bolivianische Flotte, die deprimiert auf dem Titicacasee im Altiplano umherdümpelte und auf den Tag wartete, an dem sie wieder ihr bolivianisches Meer, nuestra mar, unter den Kiel und Chilenen vor die Kanonenrohre bekommen würde. Bolivianer samt ihrer Hochgebirgsflotte wurden von Chilenen nicht sehr gemocht.
Noch unbeliebter waren die angeblich so überheblichen und heißblütigen Argentinier. Sie hatten ihr eigenes Meer, die endlosen Strände des Südwestatlantiks und stritten dafür um jeden Millimeter Bergesgipfel in der ewig langen Andengrenze zu Chile.
Gerade eben führte der Dauerkonflikt fast zu einem offenen Krieg, entzündet wegen ein paar strittiger Quadratkilometer Anden am eigentlich recht hübschen, doch „Wüstensee“ heißenden Lago del Desierto, die sich die Argentinos wohl unter den Nagel reißen wollten. Hinterberglerisch und argwöhnisch wachten die Chilenen nun über ihr Gebiet.
Meeresbio-Station
Ähnlich wachten die Professoren der Uni Conce auch über ihre Meeresbio-Station. Jeder profe hatte ein Labor. Dort standen einige Geräte oder Gläser als Platzhalter herum, ohne dass jemals jemand mit diesen Dingen arbeiten würde, da war sich Miguel sicher. Es war strengstens untersagt, das Privatgelände zu betreten oder gar Geräte zu benutzen. Nur bestimmte Personen hatten Einblick in die komplexen Strukturen und Besitzverhältnisse. Und natürlich sprach niemand offen darüber.
Im Prinzip ist arbeiten hier verboten, dachte Miguel.
Die einzige Möglichkeit, die Station zu benutzen, war, sich einem der profes mit Hausrecht anzuschließen. Miguel besuchte Unikurse bei mehreren verschiedenen Professoren und musste auch Punkte sammeln, um die Semester zu bestehen. Der Deutsche Akademische Austauschdienst DAAD drohte ansonsten mit Rückforderung der Stipendiengelder, das waren immerhin 600 D-Mark pro Monat. Nicht gerade üppig, aber besser als nichts.
Im ersten Halbjahr war Miguel in Kursen eingeschrieben bei profes, die jeder für sich allein recht nett waren, sich aber gegenseitig nicht mochten. Mal hatte er in einem der Labors arbeiten dürfen, dann wieder nicht. Letztlich hatte er bei einem sehr freundlichen profe unterkommen und bleiben dürfen. Woraufhin sich seine bisherigen Kursfreunde, allesamt Schüler eines verfeindeten profes, von ihm abgewandt hatten und nicht mehr mit ihm hatten reden wollen. Er sei ja jetzt Schüler von dem anderen profe.
Was für ein destruktiver Wahnsinn, dachte sich Miguel regelmäßig. Daran gewöhnen konnte er sich nie. Miguel machte sich nichts aus Missgunst, Intrigen und Eifersüchteleien. Er wollte seine Ruhe, Harmonie mit Menschen und Natur. Er wollte in Frieden seine Nacktschnecken erforschen. Punkt.
Die einfachen Leute – Juan der Pförtner, Juan der Taucherduschen-Beauftragte, Paulo der Vielseitige und die Fischer von nebenan mit dem Bärtigen, der tagsüber nicht trank – hielten sich aus den Machtkämpfen ihrer Meister heraus, und mit ihnen kam Miguel gut klar. Er respektierte sie und sie respektierten ihn. Was bedeutete, dass man sich nach Kräften austricksen durfte und sich gelegentlich half, wenn man Lust dazu hatte oder sich Vorteile versprach. Dass ein „Ja“ hier auch „nein“, „jetzt nicht“ oder auch „niemals“ heißen konnte, ohne allzu geringschätzig gemeint zu sein, hatte Miguel erst lernen müssen.
Und außerdem gab es Marco, den Dauerbewohner des Gästehauses. Marco kam aus Nordchile, war freundlicher und etwas dunkler als die anderen Studenten und sprach noch schneller und nuscheliger als die penquistas. Er war für Miguel am Anfang nicht zu verstehen gewesen. Keine Silbe. Nada!
Überhaupt hatte das chilenische Spanisch wenig Ähnlichkeiten mit dem spanischen Alpha-Learning-Spanisch. Gut 90 Prozent der Alltagssprache in Chile war chilenischer Dialekt, schätzte Miguel.
„Holá, quiuwo?“, begrüßte ihn Juan der kleine dürre Pförtner am portón, dem riesigen Gatter am Stationseingang, das auf Geheiß eines Unifürsten ständig geschlossen sein musste. Wobei Menschen, Kühe und ähnliches Getier ohne großen Aufwand direkt neben dem portón das Gelände betreten, sich umsehen und es wieder verlassen konnten.
„Das sind Regeln. Das müsstest du als Deutscher eigentlich wissen!“, hörte Miguel des Öfteren, wenn er sich pragmatisch über offensichtlich unsinnige Regeln hinwegsetzen wollte.
„This is a house!“, begrüßte ihn Marco, der krampfhaft Englisch lernende Dauerbewohner, der den scherzhaften Titel „resident evil“ nicht verstand, jedenfalls noch eine ganze Weile nicht. Vielleicht hatten die von marktradikalen Chicago-Boys und miesen Amifilmen geprägten Chilenen aber auch gelernt, dass Deutsche grundsätzlich keine Witze machten?
„Hola Marco, que tál?“, grüßte Miguel zurück.
„This is the sun!“, strahlte Marco.
„Sí sí“, murmelte Miguel. Sonne? Wenn es doch nur so wäre.
Dicke graue Wolken wälzten sich ein paar Meter über den schäumenden Wellen durch die Bucht, bald würde es wieder schütten. Keine Chance, bei diesem Sauwetter einen Stationsmitarbeiter oder Fischer dazu zu überreden, ihn aufs Meer hinauszurudern! Nicht mal Schnaps würde als Bestechung helfen.
Der Winter war vorbei, und eigentlich war auch schon der Frühsommer gelaufen. Miguel hatte 20 Suchstationen in der ganzen Bucht auserkoren, die er in den nächsten Wochen nach Nacktschnecken absammeln wollte, bevor es wieder Winter wurde. Was sollte es!
Er öffnete den Kofferraum mit einem Klaps an die richtige Stelle, das Schloss war ausgeleiert. Paulo, der vielseitige Stationshelfer, hob eine Augenbraue. Er beobachtete Miguel aus einer dunklen überdachten Ecke heraus, in der er es sich gemütlich gemacht hatte. Überblick war alles. Und von dem alemán loco wollte er lernen, alemannische Disziplin zum Beispiel. Und harto trabajo – viel harte, lästige Arbeit – und deren Vermeidung.
Wertarbeit
Miguel wuchtete nacheinander sieben korrodierte, antiquarische, fast schon antike Tauchflaschen aus dem Kofferraum und legte sie vorsichtig auf den Boden. Die große, behelfsmäßig golden übertünchte 15-Liter-Metallzylinder hatte es ihm besonders angetan. Jedes Mal wieder bekam er eine Gänsehaut, wenn er die schwammigen Ausblühungen der Tauchflaschen aus der Nähe sah. Das sind Aluflaschen, da kann eigentlich nichts verrosten, beruhigte er sich jedes Mal. Und sie sind ja bloß mit gut 100 bar Druck befüllt. Das entsprach etwa dem Druck in 1000 Metern Meerestiefe. Doch es blieben die korrodierten Stellen und das mulmige Gefühl, dass sich jeder deutsche TÜV bei ihrem Anblick mit Entsetzen abwenden und schleunigst in Deckung gehen würde.
Paulo schaute anerkennend herüber. Harto trabajo wie aus dem Lehrbuch. Paulo war auch nur ein ayudante, ein Helfer, aber er war schlau. Er wusste, dass man deutsche Experten die gefährlich schweren Tauchflaschen lieber allein aus dem Kofferraum hieven lassen sollte. Er wusste auch, wie schwer es war, in Concepción Tauchflaschen aufzutreiben. Noch viel schwerer war es, sie mit Luft befüllen zu lassen. Es gab zwar eine Industriegasfabrik in Talcahuano, diese weigerte sich aber standhaft, allzu marode Flaschen zu befüllen. Da half kein Flehen im Namen der Wissenschaft. Also musste der Deutsche irgendwie Don Leopoldo, den Verwalter der Fakultät, herumgekriegt haben. Denn dieser war der Einzige, der Macht über Don Francisco hatte. Und jener war der Einzige, der den universitätseigenen Kompressor bedienen konnte, und war damit Herr über alle taucherischen Forschungen im südlichen Zentralchile, der Octava Región.
Don Francisco war willig und groß, aber schwach. Oft schmerzhaft gebeugt, wenn jemand zusah, denn die schwache Wirbelsäule, la columna vertebral, war krank, sehr krank. Und er wusste um sein Monopol des Flaschenfüllens. Ein kluger Kerl, dieser Don Francisco!
Paulo hatte ausnahmsweise nichts zu tun und wusste, dass er so oder so nicht helfen konnte. Auch das Schleppen von Tauchflaschen in die Station war noch nie sein Ding gewesen. Solch schwierige Aufgaben blieben deutschen Spezialisten vorbehalten. Die waren für so was ausgebildet. Ja, Paulo bewunderte diese Deutschen ob ihrer Ausbildung und Disziplin. Und ihrer harten Arbeit.
Miguel war nicht der erste arbeitswütige Deutsche in Dichato. Genau genommen war er, nur knapp geschlagen, der zweite. Ein Jahr zuvor hatte es bereits einen Doktoranden einer norddeutschen Uni gegeben, der an Muscheln geforscht hatte. An guten, großen, ökonomisch relevanten Muscheln, die geerntet, verkauft und gegessen werden konnten. Wichtige Forschungen also. Die Muscheln waren gesammelt, auf die Art bestimmt, gewogen und vermessen und dann war mit einem selbst gebastelten Instrument die Öffnungskraft des Ligaments bestimmt worden.
Muscheln konnten ihre Schalen nämlich nur aktiv durch Muskeln schließen. Geöffnet wurden sie durch die Zugkraft des die Klappen verbindenden Ligaments. Deshalb kamen Muscheln nur dort im Sediment vor, wo sie es dank eines starken Ligaments verdrängen konnten; schließlich mussten sie auch atmen und sich ernähren. Wem das zu biologisch klang, hier ein praktischer, vielleicht gar lebensrettender Hinweis aus erster Forscherhand:
Muscheln, die beim Kochen nicht aufgehen, also geschlossen bleiben, obwohl ihr Schließmuskel weichgekocht sein sollte, sind verdächtig; man sollte sie trotz anderslautender Tipps lieber nicht essen!
Tauchfahrt
Der Doktorand, groß, blond, blauäugig, gutaussehend, dynamisch und an essbaren mariscos arbeitend, hatte sich regelmäßig von Paulo hinaus in die Bucht rudern lassen.
Paulo arbeitete gern mit dem willensstarken, großen und blonden Deutschen und beförderte ihn stetig mitten auf die Bucht hinaus. Auf dem Boot stand ein alter öliger Kompressor, mit abgesägtem – oder abgerostetem, Miguel hatte nie gefragt – Auspuff, einem Loch am Zylinder. Gegenüber des amputierten Auspuffs, etwa 30 Zentimeter Luftlinie entfernt, war eine Einsaugöffnung, also noch ein Loch, durch das die Luft in den Kompressor strömte und dort in einen kleinen Blechbehälter auf einige Bar Überdruck verdichtet wurde. An einem Stutzen des Blechbehälters war mit rostigem Draht ein grünlich verblichener Gartenschlauch festgemacht. Am anderen Ende des Gartenschlauchs hing, mit Gummiband befestigt, ein Lungenautomat, durch den man unter Wasser atmen konnte. Wenn der Kompressor ordnungsgemäß pumpte und man nicht allzu tief unten war, jedenfalls.
Es war eines der Highlights des ersten Semesters, als der deutsche Doktorand Miguel einlud, ihn zu einer Muschelsammelaktion zu begleiten. Offensichtlich wäre ihm Damenbegleitung noch lieber gewesen, aber immerhin hatte er mal interessierte Gesellschaft. Und wer wusste es schon, vielleicht konnte man einen Neuling für eine, natürlich unbezahlte, Diplomarbeit anwerben? Und Miguel, der Neuling, hoffte darauf, endlich in Chile unter Wasser zu kommen.
Schon im zarten Alter hatte er mit Atemgeräten tauchen gelernt, im klaren Wasser des Mittelmeers. Aber der Südpazifik war anders – trüb, wild, gewaltig. Voll von riesigen Tangwäldern, allerlei Meeresgetier und Unmengen an Möwen und Pelikanen um die Fischerbötchen herum. Ab und zu sah man auch Seebären und Pinguine. Und es war kalt. Irgendwann würde der große Blonde frieren, und dann würde Miguel endlich helfen dürfen beim buceo, dem Tauchen.
Seit vier Wochen war Miguel nun schon in Chile und war bisher weder getaucht noch Gleitschirm geflogen noch auf Berge geklettert. Die Zeit war reif. Ungefragt zog er seinen uralten schwarzen Haifischhaut-Tauchanzug an, den er an vielen Stellen schon mit buntem Bindfaden geflickt hatte. Wenn die Arbeit rief, war er bereit für harto trabajo. Mit Tauchflaschen oder heute eben auch ohne wie die einheimischen Fischer. Miguel war bereit für buceo artesanal.
Paulo, der blonde Doktorand, Miguel und der rostige Kompressor gingen kurz hinter der Mitte der Bucht vor Anker und das Gerät begann sein lärmendes Werk. Es bestand darin, ölige Abgaswolken über das Boot zu pusten, nur um dann einen Teil wieder anzusaugen und in den Gartenschlauch zu drücken, an dem, mit Einweckgummis befestigt, der Lungenautomat baumelte. Der Doktorand nahm ihn in den Mund, den Gartenschlauch in die Hand und ließ sich über die Bordwand ins 16 Grad kühle grünliche Wasser plumpsen. Wenn man genau hinsah, konnte man Unmengen kleiner gelbgrünlicher Kügelchen im Wasser bemerken, die kleinsten Einheiten der Algenblüte. Anzug, Kopfhaube und Arbeitshandschuhe schützten den Forscher vor den Einzellern und der Kälte.
Man mochte nun einwenden, dass 16 Grad ja nicht sehr kalt seien. Dies konnte für die erste Stunde unter Wasser gelten, aber danach wurde es irgendwann frisch. Immer wieder tauchte der Doktorand mit neuen Proben auf, reichte sie Paulo und tauchte dann wieder hinunter. Der große Blonde war zäh.
Leider, dachte Miguel.
Ab und zu füllte Paulo Benzingemisch nach und der Kompressor tat unermüdlich sein ratterndes stinkendes Werk.
Miguel war übel. Das Schaukeln der großen Pazifikwellen allein hätte wohl schon genügt. Aber zusammen mit dem brenzligen Abgasnebel waren es teuflische, nicht enden wollende Stunden der Qual. Bevor sich Miguel endgültig übergeben musste, hüpfte er ins Wasser. Der Doktorand war bereits blau angelaufen und grinste. „Hast es ja ganz schön lange ausgehalten. Magst du mal tauchen? Kannst mir helfen, ich bekomme da unten Kopfschmerzen von der Luft.“
Er wollte.
Sie befestigten einen zweiten Schlauch mit Lungenautomat und tauchten gemeinsam ab.
Im Mar Chileno
Das Wasser war trüb, und die Atemluft aus dem Gartenschlauch schmeckte nach öligen metallischen Seescheiden. In einigen Metern Tiefe lagen zwischen Sandflecken größere Steine und Felsen, die mit langen Algen überwuchert waren. Die Algen schwankten mit der Strömung der Wellen hin und her, hin und her – immer wieder. Ein Teppich aus losgerissenen Algen wogte auf dem Grund, hin und her, gemeinerweise in einem ganz eigenen Rhythmus, der nichts mit der angewachsenen Algensubstanz zu tun zu haben schien. Alles hier unten bewegte sich, hin und her, das Auge hatte keinen Anhaltspunkt in der chaotisch schwingenden Algenmasse. Miguel wurde erneut schlecht. Er war schon viel getaucht, aber so noch nie. Er wusste, wenn es nicht anders ging, musste er durch den Lungenautomaten kotzen. Sonst würde er sich unweigerlich und schlagartig Wasser in die Lunge pumpen, und das wäre auch in der geringen Tiefe fatal. Zur Sicherheit hätte er noch sein Taucherblei abgeworfen, um auf jeden Fall an die Oberfläche zu gelangen.
Für Paulo wären kotzende Taucher wohl nichts Neues gewesen. Wenn die Dichato-Fischer stundenlang nach jaibas, den großen Krabben, chorros zapatos, den Riesenmiesmuscheln, oder piure, den Seescheiden, tauchten, kam das schon mal vor. Insbesondere, wenn zuvor ordentlich aguardiente, schwarzgebrannte methylalkoholische Rachenputzer gegen die Kälte getrunken worden waren. Und wann war es hier im Mar Chileno mal nicht kalt?
Miguel konzentrierte sich auf die einzigen Fixpunkte in all der Bewegung: große Seesterne. Unterwasser-Fixsterne waren sie, ohne dass sie ihre Wichtigkeit auch nur ahnen konnten, und er beruhigte sich. Der Mensch gewöhnt sich an alles. Auch an kaltes Wasser, geringe Sichtweiten, wabernde glitschige Algen und einen penetrant öligbrenzligen Geschmack von den Lippen bis tief in den Rachen. Es gab so viele spannende Tiere zu entdecken. Große Krabben, jaibas, die drohend ihre Scheren hoben.
Mit denen ist nicht zu spaßen, so ein gringo-Fingerchen ist schnell durchgezwickt, erinnerte sich Miguel an die Warnungen der Fischer. Bestimmt übertrieben, huevones, wollen bloß nicht, dass ihnen jemand Konkurrenz macht.
Doch Miguels Interesse galt nicht seinem Magen und dessen Füllung mit mariscos oder blindmachendem Fusel, sondern dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn. Was gab es hier nicht alles zu sehen: Hübsche bunte Anemonen, filigrane Moostierchen, bei genauerem Hinsehen auch einige der scheußlich schmeckenden Seescheiden, die Wasser ein- und ausströmten und sich bei Berührung zusammenzogen. Nacktschnecken sah er leider nicht. Noch nicht, denn wenn es ihre Beutetiere gab, konnten sie eigentlich nicht weit sein. Ja, Schneckenfutter gab es in rauen Mengen! Man musste eben genau hinschauen, sich Zeit nehmen. Inmitten all dieser Pracht wurde Miguel ganz ruhig. Ruhe bewahren unter Wasser war immer schon seine Stärke gewesen. Wo andere Panik bekamen, behielt er die Kontrolle.
Aber, was war das? Irgendetwas hatte ihn am Rücken berührt, und der Doktorand war es nicht, denn den sah er als Umriss vor sich Muscheln sammeln.
Da, schon wieder!
Er drehte sich nach oben und sah Muschelschalen herabschweben, eine nach der anderen. Die beiden Taucher fuchtelten fragend mit den Armen herum und stiegen dann langsam atmend hoch. In einem Regen von herabschaukelnden Muschelschalen.
Im Boot saß Paulo, der sich die schönsten Stücke der gesammelten Proben heraussuchte, mit einem rostigen abgebrochenen Messer öffnete und genüsslich die glibberigen rohen Weichkörper ausschlürfte. Die leeren Schalen warf er über Bord. Mit neckischen, tänzerischen Bewegungen sanken sie in die Tiefe. Satt und zufrieden grinste Paulo die beiden patschnassen, durchgefrorenen, hart arbeitenden gringos an. Der Größere und Blondere war wenig erfreut und machte seinem Ärger über aufgegessenes wissenschaftliches Material in allerlei chilenisch klingenden Wörtern Luft. Miguel verstand, dass hier Welten aufeinanderprallten, mit eindeutigem Heimvorteil beim hungrigen und gelangweilten Fischer.
Ein paar Minuten später, Paulo hatte inzwischen eine gekünstelt betretene Mine aufgesetzt, die deutlich signalisierte, dass er seinen Festschmaus nicht im Geringsten bereute, meinte der Doktorand schließlich: „Es hat keinen Sinn, noch mal zu tauchen, retten wir lieber das Material, das noch da ist.“ Dabei sah er Paulo extrastreng und breitbeinig stehend von oben herab an.
Seine ökonomisch unrelevanten Nacktschnecken, falls er jemals welche fand, würde wenigstens niemand wegessen, dachte Miguel.
Als sie schlotternd Richtung meeresbiologische Station ruderten, hatten die Deutschen immer noch den penetranten ölig bleiernen Geschmack im Mund.
„Typisch für das Benzin-Altölgemisch, das die hier immer verwenden“, erklärte der Blonde, „deshalb werden die Fischer hier alle nicht alt. Wenn sie wenigstens Pflanzenöl verwenden und ab und zu die Filterkartuschen am Kompressor austauschen würden! Na ja, dann würden sie sich eben umso eher totsaufen.“
Paulo lauschte den fremdländisch harten Klängen interessiert. Sie erinnerten ihn an Maschinengewehre. Vor allem, wenn der große Blonde schimpfte. Geborene Anführer waren sie, diese Deutschen.
Demonstrativ pötterten immer noch Abluftschwaden aus dem nicht vorhandenen Auspuff, zogen diritissima über den Zylinder und hinein in die Ansaugöffnung. Das Ansaugrohr war vor einer Weile kaputtgegangen, und sie sollten doch einfach mal bei Don Francisco fragen, ob er ein neues besorgen könnte, meinte Paulo, der nicht mehr gern tauchen ging und den Tod durch Alkohol einer verteerten und verkrebsten Lunge erklärtermaßen vorzog. Zumindest, wenn er in den Armen seiner „Nichten“, lah primah, wie er die señoritas im Fischerdorf-Puff nannte, abtreten durfte.
Die alemaneh könnten gern mal mitkommen, er würde schon dafür sorgen, dass die Nichten sie gut behandelten.
Die Deutschen starrten Paulo an.
Ob sie lieber Cousinen wollten? Hilfreich wäre natürlich, wenn sie ihn, Paulo, als Guide sozusagen einladen würden, er war ja schließlich ein echter Experte auf diesem Gebiet. Nein? Ob sie denn noch reifere Damen bevorzugen würden und schon einmal Erfahrungen mit einer richtig großbusigen mamita gemacht hätten? Nein? Sie könnten sich gar nicht vorstellen, was sie verpasst hatten.
Paulo strahlte allein beim Gedanken über das ganze Gesicht. „Wann gehen wir?“
Miguel freute sich nur noch auf das Ufer, eine Kopfschmerztablette, das Gurgeln mit Shampoo und eine schöne warme Dusche. Seine Füße waren weiß. Sein vegetatives Nervensystem hatte die Durchblutung der Zehen schon vor einer Weile eingestellt, vermutlich vor Stunden. Er wusste, das war nicht böse gemeint, sondern ein physiologisches Notprogramm. Es galt, die Kerntemperatur des Körpers zu erhalten. Nicht direkt für das Überleben notwendige Körperteile an der Peripherie, wie seine Zehen, werden dabei geopfert.
Wie wunderbar war doch die Natur!
Während er gegen die Kälte ruderte, ein frischer Wind mit Nieselregen einsetzte und das Eiswasser um seine leblosen Zehen in den viel zu dünnen Neoprenfüßlingen hin- und herschwappte, überlegte Miguel, um wie viel dieser ölhaltige Bootsausflug sein hoffnungsvolles Taucherleben nun verkürzt hatte. Tage, vermutlich Wochen, vielleicht sogar Jahre?
War er bereits reif für rohe Muscheln, Methanol-Schnaps und massige mamitas, um dort im Hafenpuff sein nutzlos hektisches gringo-Leben ausklingen zu lassen? Egal, die heiße Dusche war wesentlich wichtiger. Endlich an Land, endlich wieder an der Station!
Doch die schöne warme Dusche war zugesperrt.
Juan, der Taucherduschen-Beauftragte, hatte den einzigen Schlüssel und war leider nicht aufzufinden. Es war ja auch schon nachmittags. Ein Schluck Pisco, dem grappaähnlichen Traubenschnaps, dem Stolz Chiles aus der Pulle, musste als Gift gegen die Kälte genügen. Dann wurden die geretteten Muscheln eben kalt und ohne Dusche vermessen, ihre Kraft im selbst gebauten Dehnungsapparat getestet, die Daten in seitenlange Listen eingetragen – immer wieder, pausenlos, Stück für Stück, bis in die Nacht hinein.
Paulo hatte nichts zu tun und sah ab und zu im Labor nach dem Rechten. Vielleicht trieb ihn auch die Hoffnung, seine Saat der Cousinen, also sein Plan, die Deutschen in den Puff zu locken, möge aufgegangen sein, oder zumindest der, einen großen Schluck Pisco abzubekommen. Aber die Deutschen arbeiteten einfach nur stumm wie die mariscos vor sich hin, bis alle Muscheln ausgewertet waren.
Mucho trabajo!
Trotz des Donnerwetters und der verpassten Puff-Tour war der große Blonde in Paulos Achtung nur noch weiter gestiegen: Der hat Disziplin. Deutsche Disziplin. Der weiß, was er will.
Zweiter Versuch
Miguel wusste auch, was er wollte. Das zweite Semester würde völlig anders laufen als das erste, dafür würde er sorgen. Zuerst musste er die vielen Tauchflaschen im Labor des freundlichen profes verstauen und einschließen. Sie waren der Garant für die kommenden Wochen Unterwasserforschung ohne geteerte Taucherlunge am Gartenschlauch. Die ganze Bucht wollte er nach Nacktschnecken abgrasen, erst am Rand und dann auf gerader Linie vom Strand bis in die tiefe schlammige Mündung in den Ozean.
Es war Februar, chilenischer Hochsommer. Bald begann das Semester, Miguel würde seine Freilandforschungen als Praktika anerkennen lassen und die Ergebnisse als Abschlussarbeit aufschreiben und präsentieren. Nie wieder theoretische Kurse mit launischen profes, das hatte er sich fest vorgenommen und die Kursplanung auch schon vor Semesterbeginn abgesprochen.
Er brauchte halbwegs gutes Wetter! Er brauchte Ergebnisse, um die ihm zugestandenen Freiheiten zu rechtfertigen. Neue Nachweise von Arten in der Bucht, das wäre fein! Oder sogar neue Arten für Chile? Oder neue Arten für die Wissenschaft? Das wäre der Hauptgewinn! Ach, wird schon klappen, dachte sich Miguel und war wild entschlossen, auch bei hundsmiserablem Sauwetter sein Bestes zu geben.
Noch schwieriger kalkulierbar als Wetter und Schnecken war der Faktor Mensch samt Logistik: Wer wusste, ob er den willigen, aber schwachen und oft kranken Don Francisco jemals wieder so günstig zum Befüllen der Flaschen animieren konnte? Gute Luft, die beste in Conce, dank feinsten Pflanzenöls und neuen Filterkartuschen! Sogar ein Schlauch für unverpestete Ansaugluft ragte aus dem Schuppen heraus, in dem der Hochdruckkompressor ratterte. „Bauer! Muy buena marca. La conoces?“
Ja, freilich kannte er die, eine Münchener Kompressorenfirma, das Beste vom Besten, nur waren die Dinger immer zu teuer für Miguel gewesen.
Eine Flasche aus dem Duty Free Shop war die gute Luft allemal wert. Don Francisco war zufrieden und fühlte sich weniger krank, die columna hatte sich schlagartig gebessert. Die zweite Flasche Ballantines bewahrte Miguel in Dichato auf. Für Notfälle. Er hatte sie in einem hölzernen Mikroskopkasten versteckt, den er sorgfältig verschlossen hatte. Nie wieder wollte er mit dem maroden Gartenkompressor auf dem Boot tauchen, kotzen und früh sterben müssen wie die Fischer.
Lüsternes Totsaufen in den Armen gieriger Cousinen war mittelfristig auch keine Option, vielleicht später mal. Erst galt es, die chilenischen Meeresnacktschnecken zu erforschen, ihre Artenvielfalt, ihre Fortpflanzung, ihre Biologie. Nichts davon war bekannt, nicht einmal, was die Viecher fraßen.
Es gibt keine Freunde in der Wissenschaft
„Hola profe!“, begrüßte ihn Susana. Sie war die Tochter von Juan, dem Verwalter und Pförtner, und technische Assistentin der Station. Sie war freundlich, schlau und zuverlässig, also eine Bilderbuchassistentin. Miguel hatte sie aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften sogleich als Hilfskraft zur Pflege seiner Aquarien mit Nacktschnecken eingestellt. Er konnte nicht jeden Tag in Dichato sein, und da schien es ihm logisch, dass er jemand vor Ort um den täglichen Wasserwechsel bat und im Rahmen seiner bescheidenen Möglichkeiten entlohnte. Susana freute sich jedenfalls. Und sie nannte ihn profe, wie sich alle anderen Postgraduierten-Studenten auch titulieren ließen. Nur Miguel war das unangenehm. Er war doch nur Student, hatte weder Diplom noch Titel und war nicht einmal annähernd Professor. Aber auch einige der echten Uniprofessoren hatten weder Master noch Doktorabschluss. Und diese waren nicht unbedingt die schlechteren Professoren, befand Miguel.
Heute hatte Susana aber schlechte Nachrichten. Sehr schlechte! Tränen sammelten sich in ihren Augen. Seine Aquarien waren weggeräumt worden.
„Wie, was heißt weggeräumt?“ Miguel mochte nicht glauben, was er da hörte. Bestimmt ein sprachliches Missverständnis. Auch wenn er erhebliche Fortschritte gemacht hatte, ab und zu kam er mit dem Fischerdorfdialekt noch nicht ganz mit.
„Ja, weg, wirklich alle!“ Susana zitterte. Es war Platz benötigt worden, und da hatte sie nichts gegen die Räumung tun können. Zudem hätte sich ein profe aufgeregt, dass Miguel mit Susana eine eigene Hilfskraft hätte. Studenten machten so etwas nicht. Auch nicht Postgraduierte. Momentan würde in der Uni eine Konferenz zu dieser Sache abgehalten. Einige profes wollten wohl, dass Miguel Hausverbot in der Station bekäme.
Hausverbot? Er, der Einzige, der seit Wochen, ach was, seit Monaten irgendetwas Forscherisches in der Station gearbeitet hatte? Miguel lief knallrot an unter seiner Chilotenmütze. So besonnen er unter Wasser war und so ruhig im normalen Leben, so wütend konnte er bei aus seiner Sicht schikanösen oder willkürlichen Gemeinheiten anderer werden.
Er stürmte in den Aquariensaal. Schon beim Öffnen der Türe schlug ihm der widerliche Gestank verrottender Weichtiere entgegen.
„Chucha, que al diablo pasó aquí?“, fragte er Susana. Was zum Teufel ist denn hier passiert?
Susana weinte. Es hätte einen pregrado-Studentenkurs gegeben, und für den wären Muscheln und Schnecken gesammelt worden. Zum Wiegen und Vermessen. Danach hatte sich niemand mehr um die Proben gekümmert und sie hatte sich nicht getraut einzugreifen. Die großen Schnecken waren inzwischen aus den Behältern entwischt und lagen zu erbärmlich stinkenden Schleimbatzen zerfließend auf den Arbeitsbänken und dem Boden herum. Und auch viele der Muschelbehälter warfen faulige Blasen. „Pfui Teufel, und für diese Sauerei haben die meine schönen Aquarien mit den Nacktschnecken entfernt? Sabotage ist das!“
Miguel war außer sich. Das war ein Anschlag auf ihn, ja, mehr noch, ein Attentat auf die Nacktschneckenforschung.
Niemand hatte gewusst, was chilenische Nacktschnecken fraßen. Also hatte Miguel es ausprobiert, indem er den Schneckchen in Aquarien verschiedene Futterorganismen angeboten hatte. Auch hatte niemand über die Eigelege und die Entwicklungszeiten zu Schneckenlarven Bescheid gewusst. Susana und Miguel hatten daher frische Gelege dokumentiert und längerfristig beobachtet. Alles neue biologische Daten schöner chilenischer Meerestiere. Und irgendwann publizierbar, ganz bestimmt.
Und nun? Alles kaputt!
Miguel war extrem sauer. Er fluchte so ordinär auf Chilenisch, wie er es auf Deutsch niemals getan hätte. Und hörte nur auf, weil er die völlig verzweifelte Susana nicht noch mehr stressen wollte. Die Arme konnte ja schließlich nichts dafür, hatte keine Chance gegen böswillige profes gehabt.
Wer steckte diesmal dahinter? Grimaldo, der ehrgeizige Doktorand, der schmächtige Typ mit dem hellen Teint und dem Seidenhalstuch, der die deutsche Studentengruppe anfangs mit extraschnellen modismos, dem chilenischen Dialekt, traktiert hatte?
Das hatte er bei jeder Gelegenheit und am liebsten vor Publikum auf dem Campus der Uni getan. Und dann immer dreckig über die deutschen Trottel gelacht, die nichts gecheckt hatten. Bis Alba, einer ruhigen und zierlichen deutschen Mitstudentin, irgendwann der Kragen geplatzt war. Sie hatte Grimaldo urplötzlich auf Deutsch dermaßen laut und heftig zusammengestaucht, dass ihm die Sprache weggeblieben war und er sichtlich nach Luft hatte schnappen müssen. Peinliche Vorstellung vor seiner ganzen Clique. Vermutlich hatte er gedacht, die Deutschen seien total bescheuert, zu dumm zum Sprechen, egal in welcher Sprache?
Hehe, da hatte er aber geschaut, der Grimaldo! Nie würde Miguel diese denkwürdige Szene im parkähnlichen Campus der Uni Concepción vergessen. Eins zu null für Alba!
Doch nun? Kollege Möchtegern-profe Grimaldo hatte einige Aquarien mit Sedimentproben hier im Aquarienraum stehen, sie schienen unversehrt.
„Seltsamer Zufall, Susana, oder?“
Sie schluchzte noch heftiger und verbarg mit den Händen ihr Gesicht.
Miguel reichte das als Antwort. Eigentlich war Grimaldo seit Albas Ausbruch ganz friedlich gewesen. Hatte er gelernt, weniger offensichtlich fies zu sein und dann zu sabotieren, wenn es richtig wehtat? Heimtückisch die Nacktschneckenforschung in Chile ins finsterste Mittelalter zurückzuwerfen, sobald er die Gelegenheit dazu hatte?
Alle Deutschen hatten anfangs versucht, nur Spanisch zu sprechen, und unbedingt, sobald Chilenen in der Nähe waren. Dies empfanden sie als Gebot der Höflichkeit in einem Gastland, das zumindest ein paar der Studentinnen regelrecht anhimmelten. Einige Bewohner des Gastlandes aber hatten die verkrampften Bemühungen Stöpselspanisch wohl missverstanden. Es waren so gut wie immer gebildete Leute, universitarios, die sich ob ihrer Sprache intellektuell überlegen fühlten und die deutschen Sprachidioten belächelten. Die einfachen Leute taten das nicht, zumindest nicht offen, zu groß war der Respekt vor den Ausländern. Miguel hatte anfangs weder den Willen gehabt noch das Können, immer und überall Chilenisch zu reden. Im Gegenteil, es hatte ihn angestrengt und er hatte so gut wie nichts verstanden. Wenn er es mit Englisch probiert hatte, hatten dagegen die Chilenen so gut wie nichts mitbekommen.
Ausgleichende Gerechtigkeit … in gewisser Weise. Und schon nach wenigen Tagen war klar gewesen, wie unsicher viele Chilenen wurden, wenn die Deutschen in ihrer Anwesenheit Deutsch sprachen.
„Me tomaste el pelo, no cierto?“, ihr redet schlecht über uns, nicht wahr, war der Standardspruch gewesen.
Anfangs hatte man noch ständig versucht, diesen haltlosen Verdacht zu entkräften. Nach einigen schlechten Erfahrungen dann nicht mehr so. Leute wie Grimaldo hatten dann stets mit einem lächelnden „Ja, klar!“ als Antwort umgehen müssen.
„Sí, claro“, war so ziemlich das Einzige, was Miguel anfangs locker über die Lippen bekommen hatte. Und: „Una cerveza, por fayor!“, wobei er die wichtigen „Rs“ viel zu sehr verschluckt hatte. Miguel hatte sich manchmal klein und einsam im fremden Land gefühlt und gemeint, sich wehren zu dürfen. Zumindest den Höhergestellten gegenüber.
Würden ihn diese nun aus der Meeresbiostation verbannen? Das wäre das Ende seiner Forschungen gewesen. Miguel brüllte etwas, das wie „greizgruzifigsdregsgrimaldoverreggder“ durch die Gänge hallte, und kickte die matschigen Überreste einer großen Gehäuseschnecke quer durch die geflieste Aquariumshalle. „Besser?“, fragte Paulo.
Gar nichts war besser! Seine schönen Nacktschnecken waren beseitigt worden, all die Mühe beim Sammeln umsonst, die Daten wertlos, die Aussicht auf ein besseres zweites Semester sabotiert, die Träume von der Nacktschneckenforschung zerstört. Und dazu kamen dieses achselzuckende Schweigen, diese Wurschtigkeit gegenüber dem Unrecht, vielleicht sogar etwas Schadenfreude? Tja, war halt nicht so einfach mit der Wissenschaft, sonst hätte ja jeder daherkommen und der große Forscher werden können? Der Stärkere setzte sich nun mal in der Evolution durch? Darwinismus pur!
War das so? Die würden ihn nicht kleinkriegen, so nicht! Der Weichtierforscher würde hart werden, und wie! Miguel hatte wohl laut auf Maschinengewehr-Deutsch mit sich selbst gesprochen, denn Susana zitterte mit weit aufgerissenen Augen.
„Nix gegen dich, Susana, du kannst nichts dafür. Aber das Dreckswillkürsystem kann was dafür! Na, ist doch wahr!“
Susana und er waren nur kleine Fische, Katzenfutter, Bauernopfer im großen Spiel. Katzenfutter? Miguel lächelte grimmig. Das Unrecht stank im wahrsten Sinne des Wortes zum Himmel. Momentan fühlte sich Dichato eher an wie ein Katzenklo!
Das Seemonster Cai Cai
Vor einigen Monaten hatte es schon einmal einen forscherischen Eklat in Dichato gegeben. Na ja, eher einen Zwergerlaufstand. Miguel war verbittert, wenn er daran dachte. Drei Deutsche waren bei einer Ausfahrt des kleinen schaukeligen Forschungsschiffes Cai Cai dabei, und durften im Rahmen des Benthos-Kurses per Tiefsee-Dredge einen Sack voll Schlick und Bodenlebewesen vor der Bahía de Concepción fangen. Hier fiel der Meeresboden steil zum chilenischen Tiefseegraben hin ab. In wenigen 100 Metern Tiefe findet sich eine Lebensgemeinschaft aus sogenannten Spaghetti-Bakterien. Dichte faulig stinkende Matten der hüllenbildenden Schwefelbakterien Thioploca kamen an Deck, und das gab den Mägen der meisten Studenten den Rest. Nur der Professor, die Mannschaft und zwei der drei Deutschen hielten durch. Der kleine stämmige Bootsadjutant machte lustig hüpfende Liegestütze im Rhythmus der Wellen, und Miguel machte mit. Erwischte man die Wogen im richtigen Augenblick, konnte man mühelos abheben und in die Hände klatschen. War man etwas zu spät dran, drückte es einen der Länge nach in den Matsch. Dann klatschten die anderen.
Der Professor scheuchte seine Frauen und Mannen alsbald an die Arbeit, und so wurden stundenlang der Matsch gesiebt und Krebse, Würmer und anderes Getier aussortiert. Zum ersten Mal im Leben sah Miguel einen Eichelwurm, einen Vertreter des Tierstammes der Eichelwürmer, skurril nach jenen namensgebenden Geschlechtsteilen aussehend und ein gar nicht so entfernter Verwandter des Menschen. Etwa so nah wie weniger schlüpfrig benannte Seeigel oder die ekelig schmeckenden Seescheiden. Ying und Yang am Meeresgrund. Wer dachte sich nur solche Namen aus?
Schon jetzt war das ein denkwürdiger Tag. All die Krebse und Seesterne und matschigen Geschlechtsteiltiere kamen zu Hunderten in Bottiche, und diese wurden nach dem Anlegen in Dichato in ein kleines Labor der Station gebracht, mit Blick auf den Strand. Die Sonne ging bereits unter, und der Tag hatte früh begonnen, mit Einschiffung in San Vicente um fünf Uhr morgens.
Miguel war schon frühzeitig dort angekommen und hatte versucht, in der kleinen Kajüte unter Deck zu schlafen.
Er stieg hinunter, doch nie zuvor hatte er so einen ekligen süßlichfischigen Gestank gerochen. Nicht um alles Geld oder Expeditionsglück der Welt würde er hier unten bleiben! Er legte sich also oben auf das flache Metalldach der Steuerkabine. Dort in luftiger Höhe war es kühl und er mummelte sich in seinen Schlafsack. Alles war besser, als in dieser Koje zu liegen, pfui!
Er wachte auf, als er gerade vom Dach rollte. Im letzten Moment hatte er eine Hand aus dem Schlafsack herausbekommen und hielt sich an der kleinen Dachreling fest. Hätte ihm ja auch wer sagen können, anstatt ihn fast über Bord gehen zu lassen!
Na ja, sie fuhren also schon aus der Bucht hinaus auf die offene See. Und die Cai Cai, benannt nach dem Seemonster der Mapuche, tat ihren Job in den meterhohen Wogen des Pazifiks. Sie war kiellos und über die Uni Conce hinaus berüchtigt für ihr übles Schaukeln in alle Richtungen. Bis Europa reichte der miese Ruf der Cai Cai allerdings nicht. Der profe wusste das, und deshalb tat er den deutschen Studenten gegenüber so, als wäre es eine große Ehre, mitfahren zu dürfen.
Auf See hielt sich die Ehre für Miguel in Grenzen. Die erfahrenen chilenischen Studenten aber erbrachen sich fröhlich über die Reling und lagen dann wieder in der süßsauren Kabine, wo ihnen noch übler wurde. Sie reiherten sich leer bis auf den letzten Tropfen Magensaft. Was die Erbrecher wohl verbrochen hatten, um mitfahren zu müssen? Waren die Qualen auf der Cai Cai etwa die Eintrittskarte in die Arbeitsgruppe des berühmten profes? Eine Deutsche übergab sich ebenfalls, doch hielten sich alle drei wacker auf den Beinen, im Freien. Die Koje stank schließlich so gotterbärmlich, und an Deck gab es wenigstens frische Luft. Der profe registrierte sehr wohl, wer noch arbeitsfähig war, und verteilte großzügig Aufgaben wie Schlammdurchwühlen oder Deckputzen an die Deutschen. Tätigkeiten, bei denen man trotz Geschaukels nach unten gucken musste, in den Matsch aus zerbatzten Tierleibern und nach Schwefel stinkendem Faulschlamm.
Der profe