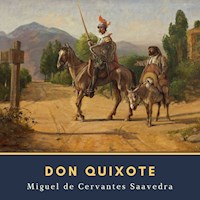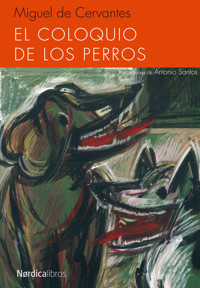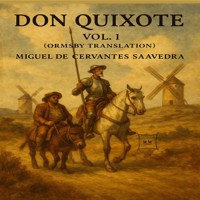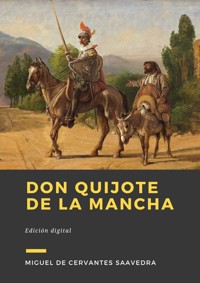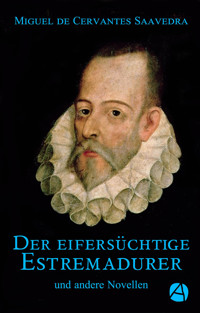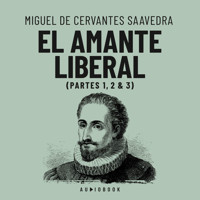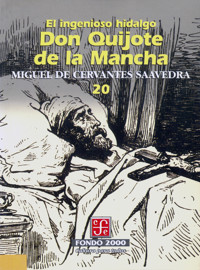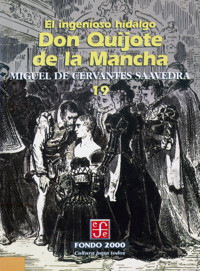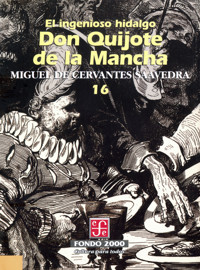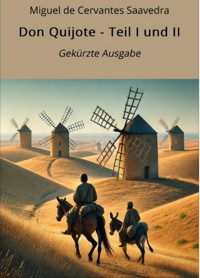
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: adlima GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch präsentiert den Klassiker der Weltliteratur in sorgfältig gekürzter Form. Der Text wurde in modernes Deutsch übertragen, wobei Stil, Ton und Ausdruck des Originals weitgehend beibehalten wurden. Für alle, die einen raschen Zugang zu diesem umfangreichen Klassiker erhalten möchten. „Don Quijote“ von Miguel de Cervantes Saavedra ist ein weltberühmter Roman über einen Mann, der glaubt, ein Ritter zu sein. Der Roman erschien erstmals 1605 (Teil 1) und 1615 (Teil 2). Die Geschichte spielt in Spanien und ist zugleich lustig, traurig und tiefgründig. Don Quijote ist ein einfacher Landedelmann namens Alonso Quijano. Er liest viele Ritterromane und verliert irgendwann den Bezug zur Wirklichkeit. Er hält sich nun selbst für einen fahrenden Ritter. Er gibt sich den Namen Don Quijote, zieht eine alte Rüstung an, wählt ein mageres Pferd namens Rosinante und bestimmt einen Bauern, Sancho Panza, zu seinem Knappen. Gemeinsam reiten sie durch das Land, um Gutes zu tun und Unrecht zu bekämpfen. Doch Don Quijote sieht die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie in den Büchern. Er hält Windmühlen für böse Riesen und Wirte für Burgherren. Sancho versucht oft, ihn zur Vernunft zu bringen, bleibt aber trotzdem treu an seiner Seite. Immer wieder geraten die beiden in merkwürdige und komische Situationen. Don Quijote wird oft verspottet, bleibt aber überzeugt von seinem Ritterideal. Der Roman zeigt auf humorvolle Weise, wie Träume mit der Realität zusammenstoßen. Er macht sich über alte Heldenromane lustig, erzählt aber auch von Freundschaft, Mut und dem Wunsch, die Welt besser zu machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Miguel de Cervantes Saavedra
Don Quijote – Teil I und II
Gekürzte Ausgabe
Dieses Buch präsentiert den Klassiker der Weltliteratur in sorgfältig gekürzter Form. Der Text wurde in modernes Deutsch übertragen, wobei Stil, Ton und Ausdruck des Originals weitgehend beibehalten wurden. Für alle, die einen raschen Zugang zu diesem umfangreichen Klassiker erhalten möchten.Inhaltsverzeichnis
Erstes Buch, 1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
Zweites Buch, 1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
Impressum
Erstes Buch, 1. Kapitel
In einem Dorf in der Mancha, dessen Name vergessen bleiben soll, lebte einst ein verarmter Junker. Er besaß einen Speer, eine alte Rüstung, einen mageren Gaul und einen Windhund. Fast sein gesamtes Einkommen ging für einfaches Essen drauf: Suppe mit etwas Rindfleisch, Fleischkuchen vom Vortag, Linsen am Freitag und ein Täubchen am Sonntag. Den Rest verwendete er für Kleidung. Er lebte mit einer Haushälterin, einer jungen Nichte und einem Knecht, der Haus und Feld versorgte.
Dieser Junker – wahrscheinlich hieß er Quijano – verbrachte seine freie Zeit fast nur mit Ritterromanen. Er war so begeistert, dass er sogar Felder verkaufte, um mehr Bücher zu kaufen. Besonders mochte er die verworrenen Texte von Feliciano de Silva, die ihn zugleich verwirrten und faszinierten. Er versuchte, die bedeutungsschweren Sätze zu entschlüsseln. Trotz seiner Kritik an übertriebenen Abenteuern in manchen Büchern, reizte ihn deren Fantasie.
Mit dem Pfarrer, einem gelehrten Mann, und dem Barbier des Ortes stritt er oft über die besten Ritter. Er selbst bevorzugte Amadís von Gallien. Der Junker las Tag und Nacht, schlief kaum noch und schließlich trocknete ihm das Gehirn aus. Er verlor den Verstand. Seine Gedanken waren erfüllt von Schlachten, Zauberern, Liebesgeschichten und fantastischen Abenteuern.
In seinem Wahn glaubte er, selbst ein fahrender Ritter werden zu müssen. Er stellte sich vor, wie er tapfer kämpfte und schließlich zum Kaiser gekrönt würde. Er war so überzeugt davon, dass er sofort handelte. Er holte die alte Rüstung hervor. Er reinigte sie und stellte fest, dass ein richtiger Helm fehlte. Kurzerhand bastelte er aus Pappe ein Visier, das er an einer Sturmhaube befestigte. Doch bei der ersten Probe zerstörte er es mit dem Schwert. Also baute er es noch einmal und verstärkte es mit Eisenstäben. So begann die Geschichte eines Mannes, der durch Bücher in den Wahnsinn geriet und sich selbst zu einem Ritter machte.
Don Quijote begutachtete seinen alten Gaul, der mehr Gebrechen hatte als ein Groschen Pfennige zählt. Trotzdem hielt er ihn für edel. Vier Tage lang zerbrach er sich den Kopf, wie er das Pferd nennen sollte. Der Name sollte zeigen, was das Tier früher gewesen war – ein einfacher Gaul – und was es nun sein würde: das edelste aller Pferde. Nach langem Überlegen entschied er sich für den Namen Rosinante.
Nun suchte er auch für sich selbst einen passenden Ritternamen. Acht Tage grübelte er, bis er sich schließlich Don Quijote nannte. Weil der berühmte Amadís seinem Namen den Herkunftsort ‚von Gallien‘ angefügt hatte, wollte auch Don Quijote seinem Namen den Ursprung beifügen – und wurde zu Don Quijote von der Mancha.
Als seine Waffen bereitstanden, der Helm verbessert war, das Pferd benannt und sein neuer Name gewählt, erkannte er, dass ihm noch etwas fehlte: eine Dame seines Herzens. Denn ohne Liebe, meinte er, sei ein Ritter wie ein Baum ohne Blätter, ein Körper ohne Seele. Er stellte sich vor, wie er einen schrecklichen Riesen im Kampf besiegt und ihn dann zu seiner Dame schickt. Der Riese solle auf Knien gestehen, vom edlen Ritter Don Quijote von der Mancha überwunden worden zu sein und sich seiner Herrin unterwerfen.
Diese Vorstellung erfüllte Don Quijote mit Stolz. Er wusste auch schon, wem er diesen Titel geben wollte: Aldonza Lorenzo, ein hübsches Bauernmädchen aus der Nachbarschaft, das er früher heimlich geliebt hatte – ohne dass sie je etwas davon ahnte. Um ihrem neuen Rang gerecht zu werden, erfand er für sie den Namen Dulcinea von Toboso. Der klang, wie er fand, edel und einzigartig.
2. Kapitel
Nachdem Don Quijote seine Ausrüstung hergerichtet und sich einen Namen gegeben hatte, wollte er endlich sein Ritterleben beginnen. Noch vor Sonnenaufgang eines heißen Julitages rüstete er sich vollständig, setzte seinen selbstgebauten Helm auf, nahm Schild und Speer zur Hand und verließ ungesehen seinen Hof durch die Hintertür. Voller Stolz und Freude zog er hinaus aufs freie Feld.
Doch kaum war er unterwegs, überfiel ihn ein beunruhigender Gedanke: Er war ja noch gar kein richtiger Ritter. Nach dem Gesetz des Rittertums durfte er so nicht kämpfen. Und seine Rüstung war auch nicht weiß, wie es für unerfahrene Ritter üblich war. Doch seine Fantasie war stärker als jede Vernunft. Er beschloss, sich vom ersten Ritter oder Herren, dem er begegnete, zum Ritter schlagen zu lassen. Die Rüstung, meinte er, könne er später noch aufhellen. Damit beruhigte er sich und ließ Rosinante den Weg bestimmen.
Während er dahinritt, sprach er mit sich selbst und stellte sich vor, wie ein weiser Zauberer einst seine Geschichte erzählen würde. Er sah sich schon als Held, dessen Taten man in Marmor meißeln oder in Chroniken schreiben würde. Er bat sogar den unbekannten Chronisten seiner Geschichte, Rosinante nicht zu vergessen.
Dann begann er, seiner geliebten Dulcinea zu huldigen. Er redete zu ihr, als wäre sie eine edle Prinzessin. Er flehte sie an, seiner Liebe zu gedenken. In dieser Art sprach er weiter, als würde er tatsächlich in einem Ritterroman leben. Die Hitze des Tages brannte, aber er ritt unbeirrt weiter – den ganzen Tag über, ohne auf ein Abenteuer zu stoßen. Das enttäuschte ihn sehr, denn er wollte seine Tapferkeit endlich beweisen.
Am Abend sah er endlich eine Schenke am Wegesrand. Für ihn erschien sie wie eine prächtige Burg. Er stellte sich sogar vor, ein Zwerg müsse gleich seine Ankunft verkünden. Tatsächlich stieß ein Schweinehirt gerade in sein Horn – was Don Quijote als das erhoffte Zeichen deutete.
Er näherte sich der Schenke und sah zwei Frauen, die ihm wie edle Burgfräulein erschienen. In Wahrheit waren es einfache Dirnen auf dem Weg nach Sevilla. Als sie den seltsamen Mann sahen, erschraken sie und wollten fliehen. Doch Don Quijote hob langsam sein Visier, zeigte sein staubiges Gesicht und sprach sie sanft und würdevoll an. Sie sollten keine Angst haben – einem Ritter sei es untersagt, Damen Leid zuzufügen, schon gar nicht so edlen Jungfrauen wie ihnen.
Die beiden Frauen sahen Don Quijote neugierig an. Sie versuchten, durch das Visier einen Blick auf sein Gesicht zu erhaschen. Als sie jedoch hörten, dass er sie ‚Jungfrauen‘ nannte – ein Begriff, der so gar nicht zu ihrem Gewerbe passte –, konnten sie sich das Lachen nicht verkneifen. Don Quijote war verärgert und mahnte sie zur Höflichkeit. Dennoch betonte er, dass er ihnen zu Diensten sei und sie sich nicht gekränkt fühlen sollten.
Die Mischung aus seiner seltsamen Sprache, der alten Rüstung und seinem ernsten Auftreten machte die Sache für die Frauen noch komischer und sie lachten weiter. In diesem Moment kam der Wirt hinzu, ein beleibter und friedfertiger Mann. Als er Don Quijote sah – ausgerüstet mit Speer, Schild, Halbrüstung und einem Papp-Helm, musste auch er fast lachen. Doch aus Vorsicht entschied er sich für Höflichkeit. Er bot dem Ritter eine Unterkunft an, wenngleich ohne Bett.
Don Quijote hielt den Wirt für den Burgherrn der ‚Festung‘ und nannte ihn ‚Kastellan‘. Stolz sprach er ein paar gereimte Zeilen über das ritterliche Leben. Der Wirt erkannte zwar die Verwirrung, ging aber darauf ein.
Mit Mühe stieg Don Quijote vom Pferd. Er bat um besondere Pflege für Rosinante. Der Wirt brachte das Tier in den Stall. Währenddessen versuchten die beiden Frauen, Don Quijote aus seiner Rüstung zu helfen. Sie schafften es, Brust- und Schulterteil zu lösen, doch der Helm war mit grünen Schnüren festgebunden. Er weigerte sich, diese durchzuschneiden, also behielt er den Helm auf.
Da er glaubte, die Frauen seien edle Burgdamen, bedankte er sich in höfischer Sprache. Er stellte sich als Don Quijote von der Mancha vor und kündigte an, dass seine künftigen Taten ihren Dienst verdienen würden. Die Frauen waren sprachlos und fragten nur, ob er etwas essen wolle. Er bejahte das gern.
Da es Freitag war, gab es nur etwas Stockfisch und ein Stück dunkles Brot. Don Quijote erklärte, viele kleine Fische seien auch recht, wenn es keine große Forelle gebe.
Man setzte ihn draußen vor die Schenke. Da er den Helm nicht abnehmen wollte, konnte er weder selbst essen noch trinken. Eine der Frauen reichte ihm das Essen. Zum Trinken schnitt der Wirt ein Schilfrohr zurecht und hielt es ihm an den Mund.
Als ein Schweinehirt vor der Schenke auf seiner Pfeife spielte, war Don Quijote überzeugt, in einer Burg zu sein – mit Tafelmusik, Forelle statt Stockfisch, edlen Damen und einem Burgherrn. Zufrieden hielt er seine Ausfahrt für gelungen. Doch es quälte ihn, noch kein Ritter zu sein, denn ohne Ritterschlag durfte er keine Abenteuer bestehen.
3. Kapitel
Don Quijote beendete hastig das dürftige Mahl, rief den Wirt in den Stall, kniete vor ihm nieder und sprach: „Ich erhebe mich erst, tapferer Ritter, wenn Ihr mir eine Gunst gewährt: Schlagt mich morgen zum Ritter! Diese Nacht halte ich hier die Waffenwacht, morgen ziehe ich aus, um Abenteuer zu suchen.“
Der Wirt beschloss, das Schauspiel auszukosten. „Ihr begehrt ganz recht“, sagte er ernsthaft. „Auch ich zog einst aus, von Málaga bis Toledo und bin schließlich hierher zurückgekehrt, um von meinem Geld zu leben. Meine Burg steht allen fahrenden Rittern offen, damit sie ihre Habe mit mir teilen.“
Er erklärte weiter, die Kapelle sei zwar abgerissen, doch könne Don Quijote die Wacht ebenso gut im Hof halten; am nächsten Morgen wolle er die formelle Zeremonie nachholen, „so echt, dass kein Ritter echter sein könnte“. Dann fragte er: „Führt Ihr Geld bei Euch?“
„Keinen Pfennig“, gestand Don Quijote. „In den Ritterbüchern zahlt niemand.“
Der Wirt belehrte ihn: „Darin irrt Ihr. Die Autoren hielten es nur für selbstverständlich, Geld, frische Hemden und Salben zu erwähnen. Versagt der Zauberer mit seiner Wunderflasche, braucht der Knappe den Beutel. Zieht nie ohne Börse und Verbandszeug aus – ich befehle es Euch als künftiges Patenkind im Rittertum.“
Der Ritter versprach, sich daran zu halten. Man legte seine Rüstung auf einen Trog am Brunnen; er nahm Schild und Speer, schritt würdig davor auf und ab, lehnte sich dann darauf und ließ die Augen nicht von den Waffen. Unterdessen erzählte der Wirt in der Schenke, welch närrisches Schauspiel sich draußen biete und Gäste wie Stallburschen kamen, um den sonderbaren Mann zu begaffen.
Die Nacht brach völlig an; der Mond leuchtete so hell, dass alle Bewegungen des angehenden Ritters klar zu erkennen waren.
Plötzlich fragte ihn ein neugieriger Maultiertreiber, weshalb er die Rüstung bewache. „Damit keine Zauberhand sie raubt, ehe ich morgen gekrönt werde“, erwiderte Don Quijote. Der Mann lachte, rückte aber bald näher, packte die Rüstung und warf sie aus Spaß einige Schritte weit. Don Quijote brüllte, stieß ihn mit dem Speer zu Boden und rief: „Schändlicher Bösewicht, wage es nicht, das heilige Eisen anzurühren!“ Eine Keilerei entstand; zwei weitere Burschen eilten herbei, warfen Steine nach dem Ritter, bis der Wirt einschritt und den Spaß beendete.
Doch Don Quijote blieb unerschütterlich. Er legte die Rüstung wieder auf den Trog, lief blutend weiter Wache, während die Zuschauer hinter den Türen kicherten. Nur der Wirt murmelte: „Der Mann ist vollkommen verrückt – und morgen schlage ich ihn zum Ritter, damit er endlich zahlt oder verschwindet.“
Gegen Morgen war Don Quijote von Erschöpfung gezeichnet. Trotzdem rief er den Wirt herbei: „Die Nacht ist um, edler Kastellan. Erfüllt Eure Verheißung.“ Der Wirt ließ zwei Dirnen als Burgdamen erscheinen, befahl Don Quijote, vor ihm zu knien und sprach mit lauter Stimme: „Im Namen der hohen Ritterschaft schlage ich Euch! Behütet Witwen, beschützt Jungfrauen, helft den Bedrängten!“ Er versetzte ihm mit der flachen Schwertseite zwei leichte Schläge auf Nacken und Schulter und erklärte schließlich: „Steht auf, Ritter und zahlt Eure Zeche!“
Don Quijote umarmte ihn voller Dankbarkeit: „Nie werde ich Eurer Gnade vergessen. Doch zahlen kann ich nicht – der Orden verbietet es.“ Der Wirt biss sich auf die Lippen. Da versprach der Ritter hoch und heilig, nach bestandenen Abenteuern reich zurückzukehren, um alle Schulden zu begleichen. Darauf bestieg er Rosinante, grüßte ernst und ritt davon, während der Wirt kopfschüttelnd hinterherrief: „Geh mit Gott – und bring Bargeld!“
4. Kapitel
In der Morgendämmerung verließ Don Quijote die Schenke. Er erinnerte sich an die Ratschläge des Wirts, sich mit Geld, Wäsche und einem Knappen zu versorgen. Also beschloss er, heimzukehren und einen armen Bauern aus seinem Dorf zum Knappen zu machen.
Auf dem Weg hörte er Schreie aus einem nahegelegenen Gehölz. Er dankte dem Himmel, dass sich ihm schon so bald eine Gelegenheit bot, einem Unrecht abzuhelfen. Als er näherkam, sah er eine Stute und einen etwa fünfzehnjährigen Jungen an Bäume gebunden. Ein Bauer schlug den Jungen mit einem Gurt und rief: „Zunge still, Augen wach!“ Der Junge schrie: „Ich tu’s nie wieder, Herr, ich schwöre es!“
Don Quijote rief entrüstet: „Feiger Ritter! Schlagt keinen Wehrlosen! Nehmt euren Speer und ich werde euch zeigen, wie ein echter Ritter kämpft!“ Der Bauer erschrak, als Don Quijote auf ihn zueilte und verteidigte sich: „Dieser Junge hütet meine Schafe, aber er ist nachlässig. Ich bestrafe ihn nicht aus Geiz, sondern wegen seiner Fehler.“
„Lüge nicht, du Nichtsnutz?“, rief Don Quijote. „Zahl ihm sofort, was du ihm schuldest!“
Der Bauer ließ den Jungen los. Auf Don Quijotes Nachfrage sagte dieser: „Er schuldet mir neun Monate Lohn zu je sieben Reales.“ Don Quijote rechnete und forderte Zahlung. Der Bauer wand sich: „Ich habe kein Geld dabei, aber Andrés kann mitkommen und es zu Hause bekommen.“
„Ich? Niemals!“, rief der Junge. „Sobald wir allein sind, schlägt er mich tot!“
„Er wird es nicht wagen“, sagte Don Quijote. „Wenn er bei seinem Ritterorden schwört, gehorcht er. Und wer das nicht tut, wird meinen Zorn spüren!“
Der Junge entgegnete: „Mein Herr ist kein Ritter. Er heißt Juan Haldudo von Quintanar.“
„Auch ein Haldudo kann ein ehrenhafter Ritter sein“, erwiderte Don Quijote.
„Die Zinsen erlasse ich Euch“, sagte Don Quijote. „Zahlt ihm seinen Lohn. Und hütet euch, den Schwur zu brechen!“
Damit trieb er Rosinante an und verschwand rasch im Wald.
Der Bauer schaute ihm nach und sagte zu Andrés: „Komm her, mein Sohn. Ich will dir zahlen, wie der edle Ritter es befohlen hat.“
„Da schwöre ich drauf“, sagte Andrés. „Er wird zurückkommen, wenn Ihr mich nicht bezahlt und Euch bestrafen.“
„Auch ich schwöre“, erwiderte der Bauer, „aber aus Liebe zu ihm will ich die Schuld vergrößern.“
Dann band er Andrés wieder an den Baum und prügelte ihn so lange, bis dieser fast bewusstlos war. „Ruf jetzt deinen Helfer!“, höhnte er. „Ich könnte dir noch lebendig die Haut abziehen.“
Schließlich ließ er ihn los. Andrés ging weinend fort und schwor, Don Quijote aufzusuchen und ihm alles zu berichten. Der Bauer aber lachte nur.
Don Quijote jedoch war stolz auf seinen vermeintlichen Sieg. „O Dulcinea von Toboso“, murmelte er, „du kannst dich glücklich schätzen, einen so tapferen Ritter zu haben.“
Bald kam er an eine Wegkreuzung. Wie in seinen Ritterbüchern hielt er inne und überlegte, welchen Weg er einschlagen solle. Dann ließ er Rosinante entscheiden – dieser trabte heimwärts.
Nach zwei Meilen traf Don Quijote auf eine Gruppe Kaufleute mit Dienern und Maultieren. Er hielt sie für fahrende Ritter und stellte sich ihnen in den Weg. Mit erhobenem Speer rief er stolz: „Niemand rührt sich, wenn er nicht bekennt, dass es keine schönere Frau gibt als die unvergleichliche Dulcinea von Toboso!“
Die Kaufleute blieben verwundert stehen. Einer sprach: „Zeigt uns diese Dame. Wenn sie so schön ist, wie Ihr sagt, werden wir es gern bekennen – ganz ohne Zwang.“
„Wenn ich sie euch zeigte“, entgegnete Don Quijote, „wäre euer Bekenntnis wertlos. Es kommt darauf an, dass ihr ohne Beweise glaubt und beschwört, dass Dulcinea von Toboso die Schönste der Welt ist. Leugnet ihr dies, so seid ihr meine Feinde. Ich bin bereit, euch entgegenzutreten.“
„Herr Ritter“, sagte einer der Kaufleute, „zeigt uns wenigstens ein kleines Bild dieser Dame. Dann können wir das Urteil selbst fällen. Und wenn sie auch schielte und Schwefel aus den Augen träte – wir würden zu ihren Gunsten sprechen, nur um Euch zu gefallen.“
„Nicht Schwefel, sondern Ambra und Moschus verströmt sie“, rief Don Quijote zornig. „Für eure Lästerung werdet ihr büßen!“
Mit angelegtem Speer stürmte er los, doch Rosinante stolperte und Don Quijote fiel samt Rüstung zu Boden. Vergeblich versuchte er aufzustehen und rief: „Flieht nicht, feiges Volk! Nicht ich, mein Pferd ist schuld!“
Ein Maultierjunge nahm ein Speerstück und prügelte auf Don Quijote ein. Die Herren riefen ihn zurück, doch er schlug weiter, bis seine Wut verraucht war.
Die Kaufleute zogen davon, plaudernd über das seltsame Abenteuer. Don Quijote, schwer verletzt, konnte sich nicht mehr erheben, doch er sah das Ganze als ritterliches Unglück an – verursacht allein durch Rosinante.
5. Kapitel
Da er sich nicht rühren konnte, erinnerte sich Don Quijote an eine Geschichte aus seinen Ritterbüchern: die von Baldovinos, den der Markgraf von Mantua verwundet im Wald zurückließ. Wie dieser wälzte er sich nun mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden.
Gerade in diesem Moment kam ein Bauer aus seinem Dorf vorbei, der eine Ladung Weizen zur Mühle brachte. Als er den Mann dort am Boden liegen sah, fragte er ihn: „Wer seid Ihr und was tut Euch so weh, dass Ihr so klagt?“
Don Quijote aber hielt ihn für den Markgrafen von Mantua und fuhr in seiner Romanze fort, ohne auf die Frage zu antworten.
Der Bauer, verwundert über das wirre Gerede, nahm ihm das Visier ab, reinigte sein staubiges Gesicht und erkannte ihn: „Herr Quijano! Wer hat Euch so zugerichtet?“ Doch Don Quijote sprach weiter wie ein verwundeter Ritter. Der Bauer untersuchte ihn und fand keine Wunden, hob ihn mit Mühe auf seinen Esel, sammelte die Rüstung ein und führte Rosinante am Zügel, während er über die merkwürdigen Worte seines Nachbarn nachdachte.
Don Quijote stöhnte vor Schmerzen und konnte sich kaum im Sattel halten. Als der Bauer ihn erneut fragte, was ihm fehle, antwortete er: „Es ist Dulcinea von Toboso, für die ich alle Ruhmestaten vollbracht habe und vollbringen werde.“
Sie sprachen weiter, bis sie gegen Abend das Dorf erreichten. Dort war ein großer Aufruhr: Der Pfarrer und der Barbier waren bei der Haushälterin, die rief: „Sechs Tage ist mein Herr fort! Die Ritterbücher haben ihn zum Narren gemacht!“
Die Nichte fügte hinzu: „Ich hätte es Euch sagen sollen – diese Bücher gehören verbrannt!“
Der Pfarrer sagte: „Das sage ich auch. Morgen werden wir die Bücher richten und verbrennen.“
Als sie Don Quijote verwundet auf dem Esel liegend sahen, brachten sie ihn ins Bett. Sie fanden keine Wunden, doch Don Quijote bestand darauf, er habe gegen zehn Riesen gekämpft und sei gestürzt. Der Pfarrer rief aus: „Riesen? Bei Gott, morgen verbrenne ich diese Bücher!“
Man stellte ihm viele Fragen, doch er wollte nur essen und schlafen. Der Pfarrer fragte den Bauern nach allem und dieser berichtete von dem Unsinn, den Don Quijote unterwegs geredet hatte. So wuchs im Pfarrer der Plan, am nächsten Tag mit dem Barbier das Haus des Ritters aufzusuchen.
6. Kapitel
Der Pfarrer ließ sich von der Nichte die Schlüssel zum Bücherzimmer geben. Gemeinsam mit dem Barbier und der Haushälterin betrat er den Raum, in dem sich über 100 Bücher befanden. Die Haushälterin holte Weihwasser und bat, das Zimmer zu besprengen, um sich vor Zauberei zu schützen.
Der Pfarrer schmunzelte über ihren Eifer, wollte aber nicht alle Bücher blindlings verbrennen. Er bat den Barbier, ihm die Bände einzeln zu reichen, um die Titel zu prüfen. Doch die Nichte widersprach heftig: „Keines soll verschont bleiben. Werft sie alle in den Hof und macht ein Feuer!“
Die Haushälterin stimmte ihr zu. Der Pfarrer aber begann mit einer Prüfung: Das erste Buch war der ‚Amadís von Gallien‘. „Dies war das erste Ritterbuch Spaniens und Ursprung vieler anderer. Ich denke, es sollte verbrannt werden.“
„Nein“, entgegnete der Barbier, „es gilt als das beste seiner Art. Wir sollten ihm Gnade gewähren.“
Der Pfarrer stimmte zu. „Gut, Amadís bleibt. Doch was ist mit dem nächsten?“
Das sind die Geschichten von Esplandian, seinem Sohn“, sagte der Barbier.
„Dann raus damit! Der Sohn kann nicht vom Ruhm des Vaters leben.“
Die Haushälterin warf das Buch begeistert aus dem Fenster. Weitere Bände der Amadís-Reihe folgten ihm.
„Und dieser?“, fragte der Pfarrer.
„Don Olivante de Laura,“ antwortete der Barbier.
„Auch er ist voller Lügen und Unsinn – ab in den Hof damit!“
Mit Vergnügen setzten sie die Bücherverbrennung fort. Viele Bücher landeten im Feuer, nur einige wenige wurden verschont.
7. Kapitel
Don Quijote begann laut zu rufen: „Hierher, tapfere Ritter! Die Hofritter gewinnen das Turnier!“ Wegen dieses Lärms wurde die Prüfung der übrigen Bücher abgebrochen.
Als sie zu Don Quijote kamen, war er aus dem Bett gesprungen, schwang die Arme wie im Kampf und rief weiter. Sie brachten ihn zurück ins Bett. „Es ist eine Schande“, sagte er zum Pfarrer, „dass wir das Turnier verlieren!“
Der Pfarrer antwortete: „Macht Euch keine Sorgen. Morgen wird es besser. Jetzt müsst Ihr Euch erholen.“
Don Quijote klagte, Roldán habe ihn mit einem Ast geschlagen. Doch bald verlangte er nur noch Essen. Nachdem er gegessen hatte, schlief er ein – und die anderen wunderten sich erneut über seinen Wahnsinn.
In der Nacht verbrannte die Haushälterin alle übrigen Bücher, auch manche wertvolle. Um Don Quijote zu heilen, mauerten der Pfarrer und der Barbier das Bücherzimmer zu.
Zwei Tage später suchte Don Quijote das Zimmer. Er fand es nicht, betastete die Wand und fragte die Haushälterin, wo es geblieben sei.
Sie antwortete: „Ein Teufel hat es geholt.“ Die Nichte ergänzte: „Ein Zauberer auf einer Schlange kam in der Nacht, ging ins Zimmer und verschwand mit allem. Nur Rauch blieb zurück.“
Don Quijote sagte: „Der Zauberer ist mein Feind. Er weiß, dass ich in einem Zweikampf jemanden besiegen werde, den er schützt und versucht deshalb, mir zu schaden.“
„Aber wer zwingt Euch überhaupt zu diesen Kämpfen?“, fragte die Nichte. „Ist es nicht besser, ruhig daheim zu leben, statt in der Welt umherzuziehen und dabei alles zu verlieren?“
„O Nichte mein“, sagte Don Quijote, „wie wenig verstehst du von diesen Dingen!“
Vierzehn Tage blieb er ruhig zu Hause. In dieser Zeit sprach er oft mit dem Pfarrer und dem Barbier über die Notwendigkeit der fahrenden Ritter. Der Pfarrer widersprach ihm manchmal, stimmte aber auch zu, um ihn nicht zu reizen.
Don Quijote überredete schließlich seinen Nachbarn Sancho Pansa, ein gutmütiger, aber einfältiger Bauer, mit ihm als Schildknappe zu reisen. Er versprach ihm, ihn zum Statthalter einer Insel zu machen.
Sancho war überzeugt und verließ Weib und Kinder. Don Quijote verkaufte einen Acker, verpfändete einen anderen und verschleuderte sein Geld für Rüstung und Ausrüstung. Sancho erklärte, er nehme auch seinen Esel mit, da er nicht ans Laufen gewöhnt sei. Don Quijote war zwar unsicher, ob ein Schildknappe auf einem Esel reiten dürfe, stimmte aber zu. Er hoffte, bald ein Pferd für ihn zu erbeuten.
In einer Nacht verließen sie heimlich das Dorf. Sancho saß wie ein Patriarch auf seinem Esel, mit Sack und Wasserflasche und träumte schon vom Regieren.
Sancho sagte: „Herr, vergesst nicht die Insel, die Ihr mir versprochen habt.“
Don Quijote antwortete: „Die alten Ritter machten ihre Knappen zu Fürsten und Königen. Auch ich will diesen Brauch ehren.“
„Dann wird meine Frau Königin und meine Kinder Prinzen?“ fragte Sancho.
„Wer zweifelt daran?“ erwiderte Don Quijote.
„Ich glaube nicht, dass meine Frau Königin werden kann“, sagte Sancho. „Eine Gräfin vielleicht, aber selbst dafür braucht sie Hilfe von oben.“
Don Quijote entgegnete: „Überlass das dem Himmel, Sancho. Du sollst dich nicht mit weniger als einem Landvogt zufriedengeben.“
„Keine Sorge, Herr“, antwortete Sancho, „Ihr werdet mir schon geben, was zu mir passt.“
8. Kapitel
Als Don Quijote dreißig oder vierzig Windmühlen in der Ebene erblickte, glaubte er, Riesen vor sich zu sehen. „Jetzt leitet das Glück unsere Angelegenheiten besser als je“, rief er seinem Knappen zu. „Dort drüben siehst du Riesen mit langen Armen. Ich will gegen sie kämpfen und sie alle besiegen. Das wird ein gerechter Kampf sein.“
Sancho Pansa versuchte, ihn zur Vernunft zu bringen. „Herr, das sind keine Riesen, das sind Windmühlen.“
Doch Don Quijote bestand auf seiner Sicht. Er sagte, Sancho habe keine Ahnung von Abenteuern und solle sich zum Beten zurückziehen. Dann trieb er Rosinante an, legte den Speer ein und rief: „Flieht nicht, feige Ungeheuer, ein Ritter greift euch an!“
Ein Windstoß erfasste einen der Flügel. Als Don Quijote ihn mit der Lanze traf, zersplitterte sie und Rosinante samt Reiter wurde zu Boden geschleudert. Sancho eilte herbei und fand seinen Herrn reglos am Boden liegend. „Habe ich es Euch nicht gesagt, dass es Windmühlen sind?“, sprach er.
„Schweig, Sancho“, erwiderte Don Quijote. „Ein böser Zauberer hat die Riesen in Windmühlen verwandelt, um mir den Ruhm zu rauben.“
Sancho half ihm wieder auf. Gemeinsam ritten sie weiter. Sancho bemerkte, dass sein Herr schief im Sattel hing. Don Quijote bestätigte, vom Sturz gezeichnet zu sein, aber ein Ritter dürfe keine Schmerzen beklagen.
Sancho meinte, er werde sich diesen Brauch nicht zu eigen machen. Bei ihm werde jeder Schmerz lautstark beklagt – sofern das für einen Schildknappen erlaubt sei.
Don Quijote lachte über die Einfalt seines Knappen und erklärte ihm, er dürfe ruhig wehklagen, denn das Rittertum verbiete es einem Knappen nicht. Sancho erinnerte ihn an die Essenszeit. Don Quijote sagte, er selbst habe keinen Hunger, Sancho aber solle essen, wenn es ihm beliebe. Sancho tat dies gern und zog essend und trinkend hinter seinem Herrn her.
Sie verbrachten die Nacht unter Bäumen. Don Quijote schlief nicht, sondern dachte an seine Dulcinea. Sancho dagegen schlief tief und fest und wenn ihn nicht Don Quijote geweckt hätte, wäre es auch den Vögeln und der Morgensonne nicht gelungen.
Am nächsten Tag ritten sie weiter. Don Quijote wies Sancho an, ihn im Kampf nur zu unterstützen, wenn einfache Leute angreifen, nicht aber, wenn es Ritter seien. Sancho versprach, sich daran zu halten, solange es nicht um seine eigene Verteidigung ging.
Während sie sprachen, näherten sich zwei Benediktinermönche und eine Kutsche mit einer Dame aus Biscaya. Don Quijote vermutete, dass es sich um Zauberer handle, die eine Prinzessin entführt hätten. Sancho warnte ihn, doch Don Quijote glaubte fest an seine Theorie. Er stellte sich in den Weg und rief: „Teuflisches Volk, lasst auf der Stelle die Prinzessinnen frei, oder sterbt durch meine Hand!“
Die Mönche hielten an, erschraken über seine Erscheinung und sagten: „Herr Ritter, wir sind nur zwei Geistliche auf der Reise. Von Prinzessinnen wissen wir nichts.“
„Mit guten Worten kommt man mir nicht an; ich kenne euch schon, verlogenes Gesindel!“ rief Don Quijote, trieb Rosinante an und stürmte mit gesenktem Speer auf einen der Mönche los. Der ließ sich erschrocken vom Maultier fallen, sonst wäre er wohl übel zugerichtet worden. Sein Gefährte floh über das Feld.
Sancho stieg vom Esel, eilte zum gestürzten Mönch und begann, ihm die Kleider abzunehmen. „Das ist die Beute meines Herrn“, erklärte er zwei Maultierjungen, die herbeikamen. Die verstanden nichts von Rittergesetzen, warfen Sancho zu Boden und verprügelten ihn, bis er ohne Bewusstsein liegenblieb.
Der erschrockene Mönch bestieg sein Tier und floh. Inzwischen hatte Don Quijote die Kutsche erreicht. „Edle Dame“, sagte er, „eure Entführer sind überwältigt. Ich bin Don Quijote von der Mancha, Ritter der Dulcinea von Toboso. Zum Dank begehr ich nur, dass Ihr nach Toboso reist und ihr berichtet, was ich für Euch getan habe.“
Ein Biskayer, der zur Eskorte der Dame gehörte, mischte sich ein: „Fort, Ritter, oder ich bringe dich um!“
Don Quijote antwortete ruhig: „Wenn du Ritter wärst, hättest du deine Strafe schon empfangen.“
Der Biskayer zog sein Schwert. Don Quijote zog ebenfalls sein Schwert. Der Biskayer griff zu einem Kissen aus der Kutsche als Schild und beide gingen aufeinander los, als wären sie Todfeinde. Die Umstehenden versuchten vergeblich, sie zu trennen.
Die Dame wich zurück und betete, dass ihr Diener verschont bleibe. Der Biskayer schlug Don Quijote einen schweren Hieb auf die Schulter. Dieser rief: „O Dulcinea, stehe mir bei!“ und stürmte erneut auf den Gegner ein.
Gerade in diesem entscheidenden Moment bricht die Erzählung ab. Der Verfasser berichtet, dass keine weiteren Aufzeichnungen über Don Quijotes Heldentaten auffindbar seien.
9. Kapitel
An dieser spannenden Stelle brach die Erzählung ab, ohne Hinweis auf eine Fortsetzung. Das erfüllte mich mit großem Unmut und ich bedauerte, dass von einem so ehrenhaften Ritter wie Don Quijote keine vollständige Geschichte vorliegen sollte. Es war kaum zu glauben, dass er, wie viele andere fahrende Ritter, keinen Chronisten gefunden hatte, der seine Taten festhielt.
Dies verstärkte mein Verlangen, die ganze Geschichte dieses Ritters zu finden. Eines Tages stieß ich zufällig auf einen Jungen, der alte Hefte verkaufte. Neugierig nahm ich eines davon zur Hand und erkannte, dass es in arabischer Schrift verfasst war. Da ich zwar die Schrift, nicht aber die Sprache beherrschte, suchte ich nach einem Übersetzer und fand bald einen Morisken.
Als dieser zu lesen begann, lachte er über eine Randnotiz: Dulcinea von Toboso sei die beste Schweine-Pöklerin in der Mancha gewesen. Beim Klang ihres Namens wurde ich hellhörig. Der Titel der Handschrift lautete: „Geschichte des Junkers Don Quijote von der Mancha“, verfasst von einem gewissen Sidi Hamét Benengelí.
Ich kaufte dem Jungen alle Hefte für einen halben Real ab und ließ sie vom Morisken vollständig ins Kastilische übersetzen. Um den Fund nicht zu verlieren, nahm ich ihn zu mir nach Hause, wo er in wenigen Wochen die ganze Geschichte übertrug.
Im ersten Heft war Don Quijotes Kampf mit dem Biskayer bildlich dargestellt, genau wie in der Erzählung beschrieben: mit gezückten Schwertern, Don Quijote mit Schild, der Biskayer mit Kissen. Auch Sancho Pansa war mit seinem Esel zu sehen.
Nur die arabische Herkunft des Verfassers konnte Zweifel an der Wahrhaftigkeit der Erzählung aufkommen lassen, denn Araber galten als unzuverlässig. Doch da er eher zu wenig als zu viel lobte, erschien er glaubwürdig.
Der Text sagte nun folgendes: Der Biskayer schlug zuerst zu, mit solcher Gewalt, dass der Hieb Don Quijote getötet hätte – wenn das Schwert sich nicht im letzten Moment seitlich gewendet hätte. Zwar zerschlug es Helm und Schulterstück und riss ihm ein halbes Ohr ab, doch der Schlag war nicht tödlich.
Rasend vor Zorn holte Don Quijote zum Gegenschlag aus und traf den Biskayer so heftig auf Kissen und Kopf, dass dieser blutüberströmt zusammensackte. Der Mann fiel zu Boden. Don Quijote trat hinzu, hielt ihm das Schwert an die Kehle und verlangte seine Übergabe.
Der Biskayer war zu benommen zum Sprechen. Doch die Damen aus der Kutsche flehten Don Quijote um Gnade für ihren Begleiter an.
Don Quijote stimmte zu – unter der Bedingung, dass der Ritter nach Toboso reise, um sich seiner Herrin Dulcinea zu stellen. Die Damen versprachen es und so gewährte Don Quijote seinem besiegten Feind das Leben.
10. Kapitel
Sancho hatte dem Kampf seines Herrn aufmerksam zugeschaut und innerlich zu Gott gebetet, Don Quijote möge siegen und eine Insel gewinnen, die er ihm versprochen hatte. Als der Streit beendet war und Don Quijote wieder aufsitzen wollte, kniete sich Sancho vor ihn, fasste seine Hand, küsste sie und sprach: „Eure Gnaden, verleiht mir die Regierung der Insel, die Ihr in diesem schweren Kampf gewonnen habt. So groß sie auch sei, ich traue mir zu, sie zu regieren wie jeder andere Statthalter.“
Don Quijote antwortete: „Merke dir, Freund Sancho, dieses Abenteuer bringt keine Insel, sondern nur zerschlagene Schädel. Habe Geduld – bald kommt eins, wo ich dich sogar zu Höherem machen kann.“
Sancho dankte ihm, küsste nochmals die Hand, half ihm aufzusitzen und folgte auf seinem Esel, während Don Quijote in ein Gehölz ritt. Rosinante war schneller als Sanchos Esel und so rief Sancho: „Wartet, Señor, ich komme nicht nach!“
Don Quijote hielt an, bis Sancho aufschloss. Der keuchte und sagte: „Mich dünkt, wir sollten in eine Kirche flüchten. Wenn die Bruderschaft erfährt, was geschehen ist, nehmen sie uns fest.“
„Schweig“, entgegnete Don Quijote. „Wann hat man je gehört, dass ein fahrender Ritter vor Gericht kam?“
Dann fragte er: „Hast du je einen kühneren Ritter gesehen?“
Sancho meinte: „Ich habe nie jemand kühneren gesehen. Doch ich bitte Euch, verbindet das Ohr – es blutet stark.“
Don Quijote seufzte: „Hätte ich doch den Balsam des Fierabrás bei mir! Mit zwei Tropfen wäre ich gesund.“
„Gebt mir lieber das Rezept als eine Insel!“ rief Sancho.
„Du bekommst beides“, sagte Don Quijote. „Doch jetzt verbinden wir das Ohr. Es schmerzt mich mehr, als mir lieb ist.“
Sancho holte die Salbe hervor. Doch als Don Quijote seinen zertrümmerten Helm sah, verlor er fast den Verstand. Er legte die Hand auf den Schwertgriff, hob die Augen gen Himmel und rief: „Ich schwöre beim Schöpfer und den heiligen Evangelien, wie der Markgraf von Mantua zu leben, bis ich Rache genommen habe. Ich will weder am Tisch essen noch mit meinem Weibe verkehren, bis ich einen ebenso guten Helm wie diesen einem Ritter mit Gewalt abgenommen habe.“
Sancho schüttelte den Kopf: „Solche Schwüre sind doch Unsinn. Was, wenn uns tagelang keiner mit Helm begegnet? Wollen wir dann all die Kasteiungen des alten Markgrafen durchstehen? Auf diesen Wegen laufen nur Maultiertreiber herum, keine Ritter.“
„Du irrst“, sagte Don Quijote.
„Wohlan denn“, sprach Sancho. „Wolle Gott, dass bald eine Insel kommt und dann kann ich meinetwegen sterben.“
„Wenn nicht eine Insel, so ein Königreich!“, lachte Don Quijote. „Aber sieh nach, ob du etwas zu essen hast.“
Sancho reichte Brot, Käse und eine Zwiebel: „Nicht gerade eine Rittermahlzeit, Señor.“
„Ein Ritter ehrt es, wenn er sich mit Wenigem begnügt“, entgegnete Don Quijote. „Deine Kost ist vollkommen ritterlich.“
„Ich verstehe nichts davon“, sagte Sancho. „Ich sorge künftig für Euch für Trockenes, für mich für Fleisch.“
„Nur zu“, sagte Don Quijote. „Aber bedenke: Die Ritter kannten auch Kräuter und auch ich kenne sie.“
Nachdem sie gegessen hatten, ritten sie weiter. Doch die Nacht kam, ehe sie ein Dorf erreichten. Als sie Hütten von Ziegenhirten sahen, beschlossen sie, dort zu bleiben. Sancho war enttäuscht. Don Quijote aber war zufrieden.
11. Kapitel
Die Ziegenhirten empfingen Don Quijote und Sancho freundlich. Sancho versorgte die Tiere und folgte dann dem verlockenden Geruch, der von einem Kessel mit kochendem Ziegenfleisch ausging. Doch noch ehe er kosten konnte, deckten die Hirten das Mahl auf und baten die Gäste, Platz zu nehmen. Don Quijote erhielt einen umgestülpten Kübel und Sancho schenkte ihm aus einem Hornbecher ein.
Don Quijote sah seinen Knappen stehen und sagte: „Setz dich, Sancho und iss mit mir. Die Ritterschaft, wie die Liebe, macht alle gleich.“
Sancho antwortete: „Ich danke Euch, Señor, doch ich esse lieber allein und ohne Umstände. Ich ziehe Brot und Zwiebel in der Ecke dem Truthahn bei Hofe vor, wenn ich dabei stillsitzen, nicht niesen und nicht husten darf. Eure Ehre nehme ich an, aber ich verzichte auf sie.“
Don Quijote erwiderte: „Und trotzdem sollst du dich setzen. Wer sich erniedrigt, den wird Gott erhöhen.“
Er zog ihn sanft heran und die Hirten schauten staunend zu, wie die beiden mit Appetit große Fleischstücke verschlangen. Nach dem Fleisch legten die Hirten Eicheln und einen harten Käse auf das Fell und der Becher wanderte fleißig im Kreis.
Als Don Quijote gesättigt war, hob er Eicheln auf, betrachtete sie und begann eine feierliche Rede: Er pries das Goldene Zeitalter, in dem es kein Mein und Dein gab, jeder von den Gaben der Natur lebte und Frieden herrschte. Die Menschen trugen einfache Kleidung aus Blättern, Wasser und Früchte stillten Hunger und Durst. In jenen Tagen wandelten Jungfrauen sicher durch Wälder und Täler, Ehrbarkeit war selbstverständlich und Recht wurde ohne Bestechung gesprochen. „Doch weil die Welt schlecht wurde“, fuhr er fort, „entstanden die fahrenden Ritter. Sie beschützen Witwen, Jungfrauen und Bedürftige. Ich bin einer von ihnen. Euch danke ich für eure Güte, auch wenn ihr nicht wusstet, dass es eure Pflicht war, uns zu bewirten. Ihr habt es freiwillig getan und darum danke ich doppelt.“
Nachdem das Abendessen beendet war, sagte einer der Hirten: „Damit Ihr seht, wie freundlich wir Euch empfangen, wollen wir Euch noch eine Freude machen. Einer von uns wird gleich ein Lied singen. Er ist sehr verliebt und kann lesen, schreiben und fiedeln, wie es schöner nicht geht.“
In diesem Moment erklang die Fiedel und ein junger Mann von etwa zweiundzwanzig Jahren trat zu ihnen. Auf die Bitte seiner Kameraden, ein Liebeslied zu singen, setzte sich der junge Antonio lächelnd auf einen Baumstumpf, stimmte seine Fiedel und begann zu singen.
Der Ziegenhirt beendete sein Lied. Don Quijote hätte gern mehr gehört, doch Sancho wollte lieber schlafen als weiter zuhören. „Eure Gnaden sollte sich zur Ruhe legen“, meinte er, „denn braves Volk muss tags arbeiten und kann nachts nicht singen.“
Don Quijote entgegnete: „Ich merke schon, der Wein hat dir zugesetzt.“
„Es hat allen gut geschmeckt“, sagte Sancho.
„Das bestreite ich nicht“, erwiderte Don Quijote. „Schlaf, wo du willst. Ich werde wachen. Aber sieh vorher noch nach meinem Ohr – es schmerzt sehr.“
Sancho gehorchte. Ein Hirt mischte Rosmarin mit Salz, legte es aufs Ohr und verband es. Es heilte rasch.
12. Kapitel
Ein Junge kam herbeigelaufen und rief: „Wisst ihr, was im Dorf vorgeht, Kameraden?“ „Wie sollen wir das wissen?“, fragte einer.
„So hört denn: Heute ist der studierte Schäfer Grisóstomo gestorben. Man sagt, er sei aus Liebe zu dieser Teufelsdirne gestorben, der Tochter des reichen Guillermo, die als Hirtin herumzieht.“
„Du meinst wohl Marcela“, sagte ein anderer.
„Genau die.“
„Was das Schönste ist“, fuhr der Junge fort, „in seinem Testament hat er befohlen, man solle ihn draußen im Feld begraben, unten beim Felsen an der Quelle. Die Geistlichen sind dagegen, aber sein Freund Ambrosio besteht darauf, alles genau nach seinem Willen zu machen. Morgen soll die Beerdigung dort stattfinden.“
„Ich gehe hin“, sagte einer der Hirten, „auch wenn ich danach nicht mehr zurück ins Dorf dürfte.“ „Wir alle“, riefen die anderen, „nur, wer bleibt bei den Ziegen?“ „Ich bleibe“, sagte einer. „Nicht, weil ich tugendhaft bin, sondern weil ich mir einen Splitter in den Fuß gestochen habe.“
Don Quijote fragte: „Wer war dieser Verstorbene und wer ist Marcela?“ Pedro antwortete: „Grisóstomo war ein reicher, gelehrter Herr aus dem Dorf. Er verstand viel von Sternen und wusste, wann Mond und Sonne sich verstecken.“
„Finsternisse, mein Freund“, verbesserte ihn Don Quijote.
„Wie auch immer“, fuhr Pedro fort. „Er riet den Leuten, was sie säen sollten und machte sie reich. Dann kam er im Hirtenkleid zurück, um Marcela nachzujagen, die ihm das Herz gestohlen hatte. Auch sein Studienfreund Ambrosio wurde Schäfer.“
„Grisóstomo konnte dichten wie kein anderer. Und dann starb er – aus Liebe zu Marcela.“
„Und wer ist diese Marcela?“, fragte Don Quijote.
„Das will ich Euch erzählen“, sagte Pedro. „Ganz gewiss, habt Ihr nie etwas Ähnliches gehört. Selbst wenn Ihr länger lebt als Jerusalem.“
„Sagt Methusalem“, warf Don Quijote ein.“ Jerusalem oder Methusalem, das ist mir einerlei“, erwiderte Pedro. „Doch wenn Ihr mir in jedes Wort fallt, werden wir nie fertig.“ „Fahrt nur fort“, sagte Don Quijote. „Ich schweige.“
„Ich will Euch erzählen, mein bester Herr“, begann der Ziegenhirt, „dass bei uns im Dorf ein Bauer lebte, reicher noch als Grisóstomos Vater. Er hieß Guillermo. Ihm schenkte Gott eine Tochter, Marcela, bei deren Geburt die Mutter starb. Aus Trauer über den Tod seiner Frau starb Guillermo bald darauf und hinterließ Marcela unter der Obhut ihres Oheims. Das Mädchen wuchs zu großer Schönheit heran. Schon mit fünfzehn Jahren war sie berühmt. Viele reiche Freier bewarben sich um sie, aber der Oheim wollte sie nicht ohne ihre Zustimmung verheiraten. Sie sagte stets: ‚Ich bin noch zu jung und nicht bereit für die Ehe.‘ So ließ man sie gewähren. Doch eines Tages erschien sie plötzlich in Hirtentracht und zog mit ihrer Herde in die Felder. Alle rieten ihr ab, aber sie ließ sich nicht beirren. Und so, Herr Ritter, liefen ihr bald alle jungen Männer nach. Sie blieb freundlich, doch sobald einer ihr seine Liebe gestand, wies sie ihn scharf zurück. Niemand konnte je sagen, sie habe Hoffnung gemacht. Darum klagten die Verliebten, sie sei grausam und stolz.
Man findet Bäume, in die ihr Name eingeritzt ist. Manche liegen nachts unter Eichen, andere werfen sich bei sengender Hitze auf den Boden – nur um ihrer zu gedenken. Und Marcela? Sie geht frei umher, stolz und ungerührt. Auch Grisóstomo, der nun tot ist, hat ihr nachgestellt. Man sagt, er habe sie nicht mehr nur geliebt – er habe sie angebetet.
Ich rate Euch, Señor, kommt morgen mit zum Begräbnis. Es ist ganz in der Nähe und Ihr werdet dort vieles erfahren.“
„Ich danke Euch, guter Pedro“, sagte Don Quijote, „Ihr habt mir eine sehr unterhaltsame Geschichte erzählt. Und ich weiß noch nicht einmal die Hälfte von all dem, was sich mit ihren Liebhabern zugetragen hat. Doch vielleicht hören wir morgen mehr.“
Der Hirt schlug vor, Don Quijote möge nun zur Ruhe gehen, um seine Wunde zu schonen. Auch Sancho Pansa, der längst genug gehört hatte, drängte darauf und so begab sich Don Quijote in die Hütte, um zu schlafen – jedoch nicht, ohne noch lange wach zu liegen und an seine Dulcinea zu denken.
Sancho hingegen schlief sogleich ein – zwischen Rosinante und seinem Esel, wie ein müder, verprügelter Knappe.
13. Kapitel
Noch vor Sonnenaufgang weckten die Ziegenhirten Don Quijote. Bald waren sie unterwegs. Schon nach kurzer Zeit begegneten sie einigen Schäfern. Auch zwei Edelleute schlossen sich dem Zug an.
Don Quijote fragte, was sie über Marcela und Grisóstomo wüssten. Der Herr erwiderte: „Ein Schäfer erzählte uns, Marcela sei von vielen geliebt worden, doch sie habe alle abgewiesen.“
Vivaldo fragte Don Quijote, warum er in voller Rüstung reise. Der Ritter antwortete: „Ich bin ein fahrender Ritter. Die Waffen sind mein Beruf.“
Die Reisenden sahen sich bedeutungsvoll an. Sie hielten Don Quijote für verwirrt – aber harmlos. Um mehr über ihn zu erfahren, fragte Vivaldo: „Was meint Ihr mit fahrenden Rittern?“
Don Quijote begann sogleich: „Kennt Ihr denn nicht König Artus und die Ritter der Tafelrunde? Seit der Zeit König Artus’ hat sich der Ritterorden über viele Länder verbreitet. Ich bin, wenn auch ein sündiger Mensch, diesem Orden beigetreten. Ich ziehe durch diese Einöden, um mit meinem Schwert den Schwachen beizustehen.“
Die Reisenden sahen sich an. Sie waren sich einig: Der Mann war verrückt. Vivaldo, heiter und klug, wollte die Zeit nutzen und fragte: „Herr Ritter, Euer Beruf ist sehr streng. Ich glaube, der Orden der Kartäuser ist kaum strenger.“
„Mag sein“, erwiderte Don Quijote. „Aber unsere Aufgabe ist wichtiger. Die Mönche beten, wir Ritter handeln. Wir schützen die Erde mit unserem Schwert. Ich sage nicht, dass wir heiliger sind, aber gewiss ist unser Leben härter, ärmer und gefährlicher.“
Vivaldo lachte. „Mir gefällt dabei nicht, dass ihr euch im Kampf euren Damen empfehlt, statt Gott. Das klingt nach Heidentum.“
„Keineswegs!“, rief Don Quijote. „Ein Ritter hat im Kampf stets das Bild seiner Dame vor Augen. Das ist Brauch! Doch auch Gott empfiehlt er sich – wenn Zeit bleibt.“
„Trotzdem erscheint es mir unrecht“, sagte Vivaldo. „Oft lese ich, wie zwei Ritter sich im Zorn treffen und im vollen Galopp aufeinander los jagen. In dem Moment sprechen sie nur von ihrer Dame. Wenn einer dabei stirbt, hat er sich wohl kaum noch Gott anvertraut.“
„Ein Ritter ohne Dame?“, fragte Don Quijote empört. „Das ist unmöglich! Ein Ritter ohne Liebe ist kein echter Ritter, sondern ein Dieb.“
„Und doch“, erwiderte Vivaldo, „meine ich gelesen zu haben, dass Don Galaor keine feste Dame hatte.“
„Werter Herr“, sagte Don Quijote, „ich weiß sicher, dass auch Don Galaor verliebt war. Nur liebte er viele und hielt es geheim. Doch am Ende hatte auch er eine Dame, der er sich besonders verbunden fühlte.“
„Dann“, sagte Vivaldo, „dürfen wir wohl annehmen, dass auch Ihr verliebt seid, Herr Ritter. Wenn Ihr es nicht so geheim haltet wie Don Galaor, so bittet Euch diese ganze Gesellschaft, uns den Namen, den Stand und die Schönheit Eurer Dame mitzuteilen.“
Don Quijote seufzte tief. „Ob es ihr gefällt oder nicht, dass man von ihr spricht, weiß ich nicht. Aber ich will antworten. Ihr Name ist Dulcinea. Sie lebt in Toboso, einem Ort in der Mancha. Ihrem Stand nach ist sie eine Prinzessin, denn sie ist meine Königin. Ihre Schönheit übertrifft alle Dichtung.“
„Und ihr Geschlecht?“, fragte Vivaldo.
„Sie stammt nicht von alten römischen Familien ab“, entgegnete Don Quijote, „Nein, sie gehört dem Geschlecht derer von Toboso an, das zwar neu ist, aber künftigen Adelsgeschlechtern Ehre machen wird. Wer das bezweifelt, soll mir im Kampf begegnen.“
Vivaldo lächelte. „Ich gehöre zum Geschlecht der Cachopines von Laredo, aber ich will mich nicht mit dem Hause Toboso messen. Nur, ich habe diesen Namen nie gehört.“
„So?“, rief Don Quijote. „Dann ist es an der Zeit, dass Ihr ihn kennenlernt!“
Alle Zuhörer hielten Don Quijote nun für verrückt.
Während sie so sprachen, kam eine Gruppe Hirten aus einer Schlucht, sechs von ihnen trugen eine Bahre mit dem Leichnam Grisóstomos. „Dort ist die Grabstelle“, sagte Ambrosio. „Hier sah er Marcela zum ersten Mal – und hier brach ihr Nein ihm das Herz.“
Ambrosio wandte sich an Don Quijote und die übrigen und sprach: „Ihr seht hier den Körper Grisóstomos, eines Mannes, den der Himmel mit unzähligen Gaben gesegnet hatte. Er war edel, klug, freundlich, ein echter Freund. Doch er liebte ohne erwidert zu werden – und bekam den Tod. Die Ursache war eine Hirtin, Marcela. Hier, in diesen Papieren, hat er seine Qualen niedergeschrieben. Doch mir gebot er, sie nach seinem Tod zu verbrennen.“
Da sagte Vivaldo: „Es ist unklug, den letzten Wunsch eines Mannes zu erfüllen, der in Verzweiflung handelte. Vernichtet nicht, was künftigen Menschen Warnung und Trost sein könnte. Lasst diese Worte weiterleben!“
Und ohne auf Antwort zu warten, griff Vivaldo nach einigen der Blätter.
Ambrosio sprach: „Ihr mögt behalten, was Ihr bereits genommen habt. Doch die anderen werde ich dem Feuer übergeben – das ist mein fester Entschluss.“
Vivaldo, begierig zu erfahren, was die Blätter enthielten, öffnete eines und las den Titel: „Gesang der Verzweiflung“.
Ambrosio sagte: „Dies ist das Letzte, was er geschrieben hat.“
14. Kapitel
Grisóstomos Gesang war voller Schmerz. Er gefiel den Zuhörern gut, obwohl Vivaldo meinte, die Verse widersprächen dem guten Ruf Marcelas. Sie klangen nach Eifersucht und Misstrauen.
Ambrosio erklärte: „Grisóstomo schrieb das Gedicht in einer Zeit freiwilliger Trennung. Er wollte prüfen, ob Abwesenheit seine Liebe verändere. Dabei plagten ihn die üblichen Ängste der Verliebten. Seine Zweifel waren Einbildung. Marcelas Tugend bleibt unantastbar. Sie ist nur stolz und abweisend, nicht aber unredlich.“
In diesem Moment erschien hoch oben auf dem Felsen Marcela selbst – so schön, dass alle staunten. Wer sie noch nie gesehen hatte, war sprachlos vor Bewunderung, und wer sie kannte, war ebenso beeindruckt.
Ambrosio rief ihr zornig zu: „Kommst du, grausame Marcela, um zu sehen, ob dein Opfer erneut blutet? Um über das Leid zu triumphieren, das du verursacht hast? Sag, was du willst! Denn wir waren Grisóstomos Freunde und sind es noch über seinen Tod hinaus!“
Marcela antwortete ruhig: „Ich komme, um mich zu verteidigen. Ihr sagt, meine Schönheit zwinge euch zur Liebe – und dafür soll ich euch Liebe zurückgeben. Das ist unvernünftig. Schönheit verpflichtet nicht zur Gegenliebe. Wahre Liebe muss freiwillig sein. Ich habe niemandem Hoffnung gemacht, auch Grisóstomo nicht. Ich habe seine Gefühle nicht erwidert, aber nie betrogen. Ich bin frei geboren und will frei leben. Darum habe ich die Einsamkeit gewählt. Sagt nicht, ich hätte ihn getäuscht. Als er mir seine Absichten erklärte, antwortete ich offen, dass ich nie zu einem Leben an seiner Seite bereit sein würde. Er hat es gewusst – und trotzdem gehofft. Wenn er nun an dieser Hoffnung zugrunde ging, dann ist nicht meine Grausamkeit schuld, sondern sein Beharren. Ich lebe so, wie ich es mir vorgenommen habe und wünsche keinem zu schaden.“
Ohne auf Antwort zu warten, verschwand sie im Wald. Alle staunten über ihren Verstand und ihre Schönheit. Einige wollten ihr folgen, doch Don Quijote zog sein Schwert und rief: „Wer Marcela folgt, muss es mit mir aufnehmen! Sie hat deutlich gemacht, dass sie niemandem Hoffnung gemacht hat und keine Schuld an Grisóstomos Tod trägt. Man soll sie ehren, nicht bedrängen!“
Die Hirten blieben stehen, das Grab wurde vollendet, die Schriften verbrannt und Grisóstomo mit vielen Tränen beigesetzt. Sie streuten Blumen und Zweige auf das Grab und nahmen Abschied von Ambrosio. Auch Vivaldo, sein Gefährte und Don Quijote verabschiedeten sich. Die Reisenden luden Don Quijote ein, sie nach Sevilla zu begleiten, wo es angeblich an jeder Ecke Abenteuer gäbe. Doch Don Quijote lehnte ab: Er wolle zuerst dieses Gebirge von Räubern säubern.
Die beiden zogen ihres Weges, reich an Gesprächsstoff über Marcela, Grisóstomo und Don Quijotes Narreteien. Dieser aber beschloss, Marcela aufzusuchen und ihr seine Dienste anzubieten – doch es kam anders, wie später erzählt wird.
15. Kapitel
Nachdem Don Quijote und Sancho sich von den übrigen Trauergästen verabschiedet hatten, ritten sie in den Wald, in den sich die Hirtin Marcela zurückgezogen hatte. Zwei Stunden lang suchten sie nach ihr, doch sie blieb unauffindbar. Schließlich erreichten sie eine schöne Wiese, durch die ein klarer Bach floss. Der Ort war so angenehm, dass sie beschlossen, dort die Mittagshitze zu verbringen. Sie stiegen ab, ließen Rosinante und den Esel frei grasen und verzehrten gemeinsam, was Sancho noch in seinem Proviantbeutel hatte.
Da Rosinante stets ruhig und sanft war, hielt es Sancho nicht für nötig, ihn festzubinden. Doch wie es der Zufall wollte, weidete ganz in der Nähe eine Herde Stuten. Rosinante, plötzlich voller Tatendrang, näherte sich ihnen und versuchte, sich aufzudrängen. Die Stuten wehrten sich heftig und als die Treiber bemerkten, was geschah, griffen sie zu Knüppeln und verprügelten Rosinante.
Don Quijote und Sancho eilten hinzu, um dem Pferd zu helfen. Der Ritter rief: „Das sind keine Ritter, Sancho! Du darfst mir helfen, Rache zu nehmen!“ Doch Sancho antwortete: „Es sind mehr als zwanzig, wir nur zwei.“ Don Quijote aber stürzte sich mit dem Schwert auf die Männer, Sancho folgte ihm. Zunächst traf Don Quijote einen der Männer hart auf die Schulter. Doch schon beim zweiten Schlag wurden beide zu Boden geprügelt und schwer verletzt liegen gelassen.
Als Sancho wieder zu sich kam, stöhnte er: „Señor Don Quijote! Gebt mir von dem Wundtrank, wenn Ihr ihn bei Euch habt.“ Don Quijote erwiderte: „Hätte ich ihn nur! Aber in zwei Tagen, wenn das Schicksal es erlaubt, werde ich ihn besitzen.“
Dann belehrte er Sancho: Gegen Bauern solle künftig nur der Knappe kämpfen, da Ritter nur Ritter bekämpfen dürften. Sancho aber weigerte sich. Er sagte: „Ich bin ein friedlicher Mann, habe Frau und Kinder zu ernähren und will niemandem etwas zuleide tun. Ich werde niemals das Schwert ziehen, gegen keinen, ob arm oder reich, Ritter oder Bauer.