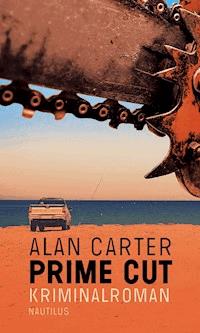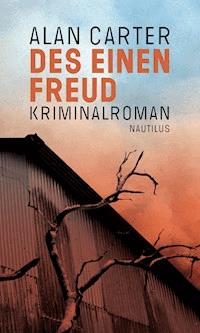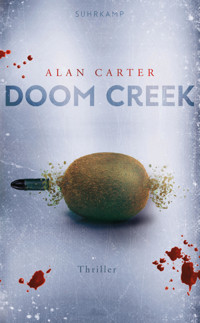
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Neuseeland-Thriller
- Sprache: Deutsch
Keine Ruhe am Marlborough Sound. Sergeant Nick Chester und Constable Latifa Rapata haben gleich doppelten Ärger. Eine Horde US-Amerikaner fällt in Neuseeland ein und kauft Land, um dort eine Luxusfestung für einen superreichen ultrarechten Amerikaner zu etablieren, der nebenbei ein kleines Reich für »Arier« errichten will. Ganz Doomsday Prepper will er hier den erwarteten Untergang der übrigen Menschheit aussitzen. Unter seinen bis an die Zähne bewaffneten Helfershelfern ist ein besonders fieses Scheusal, das Nick Chester und seine Kollegin aus dem Spiel nehmen müssen. Aber dann taucht eine Leiche auf, die auf einen cold case verweist oder vielmehr auf mehrere ungelöste Mordfälle …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Alan Carter
Doom Creek
Thriller
Aus dem australischen Englischen von Karen Witthuhn
Herausgegeben von Thomas Wörtche
Suhrkamp
Widmung
Für Kath
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
PROLOG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Danksagung
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
PROLOG
Neuseeland ohne Raubtiere? Eine tolle Idee. Eine utopische Vision, ähnlich planungs- und ressourcenintensiv wie eine erneute Mondlandung. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg – aber ist der Wille da? Wie viele Ratten, Hermeline, Wiesel, Possums, Wildkatzen würden sterben müssen? Wie viele Sterne leuchten am Himmel? Immerhin kann er einen kleinen Beitrag leisten, hier in diesem Winkel Edens, einmal die Woche, pünktlich wie die Maurer. Wenn er sich tief in den Urwald um die Pelorus Bridge hineinbegibt, Fallen überprüft und neu stellt und Kadaver zählt, um im Wettlauf mit der Zeit die winzige einheimische Neuseeland-Lappenfledermaus vor dem Aussterben zu bewahren – auch wenn sie das hässlichste Viech ist, das man je gesehen hat.
Bob schaut auf die Karte. Immer den rosa Markierungen nach, rechts sollten sich mehrere Fallen für Possums, Ratten und Hermeline befinden. Er war schon so oft hier, aber manchmal lassen ihn seine alten Augen und der Kopf im Stich: Alzheimer oder nur ein Trick des sich ständig verändernden Lichts? Gott, ist das schön hier. Gut, man hört die Touristenautos und den anderen Verkehr drüben über die Brücke rauschen und weiter entfernt die Motorsägen in der Kiefernplantage auf dem nächsten Hügel knattern. Aber wenn man die Ohren schließt und die Augen aufmacht, sieht man ein lichtgesprenkeltes Bruchtal mit grünem Moos und Rimu-Harzeiben, eine andere Welt. Außerdem kommt er raus aus dem Haus und an die frische Luft und kann Senilität und alte Sorgen abwehren, die sich manchmal anschleichen.
Nur dass die Luft gar nicht so frisch ist. Schon aus meterweiter Entfernung ist ein erdrosseltes Possum, eine zerquetschte Ratte oder ein totes Hermelin zu riechen. Heute stinkt es wirklich zum Himmel. Wie reifer Käse. Und er hört Fliegen summen, die Beute muss relativ frisch sein. Vor sich auf einer Lichtung sieht er an einem schwarzen Buchenstamm eine gelb leuchtende Wespenfangkiste und den blauen Trichter einer Possumfalle, aber nichts hängt heraus. Der Geruch muss aus einer der Holzkisten kommen, aus einer der Ratten- oder Hermelinfallen.
Bob stolpert. Er ist mit dem Fuß an einer knorrigen Kletterpflanze hängengeblieben, was die im letzten Jahr bei einem Sturz gerissene Achillessehne reizt. Alte Knochen wachsen nur schwer zusammen, Muskeln und Sehnen wollen nicht mehr heilen. Seine Nase bläht sich. Hermelin oder Ratte? Jedenfalls ein Riesengestank für so ein kleines Tier. Der Wind raschelt in den Blättern und Farnen, eine Wolke aus schwarzen Kolibris hebt ab und lässt sich auf den Zweigen eines Totara-Baums nieder. Ihm fällt auf, dass er die Luft angehalten hat, aber nicht wegen des Gestanks – sondern aus einem Urinstinkt heraus. Angst ist ihm unter die Haut gekrochen und hat sich festgesetzt wie ein zarter Pilz auf toter Rinde. Der smaragdgrüne Schimmer verdunkelt sich, als Wolken vor die Sonne ziehen. Bob erreicht die Lichtung und spürt das weiche Moos und knickende Zweige unter seinen Wanderstiefeln. Er umrundet den Totara-Baum.
Der Kadaver lehnt aufrecht an dem Baum, als würde er sich ausruhen, festgehalten von einem Seil, das um Hals und Baumstamm gespannt ist. Eine Hirschkuh, von Fliegen und Maden bevölkert. Dunkle, zähe Flüssigkeit ist ausgetreten – Maul und Vorderseite sind aufgerissen. Bob kämpft gegen die Übelkeit an, aber er sieht so etwas nicht zum ersten Mal.
Hinter ihm Geraschel, etwas knackt. Farne werden beiseitegeschoben, eine Gestalt in Backwoods-Kleidung erscheint.
»Du?« Wo ein Wille ist, ist wirklich ein Weg. Klar. Das war immer so und wird so bleiben. Bob zeigt traurig auf die tote Hirschkuh. »Das arme Vieh ist in die Falle gegangen.«
»Schade drum.« Der Neuankömmling nickt.
Zähl die Sekunden. Ein verzweifeltes Schluchzen. »O Gott.« Dann ein Geräusch, irgendwo zwischen dumpfem Schlag und Husten. Kaum laut genug, um die Schmeißfliegen aufzuscheuchen.
1
Der Fluss ist an diesem Donnerstagmorgen in Bestform, er gluckert durch die Schlucht und fängt das Grün der umliegenden Kiefernplantagen ein. Gestern habe ich im tiefen Teil des Beckens sogar eine Forelle gesehen. Wahnsinn. Manchmal ist es so klar, dass man durch das Fenster aus dreihundert Metern Entfernung einen verdammten Fisch erkennen kann. Vor allem mit Zielfernrohr.
Ich ziele auf den Rücken des Mannes. Er merkt nicht, dass er beobachtet wird. Breite Schultern, ein leichtes Ziel. Mein Finger legt sich um den Abzug. Einmal zudrücken, und das wär's. Der Fluss würde ihn runter in die Sounds tragen und mit der Ebbe rausspülen. Sie kommen immer wieder, und ich muss sie immer wieder wegschicken. Sonst hört es nie auf.
»Du darfst ihn nicht erschießen, Nick.« Vanessa stupst mich mit der Hüfte an und stellt mir einen Becher Kaffee neben den Ellbogen. »Er hat eine Ressourcengenehmigung von der Stadt.«
»Verdammte Goldgräber. Warum können die sich nicht verpissen und uns in Ruhe lassen?«
»Zwei Tage die Woche von September bis April. Und dann muss der Fluss noch so niedrig stehen, dass er mit seinem Bagger reinkommt. An den meisten Wochenenden hat es geregnet.« Sie tätschelt mein Knie. »Das ist bloß ein albernes Hobby. Noch eine Woche, dann ist bis zum Frühling Schluss. Entspann dich, Schatz.«
Seit eine kanadische Firma in der Nähe des Pubs ein beträchtliches Vorkommen des gelben Zeugs gefunden hat, ist im Valley nach hundertfünfzig Jahren erneut das Goldfieber ausgebrochen. Männer, es sind fast immer Männer, aus allen Gesellschaftsschichten, aber mit dem gleichen gierigen Glitzern im Auge, klopfen regelmäßig an unsere Tür. Freundlich lächelnd erkundigen sie sich, ob es okay wäre, unseren Pfad zum Fluss zu benutzen, wo sie graben und schürfen wollen, ihre Pickups in unserer Auffahrt abzustellen, ihre Schürfausrüstung in unserem Schuppen zu lagern. Kumpel?
Nein, ist nicht okay. Ich sehe Beim Sterben ist jeder der Erste langsam durch die Augen der Hinterwäldler. Und dann verrutscht das Lächeln, und es wird klar, dass sie sowieso nie Freundschaft schließen wollten.
»Allesamt Opportunisten und Schmarotzer.«
»Fahr lieber zur Arbeit, Griesgram. Du verbeißt dich schon wieder.« Vanessa trinkt den letzten Schluck Kaffee und brüllt: »Paulie! Wir müssen los!«
Vanessa unterrichtet an der Havelock-Grundschule, ist jedoch heute an der Reihe damit, Paulie zu seiner Highschool zu bringen, zwanzig Kilometer in die entgegengesetzte Richtung. Alle müssen früh raus, aber Vanessa ist voller Enthusiasmus, und Paulie wirkt zufrieden.
»Lunch?«, fragt er und lugt nervös in seinen Schulranzen.
»Nee, ich hatte heute keine Lust, Schatz. Versuch, den anderen Kindern was abzubetteln.«
»Mum!«
»Scherz. Du. Rein ins Auto. Jetzt.« Sie beugt sich vor, küsst mich, schiebt mir ihre Zunge in den Mund. »Hab einen schönen Tag.«
Ich verspreche, mir Mühe zu geben. Pauli hat sein Schinkenbrot und eine Banane gefunden. Er hebt den Daumen und geht zum Wagen.
Durch das Fenster sehe ich, dass der Goldgräber einen Neoprenanzug angezogen und den Bagger angeworfen hat. Ein Geräusch wie ein frisierter Rasenmäher dröhnt durch die Schlucht und übertönt den Fluss und das Vogelgezwitscher. Eine Wolke aus grauem Schlamm erblüht aus der Höllenmaschine und trübt das glasklare Wasser.
Auf der Fahrt über die Wakamarina Valley Road komme ich an immer neuen Abholzungsgebieten vorbei. Yin und Yang, wie so oft: eben noch das Paradies, eine Ecke weiter Mordor. Neulich habe ich einen Artikel gelesen, in dem Neuseeland mit einer wunderschönen Frau verglichen wurde, die von Krebs zerfressen wird. Der Vergleich leuchtet mir nicht ganz ein, Krebs ist immer schlimm, ob man wunderschön ist oder nicht. Vielleicht soll das heißen, dass Schönheit gefährlich trügerisch ist, und wenn man die Symptome erkennt, ist es zu spät. Die vor einer Generation als Steuersparmodell gepflanzten Bäume sind jetzt so groß, dass sie gefällt werden können. Und das überall im oberen Teil der Südinsel – mehrere Millionen Tonnen Oberboden warten nur darauf, in den kommenden Winterregenstürmen weggeschwemmt zu werden – eine Umweltkatastrophe mit Ansage. Manchmal glaubt man, sich an die Zerstörung zu gewöhnen, dann wieder merkt man, dass das nicht geht. Und die hundertprozentig sauberen Flüsse, von denen man Touristen vorschwärmt, wimmeln nur so vor E. coli und anderen Bakterien. Sogar in unserem eigenen glitzernden Wakamarina liegt tief unter den Steinen Quecksilber aus den alten Goldgräbertagen. Lauter tickende Zeitbomben.
Vielleicht hätten wir letztes Jahr das Angebot des Russen in seinem Hubschrauber annehmen sollen. Zu einem guten Preis verkaufen, solange das noch ging. Aber wir hatten uns in diesen Flecken Erde verliebt, waren in Sicherheit und glücklich, unsere Feinde waren besiegt. Wie ich gehört habe, hat Andrei stattdessen eine andere Immobilie weiter unten im Tal gekauft, eine altes Jagd-Ferien-Haus, für das nur ein Dummkopf oder ein Oligarch mit dubiosen Mafiaverbindungen Geld hinlegen würde. Ein Jahr später ist das Ding wieder auf dem Markt. Der arme Andrei sitzt in Sibirien im Knast und wartet auf den Korruptionsprozess, den die Behörden ihm angehängt haben. Vielleicht hätte er sich die Bemerkungen über den Präsidenten auf Twitter sparen sollen.
Am Trout Hotel habe ich wieder Netz, mein Handy klingelt. Constable Latifa Rapata will wissen, wo ich mich rumtreibe. »Bin in zehn Minuten da«, sage ich. »Ist denn was?«
»Ein Typ ist hier und will einen Fillum drehen, Sarge.«
»Film?«
»Ja, er ist …« Sie wird sehr leise. »Pākehā. Angezogen, als komme er aus Auckland oder Wellington oder so.«
»Und dafür brauchst du mich?«
»Was weiß ich denn über Fillume? Bis gleich.«
Als ich auf dem Revier – eine holzverschalte Baracke mit zwei Schreibtischen, einem Fotokopierer und einer großen Muschelschale aus Fiberglas auf dem Dach, die zeigen soll, dass wir Teil der Community sind – ankomme, wartet der Typ schon auf mich. Er sieht tatsächlich nach Großstadt aus: Hipsterbart, enger Anzug, Herrentasche, glänzende spitze Schuhe. Latifa schielt hinter seinem Rücken, klemmt ihre Vorderzähne über die Unterlippe und vollführt ein paar seltsame Tanzschritte.
»Mr Devon Cornish; Sarge. Er ist Fillumregisseur aus Wellington.«
»Eigentlich Produzent.« Er hält mir seine Visitenkarte hin.
»Wie können wir helfen?« Ich weiche Latifas spöttischem Blick aus, mit dem sie hinter der Trennwand verschwindet.
»Wie ich Ihrer Kollegin erklärt habe, will ich nur Bescheid sagen, dass wir nächste Woche ein paar Tage lang hier in der Gegend drehen werden.«
»Und?«
»Und es geht um einen Spielfilm, der in der Zeit des Goldrauschs spielt. Wissen Sie, dass es damals hier einige Morde gegeben hat?«
»Die Doom-Creek-Morde Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Fünf Goldsucher wurden für ein paar Kröten im hinteren Hügelland von Banditen überfallen. Ja, ich habe darüber gelesen.«
»Ganz genau – der Film heißt Doom Creek, und raten Sie mal, wer mitspielt.«
»Sie machen mich neugierig.« Er spuckt einen Namen aus, und ich bin nicht schlauer als vorher.
»Greg aus Shortland Street?«
Ich schüttele den Kopf, nein, ich bin kein Fan neuseeländischer Seifenopern. »Ich weiß immer noch nicht, warum Sie mir das sagen. Sie brauchen keine Drehgenehmigung von mir. Sie müssen sich an den Landeigentümer oder die staatlichen Behörden oder sonst wen wenden.«
»Wir könnten in einer Sache Ihre Hilfe gebrauchen und haben das bereits mit Ihrer District Commander in Nelson besprochen.«
Marianne Keegan – nach Fords Pensionierung frisch befördert. Danke fürs Abwälzen, Marianne. »Ja?«
»Wir hoffen, dass Sie uns mit dem Verkehr helfen könnten.«
Latifa-artiges Schnauben.
»Verkehr?«
»Wir müssen moderne Autos aus dem Bild raushalten – Sie erinnern sich an Braveheart und den weißen Wagen – und da oben fahren einige rum. Wir haben Helfer, die die Leute umleiten werden, aber falls jemand Ärger macht, wäre es gut, Sie dabeizuhaben.«
»Wir haben hier ebenfalls unsere Aufgaben, Mr Cornish. Das hat keine Priorität.«
Er zieht ein Blatt Papier aus seiner Männertasche und gibt es mir. Ein Brief von Commander Marianne, die ihm mitteilt, dass sie für seinen blöden Film gern meine Hilfe zur Verfügung stellt.
»Sie wohnen doch oben im Wakamarina Valley, nicht wahr, Sergeant?«
»Wer sagt das?«
Ein verlegenes Husten von jenseits der Trennwand.
»Wir drehen ganz in der Nähe von Ihnen, in Butchers Flat. Das sollte Ihnen ein paar Tage lang den Arbeitsweg verkürzen.« Er steht auf und hält mir die Hand hin. »Bis nächsten Dienstag, acht Uhr morgens.« Schultert seine Tasche. »Pünktlich.«
Am späten Vormittag habe ich die Nase voll davon, mich von Latifa »Best Boy« und »Key Grip« nennen zu lassen, und gehe auf einen Kaffee und Pie zum Bäcker, während sie sich auf den Weg zum SH6 macht, um Temposünder einzufangen. Der Herbst ist eine wunderschöne Jahreszeit. Das Wetter ist oft klar und sonnig, was man vor dem Winter besser nach Kräften genießt. Die Touristen sind weg, im Ort wird es ruhiger, was weniger Arbeit für die Polizei, aber auch schleppendere Geschäfte für die Läden und Cafés und die Touristenboote draußen auf den Marlborough Sounds bedeutet. Devon Cornish hat sich eine gute Jahreszeit für seinen Film ausgesucht, es sind weniger Leute im Weg, es gibt genug Übernachtungsmöglichkeiten für Cast und Crew, und es besteht in den nächsten Wochen Aussicht auf ruhiges Wetter. Ich bestelle meinen Kaffee und suche mir einen Tisch aus, dann rufe ich DC Keegan im Nelson HQ an.
»Morgen, Nick. Schön, dich zu hören.«
Sie hat die Macht, mich zu entlassen, und kennt die meisten meiner Geheimnisse, im Bett und außerhalb. All das schwingt in ihrer leicht spöttischen, nach Liverpool klingenden Stimme mit. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein.
»Bei mir im Büro ist heute Morgen ein Filmproduzent aufgetaucht.«
»Oh, Devon. Ich kenne ihn aus Wellington. Freund von einem Freund. Ein echter Tausendsassa.«
»Eine Vorwarnung wäre nett gewesen.«
»Hast du meine Mail nicht bekommen? Verdammt. Der Server spinnt seit ein paar Tagen.«
Das ist keine Lüge. Es ist ein Geschenk, nicht ständig Arbeitsschutzrundschreiben und Nachfragen nach Statistiken und Dienstplänen zu bekommen.
»Schülerlotse zu spielen, ist eine Verschwendung meiner Fähigkeiten und meines Stundenlohns. Auch hier gibt es Verbrechen, weißt du.«
»Constable Rapata wird bestimmt damit fertig. Dein Gesicht ist in deinem Tal da bekannt. Sie werden dir aus der Hand fressen. Außerdem kannst du ausschlafen und früh Feierabend machen. Win-win?«
Sie hat Hintergedanken, davon bin ich überzeugt, habe aber keine Lust, herauszufinden, welche. Wahrscheinlich irgendwelche alten Seilschaften, Gefälligkeiten, Arschkriechereien. »Wenn irgendwas Dringenderes auftaucht, bin ich da weg.«
»Natürlich, Nick. Du bist der Boss.« Stimmen im Hintergrund, das Mundstück wird zugehalten. »Und komm nächstes Mal vorbei, wenn du in der Stadt bist. Wäre schön, sich mal wieder zu sehen.«
Lieber nicht, denke ich. Der Umzug von Wellington nach Nelson hat ihrer Ehe den Todesstoß versetzt. Das kann ich mir für meine nicht leisten.
Mein Kaffee kommt, ich lehne mich zurück und genieße die Aussicht. Die Tourismusbroschüren preisen Havelock als Grünschalenmuschelhauptstadt der Welt. Alle Restaurants hier bieten Muscheln an. Eines, The Mussel Pot, hat sich auf Variationen des Themas spezialisiert und sich als unübersehbares Wahrzeichen ein Dutzend große Fiberglasmuscheln aufs Dach gesetzt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist noch eine Muschelstatue aufgetaucht, zwei Meter hoch und auf einem motorgetriebenen Surfbrett stehend. Warum? Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben den thematischen Wendepunkt fast erreicht, wir sind am Muschelhöhepunkt. Hinter mir an der Theke werden Stimmen laut.
»Was ist das?«
»Ein Becher.«
»Styropor? Habt ihr kein Porzellan?«
»Das spart den Abwasch.«
Amerikanische Akzente gehen mir grundsätzlich auf die Nerven. Vielleicht liegt es an den Sitcoms, die wir alle aus dem Fernsehen kennen, mit Gebrüll und Gelächter aus der Konserve. Bei lauten, aggressiven Amis werde ich richtig sauer. Sogar wenn sie, wie jetzt, vielleicht recht haben könnten.
»Die sind nicht recycelbar. Das landet alles auf der Müllkippe. Auf eurem Schild steht ›Organischer Fair Trade Kaffee‹, und dann serviert ihr den in diesem Scheißding? Wo ist da die gottverdammte Logik?«
»Kein Grund, ausfallend zu werden.« Und nach einer Pause, »Sir.«
Ein lautes Klomp auf der Theke. »Wer ist hier der Chef?«
»Ich, Kumpel. Nicht Sie.«
Zeit, mal hinzugehen. Janeen hinter der Theke, kaum größer als Frodo, macht sich kampfbereit. Ich gehe lächelnd dazwischen und klopfe gegen die Vitrine. »Gib mir bitte noch einen Dattelscone, ja, Janeen?«
Sie funkelt mich wütend an. »Gleich, ich muss mich noch um dieses … diesen Gast kümmern.«
Was der Ami nicht ahnt, Janeen wäre fähig, seinen Kopf durch die Glasvitrine zu rammen, bevor er weiß, wie ihm geschieht. Ich habe es miterlebt und musste sie verhaften. Sie hat Bewährung und kann sich mit drei Hosenscheißern zu Hause keinen Fehltritt leisten. Ich wende mich dem Kunden zu. Er ist nicht sehr groß, hat aber ein gefährliches Glitzern im Auge, das man üblicherweise mit Religion, Drogen oder Alkohol verknüpft.
»Schöner Tag.«
»Hau ab, Freundchen. Deine Uniform ist mir scheißegal.«
Oh-oh. »Ich glaube, wir sollten uns ein bisschen beruhigen, Kumpel. Ein Styroporbecher ist so eine Aufregung wirklich nicht wert.«
Er wendet sich mir direkt zu. »Wie ich gesagt habe, hau ab.«
»Verlassen Sie den Laden, Sir. Gehen Sie.«
»Und vergessen Sie Ihren Kaffee nicht«, sagt Janeen. »Der ist zum Mitnehmen. Wenn der Becher leer ist, werfen Sie ihn in einen Mülleimer. Wir mögen hier keine Schmutzfinken.«
Ich drehe mich zu ihr um. »Halt den Mund.«
Und in dem Moment versetzt mir das Arschloch einen Schlag in den Magen. Ich bekomme keine Luft mehr, der Tag ist versaut. Ich gehe zu Boden und weiß nicht, was ich zuerst tun soll, kotzen oder nach Luft schnappen. Er beugt sich über mich. »Bleib mir aus dem Weg.« Dann gießt er mir seinen organischen Fair Trade Kaffee auf die Brust und geht. Zum Glück hat der Kaffee während der Streitigkeiten etwas Zeit zum Abkühlen gehabt.
»Wer war das?«
Ich habe wieder Luft in der Lunge. Janeen tupft meine Uniform mit einem Spülschwamm ab, aber das macht es nur schlimmer. »Du hättest ihn mir überlassen sollen, Nick. Dich da raushalten sollen.«
Ich stehe auf, hinke zur Tür und schaue mich auf der Straße um. »In welche Richtung ist er gegangen?«
Ein paar Gäste hören kurz auf, ihre Pies und Sausage Rolls zu kauen, und zeigen gen Westen in Richtung Nelson.
»Willste ihn verhaften oder was?« Janeen gibt mir den Schwamm.
»Hatte er ein Auto?« Ich bin immer noch benommen und kurzatmig. Und ob der Absurdität des Ganzen verblüfft. Wegen eines Styroporbechers zu Boden gegangen? Im Ernst?
»Motorrad. Harley«, sagt ein junger Typ, den ich schon häufig mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt habe. Er schluckt runter, was er gerade gekaut hat. »Schwarz. Neu. Teuer.«
Ich rufe Latifa an und gebe ihr die Beschreibung durch, dann benachrichtigen wir unsere Kollegen in Nelson auf der anderen Seite des Whangamoa Saddle, damit sie sich auf den Weg machen und nach ihm Ausschau halten.
»Keine Sorge«, sagt Latifa. »Wenn er in die Berge fährt, haben wir ihn.«
»Gibt vorher jede Menge Abzweigungen.«
»Die meisten enden im Nichts.« Sie legt auf. Ich verlasse die Bäckerei, um meinen Wagen zu holen.
»Warte«, sagt Janeen. »Du hast deinen Kaffee nicht ausgetrunken.«
»Ein andermal.«
»Willst du noch den Dattelscone, den du bestellt hast?«
»Nein, danke.«
Wir treffen unsere tasmanischen Kollegen auf halbem Weg, in Rai Valley – einst ein Kuhdorf, jetzt ist auch die Kuh weg. Offensichtlich ist der Motorradfahrer irgendwo zwischen Havelock und hier von der Straße abgebogen. Ich bin bereits Umwege über Seitenstraßen und runter zum Hafen gefahren. Niemand hat ihn gesehen.
»Wo steckt er?«, frage ich unsinnigerweise.
»Mit einem neuen Motorrad wird er kaum über Schotterpisten brettern wollen«, sagt Latifa, und die Jungs aus Nelson nicken zustimmend. »Wahrscheinlich können wir uns also auf asphaltierte Straßen beschränken.«
Wir teilen uns auf und kehren zu unseren Fahrzeugen zurück. »Keine Alleingänge. Wer ihn sieht, macht Meldung und wartet auf Verstärkung.«
»Meinen Sie, der Spezialtrupp sollte anrücken?«, fragt ein Constable aus Nelson namens Blakiston.
Die bewaffnete Spezialeinheit? Ich überlege kurz. »Er ist mit Sicherheit ein Kämpfer, aber Schlagstöcke und Taser sollten ausreichen. Bisschen Pfefferspray.«
Latifa sieht aus, als würde sie sich darauf freuen.
Die Nelson-Jungs decken die Gegend zwischen Rai Valley und der Pelorus Bridge ab, wir übernehmen den Rest zwischen hier und Havelock.
»Er könnte längst umgedreht haben und in Richtung Osten unterwegs sein«, sage ich düster. »Ich hab's verbockt. Ich hätte mich nicht so von ihm überrumpeln lassen dürfen.«
»Reg dich ab, Sarge. Das war nicht deine Schuld, du bist auch nicht mehr der Jüngste.« Latifa liest eine Nachricht, die gerade auf ihrem Handy eingegangen ist. Da ihre Miene weich wird, stammt sie wohl von ihrem Verlobten, dem rasenden Daniel – netter Junge, aber die Hölle auf Rädern. »Wir kriegen ihn, wenn nicht jetzt, dann später.«
Latifa übernimmt die zehn Kilometer zwischen Havelock und Canvastown, ich den Rest. Wir verabreden, uns auf halbem Weg am Trout Hotel zu treffen. Zwei Stunden auf kleinen Straßen und mit Tür-zu-Tür-Befragungen später ist es weit nach Mittag, und ich bereue, den Scone beim Bäcker gelassen zu haben. Unter der Woche ist es im Trout erwartungsgemäß ruhig. Wobei am Wochenende auch nicht gerade viel los ist.
»Das Übliche, Nick?«, fragt der Wirt, als wäre ich erst gestern dagewesen, nicht vor zwei Monaten.
»Bin im Dienst. Ginger Beer wäre gut. Gibt's was zu essen?«
Er deutet auf die Speisetafel an der Wand. »Aber die Küche ist zu.«
Ich sehe auf die Uhr. »Um halb zwei?« Er zuckt die Achseln. »Dann eine Tüte Chips. Salt 'n' Vinegar.«
»Gute Wahl.« Er sieht meine Kollegin an. »Latifa?«
»Das Gleiche, danke.«
Ich frage ihn, ob er einen Ami auf einer großen neuen Harley gesehen hat.
»Brandon? Ja, der wird oben im alten Jagdhaus sein. Hab ihn vor ein paar Stunden gesehen.«
»Ich dachte, das Jagdhaus wäre wieder auf dem Markt?«
»Nicht mehr.« Er tippt sich an die Nase. »Ich bin immer auf dem neuesten Stand.«
Wir stürmen zur Tür raus. »Dein Wagen?«, frage ich. Dort liegt das Gewehr.
Hinter uns wird gerufen. »Sechzehn Dollar für die Getränke und die Chips. Ich schreib's auf deinen Zettel, Nick.«
Das Jagdhaus liegt ein Stück weiter oben, gegenüber einer Weide, auf der ein paar Pferde grasen. Es hat nie ein »Zu verkaufen«-Schild davorgestanden, das hätte sich nicht gelohnt. Wer hier wohnen wollen würde, kommt nicht zufällig vorbei. Das Tor ist neu. Groß, solide und geschlossen. Die Kollegen aus Nelson sind auf dem Weg. Geschätzte Ankunftszeit in fünf Minuten.
»Drüberklettern?«, fragt Latifa.
»Da ist ein Klingelknopf.« Ich drücke.
Nichts. Ich drücke noch mal.
»Ja?«
Ich zucke zusammen. Hat er sich von hinten angeschlichen? Ich mache mich für einen erneuten Schlag in den Magen bereit. »Hier oben. Im Baum links.« Jetzt sehe ich es. Eine Kamera und ein kleiner Lautsprecher.
»Polizei«, sagt Latifa. »Machen Sie auf, wir wollen mit Ihnen reden.«
»Worüber?«
»Tätlicher Angriff.«
»Verschwindet.«
»Machen Sie auf, oder wir kommen mit der bewaffneten Spezialeinheit zurück, rammen ihr Tor ein und nehmen Sie fest.«
»Das ist ein Privatgrundstück.«
»Wir bringen einen richterlichen Beschluss mit.«
»Ja, macht das.«
Latifa ist es nicht gewohnt, so abzublitzen.
Die Nelson-Jungs treffen ein. Blakiston bewundert das hohe Tor. »Tawa. Gutes hartes Holz, mit Stahl verstärkt. Beeindruckend.«
Latifa sieht mich an. »Was ist dieser Brandon für ein Typ?«
»Irgendein Yankee, dem leicht die Sicherung durchbrennt.«
Der Baum sagt, »Das hab ich gehört.«
»Ich weiß nicht, für wen Sie sich halten, aber Sie schaufeln sich gerade Ihr eigenes Grab.« Latifa schüttelt einen tadelnden Finger. »Sie haben einen Polizisten angegriffen, und Sie müssen uns jetzt entweder reinlassen oder selber rauskommen und mit uns reden. Wir gehen nicht weg.«
Ein Kichern, ein Klicken, dann schwingen die Torflügel langsam auf. Ich weise die Nelson-Jungs an, hierzubleiben und sich bereitzuhalten. Latifa und ich steigen in den Wagen und fahren die steile Auffahrt hoch. Nach einem kurzen Stück kommt etwas, das wie ein Torwächterhäuschen aussieht, umgeben von makellos gepflegtem Rasen und einer Mischung aus einheimischen und importierten Büschen und Bäumen. Schließlich erreichen wir oben auf dem Hügel das Jagdhaus, ein sechseckiges Gebäude aus Kiefernholz mit bodenlangen Fenstern, vielen Antennen auf dem Dach und einigen Nebengebäuden. Die umliegenden Hügel sind vor Kurzem bis auf den Erdboden abgeholzt worden. Der Gegensatz zwischen manikürter Luxuswelt und Kahlschlag könnte krasser nicht sein.
»Rancho-Spinner«, murmelt Latifa.
Wir steigen ein paar Treppenstufen auf eine lange, breite Veranda hoch, die Haustür geht auf, heraus tritt der Mann, der mich in der Bäckerei zu Boden geprügelt hat. Er hebt eine Hand. »Nicht näher.«
Latifa schüttelt den Kopf. »Ich glaube, Sie kapieren nicht, Mister. Wir sind hier, um Sie festzunehmen. Drehen Sie sich um und stellen Sie sich mit den Händen hinter dem Rücken an die Wand.«
»Ihr macht einen Riesenfehler.«
Ich ziehe den Schlagstock. »Tun Sie, was sie gesagt hat.«
Latifa hat den Taser vom Gürtel genommen. »Drei Sekunden.«
Er lächelt, hebt die Hände und dreht sich um. »Wie heißt du, Schwester? Du gefällst mir.«
Latifa legt ihm Handschellen an, tritt seine Füße auseinander, drückt ihn auf die Knie runter. »Wie lautet Ihr Name? Brandon wie?«
Er atmet tief ein. »Du riechst gut.«
Sie greift zum Pfefferspray und sprüht ihm die Ladung ins Gesicht. »Was riechst du jetzt, Arschloch?«
Mit tränenden Augen und brennendem Gesicht liegt er auf der Veranda und lächelt immer noch. Gluckst regelrecht. »Ich sehe, wir werden uns sehr gut verstehen, Schwester.«
2
»Er heißt Brandon Cunningham und kommt aus Shitsville, South Dakota.« Latifa hat diesen verhangenen Blick drauf, als hätte sie eine Spur erschnüffelt. Sie scrollt weiter. »Ist mit einem Entrepreneur Business Visum im Land. Er kommt mit den Händen voll Geld, hat zwei Millionen in ein Tourismusunternehmen draußen in den Sounds gesteckt.«
»Was für eins?«
»Wiederaufbau der alten Farm gegenüber von Maud Island. Als Wellness Retreat für Erwachsene, steht im Visumsantrag.« Sie schüttelt den Kopf. »Māhana. Für wen hält der sich?«
Ich verstehe die kulturelle Referenz nicht und nehme an, Latifa flucht auf Māori. »Er kommt mir nicht wie ein Wellness-Guru vor.« Mir tut von dem Schlag immer noch der Magen weh.
»Ein Ekel, wenn du mich fragst.«
»Und er kann es sich leisten, eine Anwältin aus Wellington einzufliegen.«
»Und das Haus da oben in Wakamarina ist ein ziemlich großes Ding für einen so kleinen Mann.« Latifa loggt sich aus. »Was hat er wirklich vor?«
»Das fragen wir ihn, wenn seine Anwältin da ist.«
Wir haben unsere Zelte fünfzig Kilometer südöstlich in Blenheim aufgeschlagen, der nächsten Polizeiwache mit Haftzellen. Cunningham ist nebenan im Wairau Hospital durchgecheckt worden, seine Augen brennen nicht mehr. Der Commander in Blenheim hat Interesse bekundet und will wissen, ob ich Hilfe brauche. Vielleicht sollte einer seiner Detectives anwesend sein?
»Dürfte nicht nötig sein, Sir. Es geht um leichte Körperverletzung. Ich halte es nicht für notwendig, die Sache zu verfolgen, möchte mit ihm aber über sein Verhalten reden.«
»Er hat Sie vor Zeugen tätlich angegriffen. Normalerweise lassen wir so was nicht durchgehen. Schlecht für die Moral und die PR.«
»Vielleicht erspart uns ein bisschen lange Leine auf längere Sicht Zeit und Ärger. Seine Staranwältin könnte uns monatelang beschäftigen. Eine Verwarnung von mir verhindert vielleicht eine Eskalation.«
»Ihre Sache, Nick. Seine Anwältin hat mich bereits kontaktiert, bevor sie in den Flieger gesprungen ist. Er scheint gut vernetzt zu sein. Passen Sie auf.«
»Mache ich.«
Die Anwältin trifft am frühen Abend ein. Die Sommerzeit ist seit ein paar Wochen vorbei, die Nächte werden länger, bis ich zu Hause bin, wird es dunkel sein. Ich habe Vanessa Bescheid gesagt, sie hält mir Essen und Bett warm. Latifa und ich haben im Café gegenüber vor Feierabend gerade noch ein Sandwich ergattern können. Wir sind satt und bereit.
»Mr Cunningham scheint Augenverletzungen aufgrund von Pfefferspray erlitten zu haben.« Die Anwältin heißt Helen Kostakidis und vertritt normalerweise entweder Biker oder Banker. Sie ist Spitzenklasse: teils Schuldirektorin, teils Topchirurgin, teils Käfigkämpferin.
Brandon schüttelt den Kopf. »Das war ein Versehen. Die Polizistin hat mir ihr kleines Spielzeug bloß gezeigt, da ist es losgegangen.« Er lächelt Latifa an. »Nicht der Rede wert. Stimmt doch, Süße?«
»Für Sie Constable Rapata.«
»Hübscher Name.«
»Da wäre auch noch der von Mr Cunningham auf mich verübte Angriff.« Ich beuge mich vor. »Ohne Anlass und vor Zeugen.«
Die Anwältin schaut von ihrem Notizblock auf. »Haben Sie die Zeugenaussagen, Sergeant? Namen?«
»Kann ich innerhalb von vierundzwanzig Stunden einholen.«
»Dann können wir vielleicht alle nach Hause gehen«, sagt Kostakidis. »Und morgen wiederkommen.«
»Oder wir können Mr Cunningham deutlich machen, dass es bei uns in Neuseeland so nicht läuft. Wir sind hier nicht in South Dakota. Reich, arm, das Gesetz behandelt alle gleich.«
Cunningham grinst. »Glauben Sie das echt, Buddy? Ganz im Ernst?«
Latifa sieht mich von der Seite an. Vermutlich ist sie in diesem Punkt mit Brandon einer Meinung. »Das ist der Grundsatz, nach dem ich handle, Mr Cunningham. Ich bin bereit, die Sache fallen zu lassen, um mir den Papierkram zu ersparen. Aber Sie müssen sich an die Regeln halten, Kumpel, oder Sie werden eine Menge Ärger bekommen.«
Kostakidis wendet sich an Cunningham. »Ich finde, der Sergeant verhält sich äußerst großzügig und pragmatisch. Vielleicht wäre eine Entschuldigung angemessen?«
Brandon hält mir die Hand hin. »Tut mir leid, Mann. Vergeben und vergessen?«
Ich schüttle sie kurz. »Was haben Sie für Pläne, Mr Cunningham? Die Gegend hier dürfte doch kaum Ihr Ding sein.«
»Was ist denn mein Ding?«
»Hinterwald. Country and Western. Bestechliche Cops. Alles ist käuflich.«
»Kein Grund, unhöflich zu werden, Sergeant.« Kostakidis packt ihre Aktentasche. »Alles gut und wieder Freunde. In Ordnung?«
Cunningham steht auf. »Hinterwald, hm?« Betrachtet die Plakate an der Wand: Brennholzdiebstahl, Jagdvergehen, gesuchte Junkies. »Sieht aus, als hätte ich hier ein zweites Zuhause gefunden.« Ein Blick auf Latifa. »Und ich bemühe mich, die lokale Polizei für mich zu gewinnen.«
Ich würde ihm gern eins mit dem Schlagstock überziehen. Ihm noch mal das Pfefferspray in die Fresse jagen. Oder ihn sogar erschießen. »Also, was suchen Sie hier?«
»Wellness.« Er grinst. »Und können wir das nicht alle gebrauchen?«
Als ich die Talstraße entlangfahre, sehe ich, dass das Tor am Jagdhaus geschlossen ist. Ich habe Latifa zu Hause in Havelock abgesetzt, es war deutlich zu spüren, dass Cunningham ihr zugesetzt hatte.
»Alles okay?« fragte ich.
»Ja. Er ist nicht das erste Ekel, das mir Angst einjagen will. Heiß duschen, kuscheln mit Daniel, eine Tasse Tee, und er ist Geschichte.«
Aber ich habe sie nie so … wie? erlebt. Nicht Latifa.
Cunningham ist ein Arschloch, aber hoffentlich klug genug, uns nicht zu provozieren. Wenn er irgendwelche Schandtaten plant, wäre es dumm, uns unnötigerweise auf seine Spur zu locken.
Zuhause brennt Licht. Paulie ist im Bett, Vanessa bereitet den Unterricht für morgen vor. Fünfundzwanzig Kinder, unterschiedliche Lernbegabungen, ein halbes Dutzend Fächer. Sie wird bis Mitternacht beschäftigt sein. Zur Begrüßung ein gedankenverlorener Kuss auf die Wange.
»Abendessen steht im Kühlschrank. Spag bol. Steck's in die Mikrowelle. Guten Tag gehabt?«
»Bin von einem Psycho niedergeschlagen worden und hab von meinen Vorgesetzten einen beschissenen Babysitterjob aufgedrückt bekommen. Und du?«
»Ähnlich. Aber er hat danebengeschlagen und stattdessen einen Stuhl getroffen. Und den ganzen Vormittag geheult.« Sie klappt einen Aktenordner zu und den nächsten auf. Die Mikrowelle fiept. »Was für ein Psycho?«, fragt sie über den Brillenrand hinweg. Die Brille ist neu, sie steht ihr. Manchmal behält sie sie beim Vögeln auf, das ist ziemlich erregend.
»Ein Nachbar. Amerikaner. Wohnt im Jagdhaus.«
»In Andreis alter Bude? Ich habe da in letzter Zeit öfter Fahrzeuge gesehen. Hab mir schon gedacht, dass jemand eingezogen ist.«
»Du hast nie was erwähnt.«
Ein Achselzucken. »Valleytratsch ist nicht mein Ding. Ich weiß durch die Schule schon mehr über das Privatleben der Leute, als mir lieb ist.«
»Na gut.«
»Riesenkerl, ja?«
»Nicht wirklich. Glückstreffer.«
»Hast du ihn verhaftet?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Schwamm drüber, geht vorbei?«
»Das sieht dir gar nicht ähnlich.«
Ich sauge eine Nudel ein. »Ich glaube, er gehört zu den Menschen, die bei Konflikten aufblühen. Er ist reich, hat eine Top-Anwältin, gibt nie auf, muss unbedingt gewinnen. Mr Privileg. Das Leben ist zu kurz. Ich werde ihm den Gefallen nicht tun.«
»Ich habe solche Kinder in meiner Klasse.«
»Tja, und jetzt haben wir eins als Nachbarn.« Ich kann das Gähnen nicht unterdrücken. Mein Kopf fühlt sich wattig und schwer an, das Licht ist zu hell. Ein Aspirin sollte helfen. »Wir sehen uns im Bett.«
»Ich komme in ein, zwei Stunden, um dich zu vernaschen. Halt dich bereit.«
Dann bringe ich mich wohl besser in Form.
Freitag. Latifa und ich grasen abwechselnd den SH6 nach Missetätern ab. Wieder ein schöner, klarer Apriltag, niemand scheint allzu große Dummheiten zu machen. In den Nachrichten verspricht die neugewählte linksliberale Regierung, viele der sozialen Probleme zu lösen, die ihre Vorgängerin ihr hinterlassen hat. Das ist ambitioniert und könnte sich als leere Versprechungen erweisen, aber es ist eine willkommene Abwechslung, mal jemanden mit guten Absichten zu hören. Im Gegensatz dazu kommt von beiden Seiten jenseits des großen Teichs nichts als die übliche Gehässigkeit und Boshaftigkeit. Ich verstehe langsam, warum die Kiwis den Unterarmwurfzwischenfall nicht vergessen können, auch nicht nach über dreißig Jahren. Typisch Australier, echt. Wer ist so sehr auf einen Kricketsieg aus, dass er einen unschlagbaren Ball über den Boden rollert, als würde man ihn einem Kleinkind zuwerfen? Ja, armselig und fies, genau wie die ganze australische Politik heutzutage. Rassistische Flat-Earther, alle miteinander. Und was die Amis angeht, hört mir bloß auf. Eine Nation voller Brandon Cunninghams: aufmerksamkeitssüchtige, egoistische Gören. Oder vielleicht gilt das nur für den Präsidenten. Jede seiner Launen und Wutanfälle schiebt uns näher an den Abgrund. Wie wäre es mit ein bisschen Musik? Brian FM. Talking Heads. »Road to Nowhere«. Faust aufs Auge.
Mein Handy klingelt. Latifa. »Bist du in der Nähe, Sarge?«
»Am Schuhzaun. Fünf Minuten. Warum?«
»Es gibt einen Zwischenfall im Havelock Hotel.«
»Zwischenfall?«
»Ein Typ lässt einen anderen über die Balkonbrüstung baumeln. Droht, loszulassen.«
Es sind nur wenige Meter bis dort.
»Bis gleich.«
Ich erkenne die beiden sofort. Der eine ist Bruce Gelder, der Goldschürfer, den ich gestern Morgen im Zielfernrohr hatte. Der andere ist ein Hobbygoldsucher namens Doug. Er ist derjenige, dessen Kopf nach unten hängt. Latifa rollt zur Begrüßung mit den Augen. »Ich hätte ihn selber getasert, Sarge, aber ich wollte vermeiden, dass er loslässt.«
»Ich hab's ihm tausendmal gesagt«, ruft der Schürfer. »Halt dich von meinem Claim fern.«
»Ziehen Sie ihn zurück über die Brüstung, Bruce.« Ich hebe beruhigend die Hand. »Es ist nicht nötig, dass es Verletzte gibt.«
Die gedämpfte Stimme des Hängenden. »Goldwaschen ist überall erlaubt, du Idiot. Claim hin oder her.«
»Er stiehlt mir mein Gold.«
»Was für Gold, du verdammter Blödmann«, sagt ein Oldie, der an der Bar vor seinem Bier hockt. »Hier gibt's keins. Haben sie letztes Jahrhundert alles schon mitgenommen.«
»Du findest doch nicht mal deinen Schwanz in der Hose«, sagt Bruce. »Halt die Klappe.«
Ich nehme meinen Taser vom Gürtel. »Ziehen Sie Doug wieder hoch, Bruce.«
Bruce schüttelt Doug noch einmal. »Bleib weg von meinem Claim. Letzte Warnung.« Und zieht ihn hoch in Sicherheit.
»Verpiss dich, Arschloch«, sagt Doug, zupft seine Kleidung und Haare zurecht und schiebt sich an mir vorbei. »Nehmen Sie ihn fest und werfen Sie den Schlüssel weg.«
Bruce Handschellen anzulegen, ist seltsam befriedigend. Fast so gut, wie ihn aus dem Hinterhalt abzuknallen. »Wir müssen uns mal unterhalten, Sie und ich.«
Quer über die Straße aufs Revier. Während Latifa den Bericht schreibt, setze ich Bruce an meinen Schreibtisch und zähle ihm die Anschuldigungen gegen ihn auf. Er kann in den nächsten Tagen mit einer Vorladung rechnen.
»Das ist nicht fair.«
»Sie haben Dougs Leben gefährdet. Wenn Sie ihn fallengelassen hätten, wär's das gewesen.«
»Der Mistkerl hat doch einen viel zu großen Dickschädel. Außerdem hab ich eine Genehmigung, er nicht.«
»Eine Genehmigung zum Schürfen, nicht zum Töten. Und das ist kein Exklusivrecht. Amateurgoldsucher dürfen überall waschen. Ich muss Ihnen doch nicht die Regeln erklären.«
»Jeden Tag, wenn ich gebaggert habe, kommt er an, sobald ich weg bin. Schmarotzer. Das ist mein Gold.«
»Haben Sie überhaupt schon was gefunden?«
»Nein. Ich warte auf einen guten Regenguss, der es runterspült.«
»Die Leute, die letztes Jahr hinter dem Pub Gold gefunden haben, das sind Experten. Sie sind wissenschaftlich vorgegangen. Und haben viel Geld investiert. Das heißt nicht, dass das ganze Valley wieder zum El Dorado geworden ist.«
»Wissenschaft? Was wissen Sie denn?«, fragt er. »Sie waren gegen meinen Aushubbagger.«
»Weil ich kein Industriegelände am Fluss will.«
»Gehen Sie dahin zurück, wo Sie herkommen.«
Ich reiche ihm den Papierkram. »Wir sehen uns vor Gericht. Machen Sie keinen Ärger und lassen Sie Doug in Ruhe.«
»Interessenkonflikt, um nichts anderes geht es hier. Keine Gerechtigkeit.«
»Hau ab, Bruce«, sagt Latifa hinter der Trennwand. »Du ödest mich an.«
»Das ist eine Verschwörung.«
Als er weg ist, setzen wir den Wasserkessel auf. »Gold macht wirklich seltsame Dinge mit den Menschen, wie?«, sinniere ich über meiner Tasse Tee.
»Bringt auf jeden Fall den Wichser in ihnen zum Vorschein.«
Reden wir von was anderem als Dummköpfen und Gold. »Wie geht's Daniel?«
»Gut, er fährt für ein paar Tage runter nach Christchurch. Seine Mutter hat Geburtstag.«
»Habt ihr schon einen Hochzeitstermin?«
»Noch nicht, vielleicht irgendwann im Frühjahr.«
»Er ist ein Glückspilz.« Ich hebe beglückwünschend meine Tasse.
»Das sage ich ihm auch immer wieder.« Sie trinkt aus und starrt in ihren leeren Becher.
»Alles okay?«
»Ja.« Zurück an den Schreibtisch. Ein Blick auf den Computerbildschirm. »Was machen wir jetzt? Dienstpläne oder Kriminalitätsstatistikanalyse?«
»Vielleicht ein bisschen raus auf Streife?«
»Wieder zum Bäcker? Bring mir ein Wurstbrötchen mit, Sarge. Ich halte hier die Stellung.«
Der restliche Tag vergeht mit einer Mischung aus Verkehrsüberwachung auf dem SH6, Präsenz im Ort zeigen, Papierkram und Zustellung von ein paar Strafbefehlen wegen Kleinkriminalität. Um fünf bin ich auf dem Nachhauseweg. Kurz vor der kleinen Siedlung in der Nähe des Pub läuft eine Dogge auf die Straße, stürzt sich wie wild geworden auf meinen Wagen und lässt sich nicht vertreiben. Der Hund gehört einer Familie, die von Sozialleistungen und Brennholzdiebstahl, Wilderei und Drogenhandel im kleinen Stil lebt. Außerdem veranstaltet sie regelmäßig laute Partys, denen ich auf Bitten der Nachbarn ein Ende setzen muss. Die Familie ist nicht besonders bösartig, einfach nur rücksichtslos und nervig. Die Nachbarn hassen sie und nennen sie die Von Crapps. Eine Teenagerin kommt auf die Straße gelaufen.
»Winston! Hör auf! Rein mit dir!«
Ich kurbele das Fenster runter. »Danke, Shanille. Du hast ein neues Tattoo, sehe ich.«
Sie legt den Kopf schief, damit ich lesen kann, was auf ihrem Hals steht. Himmel auf Erden. Wie nett.
»Sie bringen ihn doch nicht ins Tierheim, oder?«
»Es wäre gut, euer Tor geschlossen zu halten. Für alle sicherer. Für Winston auch.«
»Ja, nee.«
Es wird wohl nicht das letzte Mal gewesen sein. »Bis dann.«
Vier Kilometer weiter oben winkt mir mein Nachbar Charlie Evans zu. So viele Menschen auf der Straße. Ein Trubel wie in der Innenstadt von Auckland. Charlie hat ein »Zu verkaufen«-Schild vor seiner Hühner- und Alpakafarm aufgestellt, wird aber so bald nicht ausziehen. Das Schild steht schon seit sechs Monaten da. Ich halte an, steige aus und strecke mich.
»Wie geht's, Charlie?«
Er kratzt seinen weißen Bart und erschlägt eine Sandfliege. »Wie immer, wie immer.«
»Noch keine Interessenten?«
»Nee. Und jetzt, wo der Winter kommt, rechne ich auch nicht damit.«
»Und wie kommst du ohne Denzel klar?« Denzel ist der Junge, der ihm im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichprogramms zur Hand gegangen ist, als Wiedergutmachung für einen Armbrustanschlag auf ein Alpaka. Er hat sich vor Kurzem am Technikcollege in Blenheim eingeschrieben und lässt sich zum Maurer ausbilden.
»Halbwegs. Ich verkaufe die Tiere nach und nach. Lebe von Beatties und meinen Ersparnissen. Zu der Kreuzfahrt, die sie immer machen wollte, ist es nie gekommen.«
Charlie ist seit etwas über einem Jahr Witwer, und man merkt es ihm an. »Komm doch mal zum Essen vorbei. Wie wäre es nächstes Wochenende?«
»Danke, Nick. Ich ruf dich an, ja? Dann machen wir was ab.«
Tut er eh nicht. Wir führen bei jeder Begegnung das gleiche Gespräch, und keiner von uns macht den nächsten Schritt. Er zögert.
»Hast du was auf dem Herzen, Charlie?«
»Diese Leute, die ins Jagdhaus gezogen sind.«
»Leute? Als ich gestern da war, habe ich bloß einen gesehen.«
Kopfschütteln. »Heute waren zwei Minibusse auf dem Weg dahin.«
»Woher weißt du, wo die hinwollten?«
»Sie haben angehalten und mich aufs Korn genommen. Hatten alle den gleichen Akzent. Howdy und so. Ziemlich aggressiver Haufen.«
»Was hatten sie für ein Problem?«
Achselzucken. »Vermutlich hat ihnen meine Nase nicht gepasst.«
»Was haben sie gesagt?«
»Nichts Besonderes. Haben mich nur verarscht. Mich wie einen Hinterwäldler behandelt. Vielleicht hatten sie was getrunken, keine Ahnung.«
»Soll ich sie mir mal vorknöpfen?«
Er blinzelt in die untergehende Sonne. »Das wäre kein guter Auftakt, wenn ich sie wegen so einer Kleinigkeit verpfeife. Ihr Grundstück grenzt an meins.« Er dreht sich zu dem gerodeten Hügel hinter ihm um, der langsam wieder zuwächst. »Auf der anderen Seite von diesem Hügel.« Winkt ab. »Ist es nicht wert. In diesem Tal entstehen Fehden aus dem Nichts heraus und schwelen dann jahrzehntelang.«
»Trotzdem. Du musst dir so was nicht gefallen lassen.«
Er legt mir seine Hand auf die Schulter. »Bist ein Goldstück, Nick.«
3
Es gibt kaum etwas Langweiligeres als ein Filmset. Ein Haufen Leute, die ewig nur rumstehen: Beleuchtung, Kameras und so weiter, die Schauspieler in ihren Goldrauschkostümen rauchen und trinken Kaffee. Die Regisseurin berät sich mit dem Kameramann. Devon Cornish ist mit seinem Handy beschäftigt. Pech für ihn, die Chancen auf ein Netz stehen hier gleich null, selbst mit einem Satellitenhandy. Ich bin seit meiner Ankunft völlig überflüssig. Ein paar Filmstudierende vom NMIT, dem Nelson Marlborough Institute of Technology, haben den dünnen Dienstagmorgenverkehr umgeleitet. Fast niemand hatte damit ein Problem, sie waren beeindruckt vom Glamour des Filmsets und der Aussicht, echte Stars zu entdecken. Butchers Flat ist in das alte Goldfeld in Doom Creek verwandelt worden. Der ebene Campingplatz ist ideal geeignet, um ein Miniset aus maroden Goldrauschbaracken aufzustellen, die umliegenden Hügel, die Vegetation und der tosende Fluss geben eine spektakuläre Kulisse ab. Natürlich ist das eine idealisierte Version. Aufgeräumt, kantige Kinnpartien, weiße Zähne. Die Schwarzweißfotos in den Geschichtsbüchern dagegen zeigen harte, verbitterte, enttäuschte Gesichter und eine zerstörte Umwelt. Wir leben in einem geschichtsvergessenen Zeitalter. Die Lektionen liegen seit Jahrzehnten, wenn nicht gar Jahrhunderten vor uns, aber wir sind noch unwilliger als früher, daraus zu lernen. Das Wetter ist perfekt. Ein Blick auf die Uhr: halb elf. Noch sechs Stunden, und ich sterbe jetzt schon vor Langeweile. Im Ort ist es am Wochenende ruhig geblieben. Bruce und Doug sind sich nicht wieder in die Haare geraten. Brandon Cunningham hat niemanden drangsaliert. Alle sind vorsichtig gefahren. Aber selbst verglichen mit den letzten paar Tagen ist es heute wie tot.
Abgesehen davon, dass ich heute Morgen mit Blut an den Händen aufgewacht bin.
»Was ist das denn?«, fragte Vanessa, als sie die roten Schmierstreifen auf dem Laken entdeckte. »Hast du dich geprügelt?« Sie hat mitbekommen, dass ich in letzter Zeit noch reizbarer geworden bin. Es liegt nicht an mir. Es scheinen einfach auf einmal immer mehr Arschlöcher rumzulaufen.
»Nichts Ernstes«, log ich. »Kneipenklopperei. Der Wirt hat mich gebeten zu schlichten. Ich bin hingefallen und habe mir die Knöchel aufgeschlagen.«
»Davon stammt dann wohl auch der Riss in deinem Hemd.«
Ich hörte die Waschmaschine ins Schleudern übergehen und spürte die Dielen vibrieren. »Wie spät ist es?«
»Zeit zum Aufstehen. Paulie und ich fahren jetzt zur Schule, wir haben dich ausschlafen lassen, weil du so spät nach Hause gekommen bist.«
»Danke.«
»Du musst sowieso erst später los, oder nicht? Hoch zum Filmset?«
»Ja.« Wir gaben uns einen Abschiedskuss. »Bis heute Abend, Pet.«
»Könntest du die Maschine ausräumen, wenn sie fertig ist? Und die Wäsche raushängen?«
»Klar.«
Vanessa und Paulie machten sich auf den Weg, ich ging duschen. In der Hoffnung, dadurch wieder einen klaren Kopf zu bekommen, sodass mir einfallen würde, was gestern Abend passiert war. Aber nein. Alles gelöscht.
»Du hättest dir ein Buch mitbringen sollen.«
Thomas Hemi steht hinter mir. Ihm gehört das letzte Haus im Valley, noch ein Stück weiter den Hügel hoch. Er und seine Familie sind fast selbstversorgend: Gemüsegarten und Obstbäume bringen reiche Ernte, freilaufende Hühner, Schafe, gelegentlich schießen er und seine beiden Söhne ein wildes Schwein oder einen Hirsch, außerdem verkauft er legal erworbenes Brennholz, um die Nebenkosten und die Gemeindesteuer zu bezahlen. Sie sind sozusagen das Gegenteil der Von Crapps. Hemi ist nicht völlig autonom, aber nahe dran. Im Valley geht das Gerücht um, dass er eine Ladung Dynamit in petto hat, um, wenn die Zeit gekommen ist, die Deep Creek Bridge in die Luft zu jagen, damit die Zombies es nicht über den Abgrund schaffen. Das macht mir Sorgen, weil ich auf dieser Seite der Brücke lebe und mich noch nicht entschieden habe, welchem Team ich die Stange halten soll. Er hat Die Straße von Cormac McCarthy in der Hand. Passt.
»Gute Lektüre?«
»Bisschen düster, aber so ist die Apokalypse wohl. Bin überrascht, dass du hier rumhängst, Nick. Hast du nichts Besseres zu tun?«
»Nicht wirklich. Ich hoffe, ich komme als Statist zum Einsatz.«
»Viel zu sauber. Keine Chance.«
Er trägt ein kragenloses Hemd, das kunstvoll mit Dreck beschmiert ist. »Hast du denn eine Rolle?«
»Faltengesichtiger schockierter Goldgräber Nummer drei. Anscheinend bin ich bald dran.«
Er zeigt auf einen jungen Schauspieler, der gerade mit roter Flüssigkeit bespritzt wird. »Mein Ältester, Jaxon. Er wird gleich tot aufgefunden, und ich muss aus der Ferne angemessen beunruhigt wirken.«
»Kriegst du das hin?«
»Für zweihundert Eier am Tag geb ich dir Shakespeare, Kumpel.«
Jemand ruft etwas durch ein Megafon.
»Ich glaube, du bist dran.«
Thomas gibt mir sein Buch zur Aufbewahrung, nimmt eine Schaufel und stellt sich in Position.
Ich fange Devon Cornishs Blick auf und gehe zu ihm. »Sieht aus, als wäre hier alles unter Kontrolle, ich bin dann bald mal weg.«
Er schaut auf die Uhr. »Es steht noch einiges an. Wir hören sicher erst am späten Nachmittag auf, wenn sich das Licht ändert.«
Ich bin nicht dein verdammter Angestellter. »Trotzdem. Es sind keine störenden Autos zu sehen. Sie brauchen mich hier nicht.«
Wumm, wumm, wumm. Ich habe zu früh gesprochen. Ein Mule-Geländefahrzeug kommt den Weg herab: in Tarnfarben angemalt, Fahrer und drei Passagiere passend ausstaffiert. Ich erkenne Brandon Cunningham.
Die Regisseurin kriegt einen Tobsuchtsanfall und befiehlt einem Laufburschen, sich um die Sache zu kümmern. Alle halten inne in dem, was sie gerade tun, und schauen zu, wie der Buggy an einer Absperrung hält, die von einem blassen Jungen bemannt ist, der Cunningham nicht ansatzweise gewachsen ist. Ich schlendere hin. Die Rapmusik ist ohrenbetäubend, nicht mal die Leute im Buggy scheinen sie zu genießen.
»Könnten Sie das leiser machen? Oder noch besser ganz aus.«
»Sergeant Chester«, sagt Cunningham und dreht die Musik runter. »Ich wusste gar nicht, dass Sie im Filmgeschäft sind?«
»Wie Sie sehen, versuchen die hier zu arbeiten …«
»Arbeit? So nennen Sie das?« Der Fahrer neben Cunningham kichert, er ist zwanzig Jahre jünger und wirkt ähnlich drahtig fies.
Auf der schmalen Rückbank sitzen dicht gedrängt zwei größere Männer, einer haarig, der andere weniger. Auf der Pritsche liegen vier Jagdgewehre: Bushmaster Halbautomatik.
»Haben Sie dafür Waffenbesitzscheine?«
»Klar.«
»Zeigen.«
Sie reichen sie mir.
»Zufrieden?«, fragt Cunningham nach kurzem Schweigen.
Thomas Hemi gesellt sich zu mir, stellt sich vor und hält jedem im Buggy die Hand hin. Keiner ergreift sie, außer Cunningham, der zuzudrücken versucht.
»Oooh«, macht Hemi spöttisch. »Das ist aber ein starker Händedruck, mein Freund.« Er nickt in Richtung der Gewehre. »Für die Schweinejagd?«
Der große behaarte Typ hinten lacht. »So was Ähnliches.«
»Viel Glück«, sagt Thomas. »Ich glaube, ich habe gestern das letzte erwischt. Werden ein paar Tage lang keine da sein, denke ich.«
»Fachmann, wie?«, sagt der Typ hinten.
»Bin hier aufgewachsen. Unsere Leute sind seit langer, langer Zeit hier in der Gegend. Hab deinen Namen nicht gehört, Kumpel. Ich bin Thomas. Und du …?«
Cunningham unterbricht ihn. »Vielen Dank, Mr Hemi. Wir versuchen trotzdem unser Glück. Der Herr wird sicher für uns sorgen.« Er stößt den Fahrer an, der Motor röhrt auf. Eine Dreipunktwendung, dann holpern sie mit laut plärrender Musik wieder den steilen Hügel hoch.
Devon Cornish tritt auf. »Danke, dass Sie das geregelt haben. Die gefallen mir gar nicht.«
»Kein Problem.«
Er sagt ein paar Worte auf te reo Māori zu Thomas, nickt, lächelt uns an und geht.
»Was hat er gesagt?«
»Keine Ahnung, diese Stadt-pākehā denken, wir alle sprechen die Sprache. Ich hab höchstens Grundkenntnisse.« Das Megafon meldet sich wieder. »Ich geh mal wieder auf Position.« Er zeigt auf den sich entfernenden Buggy mit der wummernden Musik. »Sind das die neuen Leute im Jagdhaus?«
»Ja.«
»Amis.«
»Offenbar.«
Thomas hebt das Kinn. »Die rennen jetzt zu Tausenden hier rum, seit ihr Land den Bach runtergeht.«
»Komisch, wie? Dabei scheinen das genau die Leute zu sein, die so gewählt und das Ganze mit offenen Armen begrüßt haben.«
»Haben sich gebettet, aber wollen nicht drin liegen, wie? Vermutlich ist es klug, sich alle Optionen offen zu halten.«
»Doom Creek ist ein guter Name für das Schlupfloch von Survivalisten.«
Kopfschütteln. »Sogar da irren die sich. Das hat nichts mit doom, Untergang, zu tun. Es bezieht sich auf die Form der Felsen da oben. Dome, Kuppel. Der schottische Landvermesser hat es wie ›doom‹ ausgesprochen. Ich sag dir was, Kumpel.« Er stupst mir freundlich einen Finger in die Brust. »Komische Akzente bringen allen möglichen Ärger mit sich. Denk an meine Worte.«
Das Megafon. »Alle auf Position!«
Thomas zupft sein Hemd zurecht. »Wie sehe ich aus?«
Ich betrachte ihn. »Wie ein Valley-Hinterwäldler, der gleich den Schreck seines Lebens bekommt.«
»Ich glaube, du interpretierst da was rein, mein Lieber.«
Gegen Mittag mache ich mich vom Acker. Falls sie mit den Satellitenhandys ein Netz ergattern, können sie mich ja anrufen, sollten Cunningham und seine Freunde wiederkommen. Ich glaube nicht daran. Ich habe das Gefühl, er macht Druck und weicht zurück, macht Druck und weicht zurück. Wie um allen klarzumachen, dass er da ist und nicht mit sich spaßen lässt. Ein hohler, zielloser Störenfried, wie sein Präsident. Nicht daran interessiert, Menschen für sich zu gewinnen. Er hat seine Gefolgschaft um sich, mehr braucht er nicht. Das ist völlig okay, solange man sich um seinen eigenen Kram kümmert. Aber Brandon scheint es darauf anzulegen, uns auf die Palme zu treiben. Solcher Geltungsdrang kommt hier in der Gegend nicht gut an.
»Ist die Klappe schon gefallen?« Latifa ist gerade nach einer Session auf dem SH6 durch die Tür gekommen und schaut auf die Wanduhr. »Ihr Künstlertypen. Kein Stehvermögen.«
»Hast du schon Mittag gegessen?«
Hat sie nicht, wir begeben uns zur Bäckerei.
»Hey, Latifa«, sagt Janeen. »Ich hoffe, du passt auf den alten Knaben hier auf. Ist nicht mehr so schnell auf den Beinen wie früher.« Sie boxt in die Luft, zwinkert mir zu, schaufelt den Kaffee in die Maschine und nimmt einen Becher aus dem Regal.
»Porzellan?«, frage ich. »Hat dir jemand ein schlechtes Gewissen eingeredet?«
»Ich hab nachgelesen. Er hatte recht, dieser Ami. Vollwichser, aber er hatte recht. Es ist nicht nötig, dass die ganzen Styropordinger direkt auf die Müllkippe wandern. Da ist nicht genug Platz.«
»Was ist mit dem Wasser für die Spülmaschine?«, gibt Latifa zu bedenken. »Ist das keine Verschwendung?«
»Kann man im Garten recyceln. Außerdem ist das ein Wassersparmodell.« Sie gibt mir den Becher.
»Das war den Schlag fast wert.« Wir setzen uns mit dem Kaffee und Latifas L&P an einen Tisch. Janeen bringt meinen Lamm-Pie und Latifas Schinkenbrötchen und geht wieder hinter die Theke.
»Sind auf dem SH6 irgendwelche Strafzettel angefallen?«, frage ich Latifa.
Kopfschütteln. »Alles ruhig.«
»Ist Daniel schon aus Christchurch zurück?«
»Nee, seiner Mutter geht's nicht gut. Er bleibt die Woche über da.«
»Was Ernstes?«
»Ich glaube nicht. Wahrscheinlich trägt sie ein bisschen dick auf, damit er länger bleibt. Ich kann sie verstehen.« Sie beißt ab. »Und, wie war es oben am Filmset?«
»Viel Rumgestehe. Aus der Nähe gar nicht glamourös.«
»Hat dich Devon Wieheißternoch früher gehen lassen?«
»Ich wurde nicht gebraucht. Na ja, abgesehen von dem einen Mal, als Cunningham aufgetaucht ist.«
»Was wollte er?«
»Das Übliche. Aufmerksamkeit für seine dicke Hose.«
»Hat er sie bekommen?«
»Nein, er ist ziemlich schnell wieder abgehauen. Thomas Hemi hat die Muskeln spielen lassen.«
»Thomas?«
»Er macht im Film als Statist mit.«
Latifa trinkt einen Schluck L&P. »Thomas ist jemand, mit dem man sich keinen Ärger einhandeln sollte.«
»Hart?«
»Und wie. Er hält sich zurück. Im marae oder bei irgendwelchen Gemeindezusammenkünften sieht man ihn kaum. Er hat für so was nichts übrig, schon lange nicht mehr. Die Leute reden von ihm als dem großen Anführer, den sie nie haben werden.«
»Jeder wie er mag.«
»Wie hat er Cunningham denn verjagt?«
»Eigentlich gar nicht. Hat ihm die Hand gegeben und sich vorgestellt.«
Sie nickt. »Mana.«
»Was?«
»Stell dir Jedi-Gedankentricks vor und verdoppele das.«
»Hast du nicht gesagt, er hat für so was nichts übrig?«
»Wer hat, der hat. Ob man will oder nicht.«
Der Nachmittag verläuft routinemäßig, bis Vanessa anruft, die gerade mit Paulie nach Hause gekommen ist. »Ich glaube, die Wasserpumpe ist kaputt.«
Mist. Ich bin nicht gerade der geschickteste Handwerker der Welt. »Hast du den Stromschalter überprüft? An- und ausgeschaltet?«
»Ja, und die Hähne in den Nebengebäuden aufgedreht, falls sich irgendwo eine Luftblase gebildet hat. Das Übliche. Der Tank dürfte nicht leer sein, wir haben wochenlang jede Menge Regen gehabt.«
»Soll ich den Klempner anrufen?«
»Nee, das kann ich selber tun. Ich probiere es noch mal mit dem Stromschalter an der Pumpe.«
Zwei Minuten später ruft sie wieder an.
»Jemand hat ein Loch unten in den Wassertank geschossen.«
»Scheiße.« Das Valley ist bekannt für Querschläger. Jäger und Dummköpfe und manchmal beides in einem. Man gewöhnt sich daran. »Ich hole aus dem Bootsladen was zum Stopfen und sage der Feuerwehr, sie soll rausfahren und den Tank auffüllen.« Ich schaue auf die Uhr. »Bin in zwanzig Minuten da.«
»Bring lieber ein paar Wasserflaschen aus dem Four Square mit, damit wir bis morgen früh genug haben.«
»Mache ich.«
Während ich mit dem Notfallwasser und Harz für das Leck die Valley Road hinauffahre, gehen mir düstere Gedanken durch den Kopf. Natürlich könnte es bloß ein Unfall sein, der Querschläger eines Jägers. Es ist die beste Jagdzeit für Hirsche, Schüsse sind im Valley noch öfter zu hören als sonst. Aber ich habe beschlossen, dass es Brandon Cunningham und seine Gang waren. Als ich am Jagdhaus vorbeifahre, stelle ich mir vor, dass er mich durch die kleine Kamera im Baum beobachtet und sich ins Fäustchen lacht.
Später. Versprochen.
Vanessa ist hektisch, und Paulie steht neben sich. Er mag es nicht, wenn die Dinge nicht nach Plan laufen. Ich kenne das Gefühl. Er betrachtet die mitgebrachte Palette mit vierundzwanzig Wasserflaschen kritisch. »Damit kann ich nicht duschen.«
»Das ist zum Trinken.«
»Was ist mit meiner Dusche?«
»Achseln und Klöten heute Abend, Liebling«, sagt Vanessa. »Wenn es morgen nicht behoben ist, fahren wir nach Blenheim ins Schwimmbad.«
»Keine Dusche?«
»Heute Abend nicht.«
Er mustert erneut die Wasserflaschen. »So viel Plastik, Dad. Du solltest dich schämen.«
Ich runzle die Stirn, er bricht in Kichern aus. Er kriegt es immer besser hin, mich mit ernster Miene aufzuziehen. Im letzten Tageslicht gebe ich mir Mühe, das Loch im Tank zu stopfen, und Marvin der Wassermann hat versprochen, gleich morgen früh mit dem Löschwagen zu kommen und den Tank zu füllen. Der Abend vergeht wie so viele: Paulie versucht, seine Zubettgehzeit hinauszuzögern, Vanessa kämpft gegen einen Berg Arbeit für die Schule an, und ich betrachte aus dem Fenster das sich verändernde Licht im Valley, brüte und beschwöre neue Geister herauf, die es zu bezwingen gilt. Ich spüre meine aufgeschrammten Knöchel und versuche, die Erinnerung an die verlorenen Stunden wiederzufinden. Hinter meinen Schläfen pocht es dumpf, das habe ich in letzter Zeit häufiger.
»Solche Dinge passieren eben, Liebling.« Vanessa pult zwei zusammengeklebte Seiten im Heft eines Schülers auseinander. »Es ist bloß ein Loch im Tank, kein Weltuntergang.«
4
Am nächsten Morgen bin ich auf dem Weg ins Valley versucht, bei Cunningham vorbeizuschauen und nach dem Wassertank zu fragen. Aber wozu? Er braucht nur nein zu sagen, er war es nicht. Wegen einer solchen Bagatelle kann ich ihm schlecht die Kriminaltechnik auf den Hals schicken. Harz drauf, fünfzig Dollar fürs Auffüllen, weiter geht's. Die Kugel liegt wahrscheinlich auf dem Grund des Tanks, aber ich habe keine Lust, sie rauszufischen. Trotzdem, Cunningham braucht einen Schuss vor den Bug. Er scheint die erste Warnung nicht gehört zu haben.
Charlie Evans winkt mir vor seinem Tor zu. In seinem »Zu verkaufen«-Schild ist ein Schussloch. Ich habe wohl das Memo mit Hinweisen zur Nationalen Woche der Querschläger nicht bekommen. Allerdings ist ein solcher Anblick nicht ungewöhnlich, die meisten »Jagen verboten«-, »Hunde nicht erlaubt«-, »Kein Durchgang«- und Tempolimitschilder werden beschossen. Das ist die Valley-Version der Meinungsfreiheit. Gilt das jetzt auch für Wasserspeicher?