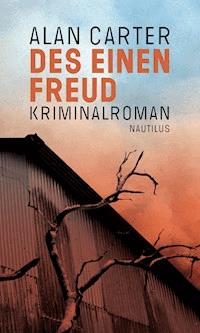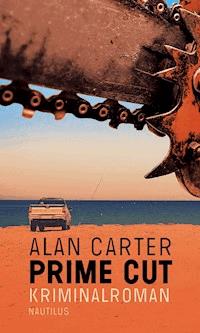
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Hopetoun, Westaustralien: In der Nickelabbau-Boomtown wird ein kopfloser menschlicher Torso ans Ufer geschwemmt. Gelegenheit für den in Ungnade gefallenen ehemaligen Vorzeigebullen Cato Kwong, sich zu beweisen. Der Polizist chinesischer Abstammung will weg von dem Posten, auf den er zwangsversetzt wurde. Nachdem der zum Torso gehörende Kopf gefunden wurde, weiß die Polizei zwar, dass der Tote ein Chinese ist, und ein Minenarbeiter gesteht den Mord an seinem Kollegen, doch das Geständnis scheint der Polizei erkauft. Steckt ein polizeibekannter Drogendealer hinter den Verbrechen? Gleichzeitig sucht der britische Ex-Detective Stuart Miller nach einem Mann, der vor 30 Jahren in England seine eigene Familie umgebracht hat und nun in Australien aufgetaucht zu sein scheint. Als es auch unter den Polizisten Tote gibt, muss Cato feststellen, dass er zwar den kriminellen Bodensatz der Stadt aufgewirbelt hat, aber der Lösung nicht näher gekommen ist. Prime Cut hat alles, was ein Spitzenkrimi braucht: Der Außenseiter Cato Kwong ist ein vielschichtiger Ermittler und hat das Zeug zum Serienhelden. Der Dokumentarfilmer Alan Carter zeichnet die Atmosphäre der kleinen Minenstadt am Rand der Welt mit britischem Wortwitz und großem Gespür für soziale Brüche. Ein großartiges Debüt in der Tradition Arthur W. Upfields, Garry Dishers, Michael Robothams und Peter Temples.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
ALAN CARTER
PRIME CUT
KRIMINALROMAN
AUS DEM AUSTRALISCHEN ENGLISCHVON SABINE SCHULTE
Dieses Buch wurde mit Unterstützung des Australia Council for the Arts, des staatlichen Förderungsorgans für die Kunst, veröffentlicht.
Die Originalausgabe des vorliegenden
Buches erschien unter dem gleichlautenden
Titel bei FREMANTLE PRESS, Fremantle,
Western Australia, 2011
Edition Nautilus Verlag Lutz Schulenburg
Schützenstraße 49 a · D - 22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten · © Edition Nautilus 2014
Deutsche Erstausgabe Februar 2015
Umschlaggestaltung: Maja Bechert, Hamburg
www.majabechert.de
1. Auflage
Print ISBN 978-3-89401-812-2
E-Book ePub ISBN 978-3-86438-169-0
Für meine wunderbare Frau Kath,
weil sie mir hilft,
den Traum zu verfolgen
INHALT
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
EPILOG
Dank
PROLOG
Samstag, 5. Mai 1973. Später Nachmittag.Sunderland, England.
Etwas verändert sich, das spürt er. Das Kräfteverhältnis verschiebt sich. Der Underdog knurrt. Gleich werden die Sanftmütigen die Erde erben. In seinen Augen flackern die Farben des Bildschirms, und er beugt sich vor, presst die Finger tiefer in die Sessellehne. Die Härchen auf seinem Arm richten sich auf und knistern wie ein reifes Feld vor einem Gewitter.
»… Hughes aus der Ecke, der Ball geht an Porterfield. Er ist drin! Porterfield schießt ein Tor für Sunderland …«
Er springt auf, bespritzt den Farbfernseher mit seinem Double Diamond und dreht sich zu seiner Frau Chrissy und dem kleinen Stephen um, die auf der Couch sitzen.
»Hast du das gesehen, Schatz? Was, mein Sohn? Brillant!«
Er trinkt einen großen Schluck aus der Bierdose. Ein bisschen läuft daneben, rinnt an seinem Kinn hinunter und auf sein rotweiß gestreiftes Hemd. Er führt ein Freudentänzchen auf. Die Spieler im Fernsehen umarmen und küssen sich. Das war völlig unvorhergesehen. Er zündet sich eine Embassy Regal an und zieht den Rauch tief in die Lungen. In Zeitlupe wird das Tor ein drittes Mal gezeigt, ein viertes. Er fragt noch einmal.
»Habt ihr das gesehen? Irre.«
Chrissys Hand ruht leicht auf ihrem schwangeren Bauch. Der kleine Stevie lehnt sich an seine Mama. Nein, Chrissy und Stevie haben das Tor nicht gesehen. Zu diesem Zeitpunkt sind sie schon mindestens zwei Stunden tot. Der schwarzbraune Yorkshire Terrier leckt unsicher an dem Blut auf dem billigen Paisley-Teppich.
Maud Street: Zweistöckige Reihenhäuser aus rotem Backstein, auf jeder Straßenseite dreißig, dicht gedrängt wie in einem schlecht sitzenden Gebiss. An dem Absperrband vor Nummer 11 sammelte sich bereits eine Menschenmenge. Wie viele andere auch präsentierte dieses Haus in den Fenstern die Teamfarben Rot und Weiß, zusammen mit einem »Ha’way the Lads«-Poster aus dem Sunderland Echo. Detective Sergeant Stuart Miller trat über die Schwelle. Chris Lawton, sein junger Assistent, folgte ihm.
Im vorderen Zimmer befragte eine Polizistin gerade die Nachbarin. Bei ihrem Anruf hatte sie angegeben, sie habe kurz reinschauen wollen, um den Sieg mitzufeiern, und da habe sie die beiden gefunden. Die Frau war klein und dünn, hatte braun gefärbtes Haar und die gelben Finger einer Kettenraucherin. Mit zitternden Händen zündete sie sich an ihrer Kippe die nächste Zigarette an und schnippte den erloschenen Stummel dann in den Kamin. Die Beamtin schaute auf, begegnete Millers Blick und nickte in Richtung Nebenzimmer.
»Kein schöner Anblick, Sir.«
Miller holte tief Luft und ging hinein.
Der Fernseher in der Ecke lief noch. Interviews und Feiern nach dem Spiel: Eine ekstatische wilde See aus Rot und Weiß überrollte das völlig verblüffte Wembley-Stadion. Vielleicht hatte bisher niemand ausgeschaltet, weil die Möglichkeit bestand, dass man vom Fernsehgerät noch Fingerabdrücke abnehmen konnte, oder aber, weil alle weiter gucken wollten, weiter dieses Wunder bestaunen und sich nicht davon trennen wollten. Der Zweitligist Sunderland hatte den Erstligisten Leeds United geschlagen. Ein einziges Tor hatte Sunderland den heißbegehrten FA-Cup beschert. Alle Experten, die nach dem Spiel zu Wort kamen, waren sich einig, dass dieser Tag in die Annalen der Fußballgeschichte eingehen würde. Miller hatte nichts dagegen einzuwenden.
Gleich hinter der Tür hing etwas schief ein gerahmtes Hochzeitsfoto an der Wand; der Bräutigam war Mitte bis Ende zwanzig und sah wie der Gitarrist von Slade aus, trug aber einen Anzug, als müsse er vor Gericht erscheinen. Große Augen, dunkles, schulterlanges Haar, ein schräger Pony und ein ebenso schräges Lächeln; vielleicht hatte er sich auf dem Weg zur Kirche irgendwo ein paar Bierchen genehmigt. Die Fahndung war schon eingeleitet worden, zuletzt hatte ein Nachbar ihn gesehen, als er nach der ersten Halbzeit die Straße hinaufgegangen war. Er war der Hauptverdächtige. An der Statistik gab es nichts zu rütteln, dachte Miller: nach dem Jawort der Gattenmord. Das Eheleben war lebensgefährlich.
Die Braut auf dem Foto erinnerte an kalifornische Frauen, sie hatte langes, fließendes blondes Haar, wie die Mädels in der Colawerbung mit ihrem »I’d Like to Teach the World to Sing«. In den tristen, versifften Straßen der nordenglischen Stadt musste sie der helle Wahnsinn gewesen sein. Es war ihr großer Tag, aber ihr Lächeln schien zu diesem Anlass nicht recht zu passen: als sei sie etwas skeptisch, nicht sicher, auf was sie sich da einließ. Daneben hing ein Foto von einem kleinen Jungen, etwa fünf oder sechs Jahre alt. Er hatte das blonde Haar seiner Mutter und das breite Lächeln seines Vaters. Und noch etwa zwei Jahre zu leben.
Das Zimmer war nicht groß, und es schien noch zu schrumpfen, als sie sich jetzt alle darin drängten: Miller mit seiner massigen Gestalt, der schlaksige Detective Constable Lawton, ein Fotograf und ein Arzt. Und dann noch die beiden Leichen.
»Du lieber Gott«, flüsterte Lawton hinter vorgehaltener Hand.
Sie saßen auf dem Sofa. Wenn man die Augen halb schloss und für einen Moment vergaß, wo man sich befand, sahen Mutter und Sohn aus, als wären sie vor der Glotze eingeschlafen. Aber das war eine grausige Täuschung. Die junge Frau war hochschwanger – die Braut auf dem Foto, mutmaßte Miller, aber er konnte bloß nach dem Haar urteilen, denn ihr Kopf war nur noch ein blutiger Brei. Sie war mit einem schweren Gegenstand erschlagen worden, einem Hammer vielleicht oder einem großen Schraubenschlüssel. Beide Ohrläppchen wiesen braune Brandmale auf. Jetzt konnte Miller es auch riechen: In den Mief von den kalten Kippen im übervollen Aschenbecher unten vor dem Kamin, zu dem der metallische, süßliche Blutgeruch und die anderen typischen Tatort-Düfte hinzukamen, mischte sich auch ein leichter Geruch nach Rauch oder etwas Versengtem.
Der kleine Junge saß neben der Frau, seine Hand ruhte auf ihrem Knie und sein Kopf an ihrer Schulter. Er schien etwa im gleichen Alter zu sein wie Stuart Millers eigener Sohn, sieben oder acht. Sein Kopf war nicht so grässlich zugerichtet wie der seiner Mutter, aber doch blutverkrustet, denn auf der rechten Seite klaffte eine Wunde. Seine Ohrläppchen waren ebenfalls versengt. Detective Constable Chris Lawton stolperte aus dem Zimmer, und Miller hörte ihn draußen im Garten ergebnislos würgen.
Vor ihnen auf dem Fußboden stand eine Art Trafo. Ein Kabel steckte in der Steckdose, das andere war ein Starthilfekabel mit Krokodilklemmen. Der Trafo sah aus, als stamme er von einer Scalextric-Autorennbahn oder etwas Ähnlichem. Der Arzt zog sein mit Schuppen bestreutes Jackett von einem Haken an der Tür, schüttelte es über seinen schmalen Schultern zurecht und ließ sein Köfferchen zuschnappen.
»Ein Stromschlag oder ein Hieb mit einem Gegenstand, eins davon hätte doch gereicht. Warum also beides?«
Miller schüttelte langsam den Kopf. Ja, warum? Einerseits der kaltblütige Einsatz von Wissenschaft und Geräten, andererseits die hitzige Anwendung roher Gewalt. Womit hatten sie es hier zu tun?
Das Zimmer war ein armseliges Loch, drei mal vier Meter, trübe beleuchtet nur durch ein Fenster, das auf einen winzigen, mit Kringeln aus Hundekacke gesprenkelten Garten hinausging. In so einem Raum war Miller selbst auch aufgewachsen. Der gleiche billige Teppich, der gleiche bittere, schale Zigarettendunst. Wer Glück hatte, wurde erwachsen, kam vorwärts und ließ sich von seiner Herkunft nicht unterkriegen. Wer nicht so viel Glück hatte, steckte für den Rest seines Lebens bis zum Hals in der Scheiße, ertrank in Selbstmitleid und teilte Schläge an die Menschen aus, die er angeblich liebte. Millers Hand wanderte instinktiv zu der kleinen Narbe am Augenwinkel, wo ihn an seinem zwölften Geburtstag der Ehering seines Vaters getroffen hatte.
War hier etwas Ähnliches passiert? War ein Familiendrama eskaliert? Er betrachtete die Leichen, die Seite an Seite auf dem Sofa lehnten. Aneinandergekuschelt, die Hände auf den Knien, in einer grausamen Parodie auf die glückliche Familie. Nein, hier handelte es sich um etwas anderes. Stuart Miller hatte Blut und Tod gesehen, Tragödien und Dummheiten und den ganzen anderen alltäglichen Horror, der zu seinem Aufgabengebiet gehörte. Aber so etwas wie hier war ihm noch nie begegnet. Vor seinen Augen verschwamm alles, die Kehle wurde ihm eng. Die Zimmerwände, das leise Summen des Fernsehers, das rauschhafte Wogen von Rot und Weiß, die jubelnden Spieler, die in endlosen Wiederholungen die Siegestrophäe in die Höhe streckten, alles rückte bedrohlich nah.
»Alles verdammter Blödsinn.« Miller schaltete das Gerät aus.
Er ging auf die Straße, um Luft zu schöpfen. Ein kleiner Yorkshire Terrier trieb sich vor der Haustür herum, neugierig und erwartungsvoll. Miller ging in die Hocke und tätschelte den Hund.
»Hier gibt’s nichts für dich, Kleiner, fort mit dir.«
Eine Gruppe von Halbstarken, festlich herausgeputzt in Rot und Weiß, war zum Royal Marine unterwegs, dem Pub oben an der Straße, wo sie die Siegesfeier fortsetzen wollten. Sie skandierten We are the champions! und klatschten dazu. Der Anführer fing Stuart Millers Blick auf und grinste. »Is heute der schönste Scheißtag in meinem Leben, Kumpel, verflucht noch mal, der allerschönste!«
1
Mittwoch, 8. Oktober 2008. Später Vormittag.Katanning, Western Australia.
An ihrer Lage war eindeutig zu erkennen, dass sie es nicht hatte kommen sehen. Ihre Beine waren in einem völlig unnatürlichen Winkel gespreizt. Das Blut neben ihrem Kopf war in der Sonne eingetrocknet, noch bevor die Lache sich die paar Zentimeter bis zum Straßenrand hin hatte ausbreiten können. Gierige Schmeißfliegen sausten über ihr hin und her. Die Oktobersonne stand hoch und war für die Jahreszeit ungewöhnlich gemein. Wer auch nur ein bisschen Verstand hatte, saß im Schatten des einzigen Baumes weit und breit. Oder hielt sich überhaupt nicht hier auf.
Der Sergeant kauerte neben dem rasch in Verwesung übergehenden Körper und sprach in ein kleines digitales Aufnahmegerät. Cato Kwong blinzelte zu ihm hinüber und trank einen Schluck lauwarmes Wasser. Die Flasche in seinen Händen fühlte sich an, als würde sie gleich schmelzen. Auf seinem iPod steigerte sich ein Crescendo in La Bohème soeben zu einem Kreischen. Cato stellte das Gerät aus und nahm die Kopfhörer ab. Ein Blick auf die Uhr: immer noch Vormittag.
In diesen Tagen schien die Zeit so langsam zu vergehen. Der Sergeant hieß Jim Buckley: Er schwatzte mit sich selbst, liebte jede Minute, jedes Detail seines Jobs. Für einen derartig großen Kerl waren seine Bewegungen elegant. Ein Pavarotti in einer Metzgerschürze.
»Kugel Nummer eins trat direkt hinter dem linken Ohr ein und durch die rechte Backe aus. Kugel Nummer zwei trat ins linke Auge ein. Kein Hinweis auf eine Austrittswunde, folglich nehmen wir an, dass Kugel Nummer zwei sich noch im Körper befindet. Zur Bestätigung beabsichtige ich, an Ort und Stelle eine Obduktion vorzunehmen. Aufnahme unterbrochen um … 10:22 Uhr. Detective Sergeant James Buckley.«
Buckley griff nach seinem Werkzeugkasten und öffnete ihn. Er nahm eine Säge heraus.
Das war einer der großen Unterschiede zwischen dem Morddezernat und dem Viehdezernat, sinnierte Cato, man brauchte nicht auf die Obduktion zu warten, sondern nahm sie einfach gleich selbst vor. Er hatte sich immer noch nicht richtig daran gewöhnt, dass der Kripobeamte Detective Senior Constable Philip Kwong beim Viehdezernat gelandet war. Morddezernat, Dezernat für schwere Straftaten oder selbst Dezernat für Bandenkriminalität, das alles hatte einen Beiklang, bei dem man die Brust herausdrückte und ein Stückchen größer wurde. Aber Viehdezernat? Ihre Aufgabe bestand darin, aktiv zu werden, wenn Diebe die Brandzeichen von Rindern veränderten und die Tiere klauten, wenn Schafe gestohlen oder Trecker entwendet wurden. Die Mitarbeiter des Viehdezernats wurden als Branchenkenner gepriesen, angeblich kannten sie die Farmer, kannten deren Jargon. In Catos Augen jedoch waren sie schlicht gescheiterte Existenzen, die bessere Tage gesehen hatten und jetzt als Kripobeamte weiterverwertet wurden. Aber der Lack war nun mal ab. Das Rindviehdezernat – eine Lachnummer. Was tun Sie denn, wenn Sie einer verdächtigen Kuh begegnen? Abführen auf die Wache? Und dann weichklopfen und im eigenen Saft schmoren lassen? Oder machen Sie gleich Hackfleisch aus dem Tier?
Bisher kam Cato sich eher wie ein besserer Landwirtschaftsinspektor vor. Viehdezernat. Das Wort flutschte ihm aus dem Mundwinkel wie der Fluch eines Feiglings. Ja, Fluch eines Feiglings fasste seine Situation ganz gut zusammen. Er war hier gelandet, weil ein Haufen Feiglinge, zu denen er früher einmal aufgeschaut hatte, ihn im Regen hatte stehen lassen. Und er konnte nichts dagegen tun, weil es diesen Kodex gab, diese Bruderschaft – oder welchen bescheuerten Namen man auch benutzen mochte, um zahllose Sünden dahinter zu verbergen.
Die Rindvieh-Abteilung war gerade on tour, mit Herz und Hirn. Die beiden anderen Mitglieder der Truppe befanden sich ehrenwerterweise auf dem Weg in den wilden Norden, während Cato Kwong und Jim Buckley sich ganz bequem in den Süden abgesetzt hatten. Eine Woche »Informationen sammeln«, so sah Buckley diese Unternehmung: Flossenschütteln, Herumschnüffeln, willkürliche Kontrollen und anständige Spesen – das würde sie bis zu ihrer Rückkehr nach Perth auf Trab halten. Eine Woche an Strohhalmen kauen, Fliegen erschlagen und weise nicken, auch wenn ihm das Gesagte total am Arsch vorbeiging, das war Catos Meinung zu dieser Tour.
Cato Kwong, Viehdezernat. Cato, nach Peter Sellers’ chinesischem Butler und Kampfsportpartner in Der rosarote Panther. Diesen Spitznamen hatten sie ihm auf der Polizeischule verpasst. Cato hatte damals noch keinen der Filme gesehen und sich daher die Videos ausgeliehen, um zu verstehen, worauf die anderen anspielten. Cato, der manische Diener? Cato, der loyale Prügelknabe? Oder schlicht und einfach Cato, der Chinese?
Tag drei hatte eben erst angefangen, aber Cato fühlte sich, als wäre er schon einen ganzen Monat unterwegs.
»Oi, Kwongie, helfen Sie hier mal ’n bisschen, Kumpel?«
Jim Buckleys Gesicht war ganz rot vor Anstrengung, als die Säge in den Nacken der Kuh biss. Blut spritzte, die Schmeißfliegen drehten durch, er war im siebten Himmel. Der zimperliche Cato zuckte zusammen. Ihm war es lieber, wenn Fleisch in Plastikfolie verpackt und mit einem Barcode versehen war.
»Jim. Sir. Sergeant …«
Cato wusste immer noch nicht, wie er Jim Buckley eigentlich anreden sollte. Nicht, dass er grundsätzlich keinen Respekt vor Höhergestellten gehabt hätte, nein, aber im Fall von Jim Buckley arbeitete er einfach noch daran.
»Hören Sie, müssen wir das denn wirklich alles machen? Ist doch ziemlich eindeutig. Jemand hat die Kuh angefahren und dann mit ein paar Kopfschüssen erledigt. Das Hinterbein wurde mit einer Kettensäge abgetrennt und zum Grillen mit nach Hause genommen. Und das war’s.«
Cato trank noch einen Schluck Bergquellwasser. In extremer Hitze funktionierte er nicht gut. Vielleicht sollte er lieber zur berittenen Polizei nach Kanada gehen oder nach Tasmanien, irgendwohin, wo es schön kühl war.
Jim Buckley runzelte die Stirn, ein ganz klein wenig enttäuscht über die Arbeitshaltung des Jüngeren. »Es ist und bleibt ein Verbrechen, mein lieber Cato. Und es ist unser Job, die Spitzbuben zu finden.«
Cato wusste, dass er gegen die sprichwörtliche Wand anrannte. Nach fünfundzwanzig Jahren im Polizeidienst hatte Buckley endlich seine ökologische Nische gefunden. Das Rindviecherdezernat war seine Domäne, und er hatte keine Lust auf Negativität. Jetzt wischte er sich mit dem Hemdsärmel über die schweißtriefende Stirn und reichte Cato das blutige Werkzeug.
»So, als Ihr Vorgesetzter würde ich Ihnen jetzt raten, die Klappe zu halten und loszusägen.«
2
Vier Stunden vorher.Mittwoch, 8. Oktober. Morgendämmerung.Hopetoun, Western Australia.
Ihre Lungen platzten fast, und ihre linke Hüfte quälte sie. Noch zwei Kilometer nach Hause, vier lagen hinter ihr. In den vergangenen zwanzig Minuten hatte sie sich ein wenig alt gefühlt, verbraucht. In letzter Zeit zwickte es an zu vielen Stellen, und es wurde immer schwieriger, dieses Zwicken in Schach zu halten. Aber dann bog sie um die Ecke, kam oben auf der Düne an, und da war das Meer. Wunderschön, dachte sie, traumhaft. Eine leichte Brise kräuselte das Wasser, und gerade ging die Sonne auf und vertrieb die Schatten von den Bergen des Nationalparks im Westen. Streifen in Orange und Rosa, Violett und Blau überzogen den weiten Himmel.
Und, kaum zu glauben, im flachen Wasser an der Buhne planschten zwei Delfine. Die letzten zweihundert Meter sprintete sie fast über den Strand, am Spülsaum entlang, wo der Sand fest war, ohne die Delfine dabei aus den Augen zu lassen. Als sie näher kam, wurde sie allerdings unsicher. Wie die Delfine sich bewegten, die Form der Flossen, das fröhliche Toben und Herumplatschen – nein, das war kein Platschen, eher ein Schlagen. Haie. Und da war etwas bei ihnen im Wasser, etwas Bräunliches, Schlaffes, Lebloses. Ein Seehund vielleicht, aus der Kolonie auf den Felsen ein paar hundert Meter draußen vor der Buhne. Sie rannte noch schneller. Heute würde sie ihrer Grundschulklasse in der Morgenrunde wirklich etwas Besonderes zu erzählen haben.
Ein Hai hatte den Seehund im Maul und schüttelte ihn wie ein Welpe eine alte Socke. Schließlich ließ er ihn los, und der Seehund flog durch die Luft und landete mit einem leisen Klatschen auf dem Strand. Aus jetzt ganz kurzer Entfernung sah sie, dass die Raubfische den armen kleinen Kerl regelrecht zerfetzt hatten, nur eine Flosse war noch drangeblieben, und er schien auch keinen Kopf mehr zu haben. Jetzt stand sie direkt vor dem Kadaver. Sie holte Atem. Ein Zittern überkam sie. Das war kein Seehund, das war ein menschlicher Rumpf. Und die vermeintliche Flosse war ein Arm – ein linker Arm, ohne Hand. Aber das mit dem Kopf hatte sie richtig gesehen – es war keiner mehr dran.
Sie beugte sich vor, stützte die Hände auf die Knie und kotzte. Hinter sich konnte sie die Haie hören, die im seichten Wasser immer noch wie Delfine herumspritzten und sie übermütig verarschten.
Hitzewallung. Senior Sergeant Tess Maguire stellte den Kaffee ab, riss ihre Jacke auf und öffnete ein Autofenster. Doch der Gestank eines überfahrenen Tieres zwang sie, es rasch wieder zu schließen. Tess fluchte und schaltete die Klimaanlage ein. Zwanzig nach sechs an einem frischen Frühjahrsmorgen an der Südküste, und sie schwitzte wie ein Schwein. Dann fror sie plötzlich und stellte die Klimaanlage wieder aus. Sie fühlte sich hundeelend. Wieso kriegte sie schon Hitzewallungen? Sie war doch gerade erst zweiundvierzig geworden. Tess betrachtete sich im Rückspiegel. Das kurzgeschnittene blonde Haar verlor allmählich den Kampf gegen die grauen Strähnen. Sie drohte immer wieder, es einfach grau nachwachsen zu lassen. Das war doch natürlich, oder? Und was war denn so schlimm an Grau? Tess versuchte, an eine bekannte, attraktive grauhaarige Frau zu denken, kam aber nicht weiter als bis zu Germaine Greer. Also setzte sie Haarfärbemittel auf ihre mentale Einkaufsliste und stellte das Radio an.
Die Interviewerin klang so jung, als könnte sie ihre Tochter sein. Sie hatte ihre Stimme ein bisschen ländlich eingefärbt. Mit Respekt einflößendem Näseln sprach sie mit einem Makler für Primärerzeugnisse über die Preise für Getreide und Wolle. Der eine Preis war offenbar hoch und der andere im Keller, im Gegensatz zum Aktienmarkt allgemein, der sich immer noch im freien Fall befand. Tess wollte es einfach nicht in den Kopf, wie eine Handvoll korrupter Hypothekenmakler in Amerika einen anscheinend globalen finanziellen Tsunami auslösen und damit das Ende der ihr bekannten Welt einläuten konnten. Egal, hier in Hopetoun würde es sie wohl kaum treffen – der Ort lag am Arsch der Welt und war stolz darauf. Es war Tess’ erste Dienststelle nach ihrer Arbeitsunfähigkeit. Neun Monate. Davon den größten Teil des ersten Monats in stationärer und ambulanter Behandlung, die nächsten drei Monate in physiotherapeutischer Betreuung und den Rest in Therapie. Sie fragte sich, wie Melissa wohl zurechtkommen würde, neu in der Stadt und auf der Highschool, neunte Klasse, zusammen mit einer Horde von schwierigen Teenagern, deren Väter hergekommen waren, um in der neuen Mine zu arbeiten. Tess hatte sie im Park herumhängen sehen – die Kids, nicht die Väter. Testosteron. Manche Leute bezeichneten ihr Schubsen und Drängeln, Fluchen und Brüllen ja als jugendliche Ausgelassenheit. Tess aber brach in letzter Zeit der kalte Schweiß aus, wenn sie so etwas sah, sie bekam Panikattacken, kriegte keine Luft mehr und musste heulen. Selbst jetzt noch, wenn sie nur daran dachte.
Ein neues Leben hatte man ihr versprochen, einen neuen Anfang, neue Hoffnung in Hopetoun. Bisher war eine ständige Polizeiwache hier im Ort nicht erforderlich gewesen. Jahrzehntelang war das Städtchen ein verschlafenes Nest gewesen, in dem Farmer aus dem Weizengürtel Urlaub machten oder ihren Ruhestand verbrachten. Da hatte es für die Polizei nichts zu tun gegeben, nur gelegentlich waren vielleicht mal Alkohol am Steuer oder Familienstreitigkeiten vorgekommen. Seit es aber in der Nähe die Nickelmine gab, war die Bevölkerung stetig gewachsen, von unverändert vierhundert Einwohnern in früheren Zeiten bis auf sage und schreibe zweitausend – und es wurden noch mehr. Bis Hopetoun ein Gotham City war, würde es zwar noch eine Weile dauern, aber seit so viele neue Häuser gebaut wurden, die Leute mit großen Geldsummen um sich schmissen und der Pub immer mehr Zulauf bekam, nahmen zusammen mit den Versuchungen auch auffälliges Verhalten, Vandalismus, Familiendramen und Drogengebrauch zu. Hopetoun war zu einem geeigneten Ort für alternde, verletzte oder untaugliche Polizeibeamte geworden, die eine Auszeit brauchten. Tess gehörte in alle drei Kategorien. Anfangs hatte sie die Versetzung abgelehnt. Senior Sergeant Tess Maguire – das »Senior« war eine Belohnung dafür, dass sie fast totgetrampelt worden war – hatte sich widersetzt. Doch nach ein paar Wochen an einem Schreibtisch im Polizeipräsidium in Perth, wo sie den besorgten, aber verlegenen Blicken der Kollegen sowie dem Verkehr, dem Lärm und den Menschenmassen ausgesetzt gewesen war, hatte Tess den Wechsel ans Meer schließlich begrüßt. Hopetoun – keine nennenswerten Verbrechen, hatte sie sich gesagt, kein Stress. Nur Sonnenschein und Seewind, um den Kopf wieder frei zu kriegen.
Erst hörte sie ihn. Dann roch sie ihn. Und dann sah sie ihn auch: Er kam die Straße entlanggekurvt, quietschend und röhrend, und seine qualmenden Reifen verbreiteten den beißenden Gestank nach versengtem Gummi. Tess schaute auf die Uhr am Armaturenbrett: Er war pünktlich. Sie hatte den Polizeiwagen an der Abzweigung zum Bergwerk geparkt, wo der Wirbel aus schwarzen Reifenspuren von früheren Kunststückchen dieses Fahrers zeugte. Solche Spuren fand man heutzutage auf jeder Straße in jedem australischen Vorort, aber die hohen Tiere im Landkreis wollten dem ein Ende setzen. Das sei ungezügelter Hooliganismus, mache einen schlechten Eindruck und sei einfach eine Schande. Und Tess Maguires Job war es, dieses Fehlverhalten im Keim zu ersticken. Sie ließ den Motor an, schaltete den Flasher ein und stellte den Wagen quer auf die Straße, um dem Raser den Weg zu versperren. Er hielt an. Sie klopfte gegen das Fahrerfenster, bis er es öffnete.
»Macht’s Spaß, Kane?«
Kane Stevenson, der Donut King – niemand konnte den Wagen so perfekt um die blockierten Vorderräder kreiseln lassen wie er. Ein Idiot aus einer Familie von Idioten. Früher hätte Tess sich vielleicht gescheut, Menschen so in Schubladen zu packen, denn man musste doch allen eine Chance geben und so. Die Zeiten waren jedoch vorbei. Wer sich wie ein Idiot benahm, der war eben ein Idiot. Aber die Bonzen im Landkreis würden daran zu schlucken haben, dass dieser spezielle Idiot ein Einheimischer war, hier geboren und aufgewachsen. Sie konnten es nicht den Bergleuten in die Schuhe schieben, weder den Pendlern noch den Zugezogenen. Kane war ein hausgemachtes Problem. Und seit er im Bergwerk arbeitete, hatte er nun auch noch Geld, das er zusammen mit seinen Reifen verbrennen konnte.
Ganz unschuldig ließ er jetzt sein Fenster herunter. »Morgen, Tess, früh auf den Beinen?«
»Für Sie heißt das Sergeant oder Officer. Sie fahren ja einen verdammt heißen Reifen.«
»Sorry, Mann, ich musste doch ausweichen. Känguru auf der Straße, konnte ich doch nicht einfach totfahren, wo ich so’n großer Tierfreund bin.«
»Aha.«
»Nee, ganz ehrlich.«
Tess trat zurück und tat so, als bewundere sie seinen Wagen.
»Firmenwagen, toll. Sind Sie befördert worden, Kane?«
Stolz schlug er auf das Lenkrad. »Ja, zum Teamleiter. Fünfzehn Riesen mehr im Jahr.«
»Glückwunsch. Die Sache ist, nach unseren schönen neuen Gesetzen gegen Rowdytum im Straßenverkehr bin ich durchaus berechtigt, dieses Fahrzeug zu beschlagnahmen.« Sie schnippte mit den Fingern. »In sechzig Sekunden ist Ihr Wagen futsch. Da wird Ihr Arbeitgeber nicht gerade begeistert sein, fürchte ich.«
Sein Arbeitgeber war Western Minerals, eine der größten und reichsten Unternehmensgruppen der Welt, die auf dem ganzen Erdball Bergwerke besaß. Western Minerals bezahlte hervorragend, war bei Verfehlungen aber gnadenlos. Das Motto: Nulltoleranz. Man ging davon aus, dass dieser Begriff sich auch auf Rowdytum bezog.
»Ach, Scheiße, Tess, hören Sie auf«, bat Kane. Zum ersten Mal blitzte in seinen großen braunen Augen die Erkenntnis auf, dass sein Verhalten Konsequenzen haben könnte.
Tess’ Handy dudelte. Greg, ihr Assistent, wie sie auf dem Display sah.
»Tess? Komm lieber zurück in die Stadt. Wir haben hier eine Leiche.«
Sie blinzelte den Donut King drohend an: »Erste und letzte Warnung.« Dann brauste sie mit dem Polizeiauto los und versengte selbst ein bisschen Reifengummi.
Unterwegs begegnete Tess einem Konvoi von weißen Wagen, die in Richtung Bergwerk fuhren, das vierzig Kilometer entfernt lag. Am Stadtrand von Hopetoun raste sie die leichte Steigung bis zum Kreisverkehr hinauf. Von dort fuhr man auf einer Seite in ein Gewerbegebiet ab und auf der anderen in die wuchernde, gesichtslose Legoland-Neubausiedlung. Die Straße geradeaus führte direkt ins Zentrum von Hopetoun. Als Tess oben ankam und die Hauptstraße hinunter bis zum leuchtend blauen Südpolarmeer ganz unten sehen konnte, entspannte sie sich ein wenig. Nach drei Monaten hier in Hopetoun konnte sie immer noch kaum fassen, wie klein und wie ruhig und, ja, wie schön dieser Ort war. Und sie hoffte auch, dass da niemals ein Gewöhnungseffekt eintreten würde.
Tess bog auf den Strandparkplatz ein. Am Strand sprach ihr Kollege, Constable Greg Fisher, mit einer Frau mittleren Alters in Joggingzeug, und der Arzt aus dem Ort hockte im Sand und untersuchte etwas. Was es war, konnte Tess nicht sehen, denn es lag hinter einem provisorisch aus einer Plane errichteten Windschutz. Eine Initiative von Greg: Es war sein erstes Dienstjahr nach der Polizeischule, und er wollte Eindruck schinden – ein Bedürfnis, das Tess schon lange nicht mehr kannte. Ein Pärchen Austernfischer stocherte mit scharlachroten Stilettschnäbeln im Sand herum. Eine kleine Handvoll Frühaufsteher bemühte sich, einen Blick auf die Leiche zu werfen, aber alle beachteten die unsichtbare Linie, die Constable Fisher gezogen hatte.
Als sie näher kam, erkannte Tess in der Joggerin eine Grundschullehrerin. Sie hatte sie schon im Ort getroffen, das passierte in einem so kleinen Kaff ja fast zwangsläufig. Die Lehrerin war ein bisschen grün um die Nase. Ihre Augen waren verschwollen, ihre Unterlippe zitterte beim Sprechen. Greg machte sich Notizen. Tess überließ die beiden sich selbst und ging über den knirschenden weißen Sand zum Arzt und zur Leiche hinüber. Der Torso glänzte in der Morgensonne. Grüne Seetangranken glitzerten auf dem fleckigen, leicht gebräunten Fleisch. Kein Kopf, keine Beine, nur ein verstümmelter Arm und blassgraue Pampe, wo die fehlenden Körperteile hätten ansetzen sollen.
Der Arzt, breitschultrig, Anfang fünfzig, stand auf. Tess war ihm schon einmal begegnet, vor ein paar Wochen, als sie einen jungen Bergmann bei ihm abgesetzt hatte. Der Bursche hatte bei einem Besäufnis versucht, den Geldautomaten im Pub k. o. zu schlagen, weil der seine Geheimzahl nicht akzeptieren wollte.
»Wie sieht’s aus, Doktor Terhorst?«
»Also, er ist tot, das ist mal sicher.« Die Lippen des Arztes kräuselten sich leicht bei diesem kleinen Scherz, dann fuhr er in seinem präzisen afrikaansen Akzent fort: »Aber in diesem Stadium kann ich die Altersgruppe nicht mehr eindeutig erkennen, nicht einmal die ethnische Gruppe lässt sich noch mit Sicherheit bestimmen. Nach der Länge des Rumpfes würde ich ihn auf mittlere Körpergröße schätzen, mittlere Statur. Fragen Sie mich nicht nach dem Todeszeitpunkt – wenn jemand im Wasser gelegen hat, kann man das ohne die richtigen Tests kaum sehen. Vor weniger als einer Woche, ganz grob geschätzt.«
»Haiangriff?« Hopetoun. Südpolarmeer. Die Frage war nicht unbegründet.
»Damals in Kapstadt habe ich einige Opfer gesehen, ja, diese Verletzungen sind typisch für Haiangriffe.«
Tess deutete auf den Brei unten am Rumpf, wo einmal die Beine angesetzt hatten. »Sieht aus, als hätten sie die glatt abgebissen.«
Der Arzt nickte düster, dann kratzte er sich das Kinn. »Schon möglich. Aber ich würde mir eher Gedanken um die Wunde am Hals machen.«
»Wieso?«
»Im Vergleich zu den sonstigen Löchern und Rissen ist sie sehr sauber. Sieht aus, als hätte jemand die Wirbelsäule mit einer scharfen Klinge durchtrennt. Entweder hatte unser Hai tadellose Tischmanieren … oder aber jemand hat diesem armen Mann den Kopf abgeschnitten.«
3
Mittwoch, 8. Oktober. Vormittag.Busselton, Western Australia.
Die Bodendiele knarrt unter Stuart Millers Schuhen. Der Flur erscheint ihm kürzer, als er ihn in Erinnerung hat, und abermals steigt ihm dieser bittere Geruch nach Aschenbecher in die Nase. Kein Licht, wieder mal Stromausfall, diese verdammten Bergarbeiter streiken dauernd. Aber warum kann er dann den Fernseher auf der anderen Seite der Tür hören? Ein Fußballspiel. Er dreht den Türknauf und betritt den düsteren Raum, der nur vom flackernden Licht des Bildschirms erhellt wird: ein wogendes, brüllendes Meer aus Rot und Weiß. Jenny und Graeme sitzen aneinandergeschmiegt auf dem Sofa und sehen sich das Spiel an. Auf dem Fußboden rasen Graemes Scalextric-Autos um die Rennbahn, in jeder Kurve sprühen sie Funken.
»Bin wieder da, Schatz, warum hast du denn alle Lichter aus?«
Seine Hand bewegt sich zum Schalter, aber nichts geschieht.
»Scheiße, die Birne muss durchgebrannt sein. Wie steht’s denn?« Er nickt zum Fernseher hinüber.
»Null zu null«, sagt der kleine Graeme und reagiert damit endlich auf die Anwesenheit seines Vaters. Jenny muss wegen irgendwas eingeschnappt sein, wahrscheinlich, weil er wieder Überstunden gemacht hat. Sie hat sich bisher nicht gerührt und keinen Ton gesagt. Miller schaut erneut auf den Bildschirm, das Pokalfinale, Sunderland gegen Leeds. Billy Hughes mit einem Eckstoß, der Ball landet Porterfield vor den Füßen. Das hat Miller schon einmal gesehen, dieses Tor, diese Szene. Panik überfällt ihn. Er berührt Schulter und Kopf seiner Frau, und als er die Finger zurückzieht, sind sie blutverklebt. Graeme hat sich an seine Mutter gekuschelt, seine Hand liegt auf ihrem Knie, über seinem Ohr klafft eine tiefrote Wunde.
Stuart Miller fuhr aus dem Schlaf hoch und rang nach Luft. Das Bett war leer und Jenny war fort.
4
Mittwoch, 8. Oktober. Später Vormittag.
Sergeant Jim Buckley stöhnte und schnaufte, er stand kurz vor dem Herzinfarkt. Sein normalerweise rotes Trinkergesicht war beinahe violett, und in seinen rötlichgrauen Koteletten glitzerten Schweißperlen. Der Kopf der Kuh war inzwischen vom Körper abgetrennt, nach einer gemeinschaftlichen Anstrengung von ihm selbst, Cato und drei Bügelsägeblättern. Der Hals lag flach auf dem Boden, und die Augen starrten nach oben in den Kuhhimmel. Buckley stand mit gespreizten Beinen über dem Kuhkopf, die Füße rechts und links auf den beiden Ohren des Tieres. Mit der linken Hand drückte er fest auf die Schnauze, um zusätzliche Hebelwirkung zu erzeugen, mit der rechten zerrte er ein letztes Mal mit voller Kraft. Triumphierend zog er die Hand mit der Zange aus dem Kuhgesicht. Zwischen den Stahlbacken klemmte ein kleiner, blutiger Metallklumpen.
»Kleinkaliber, wie ich vermutet habe.«
Cato war gerade mit Pissen fertig und zog seinen Reißverschluss zu. Er hatte sich wieder in den Schatten des Baumes verkrümelt und das Kreuzworträtsel aus dem West Australian inzwischen zur Hälfte gelöst. Beim Frühstück im Motel in Katanning war es ihm gelungen, die Zeitung vom Nachbartisch mitgehen zu lassen. Er wäre fast dabei erwischt worden, denn der Besitzer war nur zur Toilette gegangen. Als er wiederkam und seine Zeitung holen wollte, hatte Cato sich dumm stellen und andeuten müssen, dass die Kellnerin sie wohl mit abgeräumt habe. Buckley hatte angewidert den Kopf geschüttelt.
»Warum kaufen Sie sich denn nie selbst eine? Die kosten doch bloß einen Dollar. Geizkragen!«
»Nein, einen Dollar dreißig. Ich brauche ja nur das Kreuzworträtsel, den ganzen anderen Schwachsinn muss ich nicht lesen.«
Sein Vater hatte ihm vor Jahren beigebracht, die kryptischen Rätselcodes zu knacken, und inzwischen war Cato süchtig danach. Es hatte etwas, in dem scheinbar unsinnigen Geschwafel nach einem logischen Gedankengang zu suchen und die kühle Kalkulation hinter dem pfiffigen Wortspiel zu erkennen. Diese Technik war ihm gelegentlich sogar schon im Verhörraum nützlich gewesen. Sein Vater war inzwischen zu Sudokus übergegangen, um seinen Lebensabend als Witwer zu bereichern. Wenn seine Hände nicht zu sehr zitterten, erledigte er so ein Sudoku in zehn Minuten. Er hatte versucht, auch Cato dafür zu gewinnen, denn er meinte, diese geduldigen logischen Ausschlussprozesse seien ein gutes Training für einen Kriminalistenkopf. Cato aber blieb bei den Kreuzworträtseln; Intuition, Phantasie, Querdenken und Inspiration, die später von Fakten untermauert wurden – das war eher sein Stil.
Zum Grillen: Erwünscht.
Wie bitte? Ging es schon wieder um das liebe Vieh? Diese Gluthitze ließ sein Hirn gerinnen. Cato streckte seine langen Beine aus und lächelte seinem Kollegen ermutigend zu.
»Gute Arbeit, Sarge. Irgendwie ’ne Ahnung, aus wessen Waffe das Ding stammt?«
Jim Buckleys gute Laune war in der Hitze verpufft.
»Sie können mich mal. Verpacken Sie lieber dieses Beweisstück hier, während ich saubermache.«
»Was, den Kopf auch?«
»In die Kühlbox. Je eher er auf Eis liegt, desto besser.«
»Keine Sorge«, seufzte Cato. Er überlegte, ob er jetzt sofort kündigen sollte oder erst nach dem nächsten Zahltag. Schließlich war das die Absicht dahinter: Erst hatten sie ihn heruntergestuft und herabgesetzt, und jetzt wurde er entwürdigt und entmündigt – bis er die Nase voll hatte und von sich aus das Handtuch warf. Sie würden ihn nicht feuern, denn er wusste zu viel. Aber sie hatten so ihre Tricks.
Cato zog einen Ziploc-Beutel aus dem Handschuhfach des Land Cruisers, wuchtete die Kühlbox von der Rückbank und schloss die Wagentür mit einem Tritt, wobei er den Absatz mitten auf das Stierkopf-Emblem platzierte. Klar, das Logo der Rindvieh-Bullen musste ein Bullenkopf sein. Cato ließ die Kugel in den Beutel fallen und verfrachtete den Kuhschädel in die Kühlbox. In seiner Hose summte das Handy. Er war überrascht, denn er hatte nicht damit gerechnet, dass sie hier draußen Empfang hatten.
»Bist du’s, Cato?«
»Hier ist Detective Senior Constable Kwong, mit wem spreche ich?«
»Hutchens.«
Detective Inspector Mick Hutchens, sein alter Chef bei der Kripo Fremantle. Jetzt war er bei der Kripo in Albany und genoss in dieser Proletenstadt den Wechsel an die Südküste. Er hatte die Katastrophe besser überstanden als Cato.
»Was kann ich für Sie tun, Sir?«
»Lass den Scheiß, ich bin’s doch, Mick. Wo steckst du denn?«
Cato schaute über die ausgetrocknete, versengte Landschaft.
»Irgendwo in der Nähe von Katanning.«
Hutchens lachte in sich hinein. »Dann freust du dich also deines Lebens im Rindvieh-Rammel-Dezernat?«
»Weiß nicht, ob dein zynischer Ton dem Polizeipräsidenten gefallen würde, Sir.«
»Stimmt. Ist dieser Volltrottel Buckley bei dir?«
»Willst du ihn sprechen?«
»Nee. Hör mal, ich hab richtige Arbeit für dich. Eine Leiche – na ja, immerhin eine halbe. Aber ein Mensch; das wäre doch mal ’ne nette Abwechslung, oder?«
Catos Puls ging schneller, was er schon lange nicht mehr erlebt hatte.
»Wo?«
»Unten in Hopetoun, vielleicht drei oder vier Stunden Fahrt für euch.«
Cato überlegte fieberhaft – Hopetoun, Südküste, ein Fischerort? Sonst fiel ihm nichts dazu ein.
»Warum machen deine Leute das denn nicht selbst? Mich hätten sie doch am liebsten nach Sibirien verbannt, weißt du noch?«
Einen Augenblick herrschte unbehagliches Schweigen, dann räusperte Hutchens sich.
»Drei sind vom Dienst suspendiert, zwei krank, zwei in Urlaub. Ich kratze gerade die letzten Reste zusammen. Da hab ich sofort an dich gedacht.«
»Na toll.«
Eine winzige Spur jammernder Verzweiflung schlich sich in Hutchens Stimme. »Cato, Kollege, ich brauche dich. Jedenfalls für die nächsten paar Tage.«
Cato wurde den Gedanken nicht los, dass noch mehr dahintersteckte. Kratzte Mick Hutchens wirklich die letzten Reste zusammen, bevor er an seinen alten Kumpel Cato dachte? Die Sonne verbrannte ihm den Nacken, im Gesicht plagten ihn die Fliegen, und die kopflose, dreibeinige Kuh fing an, ganz widerwärtig zu stinken. Die Straße nach Katanning schimmerte im Hitzedunst. Wer war Cato Kwong, dass er einem geschenkten Gaul ins Maul sah?
»Erzähl mehr.«
»Ist heute Morgen angespült worden. Sieht aus wie ein Haiangriff, aber der Arzt hier im Ort meint, der Junge war vielleicht schon tot, als er im Wasser landete. Ist allerdings so ein Quacksalber vom Lande, der verzapft wahrscheinlich nur Blödsinn.« Mick Hutchens war immer noch der Alte, dachte Cato, Zenmeister der radikalen Pauschalurteile. »Ich brauche dich, du musst dir das ansehen und es bestätigen oder auch nicht. Kein Ärger, kein Theater. Einfach nur den Papierkram erledigen und zu den Akten legen, Cato. Freitag bist du wieder zu Hause.«
Cato hatte jegliches Zeitgefühl verloren – aber dann fiel es ihm wieder ein, heute war Mittwoch. Wenn es sich hier tatsächlich um einen so einfachen, klaren Fall handelte, würde er rechtzeitig zum Wochenende zu Hause sein. Er war mit Jake an der Reihe. Sie könnten ein Familienwochenende machen, nur Vater und Sohn. Ja, also gut.
»Wer ist denn da unten zuständig?«
»Senior Sergeant Tess Maguire …« Hutchens machte eine Pause, wollte diese Info wohl wirken lassen. Aber Cato war schlagfertig und reagierte sofort – anders allerdings, als Hutchens es sich vorgestellt hatte.
»Die Taser-Tess?«
»Genau die.«
Nachdem der Mob oben im Norden über sie hergefallen war, hatte der Polizeipräsident alle Beamten standardmäßig mit Tasern ausgestattet, in der optimistischen Annahme, dass Tess vielleicht eine Chance gehabt hätte, wenn sie »entsprechend ausgerüstet« gewesen wäre – mit einem Fünfzigtausend-Volt-Elektroschocker. Cato hatte seine Zweifel, dass die Dinger in einer derartigen Situation wirklich eine Hilfe waren, insbesondere, wenn sie in falsche Hände gerieten. Doch Skepsis beiseite, Tess war dadurch zu einer Art Volksheldin unter ihren Kollegen hier in Western Australia geworden. Für ihn selbst allerdings war sie mehr gewesen, damals.
»Ich dachte, sie hätte den Job geschmissen.«
»Ist nach Hopetoun versetzt worden, das kommt auf eins raus. Hör mal, bring Buckley doch einfach mit, dann haben wir einen Mann mehr, aber … pass auf, dass er keine Schäfchen vernascht.«
Mit einem »Määäh« beendete Hutchens das Gespräch. Cato seufzte und klappte sein Handy zu. Irgendwie war Buckley doch ein armes Würstchen, dachte er. Und da ging ihm plötzlich ein Licht auf. Zum Grillen: Erwünscht.
Erwünscht war ein Anagramm: »Würstchen«. Da konnte man ja glatt zum Vegetarier werden.
Jim Buckley stand gebückt vor dem Seitenspiegel. Er hatte die Lippen gespitzt und versuchte, sich mit einem Feuchttuch die Blutflecken von seinem Diensthemd zu wischen. Cato hustete höflich, um auf sich aufmerksam zu machen.
»Sergeant? Da hat sich eben was ergeben.«
Sie hätten schon am frühen Nachmittag in Hopetoun sein sollen, aber Jim Buckley hatte darauf bestanden, nach Katanning zurückzufahren und den Kuhkopf dort im Gefrierschrank der Polizeiwache unterzubringen. Die Jungs waren alles andere als begeistert gewesen, denn nun mussten sie etwas anderes finden, wo sie die Würstchen und die Steaks für ihr Sundowner-Barbecue am Freitag aufbewahren konnten.
»Zeigt doch mal ein bisschen Eigeninitiative«, hatte Buckley sie angeschnauzt, ziemlich undankbar, wie Cato fand.
Dann hatten sie unterwegs zu einem späten Lunch angehalten: zwei Fleischpasteten, ein Marsriegel und eine Cola für Buckley, während Cato sich auf eine Pastete, einen mehligen, angestoßenen Apfel und einen Orangensaft beschränkt hatte. Er hatte nämlich in einer Fensterscheibe sein Spiegelbild gesehen und erkannt, was eine halbe Woche auf Reisen bereits anrichten konnte. Außerdem hatten sie vier Rauchstopps und zwei Pinkelpausen eingelegt. Und dann auch noch ein paar Temposünder angehalten und Knöllchen verteilt. Damit hatte Buckley sowohl seine Punktzahl als auch Catos Blutdruck erhöht. Cato konnte es kaum erwarten, die Leiche zu sehen. Er fragte sich, ob Buckley das überhaupt kannte, diese Hochspannung, wenn es um einen möglichen Fall ging, um ein Geheimnis – ob der Mann schon tot gewesen war, als er ins Wasser fiel? Um solche Dinge eben. Wohl kaum. Cato sah sich kurz im Rückspiegel an – graue Stellen an den Schläfen, aber auch zwei Monate vor seinem achtunddreißigsten Geburtstag war er gut in Form, wie schon seit Jahren. Die Verbannung ins Viehdezernat ließ ihm mehr Freizeit, und die nutzte er zum Teil, um noch fitter zu werden. Schwimmen, Radfahren und möglichst den ganzen Mist meiden, den er runtergeschlungen hatte, als er noch normale Dienstzeiten gehabt hatte – was immer das bei der Kripo hieß.
Neuerdings konnte er anscheinend nicht genug Schlaf bekommen. Es hatte eine Zeit gegeben, da war er nach vier oder fünf Stunden putzmunter aus dem Bett gesprungen. Jetzt kriegte er normalerweise die vollen acht Stunden, oft auch mehr, trotzdem wachte er manchmal erschöpft und lethargisch auf. Und heute? Heute sah er in seinen Augen wieder eine Energie funkeln, die er schon lange vermisst hatte.
Der Nachmittag war bereits halb vorbei, als sie die Bergkuppe vor Hopetoun erreichten und in den Ort hinunterfuhren. Während sie sich der Küste näherten, hatte die erstickende Hitze nachgelassen. Der heiße Ostwind im Landesinneren war zu einem frischen Südwest geworden, und allmählich fühlte Cato sich wieder einigermaßen wie ein Mensch. Sie rollten Hopetouns Hauptstraße hinunter, die sich aus einem unerfindlichen Grund Veal Street schimpfte, »Kalbfleischstraße«, und Cato sinnierte, dass der heutige Tag dem Thema Fleisch gewidmet war. Kuhköpfe, geschenkte Gäule, Barbecues, Pasteten, ja, sogar die Lösung im Kreuzworträtsel. Und jetzt auch noch die Veal Street. So war das eben in der Rindviehtruppe.
Vor einem Café mit Holzterrasse, auf der eine Handvoll Gäste Kaffee trank, standen zwei Telefonzellen. In der einen telefonierte ein Mann in einem staubigen, blau und neongelben Overall. Er hatte ihnen den Rücken zugekehrt und hielt sich das andere Ohr zu, weil der Wind so lärmte. Als er sich umdrehte, sah Cato im Vorbeifahren, dass er Chinese war. Ihre Blicke begegneten sich kurz.
»Hier gibt’s also noch mehr als nur Sie«, bemerkte Buckley.
»Scharfe Augen. Das muss der Grund sein, warum Sie Sergeant sind und ich bloß Constable.«
»Nein, Senior Constable. Machen Sie sich nicht schlechter, als Sie sind«, korrigierte Buckley ihn.
Cato hatte bereits in der Dienststelle angerufen und den stellvertretenden Leiter erreicht, Constable Greg Fisher. Fisher hatte als Treffpunkt das Seenotrettungshäuschen neben dem Skatepark genannt. Er hatte sie vorgewarnt: Diese Hütte fungiere als Polizeiwache, bis das neue, supermoderne Mehrzweckgebäude für die Rettungsdienste fertiggestellt sei. Das könne allerdings noch eine Weile dauern, hatte Fisher gesagt, »chronischer Arbeitskräftemangel«. Nach allem, was Cato sehen konnte – einen großen Sandhaufen mit einem provisorischen Drahtzaun drumherum –, gab es kaum Anzeichen dafür, dass man bisher auch nur begonnen hatte, eine neue Polizeiwache zu bauen. Er fuhr auf den rostbraunen Schotter und parkte. Das Seenotrettungshäuschen hatte etwa die Größe eines Frachtcontainers, sah aber mit seinem abblätternden olivgrünen Anstrich nicht ganz so proper aus. Die Tür war offen, also trat Cato ein. Greg Fisher saß an einem Schreibtisch und telefonierte. Er blickte auf und begrüßte die Besucher mit einem Augenzwinkern. Senior Sergeant Tess Maguire stand an einem Whiteboard, das kürzlich gesäubert worden sein musste, denn der Geruch des Reinigers hing noch in der Luft. Tess hielt einen roten Stift in der linken Hand, und Cato fiel ihr nackter Ringfinger auf. Mitten auf das Whiteboard hatte sie »Flipper« geschrieben und dahinter ein Fragezeichen gemalt. Sie hatte der Leiche also einen Namen gegeben. Ganz rechts waren einige Namen und Telefonnummern aufgelistet.
Tess drehte sich um. Auf den ersten Blick schien sie noch ganz die Alte zu sein, aber als Cato genauer hinsah, kamen ihre Augen ihm dunkler und trauriger vor. Mit diesen Augen betrachtete sie ihn jetzt ebenfalls von Kopf bis Fuß. Cato zog seinen Bauch ein wenig ein und hob den Kopf, um seinem Hals eine kleine Chance zu geben, aber Tess schien sich mehr auf das Stierkopf-Logo auf der Brusttasche seines Diensthemdes zu konzentrieren. Er zuckte innerlich zusammen. Bei nächster Gelegenheit musste er wirklich Zivilkleidung anziehen.
»Hübsche Uniform. Hab schon gehört, dass du kommst.« Auch in ihrer Stimme schien das Licht erloschen zu sein. »Wie geht’s denn so?«, erkundigte sie sich so lahm, als spiele seine Antwort gar keine Rolle.
»Gut. Gut.« Cato sagte es zweimal, wie um es sich selbst zu bestätigen.
Dann stellte er Buckley vor, der immerhin sein Vorgesetzter war. Tess berichtete ihnen das Wenige, was sie selbst wusste: Lehrerin, Haie, Rumpf, Arzt, kein Kopf.
»Und warum Flipper?« Cato nickte zum Whiteboard hinüber.
Greg Fisher konnte sein Grinsen nicht unterdrücken. »Die Lehrerin hat erst gedacht, die Haie, die mit ihm gespielt haben, wären Delfine.«
»Habt ihr hier viel Publikumsverkehr?«
Cato sah, dass Tess sauer wurde.
»Bis morgen steht da ein Raumteiler«, erklärte sie. »Außer uns kriegt niemand das Whiteboard zu sehen.«
Cato fragte sich, wie man einen derart kleinen Raum noch weiter unterteilen konnte. Doch von unsensiblen Spitznamen abgesehen würde es auch noch eine Menge anderer Gründe geben, warum diese Infotafel der Öffentlichkeit verborgen bleiben musste.
»Dann erzähl doch mal, was der Arzt dazu gesagt hat.«
Offenkundig meinte Jim Buckley, es sei an der Zeit, seine Anwesenheit kundzutun. »Ja, hat der gute Doc denn zu viel ferngeguckt oder was?«
Tess fasste zusammen, was sie erfahren hatte, und beendete ihre Ausführungen mit der Neuigkeit, dass man die Leiche ins fünfzig Kilometer entfernte Ravensthorpe gebracht und im dortigen Krankenhaus in die Kühlkammer verfrachtet hatte.
Cato fluchte. Auf dem Weg nach Hopetoun waren sie doch durch Ravensthorpe hindurchgefahren, folglich hätte er sich die Leiche unterwegs ansehen können – wenn sich jemand die Mühe gemacht hätte, ihn zu informieren. Jetzt würde das Zurückfahren unnötig Zeit kosten. Greg Fisher schien das unangenehm zu sein, während es Tess offenbar einen Dreck interessierte. Das hier war ihr Bereich, hier bestimmte sie.
»Ein Rechtsmediziner aus Albany ist schon unterwegs. Er müsste in ein paar Stunden in Ravensthorpe sein. Sie können sich da mit ihm treffen. Wollen Sie hier noch irgendetwas tun, während Sie warten?«
Tess hatte die Frage an Buckley gerichtet und Cato damit zu verstehen gegeben, wer der Chef war. Buckley seinerseits blickte jetzt zu Cato hinüber. Detective Kwong zog seine Sonnenbrille aus der Brusttasche seines Uniformhemdes.
»Gehen wir an den Strand.«
Der Strand von Hopetoun brachte zwar keine umwerfend neuen Erkenntnisse, aber Cato genoss das Knirschen der strahlend weißen Körnchen unter seinen Dienststiefeln und das Funkeln des klaren Wassers, das tosend ans Ufer rollte. Ihm ging es bei diesem Strandgang auch darum, ein Gefühl für den Ort zu bekommen, für seine geografische Lage und das alles. Der erste Eindruck? Klein. Die Fahrt durch das Städtchen hatte etwa fünf Minuten gedauert. Von der Hauptstraße zweigten rechts und links etwa ein halbes Dutzend Seitenstraßen ab. Östlich der Veal Street befanden sich vor allem ältere Ferienhäuser, und im Westen lag das neu erbaute Legoland – wie Tess es nannte –, das Hopetoun der Mine zu verdanken hatte. Das Südende der Veal Street war das Stadtzentrum – drei Läden, ein paar Restaurants, ein Park, eine Kneipe, der Strand, das Meer. Am Nordende ging die Veal Street in die Hopetoun Ravensthorpe Road über, die, wer hätte das gedacht, nach Ravensthorpe führte. Hopetoun war eigentlich nicht mehr als ein Kaff, und auf den ersten Blick wirkte es wie ein schöner, friedlicher Ort zum Sterben.
Cato hatte Tess und Greg gebeten, die Gezeiten und die Wetterbedingungen für die vergangenen Tage herauszusuchen, weil er sehen wollte, ob sich daraus Rückschlüsse auf die Stelle ziehen ließen, an der die Leiche ins Wasser gelangt war. Außerdem hatte er vorgeschlagen, allen Vermisstenanzeigen der letzten Wochen nachzugehen. Tess hatte ihm daraufhin einen »Ach ja, Sherlock?«-Blick zugeworfen. Offensichtlich hatte sie mit diesen Nachforschungen längst begonnen. Cato hätte mit dieser Feindseligkeit ihrerseits rechnen sollen, aber sie machte ihm trotzdem zu schaffen. Es war mindestens zwölf oder dreizehn Jahre her, doch die Wunde war offenbar nie richtig verheilt. Und warum sollte sie auch? Cato war damals ziemlich frisch von der Polizeischule gekommen, vier Jahre jünger als sie. Man hatte sie zusammen in ein Zweier-Team gesteckt, und sie hatten von Perths Gangstervorort Midland aus Nachtschichten gefahren, in einem frisierten zivilen Commodore. Cato Kwong – der Prinz des Hexenkessels. Schnelle Verfolgungsjagden durch die Vorstädte, Familiendramen, Herumtreiber, Einbrüche. Routinesachen, die aber damals meistens spannend waren. Und die Adrenalinschübe hatten das Knistern zwischen ihnen noch angefacht. Es schien alles natürlich und unausweichlich zu sein, und es war gut, manchmal richtig toll. Im Nu waren sie bis über beide Ohren verknallt und unzertrennlich gewesen. Bis er sie abserviert hatte.
Als sie nach Ravensthorpe hineinfuhren, war es schon fast dunkel. Nur im Westen, zwischen der Silhouette eines fernen Hügelkamms und einer tintenschwarzen Wolkendecke, waren noch ein paar blasse Streifen Himmel zu sehen. Ravy, wie man die Ortschaft hier in der Gegend nannte, war größer als Hopey, aber nur wenig. Die Hauptstraße lag dunkel und verlassen da, bis auf das Ravensthorpe Hotel, ein zweistöckiges Backsteingebäude, vor dem eine ganze Menge Pritschen-PKWs und Geländewagen parkten. Sie waren zum Poolbillard-Turnier gekommen, das hier an jedem Mittwochabend stattfand. Einige Wagen trugen Logos der Bergbauunternehmen. Cato hatte die Lichter des Bergwerks fern im Osten gesehen, als sie die Abzweigung zum Flugplatz passierten, der genau zwischen den beiden Ortschaften lag. Die Mine war nicht zu übersehen gewesen, ein Fleck strahlendes Tageslicht in der trüben Dämmerung ringsherum. Kurz nach der Abzweigung hatten sie am Straßenrand stoppen müssen, während ein Krankenwagen mit blinkendem Flasher an ihnen vorbeiraste.
Cato hielt auf dem Krankenhausparkplatz und stellte das Radio aus. Den Acht-Uhr-Nachrichten zufolge hatte der australische Aktienmarkt heute seinen schwärzesten Tag seit zwanzig Jahren erlebt. Jim Buckley prustete und murmelte: »Mir kommen die Tränen.« Es war totenstill, kaum Lichter an. Wie viele Krankenhäuser in ländlichen Gebieten war auch Ravensthorpe kaum mehr als eine bessere Pflegestation. Diese Kliniken konnten oft nur überleben, weil der Wahlbezirk in der Pampa lag. Hier allerdings war der Grund, dass das Bergbauunternehmen seine Überredungskünste hatte spielen lassen. Der Krankenwagen hatte den Patienten offenbar abgeliefert und kurvte wieder auf die Straße hinaus. Sein Fahrer und Cato grüßten sich mit einem lässigen Handheben.
Als Cato und Buckley sich dem Haupteingang näherten, erwarteten sie, dass die Automatik-Türen zur Seite gleiten würden. Doch nichts rührte sich. Man hatte die Öffnungszeiten des Krankenhauses kürzlich auf die Stunden zwischen acht und zwanzig Uhr reduziert und machte nur für Notfälle Ausnahmen. »Personalmangel« stand auf dem handgeschriebenen Zettel, der mit Blu-Tack an die Tür geklebt worden war. Es war zwanzig Uhr fünf. Cato klingelte, und sie warteten. Und warteten. Er legte die Hand über die Augen und schaute in das grelle Licht, um zu sehen, ob sich da drinnen etwas rührte. Nichts. Cato fluchte laut und drückte zum zehnten Mal auf die Klingel. Endlich schwebte eine ältere Frau im rosa Bademantel und mit einem dampfenden Becher in der Hand in sein Blickfeld. Als sie Catos Gesicht hinter der Glastür sah, ließ sie fast ihr Getränk fallen. Er drückte seinen Dienstausweis gegen die Scheibe und formte mit den Lippen »Polizei«. Doch das nützte nichts. Die Frau schien jetzt erst recht entschlossen zu sein, rasch in ihr Bett zu flüchten und sich unter der Decke zu verkriechen.
Doch da trat Jim Buckley vor, mit freundlichem Lächeln, fröhlichem Winken und ohne asiatische Gesichtszüge. Das klappte. Die alte Frau drückte drinnen auf einen Knopf, und die Türen glitten auseinander. Mit einem Einfühlungsvermögen, das für Cato eine absolute Offenbarung war, erfragte Buckley den Weg zum OP auf der Rückseite des Gebäudes. Nebenbei erfuhr er auch noch alles, was er über die Hernie und den grauen Star der Patientin wissen musste.
»Danke, meine liebe Deirdre, und achten Sie gut auf sich.«
»Kommen Sie denn morgen wieder, Roger?«
»Ja doch, selbstverständlich, meine Liebe.«
Buckley winkte ihr ein letztes Mal zu und führte Cato dann den Gang entlang. Cato fragte sich gerade, wer sich wohl nachts um Deirdre kümmern würde, da begegnete ihnen eine mürrische Frau mit leuchtend rotem, zu einem Knoten aufgestecktem Haar. Sie kam gerade aus der Damentoilette und würdigte die beiden Männer keines Blickes, so als wäre es etwas ganz Alltägliches, dass zu dieser Uhrzeit Fremde über die Krankenhausflure wanderten. Stattdessen stampfte sie durch eine Doppeltür, hinter der Cato gedämpfte Schreie und Lärm hören konnte. Liebes Tagebuch, erinnere mich doch bitte daran, dass ich niemals eine Nacht im Krankenhaus in Ravensthorpe verbringen und auch nie wieder über die Krankenhäuser in Perth meckern will.
Immerhin war im OP Licht, ein gutes Zeichen. Sie schoben die Türen auf und traten ein. Ein kleiner, drahtiger Mann mit einem Skalpell in der Hand sah von der Arbeit auf. An einem Metalltisch hinter ihm in der Ecke saß eine Assistentin, machte mit einer Hand Notizen und aß aus der anderen ein Sandwich. Sie unterbrach ihre Arbeit nicht, blickte hinter ihrem Vorhang aus schwarzem Haar nicht einmal auf. In der anderen Ecke stand Tess und sah bedeutungsvoll auf die Uhr. Ihr Lächeln war freundlich und spöttisch.
»Ihr habt also gut hergefunden.«
Catos Geduldsfaden war kurz vorm Zerreißen. »Aber reinzukommen war ein bisschen schwierig.«
Der Mann mit dem Skalpell wollte offenbar gern weiterarbeiten. »’n Abend, die Herren, Sie müssen von der Kripo sein. Ich bin der Rechtsmediziner Harold Lewis, Harry für Sie. Verzeihen Sie, dass ich Ihnen nicht die Hand gebe. Wollen wir weitermachen?«
Diese Ansprache richtete er mit entrückter Stimme an Jim Buckley, der nickte. Doch seine Aufmerksamkeit war anderswo.
»Das ist Sally.« Harry winkte mit dem Skalpell etwa in die Richtung, wo die Schwarzhaarige saß.
Es war eine Art Billigversion von Silent Witness, bloß dass Sally geräuschvoll ihr Sandwich mampfte und ihr Kuli auf dem Notizblock schabte. Die Leiche lag auf einem blanken Metalltisch. Cato trat näher heran. Sein Blick wanderte über die Haut, die Wunden, die Stümpfe und den Arm ohne Hand. Flipper. Das sah nicht mehr wie ein Mensch aus. Aber es – Korrektur, er – war einmal ein Mensch gewesen. Dieser formlose Fleischklumpen hatte irgendwo eine Familie. Cato wollte sich bemühen, das nicht zu vergessen. Der Gestank war greifbar wie ein weiteres Wesen im Raum. Sally jedoch schien ihn gar nicht zu bemerken, sie wischte sich graziös einen Krümel Vollkornbrot aus dem Mundwinkel.
Dr. Lewis setzte seine Arbeit fort. Die Leiche war mittelgroß, männlich, im Alter vermutlich zwischen zwanzig und vierzig. Keine offensichtlichen Hinweise auf ein Leiden oder eine Krankheit. Keine Narben, Tätowierungen oder auffallende Muttermale und keine eindeutigen Hinweise auf die ethnische Zugehörigkeit. »Aufgrund der allgemeinen Hautablösung und des Verwesungszustandes schätze ich, dass er bis zu einer Woche im Wasser gelegen hat. Tut mir leid, dass ich keine genaueren Angaben machen kann.«
Harry untersuchte und Sally listete auf, die verschiedenen Wunden, vor allem Zahnspuren und Risse. Nachdem sie das Sandwich verputzt hatte, sprang sie von ihrem Hocker und machte ein paar Fotos.
Ganz behutsam hob Dr. Lewis den bleichen Arm. »Schade, dass die Hand fehlt; vielleicht wäre ein Finger mit Ehering drangewesen, das hätte uns weiterhelfen können. Aber da haben wir kein Glück.«
Soweit er sagen konnte, war es wohl Haien zuzuschreiben, dass die Hand, der rechte Arm und die Beine fehlten. Dann wandte Lewis sich dem Hals zu und zog das Vergrößerungsglas am Teleskoparm herunter.
»Die Halswirbelsäule ist nicht gebrochen, wie man es bei der reißenden Bewegung von Haifischkiefern erwarten könnte. Nein, der Kopf wurde abgeschnitten, oder wahrscheinlich eher abgesägt – vielleicht mit einer Kettensäge? Mit einer Handsäge wäre das sehr mühsam gewesen, und der Knochen wäre an der Schnittstelle rauer. Ist nicht gerade mein Spezialgebiet, aber wir werden ihn in Perth begutachten lassen.«
Dass es mit einer »Handsäge sehr mühsam« war, konnte Cato nur bestätigen. War es erst heute Morgen gewesen, dass sie in Katanning eine Kuh enthauptet hatten?
Lewis fuhr fort. »Mir scheint, hier ist mein Freund Dr. Terhorst der Fachmann. Da wir gerade davon sprechen, ich dachte, er wäre heute Abend vielleicht hier bei uns?«
Er sah sich im Raum um, als könnte Terhorst sich irgendwo versteckt haben.
Tess schaute von ihren Notizen auf. »Dr. Terhorst sollte heute Abend im Wein-Klub in Hopetoun einen Vortrag halten. Er lässt sich entschuldigen. Morgen früh ruft er an, hat er gesagt.«
»Also auch noch Weinkenner. Ein vielseitig begabter Mann, unser Dr. Terhorst«, sagte Lewis mit einer Spur von Unaufrichtigkeit in der Stimme. Er nahm den Y-Schnitt vor und öffnete die Leiche. Tess wurde blass. Cato zwang sich, weiter hinzusehen, schließlich war es keineswegs sein erstes Mal, andererseits lag die letzte Obduktion aber schon eine Weile zurück. Buckley konzentrierte sich auf Sallys Wadenmuskeln und beachtete das Gemetzel auf dem Metalltisch nicht. Lewis hob gerade die Lungen aus dem Rumpf. Jetzt sah Cato, wie er zu seiner drahtigen Muskulatur kam. Mehrmals am Tag Lungen zu stemmen hätte jeden fit gehalten.
»Der Lungeninhalt schließt Tod durch Ertrinken aus«, bestätigte Lewis.
Er untersuchte die Lungen weiter, bohrte mit dem Skalpell hinein und summte dabei leise vor sich hin. Cato versuchte, die Melodie zu erkennen – es konnten ein paar Takte von Puccini oder auch von Shirley Bassey sein. Endlich sah Lewis ihn an.
»Ich würde sagen, Ihr Freund hier war mit Sicherheit tot, bevor er ins Wasser gelangte.«
Cato und Tess warfen sich einen Blick zu; es sah also ganz so aus, als würde er noch eine Weile bleiben. Lewis zog etwas aus dem Leichnam, das wie ein blutgetränkter, halb entleerter Ballon aussah, und drückte es in einen Plastikbehälter aus. Mageninhalt. Nicht viel, enthielt aber Spuren von Reis und Huhn. Für weitere Untersuchungen würde er jetzt noch Blut-, Haut- und Gewebeproben nehmen, aber Cato hatte vorerst genug gesehen. Sein Nacken prickelte, es fühlte sich fast an wie Freude.
»Wollen Sie damit sagen, dass es sich um einen Mordfall handelt, Dr. Lewis?«
»Schon möglich; aber das ist Ihr Job, nicht meiner. Für das, was wir hier sehen, kann es eine Menge Gründe geben: Unfall, Panik, Vertuschung, Verbrechen. Jedenfalls …« Er tippte mit dem Skalpell leicht gegen Flippers Hals und sah Cato direkt in die Augen, »… ist da was faul.«
5
Donnerstag, 9. Oktober. Morgendämmerung.
»Fuck.«
Das war die sorgfältig durchdachte Antwort von Detective Inspector Hutchens, nachdem Cato seinem Ex-Chef früh am nächsten Morgen telefonisch von dem vorläufigen Befund des Pathologen berichtet hatte. Cato stand draußen auf der Straße, die Sonne war gerade aufgegangen, und Vogelgesang erfüllte die Luft. Elstern trillerten so lieblich wie Engel, die gerade in der Badewanne ertränkt werden. Ein sanfter Wind wehte durch die Eukalyptusbäume. Cato genoss den Frieden und die Ruhe.
»Fuck«, sagte Hutchens noch einmal.
Cato wartete ab und hielt den Mund. Hutchens hatte erklärt, dass er den Fall schnell zu den Akten legen wollte. Für Mordermittlungen, falls es sich tatsächlich um einen Mord handelte, hatte er keine Leute. Und so grauenhaft der Fall auch sein mochte, in diesem Stadium betrachtete er ihn nicht als besonders vorrangig. Im Moment war der Tote ein Niemand. Keiner hatte ihn bisher als vermisst gemeldet. Keiner schien sich für seinen Tod zu interessieren. Vielleicht würde das so bleiben, dann konnte diese Sache still und leise auf die ständig wachsende Liste der »ungelösten Fälle« rutschen.
Während Cato sich geduldig Hutchens’ Schimpferei anhörte, beobachtete er, wie eine Elster im Sturzflug einen morgendlichen Spaziergänger anpeilte. Die Kacke war, dass inzwischen schon Reporter bei der Pressestelle der Polizei in Perth nachgefragt hatten. Verbrechen oder nicht, Haie waren immer einen Bericht wert. Im Polizeipräsidium wollte man den Vorfall heruntergespielt sehen, bis man genauer wusste, womit man es zu tun hatte. Bisher wurden die Medien damit abgespeist, dass es sich anscheinend um einen Fall von »Ertrinken« handelte und dass der sogenannte Haiangriff höchstwahrscheinlich erst nach dem Tod stattgefunden hatte und schlicht auf die Neugier der Haie zurückzuführen war. Trotzdem musste natürlich öffentlich sichtbar sein, dass Hutchens etwas unternahm, einfach für den Fall, dass plötzlich irgendein trauernder Verwandter auf der Bildfläche erschien. Und jetzt sprach dieser Rechtsmediziner von Mord. Hutchens unterbrach seinen Monolog durch einen weiteren Kraftausdruck.
Einer seiner Detective Sergeants, der am Montag wieder im Dienst hätte sein sollen, hatte gerade aus seinem Familienurlaub in Neuseeland angerufen und gesagt, er sei auf einem Gletscher ausgerutscht und habe sich den Knöchel gebrochen.
»Auf einem Scheißgletscher. So ein Kamel.«
Der nächste war eine Frau und sollte eine Woche später wiederkommen. Sie hatte schlauerweise ihr Handy ausgestellt, während sie zweifellos auf Bali rauschende Feste feierte. Alle anderen waren einfach total mit Arbeit eingedeckt. Ein lastendes, missmutiges Schweigen entstand. Cato wollte nur zu gern in die Bresche springen, daher ließ er die Pause andauern. Immer länger. Und wurde schließlich mit einem genervten Brummen belohnt.
»Ich hoffe bloß, dass ich das später nicht bereue. Ist wohl anzunehmen, dass ihr beide, du und Buckley, ungefähr eine Woche lang die Stellung halten könnt, oder?«