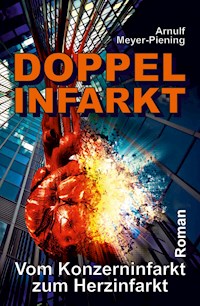
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Beyer ist Partner einer internationalen Beratungsgesellschaft. Nach der Wiedervereinigung sucht er eine neue Herausforderung in den Neuen Bundesländern. Er übernimmt die Leitung einer ehemals bedeutenden Messtechnikfirma in Dresden. Die Aufgabe stellt sich als viel schwieriger dar, als gedacht. Sowohl die Treuhandanstalt als auch dubiose Machenschaften von Investoren machen ihm das Leben schwer. Er kommt in Kontakt mit einem potentiellen Investor und hofft, dass er wenigstens einen Unternehmensteil retten kann. Der Investor zieht sich jedoch zurück und bietet ihm einen Geschäftsführerposten in seinem Unternehmen an. Beyer akzeptiert und erkennt erst nach und nach, dass auch dieses Unternehmen kaum zu retten ist. Im Zuge seiner Bemühung um die Sanierung der Firmengruppe, die inzwischen von einem großen Konzern übernommen wurde, erleidet er einen Herzinfarkt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 837
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arnulf Meyer-Piening
Der Doppel-Infarkt
Vom Konzerninfarkt zum Herzinfarkt
Thriller
Imprint
Der Doppel-Infakt
Arnulf Meyer-Piening
Copyright: © 2019 Arnulf Meyer-Piening
Cover: Erik Kinting / www.buchlektorat.net
E-Book-Erstellung: Sabine Abels / www.e-book-erstellung.de
Titelbild: tolokonov (depositphotos.com)
Published by: epubli
www.epubli.de
Ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, die über den Rahmen des Zitatrechtes bei korrekter vollständiger Quellenangabe hinausgeht, ist honorarpflichtig und bedarf der schriftlichen Genehmigung des Autors.
1. Der Anfang vom Ende
Der Stress entstand für mich, als geschäftsführenden Gesellschafter einer Konzerngesellschaft, nicht aus der täglichen Arbeitsbelastung, er kam aus der Verunsicherung, die in den letzten Jahren von den Machenschaften des Vorstands in der Holding ausgegangen waren. Immer neue Forderungen zur Ergebnisverbesserung waren an mich gestellt worden, die handelsrechtlich nicht sauber waren, die bedenklich waren, die wegen Bilanzfälschung unter Umständen auch strafrechtliche Konsequenzen haben konnten. Immer wieder wurde meine Loyalität gegenüber dem Vorstand und auch den anderen langjährigen Geschäftsführern der Schwestergesellschaften auf die Probe gestellt. Einerseits waren alle Führungskräfte genau wie ich zur Loyalität verpflichtet und wollten auch ihren Job nicht verlieren, andererseits war ich zur Korrektheit erzogen worden und fühlte mich meinem Gewissen verantwortlich.
Vor wenigen Monaten war der Konzern verkauft worden. In einer Nacht- und Nebelaktion waren zwei große Stammaktienpakete in andere Hände übergegangen, ein neuer Großaktionär hatte das Sagen. Ich kannte den neuen Vorstandsvorsitzenden flüchtig aus meiner Düsseldorfer Zeit, er vertrat einen Konzern mit weitverzweigten Interessen auf dem Gebiet des Maschinenbaus, der Elektronik und der Wehrtechnik. Das gesamte Management galt als hart, arrogant, kompromisslos und zielstrebig. Was würde das für mich, für meine Firma und meine Mitarbeiter bedeuten?
Es lag ein schwieriger Arbeitstag hinter mir, denn die telefonisch übermittelten Anforderungen der neuen Konzernherren waren nicht mit den Realitäten des Marktes in Einklang zu bringen: Sie wollten die Firma in eine Marktnische drängen, die keine langfristige Perspektive eröffnete. Das wollte ich so nicht hinnehmen. Dafür hatte ich mich die vergangenen Jahre nicht so intensiv eingesetzt, das wollte ich so nicht hinnehmen. Ich wollte für die Selbständigkeit der Firma und die Erhaltung der Arbeitsplätze meiner Mitarbeiter kämpfen.
Vor ein paar Jahren hatte ich eine Studie für den damaligen Inhaber erstellt, in der ich eine neue Konzernstruktur und eine sinnvolle markt- und produktseitige Abgrenzung zu der Schwestergesellschaft vorgeschlagen hatte, aber meine Vorschläge waren nie in die Tat umgesetzt worden, weil der alte Vorstand seit einigen Jahren nur die kurzfristigen Erfolge sah und jede Art der langfristigen Orientierung vermissen ließ. Mit meinem Konzept hätten beide Gesellschaften eine faire Chance gehabt, aber nicht mit der nun von den neuen Vorständen ohne jede Diskussion verfügten Konzernstruktur. Ich würde gegen die aus meiner Sicht unzweckmäßigen Vorstellungen des neuen Vorstands opponieren, jedenfalls soweit es mir möglich war. Ich würde die Fakten und Argumente noch einmal darlegen, es würde sicherlich einen Weg geben, die Herren zu überzeugen.
Ich fühlte mich merkwürdig ermattet und legte mich in meiner Wohnung in einem landschaftlich schön gelegenen Vorort von Essen zur Entspannung auf mein Bett, konnte aber nicht schlafen.
Daher beschloss ich, einen Abendspaziergang über die nah gelegenen Felder hinunter zur Ruhr zu machen. Ich zog leichte Kleidung und bequeme Laufschuhe an, wie ich es sonst immer getan hatte, wenn ich den Feierabend zur Entspannung in der Natur mit ausgedehnten Spaziergängen verbrachte. Während ich dahinschlenderte, überkam mich plötzlich eine unbegreifliche Angst. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Mit schweren Schritten ging ich den kleinen Hügel hinter dem Friedhof hinauf. Ich fühlte mich schwindelig, mein Herz raste, es zog sich in meiner Brust zusammen, kalter Schweiß brach auf meine Stirn aus. Ich musste mich auf eine Bank an dem Steinernen Kreuz setzen. Während ich tief durchatmete, sah ich zu dem klaren Abendhimmel mit der schon recht tief stehenden Sonne hinauf und den Flugzeugen nach, die sich in endloser Folge auf dem Gleitpfad zur Landung in Düsseldorfer einreihten. Meine Gedanken gingen zurück zu glücklichen Tagen.
Flug zum Meer
Die zweimotorige Propellermaschine, eine Cessna 340 II hatte vom Tower Stuttgart die Startfreigabe erhalten und rollte langsam zum Haltepunkt der Startbahn 28.
„Elinor, gib mir bitte mal die Checkliste.“
Zwar kannte Arnim die Liste auswendig, aber nie verließ er sich auf sein Gedächtnis, denn es war zu leicht möglich, irgendeine Kleinigkeit durch Unaufmerksamkeit zu übersehen, was fatale Folgen haben könnte. Er flog nur nebenberuflich aus Leidenschaft und weil es zeitsparend war, denn hauptberuflich war er Unternehmensberater und häufig mit seinen Gedanken bei seinen Klienten. Ruhig lehnte er sich in dem Pilotensitz zurück und ließ seinen Blick über die vielen Instrumente schweifen. Er war damals Ende 40, doch seine sportlich schlanke Gestalt, sein volles dunkelblondes Haar, sein schmales Gesicht mit blauen Augen, einem hellen Vollbart und vor allem sein strahlendes Lächeln ließen ihn jünger erscheinen.
Elinor reichte ihrem Mann die Checkliste. Sie war drei Jahre jünger als ihr Mann, eine aparte Frau, schlank mit braunen Augen und kastanienbraunen Haar. Eher ängstlich und unsportlich, teilte sie weder die Begeisterung ihres Mannes für das Fliegen noch für andere gefahrvolle Sportarten.
Elinor sollte Recht behalten, so ganz problemlos sollte der Flug nicht zu Ende gehen. Sie waren noch weit von einer sicheren Landung auf dem kleinen Flughafen in dem Maure-Gebirge entfernt! Ein enges Tal mit Bergrücken im Süden und Norden der Landebahn und am Ende wieder ein Berg. Ein Fehlanflug ist nicht unkritisch, weil man auf der westlichen Landebahn gleich nach rechts abdrehen muss, um dem Tal zu folgen. Es bleibt kein großer Entscheidungsspielraum, aber die Landebahn ist mit 1200 Meter Länge auch für größere Jets ausreichend. Armin kannte den Platz genau. Als sie vor Jahren das Haus in Port Grimaud gekauft hatten, hatte er eine spezielle Einweisung für Flüge im Gebirge erhalten. Sie war Voraussetzung für die Erteilung einer Landeerlaubnis in diesem schwierigen Gelände. Man musste jedes Jahr mindestens eine Landung im Gebirge nachweisen, um die Berechtigung nicht zu verlieren. Aber sie flogen mehrmals im Jahr dorthin, so waren sie mit den speziellen Gefahren von Flügen in diesen Bergen vertraut.
Beyer informierte die Regionalkontrolle: “Marseille Radar, this is WL, reaching level 160, standing by for further decent.”
“Roger WL, contact Nice on 112,45.”
Beyer verabschiedete sich und schaltete die neue Frequenz. “Nice, this is D-IBWL maintaining level 160, standing by for further decent.”
Prompt kam die Antwort mit der Freigabe für den weiteren Sinkflug bis Flugfläche 100.
In dieser Gegend wurde dem Piloten bei guter Sicht oft freigestellt, bis zu welcher Mindest-Flughöhe der Sinkflug fortgesetzt werden konnte. Nördlich von Nizza sind die Berge noch fast 3000 Meter hoch und bei Motorausfall kann es bei zu geringer Flughöhe schnell kritisch werden, um noch sicher einen geeigneten Landeplatz zu erreichen. Anderseits muss man nach Überqueren der letzten Berge einen steilen Sinkflug einleiten, um nicht zu weit auf das Mittelmeer hinauszufliegen. Als er die vorgegebene Flughöhe erreicht hatte, erbat er die Freigabe, nach Sichtflugregeln zum Flugplatz La Mole zu fliegen. Das wurde bestätigt, allerdings mit der Warnung von Starkwind in Küstennähe in der Umgebung von St. Tropez, verbunden mit der Empfehlung, in Nizza zu landen: „WL, we have a strong Mistral with 55 knots from the west, 280 degrees. We recommend landing at Nice airport.”
„Das hat uns noch gefehlt. Die haben Mistral da unten und wollen, dass wir in Nizza landen. Der Wind bläst mit etwa 80 km/h, das ist ganz schön happig. Was meinst du, sollen wir nach La Mole fliegen oder in Nizza landen?“ fragte Arnim seine Frau.
Elinor antwortete genervt: „Das weiß ich doch nicht, das musst du entscheiden, du bist der Pilot. Ich bin immer für Sicherheit, das weißt du, geh kein Risiko ein.“
„Aber der Wind liegt in La Mole genau auf der Bahn, es wird zwar ruppig werden, aber es wird schon gehen. Da müssen wir eben mit viel Gas landen. Die Bahn ist ja lang genug und breit ist sie auch. Außerdem haben wir unseren Wagen da unten stehen, wie sollen wir von Nizza nach La Mole kommen mit all dem Gepäck, das du mitschleppst.“
„Dass du mir immer das viele Gepäck vorwirfst, das meiste ist doch für dein Boot.“
„Ist jetzt auch egal, für wen das ist, jedenfalls haben wir einen Haufen Zeug dahinten, das kriegen wir in kein Taxi. Ich versuche in La Mole zu landen.”
“Nice Control, we prefer landing in La Mole, thanks for your advice.”
“WL, you are cleared from present position direct to St. Tropez. Report when leaving my frequency.”
“Will comply.”
Die Maschine drehte nach Westen und beim Passieren von 2000 Fuß Höhe tanzte sie auf und ab, wurde hin und her geschleudert. Alle nicht festgezurrten Gegenstände wurden von den Sitzen geschleudert und fielen zu Boden.
„Hätten wir doch das ganze Zeug besser sichern sollen.“
„Ich habe dir immer gesagt, du bist zu nachlässig.“
„Siehe bloß zu, dass uns nichts ins Cockpit fliegt, das wäre fatal. Ist so schon schwierig genug.“
„Ich kann mich selbst kaum halten, wie soll ich noch die Sachen festhalten?“
Ein kurzer Blick über die Schulter genügte. Das blanke Chaos. Alles lag wild durcheinander.
„Hoffentlich rutscht nichts unter den Sitzen hindurch nach vorne zwischen die Pedale. Dann habe ich kein Seitenruder mehr.“
Arnim wusste, dass Elinor daran auch nichts ändern konnte und meldete sich über St. Tropez vom Tower von Nizza ab, um anschließend Kontakt mit den Flugplatz La Mole aufzunehmen.
„Elinor, stell bitte die Tower Frequenz von La Mole ein.“
„Welche ist das?“
„Keine Ahnung, sieh im Handbuch nach.“
Das war leichter gesagt als getan. Auch das Handbuch lag nicht mehr da, wo es vorher gelegen hatte. Aber Elinor schaffte es: „119,75 ist die Frequenz.“
„Stell sie bitte ein“, sagte er leicht gestresst.
Die Bucht von St. Tropez öffnet sich nach Nordosten. Trotz der schützenden Nähe des Ufers war die Wasserfläche von Schaumkronen übersät. Die Sicht reichte bis zu den schneebedeckten Alpen, das Cap Roux schien wie zum Greifen nah. Arnim hätte gern – wie er es sonst immer tat – die Gegend betrachtet, doch die bevorstehende Landung in den Bergen beunruhigte Pilot und Co-Pilotin zunehmend.
„Glaubst du, wir werden es schaffen?“ Die Stimme von Elinor klang alles andere als zuversichtlich. „Wir hätten lieber nach Nizza gehen sollen. Willst du nicht umkehren? Es ist doch nicht weit.“
„Nein, wir müssen dann einen VFR-Flugplan nach Sichtflugregeln machen und den IFR-Plan canceln. Die Franzosen verstehen uns sowieso nicht. Wir versuchen die Landung wie geplant.“
Die Lage an Bord wurde zunehmend kritisch. Die kleine Maschine war kaum noch zu kontrollieren. Die Scherwinde schleuderten sie mal in die Höhe, dann wieder abrupt in die Tiefe. Das Tal von Grimaud nach La Mole kam in Sicht. Flughöhe 600 Fuß. Eindrehen in den Endteil zur Landebahn 27.
„Klappen auf 10 Grad. Übernimm du das bitte, ich brauche beide Hände am Steuer. Klappen 15 Grad. Fahrwerk ausfahren. Ich muss näher an den Luv-Hang sonst verlieren wir zu schnell an Höhe.“
Die Maschinen tanzte wie irrsinnig auf und ab.
„Du kannst die Maschine nicht halten, wir werden am Hang zerschellen.“ Elinors Stimme war schrill, ein deutliches Zeichen für die beginnende Angst: „Fliege aus dem verdammten Tal raus, mach schnell, ich halte es nicht mehr aus.“
Arnim musste endlich einsehen, dass es zu gefährlich war, die Landung in den Bergen zu erzwingen. Also griff er zum Mikrofon:
„La Mole, this is D-IBWL, on short final for runway 27.“
„WL, this is La Mole, the airport is closed because of heavy winds, I say again, airport is closed, confirm.
„Verdammt, das hat uns noch gefehlt. Der Flugplatz ist wegen Starkwind geschlossen.
Die Nerven lagen blank.
„Ich habe dir doch gesagt, es geht nicht, du musst umkehren.“
„Wie stellst du dir das in dem engen Tal vor? Wir können nur nach Westen durchstarten.“
Es begann schwierig zu werden.
„Klappen und Fahrwerk rein!“ Auch Armins Stimme hatte nicht mehr den gewohnt sonoren Klang. Der Stress der letzten Viertelstunde begann seine Wirkung zu zeigen. Die Motoren heulten unter Vollgas auf.
„Hast du die Landeklappen eingefahren?“
„Nein, welcher Hebel ist das?“
„Der da rechts von der Mittelkonsole“, und er zeigte mit der Hand auf den Hebel. „Ja, der nach oben, schnell! Und das Fahrwerk einfahren!“
Das Fahrwerk fuhr mit lautem Rumpeln ein.
Die Maschine nahm langsam Fahrt auf. La Mole Tower lag unter ihnen, dann kam das Ende der Landebahn. Nur nicht an den Hang, leichte Kurve nach rechts. – Komm schon, nimm Höhe auf, mach doch, warum steigt sie nicht? – Arnims Gedanken rasten. Die Maschine vollführte noch immer einen wilden Tanz. Mit unendlicher Langsamkeit, so kam es ihnen vor, bewegte sie sich dabei an dem gefährlichen Hang nach Süden vorbei und drehte anschließend nach Westen in das Tal Richtung Draguignan. Außer dem Lärm der auf Volllast drehenden Motoren herrschte im Cockpit gespannte Stille, die Nerven waren bis zum Zerreißen gespannt. Wird sie es schaffen, wird sie Höhe gewinnen, dachte Arnim. Wenn nicht, ist alles vorbei. Eine Wendung um 180 Grad ist in dem engen Tal nicht möglich. Sie mussten es einfach schaffen! Nach quälenden zwanzig Minuten war endlich genügend Höhe erreicht, um wenden zu können. Mit Rückenwind hatten sie dann das Tal schnell verlassen.
Die Maschine näherte sich dem Flugplatz von Fréjus. Arnim griff zum Mikrofon und bat den Tower um Landeerlaubnis. Die Antwort kam sofort und erteilte die Landeerlaubnis allerdings verbunden mit der Warnung wegen starkem Seitenwind: “WL roger, wind is from 270 with 55 knots. Runway in use is 19! Can you make it?”
Blitzartig schuss es Armin durch den Kopf: 90 Grad Seitenwind mit 55 Knoten! Die Maschine ist nur bis 35 Knoten Seitenwind zugelassen. Das wollte Arnim nicht riskieren.
“May we take runway 27 grass?”
“Negative, ground is too soft. We had a lot of rain here recently.”
“Auch das noch. Dann muss es eben auf Landebahn 19 gehen, hoffentlich hält das Fahrwerk.“
„WL is turning final.“
„Have you in sight, cleared to land, runway 19.
Mit 30 Grad Vorhaltewinkel näherte sich die Maschine langsam an die Landebahn. Endlich, die Bahn unter dem Flugzeug. Bloß auf der rechten Seite aufsetzen, dachte er, kommst sonst von der Bahn ab. Knall sie auf den Boden, sie darf nicht mehr abheben, sonst ist alles aus. Arnims geballte Aufmerksamkeit richtete sich auf die Landebahn, für Angst oder Bedenken war kein Raum mehr. Eine ruhige Entschlossenheit, diesen Flug zu einem guten Ende zu führen, hatte ihn ergriffen. Seine Hände hielten den Steuerknüppel mit sicherer Hand und zwangen die Maschine auf Kurs zu bleiben. Auch Elinors Angst war in diesem kritischen Augenblick gewichen und hatte einem fatalistischem Vertrauen Platz gemacht. Arnim wird es schaffen, dachte sie, er hat bisher jede kritische Situation gemeistert!
Die Landebahn kam langsam näher, sie erreichten die Schwelle, mit hartem Ruck und kreischenden Reifen setzte die Maschine auf. Das Fahrwerk hatte gehalten. Die Maschine rollte nach kurzem Rollweg aus, wendete und rollte zum Vorplatz. Elinor atmete tief durch, es klang wie ein Seufzer: „Das hast du ja noch mal zum Guten gewendet, aber du hättest bei dem Seitenwind keinesfalls hier landen dürfen, du hättest nach Nizza zurückgehen müssen, wie leicht hätte das schiefgehen können, du hast das Schicksal herausgefordert!“ In ihrer Stimme klang eine Mischung aus Bewunderung und Zorn mit.
„Das war sicher eine der schlechtesten Landungen, die es an diesem Platz je gegeben hat, aber wir sind heil und die Maschine auch, was will man mehr?“
„Oh, einen doppelten Cognac und eine Zigarette wären jetzt der krönende Abschluss.“
„Stimmt, beides haben wir uns redlich verdient.“ Arnim hatte die Fahrt der Maschine weiter verlangsamt und rollte sie behutsam zum Hangar: Bremsen fest, Instrumente aus, Motor aus, Hauptschalter aus. Er schloss kurz die Augen und lehnte sich im Sitz zurück, froh und dankbar, dass letztlich alles gut geendet hatte und das Flugzeug sich als stabil genug erwiesen hatte. Einer sportlichen Herausforderung stellte er sich gerne, aber er vermied unkalkulierbare Risiken. Er schaute zu Elinor, die immer noch bleich und verloren aus dem Fenster blickte. „Ich denke, wir gönnen uns erst einmal eine Zigarette.“
Mit langsamer, mühevoll kontrollierter Bewegung reichte er ihr das Etui und gab ihr Feuer. Sie war wirklich eine tolle Frau, dachte er, und vor allem, sie hat recht, ich hätte die Landung nicht riskieren dürfen, wenn etwas schiefgegangen wäre, keine Versicherung hätte auch nur einen Pfennig bezahlt, von den anderen möglichen Konsequenzen ganz zu schweigen. Gemeinsam verließen sie die Maschine. Die Knie zitterten etwas, als ihre Füße festen Boden fühlten. Hand in Hand gingen sie zum Ankunftsgebäude.
2. Unruhiger Herzrhythmus
Mein Herzrhythmus war bei dem Gedanken an den Flug noch unruhiger geworden. Es war mir unmöglich, aufzustehen und weiterzugehen. Ich blickte starr in die Gegend. Zwei verliebte Menschen kamen Hand in Hand vorbei, sie sprachen und lachten miteinander, blieben stehen, küssten sich ungeniert unter dem Kreuz und gingen weiter. Sie nahmen keine Notiz von mir, warum auch? Sollte ich sie ansprechen, sollte ich sie um Hilfe bitten? Hilfe wofür, was fehlte mir denn, ich war doch gesund. Und doch saß ich zusammengesunken auf der Bank und traute mich nicht weiterzugehen. Du musst nur tief durchatmen, dachte ich, dann wird es schon wieder gehen.
Am Kreuzweg begegneten sich zwei Ehepaare, sie begrüßten sich flüchtig, wahrscheinlich waren es entfernte Nachbarn:
„Wie war Ihr Urlaub?“, fragte die Frau.
„Wir waren in Südfrankreich, es war schön, aber viel zu kurz“, sagte der Mann im Vorbeigehen.
„Da wollen wir auch nächstes Jahr hin.“
„Es wird Ihnen dort bestimmt gut gefallen, einen schönen Abend noch.“
„Danke, auch so!“
Jeder ging seines Weges, und ich versuchte mich wieder abzulenken, dachte an die schönen Urlaubstage in Frankreich und an die für mich so folgenschwere Begegnung.
Ja, wenn wir damals wie geplant in La Mole gelandet wären, dann hätten wir in unserem Ferienhaus ein paar ruhige Tage verlebt, aber nun war es anders gekommen. Ich machte einige Erfahrungen, auf die ich zum Teil gerne verzichtet hätte. Aber das weiß man eben erst hinterher. Jetzt lieber an etwas Anderes denken.
Das war leichter gesagt als getan. Unaufhörlich kreisten meine Gedanken um ‘meine‘ Firma und die Schwierigkeiten, die es zu bewältigen galt. In erster Linie drehte es sich um die Trennung der beiden Betriebsteile. Es war vom Vorstand der Muttergesellschaft beschlossen worden, die mechanische Fertigung von der elektronischen zu trennen. Das hatte den Sinn gehabt, die zukunftsfähigen Teile der Elektronik-Fertigung von den traditionellen Schlosserarbeiten zu trennen, denn diese Arbeiten konnten von diversen kleineren Firmen erledigt werden. Das war kostengünstiger, schränkte aber die Flexibilität ein. Arbeiten, die früher von eigenen Monteuren erledigt wurden, mussten nun an Fremde vergeben werden. Das führte zu Spannungen innerhalb der Geschäftsführung, die in dieser Angelegenheit zwiegespalten war. Noch ausgeprägter war der Konflikt mit dem Betriebsrat, der seine Kompetenzen beschnitten sah. Man hatte sogar mit Streik gedroht, wobei die Gewerkschaft im Hintergrund ihre Fäden zog.
Grund genug über die Zukunft besorgt zu sein.
Begegnung mit dem Patriarchen
Der für die Privatfliegerei reservierte Teil des Flugplatzes Fréjus-St. Raphael bestand aus einem kleinen Barackenbau, der eher an eine einfache Bau-Bude als an eine Empfangshalle für VIP erinnerte ohne Restaurant und Lounge. Statt dem ersehnten Cognac mussten sich Arnim und Elinor mit Kaffee aus einem Pappbecher des Automaten begnügen.
„Das ist gerade noch mal gut gegangen. Es hätte auch schiefgehen können“, sagte Elinor zum wiederholten Mal.
„Ich hätte in Nizza landen sollen, ich hätte es nicht riskieren sollen, in Fréjus zu landen, es war ein großer Fehler, ich habe unnötig das Schicksal herausgefordert. Gut, dass das Fahrwerk gehalten hat, das war während der Landung meine größte Sorge, Armin nahm einen Schluck Kaffee.
„Bei diesem Sturm hättest du überhaupt nicht landen sollen, wenigstens nicht bei dem Seitenwind. Wir hätten doch nach Nizza zurückfliegen sollen.“
„Wir hatten nur noch für 20 Minuten Treibstoff in den Haupttanks. Auf die Hilfstanks wollte ich bei den Turbulenzen nicht umschalten. Nun, Gott sei Dank es ist alles vorbei. Wie kommen wir aber jetzt nach Port Grimaud?“
Ehe die vorhandenen Möglichkeiten ausdiskutiert werden konnten, mischte sich ein gut aussehender Herr mittleren Alters in das Gespräch. Er hatte mit vier weiteren Herren am Nebentisch gesessen, offenbar Passagiere, die auf den Abflug ihrer Maschine warteten.
„Guten Tag, verzeihen Sie, dass ich mich in ihr Gespräch einmische, wir haben ihre Landung verfolgt. War wohl nicht so einfach?“
„Nein, muss ich nicht noch einmal haben. Das reicht für den Rest meiner Fliegerei.“
„Fliegen Sie schon lange?“
„Seit fast fünfundzwanzig Jahren.“
„Na, dann haben Sie ja genug Erfahrung, um so etwas riskieren zu können.“
„Sicher nicht freiwillig.“
„Wir haben da neben Ihrer Maschine unsere Cessna 410 stehen und können uns nicht zum Start entschließen. Unser Startzeitpunkt im Flugplan ist schon überschritten. Auf den Mistral ist kein Verlass: Entweder bläst er drei, fünf oder sieben Tage. Drei Tage sind es nun schon, wir hofften auf ein Ende heute gegen Abend. Wir müssen morgen wieder im Büro sein. Übrigens, mein Name ist Pauli, Professor Bertram kennen Sie wahrscheinlich, der ehemalige Justizminister und das ist mein Rechtsanwalt Dr. Johannes und meine beiden Söhne Andreas und Michael, die haben uns hierher geflogen.“
„Guten Tag, Beyer mein Name, meine Frau“, dabei machte er eine leichte Verbeugung und deutete auf seine Frau an seiner Seite.
„Angenehm.“
Beyer wandte sich zu den beiden Piloten mit den blauen Flieger-Jacketts: „Respekt! Sie sehen noch ziemlich jung aus und sind schon ausgewachsene Piloten?“
„Ja, wir haben beide mit 18 unsere IFR-Lizenz erworben. Vater gab uns oft seine Maschine mit seinem Piloten zum Üben. Er hat uns oft fliegen lassen, so konnten wir früh Flugerfahrungen sammeln.“
„Man muss sich eben den richtigen Vater aussuchen! Trotzdem eine große Leistung, denn das Examen will auch erst einmal geschafft werden. Meine Hochachtung.“
Die beiden jungen Männer machten einen patenten Eindruck, sportlich mit zurückhaltender Bescheidenheit.
„Von Ihnen könnten wir bestimmt noch viel lernen“, sagte Andreas voller Bewunderung.
„Ihre Landung hat auch mir sehr imponiert, das hätte ich mir nicht zugetraut“, ergänzte Michael.
„Ich auch nicht“, lachte Beyer, „ich will es auch nicht noch einmal probieren. Was hat Sie denn hierher nach Fréjus geführt?“ wandte sich Beyer an Pauli Senior.
„Wir haben gestern meine neue Segelyacht in Empfang genommen“, erwiderte Pauli.
„Gratuliere, was ist es für ein Typ?“
„Eine Bénéteau 50“.
„Ein schönes Schiff, Entwurf von Bruce Farr. Bin ich auch schon gesegelt, hat hervorragende Segeleigenschaften.“
„Sie scheinen sich gut auszukennen, wollen Sie die Yacht mal sehen? Es wird heute sowieso nichts mehr mit dem Rückflug.“
„Gerne, aber wir müssen noch nach Port Grimaud.“
„Bertram hat seit vielen Jahren eine Wohnung dort und hat uns heute aus Anlass unserer Schiffstaufe besucht. Er ist mit seinem Wagen hier und kann Sie sicherlich nachher mitnehmen.“
Bertram nickte.
„Wo genau haben Sie Ihre Wohnung, Herr Professor?“
„In Port Grimaud Sud.“
„Welch ein Zufall, da befindet sich auch unser Haus, schräg gegenüber vom Place du Sud.“
„Das ist ganz in meiner Nähe.“
„Dann schlage ich vor, wir fahren jetzt zum Hafen und Professor Bertram nimmt Sie anschließend mit nach Port Grimaud.“
Dr. Pauli blickte fragend in die Runde.
„Machen Sie keine Umstände!“
„Ich bitte Sie!“
Beyers nahmen ihr Reisegepäck aus dem Flugzeug.
„Sympathischer Mensch, so ein väterlicher, freundlicher Typ, was der wohl beruflich macht?“ meinte Arnim. „Vorstand einer großen Aktiengesellschaft oder Inhaber eines mittelständischen Unternehmens? Wenn er mit seinem Rechtsanwalt hier ist, haben sie wohl eine geschäftliche Besprechung gehabt. Und Professor Bertram ist auch dabei. Es muss eine bedeutende Firma sein.“
„Aber der Rechtsanwalt passt nicht so richtig zu den beiden anderen“, sagte Elinor, „ich habe selten so viele Schuppen auf dem Kragen gesehen, richtig ekelig. Und dann ein Nadelstreifen-Anzug, aber braune Schuhe mit weißen Socken! Und die Weste bis unten zugeknöpft, offener Kragen, Krawatte und Einstecktuch aus gleichem Material, die Hose zerknittert.“
„Man soll die Menschen nie nur nach ihrem Äußeren beurteilen“, meinte ihr Mann beschwichtigend, „aber du hast schon Recht, an dem Mann stört mich auch etwas, nicht nur der Anzug. Er blickt so merkwürdig drein, irgendwie verschlagen, jedenfalls nicht seriös.“
Sie trafen die Herren an Bertrams Wagen und fuhren wie vereinbart zum Hafen.
„Dort am zweiten Kai liegt meine Yacht“, Pauli deutete mit der Hand seitlich aus dem Fenster.
„Sieht ohne Segel noch nagelneu aus“, meinte Beyer.
„Ist sie auch! Wir wollen erst in zwei Wochen zur Jungfernfahrt auslaufen. Meine Frau wird auch dabei sein.“
„Wo soll es denn hingehen?“
„Erst wollen wir uns hier in der Gegend umsehen, wir haben alle noch keine Segelerfahrung, aber Professor Bertram und Dr. Johannes, sind erfahrene Segler. Meine Söhne haben ihren Segelschein erst in diesem Jahr gemacht.“
„Und Sie, haben Sie keinen? fragte Beyer?
„Dazu habe ich noch keine Zeit gehabt, ich werde ihn aber unbedingt noch machen.“
„Man fragt in Frankreich nicht nach Lizenzen. Man darf nur keinen Unfall verursachen, denn dann hat man keinen Versicherungsschutz.“
„Sie haben sicher einen Segelschein?
„Ich habe sie alle, einschließlich dem Hochseeschifferpatent“, sagte Beyer nicht ohne Stolz. „Aber ich habe den Schein hier noch nie gebraucht. Das Segeln lernt man ohnehin nicht auf der Schule“, ergänzte Beyer.
Pauli sprang trotz seines stattlichen Gewichts ziemlich elastisch von der Hafenmauer auf den Spoiler seiner Yacht und die anderen folgten ihm. Die meisten Boote lagen mit dem Heck zur Kaimauer, römisch-katholisch, wie man hier sagte.
„Willkommen an Bord, was trinken Sie?“
„Was Sie haben.“
„Ein Glas Champagner wäre sicher dem Augenblick angemessen.“
„Wir sind dabei.“
Der Champagner war zwar nicht eiskalt, aber in der Bilge herrschte die kühle Wassertemperatur des herbstlichen Mittelmeeres.
„Mast und Schotbruch und allezeit eine Handbreit Wasser unter dem Kiel!“
Beyer nahm die Yacht in Augenschein und gab bewundernde Kommentare. „Da fehlt es an nichts: Instrumente wie im Flugzeug: Echo Lot, elektronisches Log, Radar, GPS mit Kartenplotter, Autopilot, Funkgerät, was will man noch mehr!“
„Ich habe eine Elektronik-Firma, Elektronik ist mein Beruf und mein Hobby“, erklärte Pauli.
„Na dann ist alles klar. Sie müssen nur immer für genügend Strom an Bord sorgen.“
„Ja, wir haben vier Akkus mit jeweils 105 Ampere.“
„Sollte wohl genügen, trotzdem, der Strom ist immer die Schwachstelle an Bord.“
„Sie kennen sich offenbar aus?“
„Ja, wir haben seit ein paar Jahren unsere Yacht in Port Grimaud liegen.“
„Was für eine?“
„Eine Comet 13, eine italienische Yacht aus Forli bei Bologna.“
„Sieh da. Wir waren letztes Jahr zu einer Werftbesichtigung dort, haben uns aber doch eine französische Yacht ausgesucht, wegen der besseren Ersatzteilversorgung in Frankreich.“
„Da haben Sie recht, das ist tatsächlich ein großes Problem.“ Frau Beyer warf einen vielsagenden Blick von der Seite auf ihren Mann, als wolle sie sagen: „Das hättest Du damals auch bedenken sollen.“
Die Gespräche kreisten um das Fliegen, das Segeln, das Mittelmeer und die besten Speiselokale. Inzwischen waren auch Andreas und Michael angekommen, man saß im Cockpit und genoss den prickelnden Champagner. Zwischendurch lockerte Dr. Johannes die Runde mit Witzen auf, die er meisterhaft vortrug: „Kommt Kohl in den Himmel und trifft dort den Papst …“ Ein Witz reihte sich an den anderen, die Stimmung wurde zunehmend fröhlich und ausgelassen. Die Anspannung des vergangenen Fluges war verschwunden und auch Elinors Gesicht hatte wieder Farbe bekommen. Schließlich schlug Beyer vor: „Wir fahren jetzt nach Port Grimaud in unser Haus und feiern dort weiter.“
„Sie sind sicher von dem Flug erschöpft und wollen lieber Ihre Ruhe“, gab Pauli zu bedenken.
„Im Gegenteil! Das Leben hat uns wieder, wir müssen das feiern.“
„Wir wollen Ihnen keine Umstände bereiten, außerdem müssen wir heute Abend wieder hierher zurück, denn morgen früh müssen wir nach Hause fliegen.“
„Sie machen keine Umstände und wir würden uns freuen, Sie als unsere Gäste bei uns zu haben.“
Das Für und Wider wurde noch eine Weile diskutiert, doch der Mistral blies mit unverminderter Heftigkeit und der Champagner tat seine befreiende Wirkung. Professor Bertram, der sich beim Champagner zurückgehalten hatte, schlug vor, mit Frau Beyer und Dr. Johannes in seinem Wagen zu fahren, während Beyer mit Pauli und dessen Söhnen eine Taxe nehmen sollte.
Sie fuhren die Küstenstraße entlang. Es war schon fast dunkel geworden. Kurz vor St. Maxime sah man das hell erleuchtete St. Tropez auf der anderen Seite vom Golf liegen. Ein paar Motorboote zogen ihre Furchen durch das aufgewühlte Wasser.
„Ein schönes Fleckchen Erde haben Sie sich hier ausgesucht.“ Dr. Pauli sah gedankenversunken durch das Fenster: „Hier würde es mir auch gefallen.“
„Warum kaufen Sie sich hier nicht auch ein Haus? Man findet immer etwas.“
„Ich habe eine Wohnung in Florida und eine auf Sylt und ich finde kaum Zeit, dorthin zu fahren und dann noch ein weiteres Domizil?“
„Sie haben Recht, man kann sich nicht zerteilen. Aber irgendwann werden auch Sie mal aufhören zu arbeiten.“
„Irgendwann, aber jetzt muss ich erst meine Firma weiter vorantreiben. Wenn ich es nicht tue, dann macht es keiner. Das ist eben das Schicksal eines Unternehmers!“
„Schweres Schicksal“, meinte Beyer ironisch und fuhr ernsthaft fort, „Ich wollte immer eine eigene Firma haben, dazu ist es aber irgendwie nie gekommen.“
„Was machen Sie beruflich?“
„Ich bin Partner einer internationalen Beratungsgesellschaft.“
„Seien Sie froh, dass Sie kein eigenes Unternehmen haben, es macht doch viel Arbeit und Sorgen.“ Pauli seufzte.
Die beiden Wagen bogen rechts von der Straße ab und fuhren über die Brücke, am Rondell wieder rechts entlang der Häuserreihe und hielten vor der Schranke. Beyer zeigte seinen Passierausweis und die Schranke wurde geöffnet. „Der Wagen hinter uns gehört auch zu uns!“ Der Sicherheitsbeamte nickte freundlich.
„Hinter der Brücke links, dann sind wir gleich da“, dirigierte Beyer den Taxifahrer.
Das Reihenhaus war in einem warmen provenzalischen rostroten Ton gestrichen. Die Innenaufteilung der Häuser in Port Grimaud war bei allen weitgehend identisch, aber durch die unterschiedliche Farbgebung und Detailänderungen an den Fassaden wurde der Eindruck von Vielfalt und Individualität geweckt. Die Fensterläden ihres Hauses waren geöffnet.
„Lassen Sie immer alles offen auch wenn Sie nicht da sind?“
„Nein, der Gardien macht das für uns. Wir rufen ihn von Zuhause an und er stellt die Heizung an, seine Frau macht sauber und wäscht die Wäsche, das ist sehr praktisch“, sagte Frau Beyer, „wir brauchen uns um nichts zu kümmern.“
„Wenn Sie mich entschuldigen wollen“, meinte Bertram, „ich gehe die paar Schritte nach Hause, meine Frau wartet auf mich. Vielleicht ein anderes Mal.“
Man verabschiedete sich und versprach, sich bei Gelegenheit zu besuchen.
„Treten Sie ein, meine Herren“, sagte Beyer und breitete seine Arme zu einer einladenden Geste aus.
Das Wohnzimmer war gediegen mit provenzalischen Antiquitäten eingerichtet, eine Burgunderuhr, eine geschnitzte Truhe, ein ovaler Esstisch mit Renaissance Stühlen und eine gemütliche Sitzgruppe, Bilder von alten Seglern zierten die Wände. Ein Kamin war zur Feuerung vorbereitet. Eine behagliche Atmosphäre zum Ausspannen und sich Wohlfühlen.
„Meine Herren, wie wäre es mit einem leichten Weißwein? Wir haben hier einen ausgezeichneten Winzer in der Nähe, die ‘Domaine de la Giscle‘, bei Grimaud, dort kaufen wir immer den Vin Blanc und den Rosé Wein.“
Man entschied sich sowohl für den Weißen als auch für den Rosé Wein, um beide zu probieren.
Beyer öffnete die große Glastür zur Kanalseite, und sie traten auf die Terrasse. Es war eine sternenklare Nacht aber kalt, denn der Nordwind heulte und pfiff durch die Takelagen der Yachten, die fest vertäut – mit dem Heck zum Kai – vor den Häusern im Kanal lagen.
„Es ist wirklich schön hier. Schade, dass es so stürmt. Das stelle ich mir sonst sehr friedlich vor.“ Die vielen Yachten hinter dem Haus im Wasser rissen und zerrten an den Festmacherleinen.
„Das ist unsere Yacht, hier direkt vor dem Haus“, sagte Beyer mit leichtem Stolz.
Johannes zeigte sich beeindruckt: „Eine elegante Yacht, man erkennt das italienische Styling.“
„Sie sind das erste Mal in Port Grimaud?“
„Ja, ich hatte noch nie die Gelegenheit, hierher zu kommen, habe aber schon viel davon gehört. Professor Bertram hat oft davon erzählt. Er ist immer ganz begeistert von diesem Ort. Wir sind schon oft miteinander gesegelt, aber nie von hier aus.“
„Es ist wirklich schön hier. Im Winter ist man fast ganz allein, erst zu Ostern erwacht das Städtchen zum Leben, schläft aber anschließend wieder ein. Im Sommer, im Juli und August kann man es vergessen, dann ist es hektisch und laut, dann sind alle Häuser bewohnt, viele werden vermietet, dann verlassen wir fluchtartig den Ort. Aber im Herbst wird es wieder richtig schön. Dann ist es noch warm, aber friedlich, das ist für uns hier die schönste Jahreszeit.“
„Würde mir auch gut gefallen, aber meine bevorzugte Jahreszeit ist der Sommer, wenn es warm ist.“
Beyer musterte Johannes etwas genauer: Etwa Mitte 50, wohl im gleichen Alter wie Pauli. Die asketischen Züge verrieten großen Ehrgeiz und Zielstrebigkeit. Seine Augen wanderten unablässig hin und her, als suche er etwas, jedenfalls sollte ihm nichts entgehen. Hinter der jovialen Fassade versteckte sich eine unharmonische Persönlichkeit. ‚Man müsste vorsichtig sein‘, dachte er, ‚man wird ihm nicht in jedem Fall und unbedingt trauen können.‘
Der Hausherr tischte den Wein in schlanken Karaffen auf. Sie probierten den Weißen und den Rosé und jeder entschied sich dann individuell entweder für den einen oder für den anderen. Nach ein paar Gläsern war der Abend von fröhlicher Heiterkeit geprägt.
„Sollten wir nicht lieber etwas Essen gehen?“ meinte Frau Beyer, „ich merke den Wein schon jetzt.“
„Ich glaube, wenn wir so weiter trinken, ist auch morgen nicht an einen Rückflug zu denken, sagte Pauli, ihr Jungen, ihr bleibt aber bei Wasser, verstanden? ihr müsst uns morgen heil nach Stuttgart fliegen!
„Versteht sich von selbst“, sagte Andreas etwas vorwurfsvoll. Dabei blickte er gleichgültig aus dem Fenster.
„Darf ich mal mit meiner Frau telefonieren? erkundigte sich Pauli.
„Ja, sicher, bedienen Sie sich“, sagte Beyer und wies mit der Hand zur Anrichte.
„Hier auch Pauli“, hörte man ihn sagen, „wir kommen heute nicht zurück, die Maschine steht noch in Fréjus. Wir sind jetzt in Port Grimaud bei einer Familie Beyer, die wir auf dem Flugplatz kennengelernt haben. Stammt aus Stuttgart … Wir konnten nicht starten wegen des starken Mistrals … Ja, mit der Maschine ist alles ok, sie ist fest am Boden verankert … Nein, es kann nichts passieren … Wir bleiben über Nacht … Sehen uns morgen, sage bitte morgen Frau Feiner in der Firma Bescheid. Nein, sie ist jetzt nicht mehr dort. Wer hat angerufen? … Oderbruch? … Sage ihm, wir fliegen morgen früh los und werden gegen 10 Uhr in der Firma sein … Schönen Abend noch … Adele, gute Nacht.“
Die sechs gingen in das nahe gelegene Restaurant ‘Oasis‘. Die Inhaberin, Madame Berliet, begrüßte die Gäste.
Man wählte den Tisch am Fenster mit Blick auf die Marina gleich neben der Bootswerft. Es lagen noch viele Boote aufgebockt auf Land. Zu dieser frühen Jahreszeit wurden die Yachten in der Werft überholt und auf die Segelsaison vorbereitet.
„Was für eine Verschwendung, jeder will seine eigene Yacht und nutzt sie dann durchschnittlich nur fünfzehn Tage im Jahr“, bemerkte Beyer etwas wehmütig.
„Nutzen Sie ihre Yacht häufiger als das?“
„Ich fürchte nein, aber ich will auch nicht auf meine eigene Yacht verzichten, es ist doch etwas anderes als eine Charter-Yacht.“
„Da haben Sie recht, auch ich schlafe nicht gern in fremden Betten.“
„Man kann es nicht immer vermeiden, wenn man so viel auf Reisen ist wie ich, aber hier in Frankreich sind wir zu Hause, an Land und auf dem Schiff! „
Die Chefin des Hauses war eine typische Südfranzösin, untersetzt, etwas korpulent, nicht gerade schön, aber doch irgendwie attraktiv und von gewinnender Freundlichkeit. Man fühlte sich in ihrem Lokal immer gut aufgehoben. Der Reihe nach wurde bestellt, Pauli wählte Gigot, Johannes Dorade, Herr und Frau Beyer Loup de Mèr, Michael und Andreas wählten ‘Steak au poivre‘.
„Dazu unser Rosé de la Maison?“, erkundigte sich die Wirtin.
„Der ist hier gut trinkbar“, sagte Beyer.
„Ja, und dazu eine Flasche Wasser“, entschied Pauli.
Das Essen war ausgezeichnet, und die sechs, so flüchtig sie sich auch kannten, verstanden sich ausgezeichnet. Man scherzte wie unter alten Freunden. Sogar Pläne für den kommenden Sommer erwogen und eine gemeinsame Segeltour nach Sardinien mit Zwischenstation in Korsika wurden geschmiedet.
„Wir müssen mal sehen, wie wir mit der neuen Yacht zurechtkommen, da kann ein erfahrener Skipper sehr hilfreich sein.“
Pauli war voll überschäumender Begeisterung.
„Wie der wohl als Vorgesetzter ist? ging es Beyer durch den Kopf. Er fand Pauli sympathisch, offen, aber in einigen Punkten merkwürdig unbesonnen und naiv. Während der kurzen Gesprächsphasen, die sich auf die aktuelle politische Lage bezogen, war eine extreme konservative Grundeinstellung zu erkennen. Besondere Kritik konzentrierte er auf den Arbeitsminister und insbesondere auf die Gewerkschaften, die seiner Meinung nach für die kritische Arbeitslage in Deutschland allein und ausschließlich die Verantwortung trügen. Die gelegentlichen Einwände seiner Söhne wurden mit unerwarteter Schroffheit zurückgewiesen, so dass sich diese im weiteren Gesprächsverlauf kaum noch zu einer eigenständigen Meinungsäußerung bewegen ließen. Allenfalls zustimmendes Nicken oder leichtes Neigen des Kopfes signalisierten ihre aufmerksame Gesprächsteilnahme. Besonders polemische und radikale Äußerungen ihres Vaters wurden wortlos mit einem kaum merklichen Blickwechsel zwischen den beiden begleitet.
Frau Beyer hatte die beiden jungen Männer seit längerer Zeit aufmerksam gemustert. Der ältere mochte so um die zweiundzwanzig Jahre alt sein, der jüngere wohl um die zwei Jahre weniger. Beide sahen gut aus, sportlich und liebenswürdig. Der ältere könnte was für unsere Tochter Sara sein, dachte sie insgeheim. Merkwürdig allerdings die Unsicherheit, wahrscheinlich aber nur in Gegenwart des Vaters.
„Und was machen Sie, meine Herren?“ fragte Frau Beyer in einer Gesprächspause.
„Wir studieren in Karlsruhe auf der Technischen Hochschule.“
„Beide die gleiche Studienrichtung?“
„Nein, ich studiere Maschinenbau und Michael studiert Elektrotechnik“
„Dann werden Sie bestimmt eines Tages die Firma Ihres Vaters übernehmen.“
„Ja, vielleicht, wenn wir gut sind. Jedenfalls möchte es Vater gerne.“
„Und Sie?“
„Ich wohl auch, aber ich hätte mir auch ein Medizinstudium vorstellen können“, meinte Andreas. „Mein Bruder Michael wollte eigentlich Soziologie studieren, aber Vater hielt das für brotlose Kunst.“
„Ja, ja, die Väter, die haben immer ihre eigenen Pläne mit ihren Söhnen, nicht wahr mein Schatz?“ Frau Beyer warf einen vielsagenden Blick auf ihren Mann.
„Man muss sie leiten und beraten, sie wissen oft noch gar nicht was sie wollen.“
„Ich bin ganz Iihrer Meinung, Herr Beyer“, und Pauli nickte dabei zustimmend.
„Man muss sie leiten. Nach dem Examen sollen sie in einer meiner Tochtergesellschaften, vielleicht in den USA oder England ihre ersten beruflichen Erfahrungen sammeln, anschließend kommen sie zu mir in die Zentrale, damit sie lernen, wie man ein Unternehmen erfolgreich führt“, sagte er in bestimmten Ton, der keinen Widerspruch duldete.
Bei diesen letzten Worten war eine gespannte Atmosphäre eingetreten. Die Söhne erwiderten nichts und die anderen hielten sich aus Höflichkeit mit ihrer Meinung zurück.
Dr. Johannes überbrückte die Stille und erzählte eine weitere Serie von Witzen, wobei die Christuswitze auf ein geteiltes Echo stießen. Etwas unvermittelt wandte er sich an Beyer.
„Wie ich höre sind Sie Unternehmensberater, bei welcher Firma, wenn ich fragen darf“, fragte er mit leicht ironischem Unterton.
„Ich bin Partner bei Kanders Management Consultants mit Sitz in Chicago.“
„Das sind die Herren, die einen Haufen Geld verdienen indem sie ihren Klienten nach seiner Uhr fragen und ihm anschließend sagen, wie spät es ist.“
Die Bemerkung war offensichtlich als Provokation gemeint, Beyer ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen.
„Ja, Sie haben recht, es gibt tatsächlich Führungskräfte, selbst im Vorstand großer Aktiengesellschaften, die nicht wissen, was die Uhr geschlagen hat. Denen muss man dann helfen, die kritischen Zeiten zu erkennen.“
„Wissen Sie denn immer wie spät es ist? Dann sind Sie sicher einer von diesen Super-Gurus?“
„Nein, aber manchmal sehen Externe einige Dinge klarer, weil sie mehr Distanz haben und nicht durch die lange Zeit im Unternehmen betriebsblind geworden sind.“
„Ich kann das mit der Betriebsblindheit nicht mehr hören, jeder Berater erzählt mir dasselbe.“
„Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sind Sie Rechtsanwalt?“
„Ja, seit fast 40 Jahren!“
„Aber dann sind Sie doch auch eine Art Berater?“
„Das kann man nicht vergleichen, wir verhelfen unseren Mandanten zu ihrem Recht.“
„Und wir Berater zu ihrem beruflichen Erfolg, das ist der Unterschied“, sagte Beyer mit gezügelter Aggressivität. Aber er versuchte sie zu unterdrücken, schließlich wollte er den bisher so harmonisch verlaufenden Abend nicht gefährden.
Pauli vermittelte zwischen den beiden, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Er kannte seinen Anwalt nur zu gut und wusste, wie zynisch er werden konnte, wenn er sich bedrängt fühlte.
„Es ist wirklich schlimm, wie schlecht manche Konzerne geführt werden. Denken Sie beispielsweise an unser hoch gepriesenes Vorzeigeunternehmen im Ländle, unser Muster-Autobauer. Der jetzige Vorstandsvorsitzende ist ein Unglück für das Unternehmen. Auf unserer letzten Beiratssitzung berichtete Professor Bertram über eine Aufsichtsratssitzung bei Daimler, in dem der Vorsitzende in aller Offenheit wegen seiner Firmen- und Modellpolitik kritisiert worden war. Aber dieser Mann ist gegenüber anderen Meinungen völlig unzugänglich, hält sich für Deutschlands Vordenker Nummer eins und wirtschaftet den Konzern an den Rand des Abgrunds. Haben Sie mal für Mercedes gearbeitet?“
„Ja, wir haben eine Logistik-Studie im Fahrzeug-Bereich gemacht. Es ging dabei um die Verbesserung des Lieferservice insbesondere im Ersatzteilwesen.“
„Interessant, wir könnten sicher auch so eine Studie gebrauchen, ich höre von unseren Kunden immer wieder Klagen über fehlerhafte und unvollständige Lieferungen“, sagte Pauli.
„Wenn wir Ihnen helfen können, freuen wir uns.“
„Sie können mir ja mal Ihre Unterlagen schicken, am besten direkt an mich persönlich und vertraulich. Hier ist meine Geschäftskarte mit meiner Privatanschrift in Pforzheim. Ich will keine Unruhe im Unternehmen. Sie wissen ja, ein Berater bringt immer Besorgnis bei den Mitarbeitern mit sich. Wenn mein Bruder Fritz hört, dass ich einen Berater ins Haus hole, sieht der gleich rot.“
„Ihr Bruder ist auch in Ihrem Unternehmen beschäftigt?“
„Ja, beschäftigt ist der richtige Ausdruck, die Frage ist nur, was dabei herauskommt! Er leitet unsere größte Tochtergesellschaft.“
Bayer las die Karte aufmerksam. Dr. Leopold Pauli war geschäftsführender Gesellschafter der Pauli GmbH & Co, KG mit Sitz in Pforzheim, sein Bruder Fritz war offenbar von ihm abhängig, möglicherweise aber auch umgekehrt. Beyer würde sich später Notizen über das Gespräch machen, wie er es bei ähnlichen Gelegenheiten immer tat. Man konnte nie wissen, wozu man die Information brauchen konnte. Der erste Kontakt war hergestellt, das weitere musste man abwarten. Er war sich sicher, dass früher oder später eine berufliche Verbindung hergestellt werden würde. Aber beunruhigend war dieser Rechtsanwalt Johannes. Er wollte offensichtlich den Berater aus einer engeren geschäftlichen Beziehung mit Pauli heraushalten. Aber warum? In welcher Beziehung standen die beiden miteinander? Es gab sicher eine Form der gegenseitigen Abhängigkeit.
Madame Berliet unterbrach das Gespräch und erkundigte sich nach den Dessertwünschen: „Vous désierez un dessert? Nous avons ce soir un Mousse au Chocolat ou un Crème Caramel, excellants les deux. “ Die Entscheidung fiel schnell. Niemand konnte bei Mousse au Chocolat widerstehen. „Es ist sicher nicht vernünftig, aber wer kann schon immer vernünftig sein“, meinte Beyer. „Nun, Sie haben doch keine Gewichtsprobleme, was soll ich da sagen?“, seufzte Pauli.
„Es sind nicht der Fette allein, es sind die Cholesterine, die verursachen die Probleme“, mischte sich Johannes ein.
„Sie können ja morgen am Strand Joggen, dann ist wieder alles in Ordnung.“
„Hoffentlich.“
Der Abend wurde mit einem Kaffee und einem Cognac beschlossen. Dr. Pauli ließ sich die Bezahlung der Rechnung nicht nehmen. „Mit Dank für den schönen Abend und ihre Einladung in Ihrem Hause“ sagte er.“
„Der Dank ist auf unserer Seite“, sagte Beyer.
Man verabschiedete sich aufs Herzlichste.
„Vergessen Sie nicht, Ihre Unterlagen zu schicken“, sagte Pauli. „Mache ich auf jeden Fall. Auf Wiedersehen und guten Flug.“
Ein Taxi war gerufen worden und fuhr die Herren nach Fréjus zurück.
Arnim und Elinor verbrachten noch ein paar traumhafte Tage an der Côte mit Schwimmen und Spaziergängen im Park von St. Tropez. Sie folgten immer wieder gern dem felsigen Küstenweg, auf dem man bis nach Marseille gehen konnte. Aber sie verweilten am Grab des Dichters Olivier: ‘Et respice finem‘, war auf dem Stein gemeißelt.
„Sehr sinnreich“, sagte Arnim.
„Was heißt das?“, ich war nie besonders gut in Latein.
„Es ist der Schluss eines Zitats, welches aus der mittelalterlichen Sammlung Gesta Romanum stammt. Insgesamt heißt es ins Deutsche übertragen: Was auch immer du tust, tue es klug und bedenke das Ende.“
„Das sollten wir immer tun, jetzt zum Beispiel, indem wir zurückkehren.“
Es war warm und sonnig, das Meer tiefblau, der Eukalyptus duftete und sie entspannten sich prächtig. An nächsten Tag fuhren sie zur Chartreuse de la Verne, einem alten Kloster oben im Maure Gebirge, um von dort Richtung La Mole zu wandern. Sie genossen von dort oben einen unvergleichlichen Blick auf die Bucht von St. Tropez und bis hinüber zu den Hyères Inseln. Viel zu schnell gingen die unbeschwerten Tage vorüber und sie mussten wieder zurück nach Hause fliegen. Diesmal verlief der Flug angenehm und problemlos.
„Ich bin mal gespannt, ob wir den Pauli wieder treffen werden.“
Beyer dachte nach: „Eine gemeinsame Segeltour wäre sicher interessant. Vielleicht ergibt sich später mal ein Beratungsauftrag, man kann nie wissen.“
„Dann wirst du aber vorsichtig sein müssen, der Pauli scheint mir eine zwiespältige Persönlichkeit zu sein,“ gab Elinor zu bedenken, „freundlich jovial auf der einen Seite und radikal autoritär auf der anderen. So wie er mit seinen Söhnen sprach. Auf jeden Fall ist er schwer zu durchschauen, mit dem würde ich keine Segeltour machen wollen.“
„Traust du ihm nicht?“
„Doch, eigentlich schon. Ich finde ihn sympathisch, aber ich fühle mich in seiner Gegenwart – wie soll ich es ausdrücken – etwas unbehaglich. Er hat keine Segelerfahrung, aber er ist sehr beherrschend, das wird auch auf See nicht anders sein, das kann nicht gut gehen. Ich glaube nicht, dass er sich in ein Team einfügt und unterordnen kann, was aber an Bord eine Grundvoraussetzung ist.“
Arnim stimmte seiner Frau zu, auch er konnte Pauli nicht richtig einschätzen: „Nun ja, es ist ja noch nichts entschieden. War auf jeden Fall ein netter Abend mit ihm und seinen Söhnen.“
„Finde ich auch. Nette Kerle die beiden. Was meinst du? Wäre der ältere nicht etwas für unsere Tochter?“
„Weiß nicht. Sarah wird sich ihren Mann lieber selber auswählen wollen.“
„Nun, war ja nur ein kurzer Gedanke. Ist ja auch noch nicht aktuell.“
3.Beobachtung auf der Bank
Ich blickte gedankenverloren auf das junge Liebespaar, welches sich an den Wegesrand auf die Wiese gesetzt hatte. Sie hat Ähnlichkeit mit unserer Tochter Sarah, dachte ich. Ja, damals war sie noch nicht verheiratet gewesen, inzwischen hatte sie einen sehr netten jungen Mann geheiratet. Es war sicher gut, dass sie damals nicht einen der Söhne des Firmeninhabers geheiratet hatte, das heißt, eine Verbindung hatte gar nicht wirklich zur Debatte gestanden, denn niemand hatte einen ernsthaften Vorstoß in dieser Richtung gemacht. Nur sein Vater hatte bei einem Besuch in unserem Hause einmal versonnen vor ihrem Bild gestanden und voller Bewunderung gesagt: „Sie haben eine attraktive Tochter!“
Wir konnten das nur bestätigen und ich dachte damals, dass sein ältester Sohn eigentlich ganz gut zu ihr passen würde. Damit hatte es allerdings sein Bewenden gehabt. Ja, seine Söhne: Was die wohl machen? Sie sollen in Amerika sein. Ob sie sich wohl von ihrem dominanten Vater freigeschwommen haben? Gut möglich.
Ich erhob mich von der Bank vor dem ‘Steinernen Kreuz‘ und ging langsam den Weg hinunter zum Baldeney See, mit den vielen Segelbooten. Die Schritte fielen mir schwer. Ich fühlte meinen Herzschlag im Hals und im Kopf, meine Brust schnürte sich zusammen.
‚Ich werde mich entspannen‘, dachte ich, ‚ich darf nicht nachlassen, ich muss einen klaren Kopf behalten. Geh mal ruhig weiter, der Abend ist schön, die Luft ist lau und angenehm. Bloß nicht nachgeben, gehe nur ganz langsam, dann wird es schon wieder werden. Du musst stark sein, stark wie damals der Firmenchef war. Der hat niemals nachgegeben, auch als es schwierig war, hat er unablässig gekämpft.‘
Aber an Kampf wollte ich nicht denken, mich lieber auf etwas Schönes konzentrieren. Es gibt doch so viel Schönes in der Welt: Musik von Mozart und Beethoven, Gemälde von Liebermann, grüne Wiesen, Blumen und dichte Wälder. Rinder weiden friedlich auf den Feldern, dazu ein paar Pferde und Vögel segeln in der Höhe. Es duftet nach frischem Gras und manchmal auch nach Heu.
Pauli GmbH
„Gut, dass Sie kommen, Herr Dr. Pauli! Der Wirtschaftsprüfer Dr. Schubert, die Herren Dr. Kramer, Dr. Oderbruch, Winter, Ihr Bruder und Herr Ceponek warten im Besprechungszimmer auf Sie. Wir haben uns schon Sorgen gemacht.“ Frau Feiner, die Sekretärin der Geschäftsführung, begrüßte ihren Chef. Sie war eine attraktive Frau, Anfang 40, trug das kurze dunkle Haar sorgfältig nach hinten frisiert, und verriet in ihrem gutsitzenden Kostüm eine tadellose Figur.
„Haben Sie den Herren schon einen Kaffee gemacht?“
„Selbstverständlich“, antwortete Frau Feiner entrüstet. „Sie sollten mich eigentlich kennen.“
„Geben Sie mir auch eine Tasse. Es war etwas spät gestern Abend.“
Pauli eilte in den Sitzungsraum.
„Guten Morgen, Herr Schubert, grüß Gott meine Herren, entschuldigen Sie die Verspätung, ich komme direkt aus Südfrankreich. Wir konnten gestern wegen ungünstigem Wetter nicht starten und sind erst vor einer Stunde in Karlsruhe gelandet.“
„Kein Problem“, meinte Schubert, „wir waren gut betreut.“
„Ich habe zufällig einen Berater kennengelernt, ein interessanter Mann, versteht eine ganze Menge von Strategie und Finanzen. Vielleicht kennt jemand von Ihnen den Mann, Dr. Beyer, ein Partner von Kanders Management Consultants.“
„Der Name ist mir geläufig“, meldete sich Schubert zu Wort. Die Firma hat kürzlich für einen unserer Kunden gearbeitet, das hat, soweit man hört, erhebliche Kostensenkungen gebracht und wäre auch mal was für Sie. Ich glaube, Sie könnten einen guten Rat gebrauchen.“
„Wieso, ist die Bilanz ist gut?“ fragte Pauli erstaunt.
„Nein, die Bilanz ist gut, aber wir hatte neulich mal über den von Ihnen geplanten Börsengang des Unternehmens gesprochen, und da wäre ein neutrales Gutachten sicher hilfreich. Die Überprüfung der Börsenreife sowie die Planung des Emissionskonzepts ist ein zeitaufwendiges Vorhaben, das erhebliche Ressourcen in Ihrem Unternehmen bindet. Außerdem könnten die auch das Projektmanagement machen. Dazu haben Sie wohl kaum genügend Personalkapazität.“
„Was meinen Sie, Herr Kramer, brauchen wir einen Berater für den geplanten Börsengang?“
Dr. Kramer blätterte in seinen Akten, als suche er die Antwort auf die an ihn gerichtete Frage. Es war ihm sichtlich unangenehm, dass er so direkt angesprochen wurde. Am liebsten blieb er im Hintergrund, von wo aus er seine Fäden spinnen konnte. Er antwortete ausweichend: „Wir sollten uns von Herrn Schubert erst einmal die Aufgaben im Einzelnen erläutern lassen und sollten dann eine Entscheidung fällen.“
Pauli hatte seinen Kollegen vor vielen Jahren auf einem Symposium in St. Gallen kennengelernt. Man hatte sich zufällig getroffen und spontane Sympathie entdeckt, als der eine den anderen versehentlich angestoßen hatte, und die Salatsauce über den Abendanzug lief. Man entschuldigte sich, lachte und die Peinlichkeit war erledigt. Sie waren beim Abendessen miteinander ins Gespräch gekommen und tauschten ihre Visitenkarten aus. Kramer war damals Leiter der Produktentwicklung in einem schwäbischen Maschinenbau-Unternehmen.
Kurze Zeit später erhielt er ein Angebot von Dr. Pauli als Leiter der Entwicklung in dessen kleiner Elektronik Firma, das er annahm. Er war ein ziemlich durchschnittlicher Mann, allerdings mit der Fähigkeit, zur rechten Zeit die rechten Worte zu finden. Er wusste immer gerade so viel von allem, dass er zutreffende Bemerkungen machen konnte, ohne allerdings in die Materie tiefer einzudringen. Auch hatte er ein gutes Gedächtnis für wichtige Geschäftsvorfälle, die er mit korrektem Zeitpunkt und Inhalt immer gegenwärtig hatte. Im Laufe der Jahre gewöhnte sich Pauli an seine ständige Anwesenheit als Aktenträger, so dass er ohne ihn fast nicht mehr auskommen konnten. Zudem widersprach er nie und begnügte sich mit seiner Rolle als rechte Hand des Chefs.
Als die Firma wuchs, und Dr. Pauli mit operativen Aufgaben ständig überlastet war, wurde Kramer von ihm zum zweiten Geschäftsführer ernannt. Tatsächlich waren es aber die Banken, und in deren Folge der Beirat, die einen zweiten Mann in der Verantwortung haben wollten, den Pauli regierte allzu selbstherrlich und ohne interne Kontrolle. Pauli hatte Kramer damals selbst vorgeschlagen, weil er wusste, dass er ihm nie widersprechen würde. Und außerdem hatte er von all den möglichen Kandidaten aus dem eigenen Haus am meisten Zeit.
Später wurde die Holding zur Koordination der wachsenden Zahl von Gesellschaften gegründet. Kramer wurde neben Dr. Pauli zweiter Geschäftsführer in der Holding. Es genoss nie wirkliches Ansehen seitens der nachgeordneten Geschäftsführer in den Tochtergesellschaften, weder von Oderbruch, Leiter der Verkehrstechnik GmbH, noch von Fritz Pauli, Leiter der Steuerungstechnik GmbH, schon gar nicht von dem Finanz- und Personalchef Ceponek. Von keinem wurde er als ebenbürtig angesehen. Sie waren der Meinung, dass sie selbst in diese Position hätten berufen werden müssen, aber sie wagten kein offenes Veto. Untereinander im privaten Gespräch wurde die Ablehnung offen ausgesprochen, aber nie in seiner Gegenwart. Kramer wusste von dieser Ablehnung, aber es kümmerte ihn nicht. Solange Dr. Pauli ihn stützte, konnte ihm nichts geschehen. Er musste nur dafür sorgen, dass keiner der anderen zu mächtig wurde. Immer wenn sich einer der nachgeordneten Führungskräfte zu stark profilierte, dann wusste er kurze Zeit später negative Dinge über den Betreffenden zu berichten, so dass dieser wieder in die Reihe der gleichgeschalteten Untertanen trat.
Kramer war ein vollkommen anderer Typ als Pauli, ein ungleiches Paar, aber in wichtigen Angelegenheiten der Firma unzertrennlich: Er war mittelgroß und schlank, dunkelhaarig, trug eine randlose Brille, er hatte etwas Mürrisches und Verschlagenes in seinen Augen, selten blicke er seinen Gesprächspartner direkt an, meistens suchte er irgendetwas im Raum oder auf dem Tisch, wenn er nicht in seinen Akten blätterte. Er wirkte unsicher, wohl deshalb trug er immer einen tadellosen dunkelblauen, nadelgestreiften Anzug, gleichsam als Uniform eines bedeutenden Geschäftsführers.
Kramer räusperte sich bedeutungsvoll. „Ja, man sollte das mit der Beratung wirklich überlegen.“
Dr. Pauli ging auf die Bemerkung nicht weiter ein und eröffnete die vorgesehene Besprechung.
„Meine Herren, wir wollen heute die Möglichkeiten für den Börsengang unseres Unternehmens besprechen. Ich möchte Ihnen noch einmal die Gründe dafür darlegen. Zum einen gehe ich auf die sechzig zu und muss an meine Nachfolge denken. Ich bin nicht sicher, ob meine Söhne das Zeug zum Unternehmer haben, da ist es besser, wenn ich jetzt schon die Weichen stelle, dass das Unternehmen künftig von einem professionellen Management geleitet wird.“
„Sie haben vollkommen recht“, bestätigte Schubert, „die meisten Unternehmer denken erst daran, wenn es zu spät ist.“
Die anderen Herren sagten nichts, sie waren froh zu hören, dass die Söhne ihres Chefs offenbar nicht für die Nachfolge vorgesehen waren und rechneten sich ihre Chancen auf einen möglichen Posten als Vorstand aus.
Dr. Pauli nahm den Gedankengang wieder auf. „Es kommt noch etwas Anderes hinzu Mein langjähriger Geschäftspartner, Herr Erbracht, möchte als stiller Gesellschafter ausscheiden und auch die Württemberger Versicherung denkt mittelfristig ebenfalls an einen Ausstieg. Da wird die Beschaffung von zusätzlichem Eigenkapital schwierig. Wie Sie wissen, war das in der Vergangenheit immer ein gewisser Schwachpunkt bei uns. Jedenfalls kann ich das Kapital nicht allein aufbringen, oder wäre jemand von Ihnen bereit, bei uns mit ein paar Millionen einzusteigen?“
Die Frage war eher theoretisch, den keiner war dazu bereit und in der Lage. Insofern schauten sie alle ausnahmslos auf den Tisch oder in die vor ihnen liegenden Papiere.
Pauli fuhr nach der Kunstpause, die er sichtlich genoss, weil sie die Abhängigkeit seiner Geschäftsführer von ihm deutlich machte, fort: „Wenn wir unsere Firma“ – plötzlich sagte er ‘unsere Firma‘, wo er sie doch ausschließlich als ‘seine Firma‘ betrachtete und auch so behandelte – „in eine AG umwandeln, dann können wir kleinere Anteile über die Börse verkaufen und auch die Geschäftsführer und leitenden Angestellten an der Firma beteiligen, das steigert den Einsatzwillen und die Motivation.“
„Das kommt auf den Emissionskurs an“, meinte Fritz Pauli trocken und Oderbruch meinte: „Man könnte auch Gratisaktien ausgeben.“
Dr. Pauli überhörte die Einwürfe und bat Herrn Schubert, die erforderlichen Schritte zur Börseneinführung zu erläutern.
„Herr Dr. Pauli, ich möchte noch einmal betonen, wie sehr ich diesen Entschluss begrüße. Ich halte auch den Zeitpunkt für geeignet, denn die Börsensituation ist günstig. Zunächst muss ich feststellen, dass Ihr Unternehmen mit Sicherheit die Kriterien für die Börseneinführung erfüllt. Sie haben das Unternehmen mit Mitarbeitern und vor allen den anwesenden Geschäftsführern“, dabei machte er eine Verbeugung zu jedem einzelnen der Herren, „zu der heutigen Größe aufgebaut und werden es erfolgreich weiterführen. Das festzustellen ist mir wichtig, denn die Kontinuität in der Geschäftsführung ist entscheidend. Sie benötigen das Vertrauen Ihrer künftigen Aktionäre und das gelingt am besten, wenn die wissen, dass die Verantwortlichen über viele Jahre ein Unternehmen erfolgreich führen können.“
Man konnte den Herren anmerken, dass die Ausführungen von Herrn Schubert ihnen guttaten, weil sie doch in der Vergangenheit von ihrem Chef allzu oft gescholten worden waren. Jetzt wurde einmal positiv erwähnt, dass sie wesentlichen Anteil an dem Erfolg hatten.
„Es kommt noch etwas Bedeutsames hinzu. Sie haben eine klare Unternehmensstruktur mit eindeutigen Verantwortlichkeiten“, fuhr Herr Schubert fort, „jedes Unternehmen ist in einem eigenständigen Marktsegment tätig. Ihre Produkte sind erfolgreich im Markt etabliert, auch die Märkte sind weltweit vielversprechend. Bei den Maschinensteuerungen sind Sie Marktführer, bei der Verkehrstechnik, haben sie kaum noch Wettbewerber, wenn ich den Vorstand richtig verstanden habe. Und in der Militärtechnik machen Sie Jahr für Jahr gute Umsätze. Die Erträge waren in den vergangenen Jahren eigentlich immer ganz ordentlich, das letzte Jahr war wohl etwas schwächer, aber darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, wir werden sehen, was sich noch machen lässt. Also, ich fasse zusammen: Sie können den Börsengang ruhig wagen. Sie bekommen neues Kapital, das Sie bei Ihrer Bilanzstruktur gut gebrauchen können. Und womit Sie neue Chancen erhalten.“
Dr. Schubert hatte mit Überzeugung gesprochen, er nahm einen Schluck Wasser und sah Dr. Pauli erwartungsvoll an.
„Vielen Dank, Herr Schubert, das hätte ich nicht besser ausdrücken können, es war alles verständlich.“
„Vielleicht sollte ich einen Punkt noch einmal deutlich herausstellen“, ergriff Schubert noch einmal das Wort. „Der Gang an die Börse, ist ein einmaliger Schritt. Er enthält eine gesellschafts- und steuerrechtliche Neuordnung des Unternehmens. Er hat die Publizitätspflicht zur Folge. Sie werden viele Interna preisgeben müssen, die Sie sonst vielleicht nicht preisgeben würden. Sie benötigen ein erfolgsorientiertes Controlling, das die Ertragsperspektiven aufgrund von Marktdaten und Trends überzeugend darlegt.“ Dabei sah er Herrn Ceponek bedeutungsvoll an, der seinerseits auf den Boden sah und nichts erwiderte.
„Meine Herren“, sagte Dr. Pauli bedeutungsvoll, „Sie wissen alle, was jetzt auf uns zukommt, nämlich viel Arbeit. Wir müssen einerseits das Tagesgeschäft führen, die Umsätze steigern, die Kosten senken und gleichzeitig die Umwandlung unserer Firma in eine AG schaffen. Dies wird in erster Linie die Aufgabe von Herrn Kramer und mir sein. Für die Ergebnisse der einzelnen Gesellschaften sind Sie verantwortlich, also strengen Sie sich an, damit wir es schaffen. Es geht um die Zukunft unseres Unternehmens.“
Herr Schubert dankte kurz und verabschiedete sich unter Hinweis auf einen anderen wichtigen Termin, der leider nicht zu verschieben gewesen sei.
„Herr Ceponek, würden Sie Herrn Schubert bitte hinausbegleiten, damit er ungehindert durch die Sicherheitskontrollen kommt?“
Ceponek öffnete eilig die Tür für den Gast und verließ mit ihm den Raum, wobei sie sich gemeinsam durch die Tür zwängten. Pauli sah seinem Finanzchef kopfschüttelnd hinterher, die anderen Herren grinsten unverhohlen.
„Darf ich Sie bitten, noch einen Augenblick hierzubleiben? Ich möchte noch einige Punkte mit Ihnen besprechen. Herr Schubert hat soeben auf die Bedeutung des internen Controllings aufmerksam gemacht. Wir haben bei unserem Berichtswesen tatsächlich einen Nachholbedarf.“
„Das stimmt, hier ist wirklich eine Schwachstelle in unserem Unternehmen“, bekräftigte Fritz Pauli und fügte hinzu, „seit Jahren rede ich schon, dass wir eine ordentliche Kostenrechnung benötigen, aber Kollege Ceponek bringt nichts auf die Beine.“
Oderbruch nickte. „Wir können seine miserable Kostenrechnung für unsere öffentlichen Auftraggeber ohnehin nicht gebrauchen. Wir haben für diesen Bereich unser eigenes Rechnungswesen geschaffen. Es ist sehr einfach, aber es schafft die Zahlen, die ich brauche.“
„Wir wissen innerhalb des Jahres überhaupt nicht, wo wir stehen“, bestätigte auch Winter, „wir benötigen dringend für die Funkmesstechnik eine aussagefähige kurzfristige Erfolgsrechnung, die uns die Ergebnisse für die wichtigsten Produktgruppen darstellt.“
Jeder äußerte unverhohlen seine Meinung, denn der Verantwortliche, Ceponek, war nicht anwesend. Dr. Pauli drückte auf einen Knopf auf dem Tisch, worauf Frau Feiner den Raum betrat. „Rufen Sie mir sofort den Ceponek“, sagte Pauli ziemlich schroff.
Kurz darauf betrat Herr Ceponek erneut den Raum. Ceponek war ein kleiner, glatzköpfiger, etwas dicklicher Mann mit auffallender Hornbrille, dunklem Anzug, braunen Schuhen mit hohen Absätzen. Er blieb kerzengerade, mit hoch erhobenen Kopf an der Tür stehen.
„Setzen Sie sich noch einmal kurz dazu“, befahl Pauli.
Ceponek machte eine linkische Verbeugung, und setzte sich artig auf seinen Platz.
„Wie Sie eben gehört haben, hat uns Herr Schubert gerade über die Voraussetzungen zur Börseneinführung berichtet. Er hat ganz klar herausgestellt, dass wir ein modernes Rechnungswesen brauchen. Alle Herren in diesem Raum haben eben die schlechte Berichterstattung beklagt. Ich will mir nicht von Ihnen den Börsengang vermasseln lassen. Sie sind für das Berichtswesen verantwortlich. Seit Jahren reden wir darüber, dass wir ein aussagekräftiges Berichtswesen brauchen. Immer wieder sagen Sie, dass es nun besser wird, aber es kommt nichts dabei heraus. Sie sind offensichtlich überfordert. Sie sind ein Buchhalter, von modernem Controlling haben Sie keine Ahnung!“





























