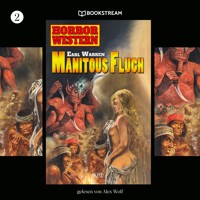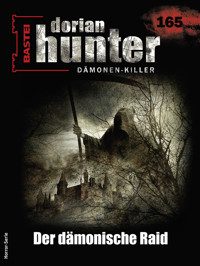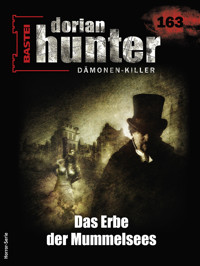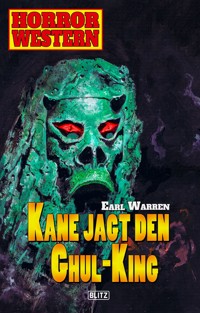1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Dorian Hunter - Horror-Serie
- Sprache: Deutsch
Roman Lipwitz wollte seinen Augen nicht trauen, als er die Stadt im Dschungel sah. Unmittelbar bei dem Lagerplatz der neun Männer vom Suchkommando war sie entstanden, wo am Tag zuvor nur Dschungel gewesen war. Die Männer standen im dichten, verfilzten Unterholz am Rande der riesigen Lichtung.
»Das ist El Dorado, die sagenhafte Hauptstadt des Inkareiches«, flüsterte Roger Ballard, der ebenso wie Roman Lipwitz ein Mitglied von Jeff Parkers Playboy-Clique war. Außer den beiden gehörten die brasilianischen Mischlinge Calo und Jorge und fünf indianische Träger zum Suchtrupp.
»El Dorado habe ich mir immer etwas größer vorgestellt«, meinte Lipwitz skeptisch. »Das hier sind nur vierzig Gebäude und eine Vierkantpyramide.«
Welches Geheimnis birgt El Dorado? Um das Rätsel zu lösen, dringt Dorian immer weiter in den Dschungel vor ... und das Grauen, das dort seit Jahrhunderten schlummert, erwacht zum Leben!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
TOD IN DER GRÜNEN HÖLLE
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
mystery-press
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Mark Freier
eBook-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-9195-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Auf Schloss Lethian an der österreichisch-slowenischen Grenze gerät der Reporter Dorian Hunter in ein Abenteuer, das seinen Verstand übersteigt. Die acht Männer, die seine Frau Lilian und ihn begleiten, sind seine Brüder – gezeugt in einer einzigen Nacht, als die Gräfin von Lethian, selbst eine Hexe, sich mit dem Teufel Asmodi vereinigte! Dorians Brüder nehmen die Offenbarung euphorisch auf. Nur Dorian will sein Schicksal nicht akzeptieren. Er tötet seine Mutter und eröffnet die Jagd auf seine Brüder. Danach steckt er das Schloss in Brand und flieht mit seiner Frau. Aber Lilian hat bei der Begegnung mit den Dämonen den Verstand verloren. Übergangsweise bringt Dorian sie in einer Wiener Privatklinik unter, die auf die Behandlung psychischer Störungen spezialisiert ist – und begegnet kurz darauf der jungen Hexe Coco Zamis, die von ihrer Familie den Auftrag erhalten hat, Dorian zu töten. Doch Coco verliebt sich in den Dämonenkiller und wechselt die Seiten, wodurch sie nicht nur ihre magischen Fähigkeiten verliert, sondern darüber hinaus aus der Schwarzen Familie ausgestoßen wird.
Coco wie auch Dorian sind nun gleichzeitig Jäger und Gejagte, denn Dorian hat sich geschworen, seine Brüder, die das Feuer auf Schloss Lethian offenbar allesamt überlebt haben, zur Strecke zu bringen. In London tötet er Roberto Copello, nachdem dieser den Secret-Service-Agenten Donald Chapman auf Puppengröße geschrumpft hat. Mit Hilfe des Secret Service gründet Dorian die »Inquisitionsabteilung«, der nicht nur er selbst, sondern auch Coco und der Puppenmann Chapman fortan angehören. Ein weiteres »inoffizielles« Mitglied ist der geheimnisvolle Hermaphrodit Phillip, dessen Adoptiveltern von Dämonen getötet wurden. Zum Hauptquartier der Inquisitionsabteilung wird die Jugendstilvilla in der Baring Road, in der Phillip aufgewachsen ist, doch gleichzeitig stöbert Dorian Hunter weiter in der Bibliothek seines alten Reihenhauses in der Abraham Road nach Hinweisen auf dämonische Umtriebe – und stößt auf das Tagebuch des Barons Nicolas de Conde, der auf dem Eulenberg nahe Nancy im Jahr 1484 seine Seele dem Teufel verkaufte. De Conde bereute, wurde zum Hexenjäger und Mitautor des »Hexenhammers« und starb als angeblicher Ketzer. Der Fluch erfüllte sich. Seither wird de Condes Seele nach jedem Tod in einem neuen Körper wiedergeboren – und tatsächlich gelingt es ihm als Dorian Hunter, nicht nur sieben seiner Brüder, sondern schließlich auch seinen Vater Asmodi zu vernichten!
In der Folge zerfällt die Inquisitionsabteilung – obwohl sich mit Olivaro schnell ein Nachfolger für Asmodi findet, der innerhalb der Schwarzen Familie allerdings nicht unumstritten ist. Durch eine Finte zwingt Olivaro Coco an seine Seite, und Dorian kann nicht einmal um seine Gefährtin kämpfen, denn zur gleichen Zeit gerät sein alter Freund Jeff Parker im Dschungel in Not – auf der Suche nach der sagenhaften Goldstadt El Dorado …
TOD IN DER GRÜNEN HÖLLE
von Earl Warren
Roman Lipwitz wollte seinen Augen nicht trauen, als er die Stadt im Dschungel sah. Unmittelbar bei dem Lagerplatz der neun Männer vom Suchkommando war sie entstanden, wo am Tag zuvor nur Dschungel gewesen war. Die Männer standen im dichten, verfilzten Unterholz am Rande der riesigen Lichtung.
»Das ist El Dorado, die sagenhafte Hauptstadt des Inkareiches«, flüsterte Roger Ballard, der ebenso wie Roman Lipwitz ein Mitglied von Jeff Parkers Playboy-Clique war. Außer den beiden gehörten die brasilianischen Mischlinge Calo und Jorge und fünf indianische Träger zum Suchtrupp.
»El Dorado habe ich mir immer etwas größer vorgestellt«, meinte Lipwitz skeptisch. »Das hier sind nur vierzig Gebäude und eine Vierkantpyramide.«
Sie spähten durch das Fernglas.
»Aber sieh doch nur, wie groß die Gebäude sind!«, sagte Ballard. »Die Pyramide ist sicher dreißig Meter hoch. Ich möchte wissen, wie diese riesigen Steinblöcke in den Dschungel gekommen sind. Fugenlos und ganz ohne Mörtel sind sie zusammengefügt.«
1. Kapitel
Die Indios tuschelten aufgeregt miteinander. Tiquito, ihr Sprecher, trat vor Lipwitz und Ballard hin. Äußerlich konnte man sich keinen größeren Gegensatz vorstellen als den kleinen, krummbeinigen Lipwitz mit seinem krausen, schwarzen Haar und den zusammengewachsenen Brauen und den blonden schlaksigen, über ein Meter neunzig großen Ballard. Aber die beiden verstanden sich gut. Sie genossen das Leben in vollen Zügen und machten sich mit Gott und der Welt ihren Spaß. Der Anblick der aus dem Nichts entstandenen Stadt hatte den beiden Playboys aber doch einen Moment den Atem verschlagen.
»Böser Ort«, sagte der stämmige Indio Tiquito. »Wir nicht hierbleiben. Schnell weggehen. Sonst alle verloren. Die Überlieferung sagt, Geisterstadt ist verflucht.«
Er sprach nur gebrochen Spanisch. Lipwitz, der Sohn eines kolumbianischen Diplomaten, verstand ihn. Ballard sprach als typischer Amerikaner nur Englisch und hatte kein Wort mitbekommen; er konnte sich aber denken, worum es ging. Auch die beiden Mischlingsführer schauten äußerst unbehaglich drein.
»Ihr kennt diese Stadt?«, fragte Lipwitz den stämmigen Indio. »Eure Überlieferungen sprechen davon? Erzähl mir mehr darüber.«
Tiquito spuckte aus. Er trug ein zerlumptes Wollhemd und eine ausgefranste Hose. Das strähnige, blauschwarze Haar war in der Mitte gescheitelt und umrahmte ein rundes Gesicht.
»Stadt kommen und verschwinden«, sagte er mit kehliger Stimme. »Viele Männer sehen – alle sterben. Böse Dinge geschehen. Hier schlimmer Geist in Dschungel.«
Lipwitz schaute durchs Fernglas zur Stadt hinüber. Keine Menschenseele war auf den breiten Straßen zu sehen. Die Parks waren verlassen. Es war keine Ruinenstadt, im Gegenteil, die mächtigen Gebäude schienen nicht älter als einige Jahre zu sein; kein Unkraut wucherte auf den Straßen.
Lipwitz wurde es unbehaglich, als er die Dschungelstadt anschaute, ohne dass er erklären konnte, weshalb.
»Wenn die Männer alle gestorben sind«, sagte er und setzte das Fernglas ab und sah Tiquito scharf an, »woher wisst ihr dann überhaupt etwas von dieser Stadt?«
»Ein paar nicht gleich gestorben«, sagte Tiquito, und sein rotbraunes Gesicht war fahl vor Angst. »Sie verrückt geworden und bei Nacht nie mehr geschlafen aus Angst vor Geistern. Sie nicht mehr lange gelebt. Geister haben sie gerufen. Und eines Nachts sie spurlos verschwunden.« Er verstummte.
»Was sagt er?«, wollte Ballard wissen.
»Dummes Geschwätz.« Lipwitz trat von einem Bein auf das andere. »Wir sehen uns die Stadt an.«
Plötzlich wusste er, was mit der Stadt und der riesigen Lichtung, auf der sie stand, nicht stimmte. Der Dschungel ringsum brodelte; Myriaden von Insekten summten, Affen schrien in den Bäumen und Vogel- und Tierstimmen waren zu hören. Auf der Lichtung, im Gestrüpp und zwischen den hohen Farnen regte sich aber nichts. Es war, als seien alle Tiere und sogar die Insekten aus dem Umkreis der geheimnisvollen Dschungelstadt geflohen.
»Mir gefällt das ganz und gar nicht«, sagte Calo, der ältere der beiden lederhäutigen Mestizen. »Ich finde, wir sollten uns so schnell wie möglich verdrücken.«
Lipwitz übersetzte es Ballard, doch der schüttelte heftig den Kopf.
»Seit zwei Tagen lassen wir uns von Moskitos und allem möglichen Ungeziefer auffressen, schlagen uns mit Panthern, Schlangen und Giftspinnen herum, und nun, wo wir endlich etwas vor uns sehen, sollen wir wieder abhauen? Niemals! Ich behaupte, das ist El Dorado. Eine zweite Stadt wird es hier kaum geben.«
»Es ist die Stadt des Dämons«, sagte Jorge, der zweite Mestize. »In Manaus in der Kneipe habe ich davon gehört.«
Die Indios fingen an, ihre Lasten abzuwerfen. Lipwitz nahm die Remington-Großwildbüchse von der Schulter, Ballard entsicherte das M16-Schnellfeuergewehr. Tiquito, der außer seiner Packlast auch noch Lipwitz’ französischen M49-56 Schnellfeuerkarabiner trug, umklammerte trotzig den Schaft und den Kolbenhals der Waffe. Er machte ein böses Gesicht, hatte aber den Karabiner nicht entsichert. Gefährlicher waren da schon die beiden Mestizen, beides abenteuerliche Gestalten mit Trommelrevolvern und Gewehren. Einer trug einen Winchester-Repetierer, der andere eine Doppelbüchse; und sie konnten mit ihren Waffen umgehen.
»Ihr geht mit in die Stadt!«, sagte Lipwitz scharf.
»Versuchen Sie lieber nicht, uns dazu zu zwingen, Señor«, antwortete Jorge. »Vor den Gefahren des Dschungels, vor den Kopfjägern und den Jaguaren fürchten wir uns nicht, aber mit Dämonen und Geistern wollen wir nichts zu tun haben.«
Lipwitz zerbiss einen Fluch zwischen den Zähnen.
Da regte sich seitlich von den Männern etwas im Unterholz. Zwei seltsame Gestalten traten hervor. Es waren Indianer, aber keine Angehörigen der primitiven Jäger- und Sammlerstämme, die den Dschungel durchstreiften. Sie trugen Wattepanzer und runde, reich mit Schnitzereien und Einlegearbeiten verzierte Schilde. Über der linken Schulter hatten sie kurze Bögen und einen Köcher mit Pfeilen hängen. In der Rechten hielten sie lange Klingen aus einem schwarzglänzenden, wie poliertes Glas aussehenden Material. Es waren Obsidianklingen, wie die Inkas und andere Völker sie benutzt hatten. Auf dem Kopf hatten die beiden Indios dicke, konische, mit Borten verzierte und bestickte Hauben. Trotz ihrer seltsamen Aufmachung sahen sie wild und kriegerisch aus.
Die fünf Indios vom Suchkommando und die beiden Mestizen starrten sie konsterniert an. Einzig Lipwitz und Ballard wussten, wen sie vor sich hatten. Das waren Inkas; und sie sahen so aus, als stammten sie noch aus der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts, als Francisco Pizarro und seine Konquistadoren das Reich der Inkas in Blut und Feuer untergehen ließen.
Rund um den Suchtrupp traten jetzt weitere Inkas aus den Verstecken. Sie hatten sich zwischen Farnen und Gestrüpp ungesehen herangepirscht. Drohend fuchtelten sie mit den blanken Obsidianschwertern und –beilen herum und richteten Pfeile auf die neun Männer, die sich in die Nähe ihrer Stadt begeben hatten. Einer, prächtiger gekleidet als die anderen und mit einer Federhaube auf dem Kopf, trat vor. Er deutete mit der Obsidianklinge auf die Stadt und sagte mit kehliger Stimme ein paar Worte in einer unbekannten Sprache.
»Er will, dass wir zur Stadt gehen«, sagte Ballard zu Lipwitz.
Der kleine, kraushaarige Kolumbianer, der mit seiner Stupsnase einem Äffchen ähnelte, hatte jetzt weit weniger Lust, die Stadt aufzusuchen, als noch vor zwei Minuten.
»Das gefällt mir ganz und gar nicht«, sagte er auf Englisch zu Ballard.
Der Inka wiederholte seinen Befehl und fuchtelte mit dem Schwert herum. Die fünf Indios vom Suchkommando zitterten wie Espenlaub. Die beiden weißen Männer und die Mestizen hielten die Waffen im Anschlag, bereit, unter den Inkas ein Blutbad anzurichten, sollten diese sie angreifen.
Da hörten sie eine donnernde Stimme, und jeder verstand die Worte, die sie sprach, in seiner Muttersprache.
»Werft die Waffen weg, ihr Würmer! Ihr gehört mir! Und einer von euch soll die Reise ohne Wiederkehr machen wie einst der Dämon Aguilar. Ergebt euch dem mächtigen Fürsten der Finsternis!«
Calo und Jorge schrien vor Schrecken auf, und drei der fünf Indios fielen zu Boden und wimmerten um Gnade. Dann trat der Sprecher durch die geschlossene Reihe der Inkas. Er war prächtig gekleidet. Sein roter Umhang wies herrliche Stickereien auf, war mit Gold und Edelsteinen geschmückt. Auf dem Kopf trug er eine Federkrone, und sein Gesicht war edel, energisch und wild zugleich; eine große, gebogene Nase beherrschte es. Seine Augen waren blutunterlaufen, als seien alle Äderchen in ihnen geplatzt. Von Gestalt war er stämmig und groß für einen Indio.
Lipwitz starrte diese Erscheinung, den Herrscher der umstehenden Inkas, mit hervorquellenden Augen an. Er war wie vom Donner gerührt, denn er kannte dieses Gesicht; auf einer alten Zeichnung eines Gefolgsmannes des Francisco Pizarro hatte er es gesehen. Es war das Gesicht von Atahualpa, dem Inkaherrscher – jener Atahualpa, der am 19. August 1533 von den Spaniern in Cajamarca nach einem Scheinprozess hingerichtet worden war.
Vor Lipwitz und dem Suchkommando standen Inkas, wie sie vor über vierhundert Jahren gelebt hatten, und sie wurden von einem Mann angeführt, der seit mehr als vier Jahrhunderten hätte tot sein sollen.
»Ergebt euch!«, rief Atahualpa.
Lipwitz riss mit einem erstickten Schrei das Remington-Repetiergewehr hoch und schoss dem Inkaherrscher eine Zehn-Millimeter-Kugel durch den Kopf. Atahualpas Schädel hätte wie eine überreife Melone zerplatzen müssen, doch nichts dergleichen geschah. Der Inka blieb auf den Beinen. Aus dem Einschussloch quoll eine gallertartige, graue Masse und verschloss die Wunde. Atahualpa lachte höhnisch.
Als hätte der Schuss einen unheilvollen Bann gebrochen, begann nun ein wilder, kurzer Kampf. Atahualpa zeigte mit ausgestrecktem Finger auf Roger Ballard. Ihn trafen kein Pfeil, keine geschleuderte Kriegskeule, kein Obsidianbeil, obwohl er drei Inkas mit kurzen Feuerstößen fällte. Calo starb, bevor er mit seiner Winchester feuern konnte. Mehrere Pfeile hatten seine Brust und seine Kehle durchbohrt. Von den Indios lagen drei am Boden, ohne Gegenwehr ihr Schicksal erwartend, einer versuchte zu fliehen. Eine Kriegskeule zerschmetterte den Schädel des Flüchtenden.
Tiquito verteidigte sich verbissen. Er zog immer wieder den Abzug des Schnellfeuerkarabiners durch und wunderte sich, weshalb die Waffe nicht schoss, wie er es bei den weißen Männern gesehen hatte. Er hatte sie noch immer nicht entsichert. Ein Pfeil fuhr ihm in den Unterleib, und dann waren die Inkas heran. Ein wildes Handgemenge begann.
Jorge erschoss einen Inka mit seiner Doppelflinte. Dann sauste ein Obsidianbeil horizontal heran, traf seinen aufgerissenen Mund und schlug ihm die Zähne aus. Das Beil blieb im Kieferknochen stecken. Unartikulierte Laute kamen aus Jorges Mund. Er ließ die Doppelflinte fallen. Obsidianklingen teilten ihn förmlich in Stücke.
Tiquito schlug mit dem Karabinerkolben um sich und wurde niedergemetzelt.
Ein Inka entriss Roger Ballard das Schnellfeuergewehr. Roman Lipwitz, der bis jetzt voller Entsetzen und fassungslos Atahualpa angestarrt hatte, erwachte aus seiner Erstarrung und kämpfte um sein Leben. Er ließ das Remington-Repetiergewehr fallen und zog den schweren Ruger-Revolver aus der Halfter. Der Super-Blackhawk, Kaliber .44 Magnum, krachte wie eine Kanone. Lipwitz spürte den Rückstoß im ganzen Arm.
Der Inka, dem er die Waffe vor den Bauch gehalten hatte, wurde von den Beinen gerissen. Wieder schoss Lipwitz und dann noch einmal. Zwei weitere Inkas stürzten zu Boden, tot der eine, schwerverletzt der andere. Der Super-Blackhawk konnte selbst einen Büffel umlegen.
Lipwitz hatte sich etwas Luft verschafft. Er sah, wie sein Freund Roger Ballard niedergerungen wurde und wie die Inkas die drei Indios niedermetzelten, die noch am Leben waren. Die Inkas kämpften völlig lautlos, nur das Röcheln und die Todesschreie der Sterbenden und das Stöhnen der Verwundeten waren zu hören.
Der kleine Lipwitz hatte einen Brustkasten wie ein Gorilla und enorme Kräfte. Er schlug einem Inka den schweren Revolverlauf quer übers Gesicht, durchbrach mit einem Sprung den Ring der Angreifer und flüchtete in die Büsche.
»Halt!«, donnerte Atahualpas Stimme hinter ihm.
Lipwitz hörte hinter sich Rascheln, Knacken und die Rufe der Verfolger. Blindlings stürmte er weiter. Nur weg von hier – weg, das war sein einziger Gedanke. Er wich einem völlig verfilzten Gestrüpp aus und fiel fast in einen stinkenden Tümpel. Eine giftige Buschmeisterschlange zischte ihn an, aber Lipwitz sah sie ebenso wenig wie das Netz einer faustgroßen, haarigen Spinne. Er rannte hinein und hatte die Spinne am Hals sitzen. Die Giftzangen der Tropenspinne bohrten sich wie glühende Nägel in seinen Hals.
Er stieß einen Schrei aus, riss sich die Spinne vom Hals und schleuderte sie weg. Sein rechter Fuß verfing sich in einer Luftwurzel. Der kleine Mann stürzte zu Boden und verstauchte sich ein Fußgelenk. Der Schmerz war so groß, dass ihm Tränen in die Augen traten. Hinter sich hörte er die Rufe der ihn verfolgenden Inkas. Sie kamen näher.
Der Spinnenbiss brannte wie Feuer. Lipwitz spürte seinen Puls im Hals klopfen, und sein Herz hämmerte. Er hatte grässliche Angst vor dem Tod. Vorsichtig kroch er unter den hohen Farnen und zwischen dem Schachtelhalmgras hindurch und entdeckte eine längliche Bodenmulde. Er legte sich hinein und presste das Gesicht in das feuchte Moos. Ein fingerlanger Tausendfüßler rannte ihm über die heiße Wange.
Dann waren die Verfolger heran. Sie hielten Ausschau nach Lipwitz in dem Dämmerlicht unter dem dichten Laubdach der Bäume, die in drei Etappen wuchsen.
Mit zitternder Hand umklammerte er seinen Revolver, entschlossen, die letzten Kugeln hinauszujagen, wenn er entdeckt wurde. Sein Kopf tat immer mehr weh, und von seinem rechten Fuß strahlten Schmerzen in den ganzen Körper aus. Schleier wogten vor seinen Augen, und von einer Sekunde zur anderen verlor er das Bewusstsein.
Als er wieder zu sich kam, hörte er nur noch die Stimmen des Urwaldes – die Vogelrufe und vereinzelten Tierlaute, das Summen der Moskitos, das Rascheln irgendeines Tieres in der Nähe. Die Inkas hatten die Suche nach ihm aufgegeben.
Er wollte aufstehen, aber sein Fuß schmerzte, so dass er unmöglich auftreten konnte. An seiner linken Halsseite war vom Spinnenbiss eine faustgroße Beule entstanden, in seinen Ohren rauschte das Blut, und sein Körper war mit kaltem Schweiß bedeckt.
Nachdem er einige Minuten gelauscht hatte, ob kein Feind mehr in der Nähe war, kroch der kleine Mann mit zusammengebissenen Zähnen zu einem vom Blitz gefällten Baum. Er nahm das scharfgeschliffene Fahrtenmesser aus der Gürtelscheide und hackte damit einen gegabelten Ast vom Stamm. Dann kürzte er die Astgabeln und entfernte die Zweige, dabei immer lauschend, ob nicht die Inkas auf der Suche nach ihm umherschlichen. Mit Hilfe des dünnen, aber starken Astes, den er wie eine Krücke unter die rechte Achsel klemmte, konnte er sich aufrichten.
Er hatte Schmerzen und fühlte sich elend, aber er wollte wissen, was mit seinem Kameraden Roger Ballard geschehen war. Er lud seinen Revolver und humpelte durch das Dämmerlicht des Dschungels. Für die Strecke, die er zuvor in panischer Flucht gerannt war, brauchte er jetzt viermal so lange.
Dann hörte er die Stimmen der Inkas, einen Chor, dessen Sinn er nicht verstehen konnte, und dazwischen grässliches Wimmern und hin und wieder einen Schrei.
Als er den Rand der Lichtung und den Kampfplatz erreichte, duckte er sich hinter die meterhohen, moosüberwucherten Brettwurzeln eines mächtigen Ceibabaumes. Ein furchtbarer Anblick bot sich ihm.