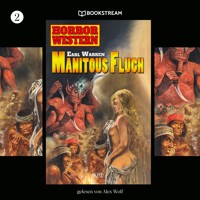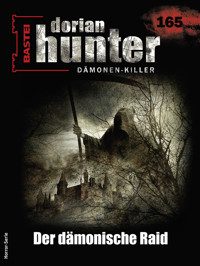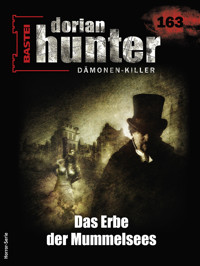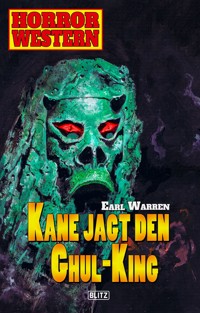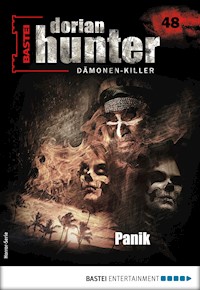
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Dorian Hunter - Horror-Serie
- Sprache: Deutsch
Der Sturm heulte, die Brandung toste, und die Gischt spritzte hinauf bis zu dem einsamen Wanderer auf den Klippen am Moray Firth.
Olivaro, der als Magus VII. zum Herrscher der Schwarzen Familie und zum Fürsten der Finsternis aufgestiegen war, blickte finster über das Meer.
Er wusste inzwischen, dass Coco Zamis sich immer noch zu Dorian Hunter hingezogen fühlte. Nicht nur wegen des ungeborenen Kindes, das sie gemeinsam mit dem Dämonenkiller gezeugt hatte.
Aber nun würde Coco sich entscheiden müssen - für Olivaro, der ihr ein Weltreich und die Herrschaft über die Schwarze Familie bot ... oder für die Panik und den Tod, den sein Geschöpf Tangaroa über die Menschheit bringen würde!
Dorian Hunter bleibt nicht mehr viel Zeit, Coco aus Olivaros Klauen zu retten, denn das Oberhaupt der Schwarzen Familie erweckt ein Monstrum, das gigantischer und tödlicher ist als alle Dämonen, die Dorian bisher zur Strecke gebracht hat!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Was bisher geschah
PANIK
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
mystery-press
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabeder beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Mark Freier
eBook-Produktion:3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 9-783-7325-9800-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Der ehemalige Reporter Dorian Hunter hat sein Leben dem Kampf gegen die Schwarze Familie der Dämonen gewidmet, seit seine Frau Lilian durch eine Begegnung mit ihnen den Verstand verlor. Seine Gegner leben als ehrbare Bürger über den gesamten Erdball verteilt. Nur vereinzelt gelingt es dem »Dämonenkiller«, ihnen die Maske herunterzureißen. Unterstützung in seinem Kampf erhält er zunächst durch den englischen Secret Service, der auf Hunters Wirken hin die Inquisitionsabteilung gründete.
Bald kommt Dorian jedoch seiner eigentlichen Bestimmung auf die Spur: In einem früheren Leben schloss er als französischer Baron Nicolas de Conde einen Pakt mit dem Teufel, der ihm die Unsterblichkeit sicherte. Um für seine Sünden zu büßen, verfasste de Conde den »Hexenhammer« – jenes Buch, das im 16. Jahrhundert zur Grundlage für die Hexenverfolgung wurde. Doch der Inquisition fielen meist Unschuldige zum Opfer; die Dämonen blieben ungeschoren.
Als de Conde selbst der Ketzerei angeklagt und verbrannt wurde, ging seine Seele in den nächsten Körper über. So ging es fort bis in die Gegenwart. Dorian Hunter begreift, dass es seine Aufgabe ist, de Condes Verfehlungen zu sühnen und die Dämonen zu vernichten. Er jagt die Dämonen auf eigene Faust, und als die Erfolge ausbleiben, gerät Trevor Sullivan, der Leiter der Inquisitionsabteilung, unter Druck. Die Abteilung wird aufgelöst.
Hunter bleibt nur sein engstes Umfeld: die junge Hexe Coco Zamis, die früher selbst ein Mitglied der Schwarzen Familie war, bis sie wegen ihrer Liebe zu Dorian den Großteil ihrer magischen Fähigkeiten verlor; weiterhin der Hermaphrodit Phillip, der weder Mann noch Frau ist und dessen hellseherische Fähigkeiten ihn zu einem lebenden Orakel machen – sowie die Ex-Mitarbeiter des Secret Service Marvin Cohen und Donald Chapman. Letzterer wurde bei einer dämonischen Attacke auf Zwergengröße geschrumpft.
Trotz der Rückschläge gelingt es Dorian, Asmodi, das Oberhaupt der Schwarzen Familie, zu vernichten. Doch mit Olivaro steht schon ein Nachfolger bereit, der in der Vergangenheit keinerlei Skrupel hatte, sogar mit Dorian zusammenzuarbeiten, wenn es seinen eigenen Interessen diente.
So hat Olivaro auch Coco Zamis auf seine Seite gezwungen und präsentiert sie während einer Schwarzen Messe auf der griechischen Insel Athos als neue Gefährtin, die sein Kind unter dem Herzen trage. Umso schlimmer trifft ihn Cocos Geständnis: Das Kind stammt von Dorian Hunter! Um Coco zu retten, folgt Dorian Coco und Olivaro im Körper des Architekten Ronald Chasen auf ein Atoll in der Südsee und erfährt von Coco, wo Olivaro als Nächstes zuschlagen will, um seinen Stand in der Schwarzen Familie zu festigen: in Rabaul auf Neubritannien. Doch wie umfassend und tödlich Olivaros Plan wirklich ist, ahnt Hunter nicht ...
PANIK
von Earl Warren
Olivaro blickte finster über das Meer. Der Dämon, der als Magus VII. zum Herrscher der Schwarzen Familie und zum Fürsten der Finsternis aufgestiegen war, hatte Sorgen. Deshalb spazierte er über die Klippen am Moray Firth. Er hatte den Mantelkragen hochgeschlagen. Sturm und Regen peitschten sein Gesicht. Das Wetter passte zu seiner gegenwärtigen Stimmung.
Weshalb hatten viele Dämonenfamilien immer noch Ressentiments gegen ihn? Weshalb würdigten sie seine Verdienste nicht gebührend? Hatte er nicht mehr Macht, als je ein Dämon vor ihm? Olivaro hatte jahrhundertelang gewartet und sich vorbereitet, ehe er die Macht übernahm.
Geschickt hatte er seinen Vorgänger, Asmodi II., mit Hilfe Dorian Hunters, den er als Werkzeug benutzte, aus dem Weg geräumt. Doch immer noch gab es Schwierigkeiten.
Vielleicht habe ich mich in den vergangenen Jahrhunderten zu ruhig verhalten, dachte Olivaro. Die Mitglieder der Schwarzen Familie fürchten mich nicht genügend, sehen in mir immer noch den Gemäßigten. Oh, diese Narren ...
1. Kapitel
Ich habe die Macht und die Kraft, diesen ganzen Planeten in Stücke zu reißen. Ich kann allen Zweiflern Schrecken bereiten, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Ich werde dafür sorgen, dass mein Name wie ein glühendes Menetekel in ihre kümmerlichen Gehirne eingebrannt wird, damit sie mich endlich als den Größten und Schrecklichsten anerkennen, ehren und fürchten. Mich, Magus VII., Fürst der Finsternis.
Olivaro ging weiter. Der Sturmwind umheulte die einsame Gestalt in dem schwarzen Mantel mit dem blutroten Innenfutter.
Sie munkeln, ich hätte nicht das Charisma eines Führers, sinnierte Olivaro weiter. Wohlan, sie sollen mein Charisma spüren und sich ihm beugen oder sterben. Denn mein Charisma ist das Böse.
Der Sturm heulte, die Brandung toste, und die Gischt spritzte hinauf bis zu dem einsamen Wanderer auf den Klippen.
Vielleicht liegt es daran, dass ich Dorian Hunter bisher noch nicht habe zur Strecke bringen können. Er hat der Schwarzen Familie schon viel Schaden zugefügt und muss endlich sterben. Ach, ich wünschte, ich könnte ihm ein Messer in den Bauch stoßen, ihm mit einem Donnerkeil den Schädel spalten oder einfach ein paar Killer anheuern. Aber als Dämon und Fürst der Finsternis bin ich den Gesetzen der Schwarzen Familie unterworfen und muss mich an ihre Regeln halten. Dorian Hunter muss durch meine Magie sterben, und es muss ein Tod sein, der einem Feind des Fürsten der Finsternis würdig ist.
Ich glaube, Coco Zamis fühlt sich noch immer zu ihm hingezogen. Was hat dieser Kerl nur, was ich nicht habe, was auch die schwarze Magie mir nicht verleihen kann? Ist es, weil Dorian Hunter ein echter Mann ist, tapfer und im Grunde seines Wesens gut? Pah! Ich spucke den ätzenden Schleim des Höllenhundes Zerberus darauf. Ich bin der Fürst der Finsternis, und es wäre ein Unding, wenn ich nicht Coco Zamis’ Zuneigung gewinnen könnte.
Sie hat Dorian Hunter einmal geliebt, aber kann denn Liebe stärker sein als all meine dämonische Kraft und die geballte Macht des Bösen? Wenn es so wäre, dann stünden wir Dämonen letzten Endes auf verlorenem Posten.
Olivaro schaute in die tobende Brandung unter sich. Ärgerlich riss er sich nach einer Weile von seinen Gedanken los. Was brachte es, zu philosophieren und zu grübeln? Praktische Maßnahmen mussten ergriffen werden. Er beschloss, den Dämonenkiller zu vernichten und Coco Zamis auf die Probe zu stellen. Jetzt wollte er es genau wissen. Wenn Coco sich für ihn, den Fürsten der Finsternis, entschied, dann würde er ihr sein dämonisches Reich zu Füßen legen. Wenn sie aber Dorian Hunter wählte, dann sollte sie elendig umkommen, mitsamt ihrem ungeborenen Kind.
»Ja!«, rief Olivaro in den tobenden Sturm, der ihm die Worte von den Lippen riss. »Ich werde Tangaroa wecken. Mein schrecklichstes Geschöpf soll alle meine Feinde und Gegner mit Furcht und Schrecken erfüllen. Tangaroa – gegen den selbst der mörderische Moloch nur ein harmloses Haustierchen war.«
Begeistert von seinem Plan, machte sich der Fürst der Finsternis sofort auf, ihn zu verwirklichen.
Das amerikanisch-japanische Gemeinschaftsunternehmen faszinierte die Öffentlichkeit. Immer wieder tauchten Meldungen in der Presse auf, und regelmäßig wurden im Fernsehen Filme und Dokumentationen gezeigt, Observator beschäftigte sich mit den tiefsten Meerestiefen.
Der 11.022 Meter tiefe Marianengraben sollte erforscht werden. Zwar hatte Jacques Piccard zusammen mit dem amerikanischen Marineleutnant Don Walsh bereits am 25. Januar 1960 in seinem Tauchboot Trieste eine Tiefe von 10.910 Metern erreicht, aber er hatte nicht die Möglichkeiten gehabt, die den Leitern des Projekts Observator zur Verfügung standen. Und damals hatten nicht Millionen zu Hause im bequemen Fernsehsessel die Pionierleistung miterleben können.
Die Projektleiter waren Professor Dr. Benjamin Jefferson vom Marineforschungsinstitut in Portland, Maine, und Professor Takahama Yakumotu von der Kaiserlichen Universität in Tokio. Beide waren Ozeanologen. Jefferson hatte sich auf die Flora der Tiefsee spezialisiert, Yakumotu auf die Fauna. Für das Projekt Observator standen zur Verfügung: Ein Forschungsschiff von 18.000 Bruttoregistertonnen, ein Schwergut-Frachtschiff, das speziell für die Belange des Tauchbootes Challenger hergerichtet worden war, das Tauchboot, zwei Kleinunterseeboote sowie die volle Unterstützung der amerikanischen und japanischen Marine. Ein Team von dreißig Spezialisten und sechshundert Helfern der amerikanischen und japanischen Marine arbeitete für Observator.
Am 31. Juli tauchte Challenger wieder auf den Grund des Marianengrabens, und zwar an der tiefsten Stelle, beim Witjas-Tief. An Bord des Forschungsschiffes und an Bord des Frachtschiffes konnte man auf den Monitoren sehen, was die beiden Spezialkameras des Tauchbootes aufnahmen. Über Funk stand die fünfköpfige Besatzung des Tauchbootes mit den beiden Schiffen in Kontakt. Der japanische Marineleutnant Hirogawa Toki hatte an Bord der Challenger das Kommando. Seine Stellvertreterin war die Ozeanologin Dr. Susan Allison. Drei weitere Wissenschaftler befanden sich an Bord. Das Tauchen auf eine Tiefe von elftausend Metern nahm mehrere Stunden in Anspruch. Der Druck musste immer wieder reguliert werden, um die gefürchtete Caissonkrankheit zu vermeiden.
Um elf Uhr hörte Professor Jefferson, ein schmaler, sehniger Mann von fünfundvierzig Jahren und mit angegrauten Schläfen, Leutnant Tokis Routinemeldung.
»Hier Challenger, Leutnant Toki«, tönte es gut verständlich aus dem Übertragungslautsprecher des Funkgeräts. »Haben eine Tiefe von zehntausendfünfhundert Metern erreicht. Druckkompensation ist vorgenommen. Wassertemperatur minus 0,5 Grad, Außendruck 1.430 atü. Keine besonderen Vorkommnisse.« Er leierte eine Liste von technischen Daten herunter, die er von den Instrumenten ablas. »Wir gehen auf die endgültige Tauchtiefe. Kommen!«
»Verstanden. Wir erwarten Ihre nächste Meldung. Ende«, sagte Professor Jefferson.
Er wandte sich seinem japanischen Kollegen Yakumotu zu, der hinter ihn getreten war. »Verdammt wortkarg, dieser Bursche.«
Yakumotu lächelte. »Was soll er sagen? Zu romantischen Betrachtungen besteht kein Anlass.«
Das stimmte. Auf den Monitoren war nur milchiges Grau zu sehen. Starke Scheinwerfer des Tauchbootes leuchteten die Umgebung aus, doch in einer Tiefe von mehr als zehntausend Metern gab es längst kein Licht mehr und kaum noch pflanzliches und tierisches Leben. Knochenplattfische und Garnelen existierten noch und niedere Lebewesen wie Schwämme und Stachelhäuter, Tiefseevertreter der Seegurke und Seeigel.
»Mich würde interessieren, worum es sich bei diesem Riesenei auf dem Meeresgrund handelt«, sagte Professor Yakumotu nachdenklich. »Gestern, als das Gebilde beim letzten Tauchversuch entdeckt wurde, war die Zeit zu knapp, es zu untersuchen.«
»Dafür haben wir ihm heute das gesamte Tagesprogramm gewidmet«, antwortete Professor Jefferson. »Ich nehme an, dass es sich um eine Gesteinsformation handelt. Aber vielleicht ist es auch das Ei eines Riesenkraken, und er kommt ab und zu vorbei, um es auszubrüten.«
Yakumotu war einige Augenblicke verdutzt, dann erkannte er, dass der gutaussehende sportliche Amerikaner Spaß gemacht hatte. Er lachte. »Der Größe nach zu urteilen, müsste es sich eher um ein Ei des Filmmonsters Godzilla handeln.«
Die beiden Männer unterhielten sich über das Tauchboot. Challenger bestand aus einem bootsförmigen Unterwasserkörper von fünfzehn Meter Länge und einem Durchmesser von dreieinhalb Metern. Es wog fünfzehn Tonnen und fasste hunderttausend Liter Tragbenzin – denn wie ein gasgefüllter Stratosphärenballon sich durch die Luft bewegte, so sollte das Tauchboot unter Wasser operieren – das Benzin, leichter als Wasser, ermöglichte das. Um die nötige Tauchtiefe zu erhalten, wurden Tauchtanks geflutet. Außerdem dienten Pakete von Eisenschrott als Ballast. Der Eisenschrott wurde zum Teil bei Erreichen der Tauchtiefe und später beim Aufsteigen durch Klappen abgeworfen. An dem Schwimmkörper hing eine Passagierkapsel aus Edelstahl mit Druckfenstern aus Plexiglas, eingebauten Scheinwerfern und Videokameras.
Um zwölf Uhr fünfzehn meldete Challenger, dass die endgültige Tauchtiefe erreicht sei. 10.960 Meter. Das Tauchboot schwebte etwas über dem gigantischen Riesenei. Die Techniker an Bord des Forschungsschiffes errechneten die Maße: »Das Ei – oder was immer es auch sein mag – ist fünfzehn Meter lang und hat einen Durchmesser von neun Metern.«
Jefferson pfiff durch die Zähne. »Ein ganz schöner Brocken.«
Die Umrisse waren auf den Monitoren nur verschwommen zu erkennen. Man konnte die Konturen ausmachen und sehen, dass das eiförmige Gebilde halb im Schlamm versunken war oder aus diesem hervorwuchs. Die Scheinwerfer der Challenger strahlten es an.
»Es sieht tatsächlich wie ein riesiges Ei aus«, meldete sich Leutnant Toki über Sprechfunk. »Wir werden jetzt mit Spezialwerkzeugen ein Loch hineinbohren und Materialproben entnehmen.«
»Gut.«
Der elektrische Antrieb brachte das Tauchboot ganz nahe an das Riesenei heran. Aus einer Luke wurde ein Bohrer ausgefahren. Plötzlich meldete sich Leutnant Tokis Stimme über Funk, ganz im Gegensatz zu sonst aufgeregt und hektisch.
»Hier Challenger. Das Ding bekommt Sprünge.«
»Es handelt sich wohl um ein leicht zerbrechliches Material«, sagte Professor Yakumotu ins Funkmikrofon. »Es hält die Bohrung nicht aus.«
»Aber der Bohrer hat es überhaupt noch nicht angerührt!«
Jetzt konnte man es auch auf den Monitoren erkennen. In der Zentrale des Unternehmens schauten alle wie gebannt zu. Große Sprünge durchzogen das Riesenei, ein Stück bröckelte ab, und eine Öffnung entstand. Man konnte aber nicht erkennen, was sich darin befand.
»In diesem Ei lebt etwas!«, rief eine Stimme aus dem Hintergrund. »Es schlüpft aus.«
Jefferson drehte sich um. Außer ihm waren noch dreißig Männer in der Zentrale, um die verschiedenen Instrumente zu überwachen. »Wer hat das gesagt? So ein Blödsinn! Das Ganze spielt sich in elftausend Meter Tiefe ab. Abgesehen davon, dass es so große bebrütete Eier überhaupt nicht gibt. Vielleicht ist es ein Meeresbeben, das diese ovale Formation zerfallen lässt.« Er wandte sich über Funk an Leutnant Toki. »Zeigt euer Seismograph etwas an?«
»Nein. Keine Anzeichen eines Bebens. Es werden immer mehr Sprünge. Die Öffnung vergrößert sich. Jetzt sehen wir durchs Fenster, dass sich in dem Ei etwas bewegt. Großer Gott, auf was sind wir da gestoßen?«
»Halten Sie größeren Abstand! Gehen Sie auf dreißig Meter Distanz und warten Sie ab!« Zu den andern gewandt sagte Jefferson: »Jetzt fangen die da unten auch schon an, Gespenster zu sehen.«
Auf den Monitoren war jetzt so gut wie gar nichts mehr zu erkennen. Ausgerechnet in diesem Augenblick gab es eine Bildstörung.
»Berichten Sie, Leutnant Toki!«, forderte Jefferson über Funk. »Die Bildübertragung ist gestört!«
»Es ist grässlich«, gellte es aus den Übertragungslautsprechern. »Das Ei bricht auf. Ja, es ist nichts anderes als ein gigantisches Ei, und etwas steckt darin, schlüpft aus. Ich sehe einen Tentakel nach uns greifen. In unseren Köpfen raunt und singt etwas. Jemand flüstert uns etwas zu. Ja, jetzt höre ich es ganz deutlich.« Eine kurze Pause folgte. Dann schrie der Leutnant auf: »Tangaroa! Tangaroa erwacht! Wehe uns allen! Wehe der ganzen Welt!«
Gebrüll folgte, Angstschreie einer Frauenstimme. Das Bild auf dem Monitor wurde nun schärfer. Man sah, dass das Ei geborsten war. Das Wasser wurde durcheinandergewirbelt, und dann schwankte plötzlich alles. Aufgewirbelter Schlamm verdeckte die Sicht. Ein riesiger Tentakel war noch zu erkennen, dann nichts mehr.
»Tangaroa hat das Boot gepackt und schüttelt es!«, schrie Toki aus dem Übertragungslautsprecher. »Mein Gott, es knackt in allen Verstrebungen und Wänden! SOS! SOS! Rettet unsere Seelen! Die Passagierkapsel wird vom Bootskörper abgerissen. Ein Leck! Ein Leck! Elfhundert Atmosphären Wasserdruck und ...« Ein Krachen und Bersten war zu hören, dann kein Laut mehr. Auch die Monitore zeigten nichts.
Bleich sahen die Männer in der Zentrale sich an.
»War das wirklich ein Lebewesen, ein Ungeheuer, das die Challenger vernichtet und fünf Menschen getötet hat?« Jefferson hielt noch immer das Mikrofon in der Hand. »Ich kann es nicht glauben. Es ist unmöglich.«
»Tiefenrausch«, sagte Professor Yakumotu. »Plötzlicher Wahn oder Halluzinationen. Wir werden vielleicht nie erfahren, was sich da unten wirklich abgespielt hat.«
»Was wollen Sie denn noch, Sie verbohrter Hohlkopf?«, schrie ein junger Techniker. »Ein Exklusivinterview mit Tangaroa? Sie haben doch gehört, was passiert ist.«
»Halten Sie den Mund!«, rief Jefferson scharf. »Der Mann ist abzulösen«, sagte er zum befehlshabenden Offizier. Und leise fügte er hinzu: »Wir müssen sofort das Marineoberkommando verständigen. Vielleicht kann man mit leistungsfähigen Ortungsgeräten etwas feststellen.«
Rabaul, einer der Hauptorte des Bismarckarchipels, ist ein malerisches Nest mit 17.000 Einwohnern. Es gibt einen Hafen, einen Luftwaffenstützpunkt, Hotels, Kinos und ein paar Bars.