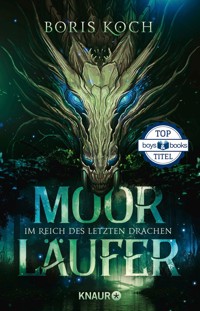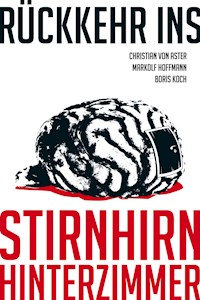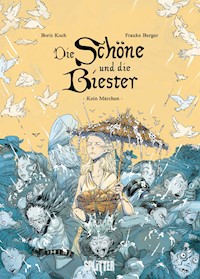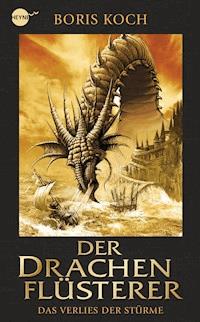9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Dornen von Ycena
- Sprache: Deutsch
Um einen Tyrannen zu stürzen, folgen sie einem alten Märchen. »Dornenthron« ist eine düstere Neuinterpretation des geliebten Märchens "Dornröschen": Boris Koch erzählt sprachgewaltig, atmosphärisch und fesselnd. Das Königreich Lathien, einst Teil eines mächtigen Kaiserreichs, wird von Dürre und König Tiban beherrscht, einem grausamen Tyrannen. Die Menschen hungern, Räuberbanden ziehen durch das Land, Kinder werden verstoßen und Rebellion liegt in der Luft. Ukalion, der illegitime Bastard des Königs, möchte seinen verhassten Vater stürzen und begibt sich in die ehemalige Kaiserstadt Ycena. Einst war sie prunkvoll und voller Leben, nun stehen nur noch von alter Hexerei verseuchte Ruinen – und der alptraumhafte Palast. In ihm soll noch immer die Kaiserstochter schlafen, seit sie vor 600 Jahren vom Zirkel der 13 Zauberinnen in einen ewigen Dornröschenschlaf versetzt wurde. Den Legenden zufolge wird ihr Retter die dreizehn Königreiche wieder vereinen und Kaiser werden. Auch Tyra, die ehemalige Duftfinderin, hat die Fährte aufgenommen. Sie jagt den rätselhaften Mann, der ihren Sohn entführt hat und allem Anschein nach ein Hexer ist – oder etwas noch Schlimmeres. Welche Pläne hat er mit dem kleinen Jungen? Und Tyras Kind ist nicht das einzige, das er in seine Gewalt bringt … »Dornenthron« ist der Auftakt eines phantastischen Zweiteilers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Boris Koch
Dornenthron
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Das Königreich Lathien, einst Teil eines mächtigen Kaiserreichs, wird von Dürre und König Tiban beherrscht, einem grausamen Tyrannen. Die Menschen hungern, Räuberbanden ziehen durch das Land, Kinder werden verstoßen und Rebellion liegt in der Luft.
Ukalion, der illegitime Bastard des Königs, möchte seinen verhassten Vater stürzen und begibt sich in die ehemalige Kaiserstadt Ycena. Einst war sie prunkvoll und voller Leben, nun stehen nur von alter Hexerei verseuchte Ruinen – und der alptraumhafte Palast, in dem noch immer die Kaisertochter schlafen soll. Den Legenden zufolge wird ihr Retter die dreizehn Königreiche wieder vereinen und Kaiser werden.
Auch Tyra, die ehemalige Duftfinderin, hat die Fährte aufgenommen. Sie jagt den rätselhaften Mann, der ihren Sohn entführt hat und allem Anschein nach ein Hexer ist – oder etwas noch Schlimmeres. Welche Pläne hat er mit dem kleinen Jungen? Und Tyras Kind ist nicht das einzige, das er in seine Gewalt bringt …
Inhaltsübersicht
Widmung
Karte
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Der Bastard des Königs
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Die, die einst Duftfinderin war
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Der Name des Bastards
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Der Narr, der in die Höhe strebt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Unterwegs
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Vor dem Sonnenfest
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Nach dem Sturm
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Das Wissen der Schwebenden Bibliothek
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Ruinen und Dornen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Im Wilden Wald
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Die Stadt der Träumer
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Am Hof und im Land
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Hexerei
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Auf der Spur des Namenlosen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Träume
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Abschied und Aufbruch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Danksagung
Für Elli
Das ist ein Versprechen.
Prolog
1
Als die brennende Fackel auf den Boden des Schachts prallte, landete sie zwischen dürren Zweigen und faustgroßen Steinen. Funken stoben auf, die Flamme schrumpfte zusammen, und das Geröll warf zitternde Schatten an die Wände. Trotzdem reichte das Licht aus, um in der Ostwand einen mannshohen Durchgang zu erkennen.
Gahadh Durnis, der sich oben über die Brüstung beugte, lächelte. Im Osten lag der eingestürzte Tempel der dreigesichtigen Suula, der alten Göttin der Winde, die seit Jahrhunderten nur noch in Kylokien und von Seeleuten verehrt wurde.
Die kleine Straßenratte hatte also nicht gelogen. Endlich zahlte es sich aus, dass er mit den Streunern sprach und ihnen ab und zu etwas Geld zusteckte. Den Ausreißern aus den nächsten Dörfern und den vom Bordell Ausgesetzten, die Tag und Nacht an den Ecken herumlungerten und alles sahen.
»Warum verrätst du mir das?«, hatte Gahadh den Kleinen gefragt. »Warum steigst du nicht selbst hinab?«
»Es ist tief, und da unten ist es dunkel«, hatte der Junge geantwortet. Er war höchstens acht gewesen, abgemagert und schmutzig. Gahadh hatte seine Angst deutlich gespürt.
Niemand hatte es bislang geschafft, durch die Tempelruine in die Gewölbe darunter zu gelangen, obwohl es über die Jahrhunderte hinweg Dutzende versucht haben mussten, vielleicht mehr.
Selbst eingestürzt ließ das Bauwerk seine einstige Pracht und Größe noch erahnen, nahm man die Dicke der Säulen, die drei Männer gemeinsam nicht umfassen konnten, und die Detailfülle des einstigen Deckenfrieses zum Maßstab. Im einstigen Kaiserreich waren die Tempelschätze oft in geschützten Kellerkammern aufbewahrt worden, und so würde das, was dort unten wartete, Gahadh zu einem reichen Mann machen.
Noch immer lächelnd knotete er das eine Ende seines Seils um einen Pfeiler vor dem Schacht, prüfte den Knoten drei Mal und warf dann das andere Ende in die Tiefe. Geschickt schwang er sich über den Rand und ließ sich hinabgleiten. Er war sicher, dort unten endlich die Schätze zu finden, für die er vor Monaten nach Ycena gekommen war, der untergegangenen Metropole, Kaisersitz, als es noch einen Kaiser gegeben hatte.
Vor Jahrhunderten von Hexerei zu Fall gebracht und verlassen, war sie nur noch eine schattenreiche Ruinenstadt, deren Mauern der Zeit und den Unwettern beharrlicher trotzten, als es Gebäude irgendwo sonst in den Königreichen taten, und in deren gewaltigen schlafenden und albträumenden Palast seit dem Fall niemand vorgedrungen war, zu fest hatten die alte Magie und die Dornen ihn noch immer im Griff. Ein Ort, an dem die Nächte dunkler waren als anderswo.
Hier wollte Gahadh sein Glück finden. Er war das Wandern und die Schicksalsschläge leid. Mit einundzwanzig hatte er seine Frau Myniam verloren, da war er fortgegangen, ein zornerfüllter Glücksritter ohne Glück. Er war Soldat geworden, ein Veteran von acht siegreichen Schlachten im Kylokischen Krieg, doch fette Beute hatte es nur nach der neunten gegeben, und da war er schon nicht mehr dabei gewesen. Ein Spieler, der nur ein einziges Mal viel gewonnen hatte, um dann mit dem Gewinn in den Taschen in die Fänge von Räubern zu geraten und wieder mit leeren Händen dazustehen. Getrieben von ständig wachsendem Zorn, hatte er zu viele Städte und Dörfer im Streit verlassen, hatte sich in Gasthäusern geprügelt und auf der Straße, wegen einer Frau, einer Beleidigung oder einer Bemerkung. Jede verlorene Prügelei hatte seinen Zorn noch weiter befeuert, keine gewonnene ihn verringert.
Doch er war müde geworden, er war das Blut an den Fäusten ebenso leid wie die blauen Flecken unter der Haut, die Armut ebenso wie die Einsamkeit, sein unstetes Leben von einem Tag zum nächsten.
Zeit, dass das Blatt sich wendet, dachte Gahadh und kletterte weiter hinab.
Als er den halben Weg zurückgelegt hatte, riss das Seil. Überrascht schrie er auf, seine Arme ruderten hilflos umher. Die rechte Hand erreichte die Schachtwand, doch sie fand keinen Halt. Es gab kein Sims, an dem er sich hätte festhalten können, keine Ritze, kein Loch, keinen Vorsprung. Die Fingerkuppen schrappten über den rauen Stein und rissen auf.
Und dann war es auch schon vorbei, er schlug auf und schrie erneut, diesmal vor Schmerz. Knackend brach sein Knöchel, und mit dem Gesicht landete er nur eine Handbreit vor der Fackel auf dem Boden. Die Schläfe schlug gegen einen Stein, und ihm schwindelte, die Flamme versengte seine Haarspitzen. Er zuckte zurück, es roch verschmort.
Keuchend starrte er hinauf zur überdachten Öffnung, die bestimmt ein Dutzend Schritt über ihm war. Ein Kreis aus gedämpftem Tageslicht, das nicht bis hier herunter reichte. Der Kopf pochte, stechender Schmerz fuhr vom Knöchel das ganze Bein hinauf. Fluchend setzte Gahadh sich auf, nahm den Rucksack ab und betastete den Fuß. Wenigstens war es kein offener Bruch.
Langsam sah er sich um und fluchte erneut. Der Gang vor seiner Nase schien nach wenigen Schritten zu enden.
Er packte die Fackel und leuchtete hinein. Tatsächlich, der Gang, der ihn zum Reichtum hatte führen sollen, war verschüttet. Teils mannsgroße Gesteinsbrocken und massives Geröll versperrten ihn vollständig, nicht die geringste Lücke war zu entdecken. Dort war kein Durchkommen. Die Luft roch abgestanden.
Und dann stellte Gahadh fest, dass das, was er von oben für Zweige gehalten hatte, Knochen waren. Die meisten schienen von kleineren Tieren zu stammen, manche von größeren und einige auch von Menschen. Sie lagen über den ganzen Schachtgrund verteilt, einige waren zerbrochen. Dazwischen wand sich das gerissene, nutzlose Seil.
Wütend packte Gahadh einen Steinbrocken und schleuderte ihn gegen die Schachtwand. Warum nur hatte er den Wurfhaken für das Seil nicht eingepackt?
»Mehr Platz für Schätze im Rucksack! Ha!«, schrie er und warf noch einen zweiten Stein. Welche Schätze? Die Wände von Schacht und Gang waren von schwarzen Flecken übersät.
Plötzlich durchfuhr ihn eine kalte Angst. Ohne Seil kam er den Schacht nicht wieder hinauf, ohne fremde Hilfe war er verloren.
»Hallo!«, brüllte er, weil er trotz allem zu stolz war, um »Hilfe!« zu schreien.
Niemand antwortete.
»Hallo!«
Stille.
»He! Hallo!« Noch einmal brüllte er, so laut er konnte.
Doch niemand kam – natürlich nicht.
Ycena war gewaltig, einst sollte hier eine unvorstellbare Million Menschen gelebt haben, jetzt gab es – abgesehen von wenigen hundert Suchern und den streunenden Kindern – niemanden mehr. Ycena war nur noch ein verblassender Traum von Macht, ein Begriff für vergangene Größe. Nach dem Sturz der Metropole war das alte Kaiserreich in dreizehn Königreiche zerfallen, und alle Versuche, sie wieder zu einen, waren gescheitert. Ycena war nur noch Ruinen und eine Idee.
Die meisten Sucher lebten in der Siedlung am schlafenden Palast, weit weg vom verschütteten Suulatempel und diesem Loch im Boden. Dort, im einstigen Kern der Stadt, suchten sie nach verschütteten Münzen, Schmuck, Kunstwerken, Gold, Steinfratzen und allem anderen, das sich zu Geld machen ließ – hierher verirrte sich kaum jemand. Und die von dicken Säulen getragene Kuppel über dem Schacht sorgte dafür, dass die Rufe nicht weit trugen. Im ganzen Umkreis gab es nur verlassene Gebäude, und Gahadh hatte der Straßenratte gesagt, sie solle in den nächsten Tagen niemanden hierher führen, weil er die Funde für sich allein wollte. Der Junge hatte es versprochen, und die wenigsten Sucher entfernten sich grundlos so weit von der Siedlung, Gahadh war ganz auf sich allein gestellt.
»Ist ja nicht das erste Mal«, murmelte er vor sich hin und richtete sich entschlossen auf. Als er auf den verletzten Fuß trat, durchfuhr ihn erneut ein stechender Schmerz. Zähneknirschend hüpfte er auf einem Bein in den Gang und zerrte ein paar Steine aus dem Geröll. Zwei Schritt entfernt baute er aus ihnen eine Halterung für die Fackel und stellte sie hinein. So brannte sie höher und heller als auf dem Boden.
Dann trug er mit bloßen Händen Geröll ab. Dahinter fand sich der einzig mögliche Weg hinaus, den vier Schritt durchmessenden Schacht hätte er ohne Seil nicht einmal unverletzt erklimmen können. Er grub auf den Knien, der Knöchel war dick geschwollen und schmerzte bei jeder Bewegung. Gahadh fluchte mit zusammengebissenen Zähnen, aber er schrie nicht mehr.
Immer wieder unterbrach er die Arbeit, um die wenigen Schritt zum Schacht zurückzukriechen und »Hallo!« zu rufen, doch nie antwortete jemand, kein Mensch, kein wildes Tier und zum Glück auch keine der Kreaturen, die irgendwo in den Ruinen hausten und erst nachts herauskamen.
Mühsam wühlte er sich durch das Geröll, doch er kam kaum voran. Die Steine hatten sich ineinander verkantet, Sand und Erde die Ritzen ausgefüllt. Schon bald waren Gahadhs Hände von Kratzern und Schürfungen übersät und die Nägel eingerissen. Er blutete und wühlte verbissen weiter, aber er rief nicht mehr; er sparte sich alle Kraft für das Graben auf. In den Schacht kroch er nicht mehr zurück.
2
Gahadh verlor jegliches Zeitgefühl, und die Hände waren längst taub, als plötzlich eine Stimme zu ihm herab tönte. »Hallo?«
Vertieft ins Graben, hätte er sie fast nicht gehört. Als sie in sein Bewusstsein drang, ließ er sofort vom Geröll ab und rief: »Hier!«
So schnell er konnte, kroch er zum Schacht zurück.
»Hier!«
Er fürchtete, er könnte sich die Stimme nur eingebildet haben oder ihr Besitzer könnte ihn nicht gehört haben und weitergegangen sein, doch als er nach oben sah, erkannte er erleichtert einen schlaksigen Mann, der rittlings auf der Brüstung des Schachts saß. Seine Beine steckten in einer weiten Hose, der Oberkörper war abgesehen von einer bunten Weste nackt. Um seinen Hals hing eine Kette, an den Handgelenken glänzten goldene und silberne Armreifen und auf dem Kopf trug er einen breitkrempigen Hut, wie ihn fahrende Schausteller trugen. Er erinnerte Gahadh an den pfeifenden Gaukler, der sein Dorf besucht hatte, als er noch ein Kind gewesen war. Als der Gaukler, brennende Fackeln jonglierend, über ein Seil getanzt war, hatte der junge Gahadh ihn bewundert wie nie zuvor einen Menschen. Noch tagelang hatte er das Lied von Freiheit und wilden Nächten gesummt, das der Gaukler gespielt und gesungen hatte. Er hatte es so lange gesummt, bis sein Vater ihn dafür verdroschen hatte, und dann hatte er monatelang davon geträumt, sich den Gauklern anzuschließen, wenn sie wiederkehrten, von ihrer Freiheit und den wilden Nächten. Doch sie waren nicht wiedergekehrt.
Der Mann da oben war dünner, seine Haare waren länger, und der Hut hatte eine breitere Krempe, aber Gahadh blieb bei seinem Vergleich. Das Gesicht konnte er nicht genau erkennen, doch es schien zu lächeln.
»Guter Mann, ich bin gestürzt«, rief er hinauf. »Könntest du mir ein Seil herunterwerfen?«
»Sicher«, antwortete der Gaukler freundlich und schwang auch das zweite Bein über die Brüstung. Er war barfuß.
»Danke.« Gahadh wartete.
Der Gaukler ließ die Beine baumeln und pfiff eine einfache Melodie. Einen Moment dachte Gahadh, es sei das Lied des anderen Gauklers, doch dann erkannte er ein Schlaflied aus seiner Kindheit. In Gedanken sang er die erste Strophe mit.
Schlaf, du Kinde, träume gut,
deine Mutter schenkt dir Mut,
Vater schlägt den Lindenwurm,
und die Hex verschlingt der Sturm.
Als der Gaukler sich danach immer noch nicht anschickte, das Seil herunterzuwerfen, fragte Gahadh: »Könntest du es auch jetzt tun?«
»Klar könnte ich.« Noch immer klang die Stimme freundlich, fast fröhlich. Aber der Gaukler blieb sitzen, holte eine Handvoll Münzen aus der Tasche und jonglierte mit ihnen.
Hält der dämliche Kerl sich für witzig?, dachte Gahadh. Der alte Zorn kochte in ihm hoch, doch er beherrschte sich. Er brauchte ihn, um hier herauszukommen, und so fragte er nur: »Tust du es auch?«
Der Gaukler, der Gahadh immer deutlicher an den aus seiner Kindheit erinnerte, fischte alle Münzen aus der Luft. »Kommt darauf an, was du mir dafür gibst.«
»Was?«, entfuhr es Gahadh.
»Genau, das: was. Was gibst du mir dafür?« Der Gaukler kicherte. »Ich habe ein Seil, du willst es. Also?«
Gahadh wollte aufbrausen, der Schmerz im Knöchel wuchs und wuchs, aber er riss sich zusammen. Sollte der Kerl doch seinen Spaß mit ihm haben, er wollte nur raus aus dem elenden Loch. »Ich kauf dir das Seil ab, wenn du willst. Und lade dich zum Dank auf einen Wein ein.«
»Wein?«, fragte der Gaukler gedehnt. »Einen ganzen Krug oder nur einen Becher?«
»Sauf, so viel du willst; ich bezahle. Nur hol mich hier raus!«
»Für ein bisschen Wein, ja?«, spottete er. »Das ist dir dein Leben also wert?«
»Was? Nein. Wieso mein Leben?«
»Wieso? Wieso wieso? Ohne mich steckst du hier fest, oder? Auch wenn wir über ein Seil reden, eigentlich verhandeln wir über dein Leben, oder nicht?« Er sprach wie ein Händler, der seinen Kunden auf die Einzigartigkeit einer bestimmten Ware hinwies. Spott und Fröhlichkeit waren verflogen.
»Ich habe nichts, verdammt!«, fuhr Gahadh auf. »Du kannst meine ewige Dankbarkeit haben, aber sonst habe ich nichts! Verstehst du? Wäre ich reich, wäre ich doch nicht hier.«
»Ich habe reiche Männer und Frauen schon an den seltsamsten Orten getroffen. Also?«
»Es kostet dich doch nichts, mir ein Seil runterzuwerfen! Was hättest du davon, wenn ich hier verrecke?«
»Vermutlich nichts. Doch die eigentliche Frage lautet: Was hättest du davon?«
Das war der Moment, in dem Gahadh begriff, dass der Kerl ihn ohne Gewissensbisse seinem Schicksal überlassen würde. »Ich … Meinen Dolch, du kannst meinen Dolch haben«, sagte er schnell. Es war das Erste, das ihm einfiel; das Wichtigste, das er bei sich trug. »Es ist ein Erbstück.«
»Ein Erbstück, soso.« Der Gaukler lächelte wieder. »Wir kommen der Sache näher.«
»Näher? Aber ich habe sonst nichts!«
»Bist du dir sicher?«
»Ja!«, stieß Gahadh hervor. »Und wenn du mir nicht glaubst, komm mit in meine Bleibe und such dir etwas aus. Egal, was!«
»Egal, was?«
»Ja.«
»Auch wenn es nicht in deiner Bleibe ist?«
»Ja!«
»Gut. Dann möchte ich dein erstgeborenes Kind. Ob Sohn oder Tochter, ist mir egal, ich mach da keine Unterschiede so wie andere.«
Gahadh verschlug es die Sprache. Er hatte kein Kind, Myniam war im Kindbett gestorben, das Kleine hatte keinen einzigen Atemzug getan. Wenn Gahadh davon träumte, träumte er von Unmengen roten Bluts, während alles andere immer grau blieb. Sollte er irgendwann einmal tatsächlich Vater werden, dann …
»Nein.«
»Wie bitte?«
»Nein!«
»Bist du sicher?«
»Natürlich! Was bildest du dir ein? Wer bist du?«
»Ich bin der mit dem Seil.« Der Gaukler schwang pfeifend die Beine aus dem Schacht, stand auf und trat zurück. Verschwand aus Gahadhs Blickfeld.
»He! Wohin gehst du?«, rief Gahadh. »Es muss doch etwas anderes geben! Schätze, die ich noch finde, oder meine Dienste als Söldner. Was?«
»Ich komme morgen wieder. Vielleicht hast du es dir bis dahin überlegt.«
»He!«, rief Gahadh noch einmal, doch es kam keine Antwort mehr. Er war wieder allein, der Gaukler war weg.
Wie damals in der Kindheit.
3
Noch eine ganze Weile starrte Gahadh hinauf, doch der Gaukler kehrte nicht zurück.
Elender Schwachkopf, dachte er und meinte sich selbst. Hättest du es ihm doch einfach versprochen. Du hast doch gar kein Kind.
Aber er wusste, dass es ihm damit nicht ernst war. Einen solchen Handel ging man nicht ein, niemals. Welcher Mensch forderte schon ungeborene Kinder? Noch konnte er sich vielleicht herausgraben. Noch konnte jemand anders kommen, der bereitwilliger half.
»Verdammte Hexerei«, brummte Gahadh, denn daran dachte er bei ungeborenen Kindern, und kroch zurück in den verschütteten Gang. Sein Knöchel pochte und stach; er war längst so dick geschwollen, dass Gahadh ihn nicht aus dem Schuh bekam, um ihn zu kühlen. Womit auch? Das wenige Wasser, das er besaß, brauchte er zum Trinken. Hier unter der Erde war es nicht ganz so heiß wie draußen, doch es hatte seit Wochen nicht geregnet, und der Sommer nahte.
Gahadh kroch über den knochenübersäten Boden zurück, und plötzlich fiel ihm auf, dass er nirgends einen Schädel sah, weder einen menschlichen noch einen von einem Tier. Mühsam richtete er sich auf und leuchtete mit der Fackel in alle Richtungen, ohne auch nur einen einzigen Schädel zu entdecken, nicht einmal den einer Maus oder eines kleinen Vogels.
Was hatte das zu bedeuten?
Hatte hier irgendwer lauter kopflose Leichen hinabgeworfen? Aber wozu? Oder hatte jemand die Köpfe später fortgeschafft? Hatte irgendwer sie gefressen und mitsamt den Knochen verdaut? Oder waren die Schädel zu unkenntlichem Staub zermahlen?
Alles Unsinn, dachte er, aber die Feststellung gefiel ihm nicht. Er steckte die Fackel zurück in die Halterung und löste den nächsten Stein aus dem Geröllhaufen. Mit Schwung warf er ihn in den Schacht hinaus und packte sofort den nächsten. Er musste den Gang freischaufeln, anders kam er hier nicht heraus.
Stein um Stein schleuderte er in den Schacht, aber es fanden sich nur immer neue Brocken, zerbrochene Ziegel und schwarze Erde; ein Ende war nicht auszumachen. Was, wenn der ganze Gang bis zum Tempel zugeschüttet war? Oder auch nur der halbe? So weit würde er es nie schaffen.
Wo sind die Schädel?
Einen kurzen Moment dachte er, er könnte mit all dem Geröll an der Schachtwand eine grobe Treppe aufschütten und über sie hinausklettern, aber natürlich war das Unsinn. Sie würde hundertmal einstürzen, bevor sie fertig wäre, und sowieso würde das viel zu lange dauern.
»Warum?«, brüllte er. »Ihr Götter, warum?«
Und damit meinte er alles zusammen. Warum hatte er den Wurfanker nicht eingesteckt? Warum war der Gang verschüttet? Warum war das elende Seil gerissen? Warum hatte nicht jemand mit klarem Verstand ihn schreien gehört, sondern der Gaukler?
»He!«, schrie er wieder. »Hallo?«
Nichts geschah.
Er dachte an den Gaukler und grub und grub und grub, bis seine Hände steif waren und jedes Stückchen Haut von Blut oder Schmutz bedeckt. Er grub mit steifen Fingern und zitternden Armen, bis er sie einfach nicht mehr heben konnte. Und noch immer war an ein Durchkommen nicht zu denken.
Die Sonne war untergegangen, der obere Schachtrand lag nun im Dunkeln, und das Licht der Fackel reichte nicht bis hinauf.
Leise löste Gahadh noch einen Stein aus dem Geröll, so leise wie möglich, denn in der Dunkelheit erwachten in Ycena Kreaturen, deren Aufmerksamkeit er nicht erregen wollte. Er konnte nur hoffen, dass sie sich woanders herumtrieben, dass sie ihn hier unten nicht entdecken würden – so wie niemand ihn entdeckte.
Den nächsten Brocken konnte er nicht mehr halten, er rutschte ihm aus den zitternden Händen und rollte einfach zu Boden. Dann erlosch die Fackel, und um Gahadh herrschte völlige Finsternis.
Erschöpft legte er sich hin, die Hände zitterten noch immer, der Mund war ausgedörrt. Er hatte nicht mehr genug Speichel, um den Staub von der Zunge zu spucken, aber den letzten Schluck im Wasserschlauch wollte er bis zum nächsten Morgen aufheben. Ausgelaugt tastete er nach dem Rucksack und bettete den Kopf darauf. Trotz seiner Schmerzen und obwohl er um die Kreaturen dort draußen wusste, schlief er beinahe sofort ein.
Er träumte von einem granitgrauen Lindwurm, dessen flackernder Schatten die Köpfe toter Menschen fraß. Auf seinem Rücken saß der Gaukler mit Gahadhs blutigem, totgeborenem Kind im Arm. Das Kind schrie und schrie, bis der Gaukler es lächelnd mit Wein aus einem riesigen Schlauch fütterte und gurrte: »Ruhig, Kleiner, ganz ruhig, dein Vater zahlt, er zahlt alles, was wir zu uns nehmen.« Knirschend knackte der Schatten des Lindwurms weitere Schädel, auch den von Gahadhs verstorbener Frau. Und Gahadh lag hilflos da und konnte nichts tun, denn er vermochte sich nicht zu rühren. Knochenstaub rieselte auf ihn herunter, das tote Kind rülpste und soff weiter, der Gaukler pfiff das Lied von Freiheit und wilden Nächten.
Zitternd erwachte Gahadh in der Dunkelheit, etwas Kleines kroch ihm übers Gesicht, größer als eine Fliege, vielleicht einer der zahlreichen Nachtsalamander, und er wischte es keuchend und fluchend fort.
»Nur ein Tier«, beruhigte er sich. Er sprach es aus, um sich in der Schwärze selbst zu hören, aber seine Zunge war so schwer und trocken, dass er sich nicht verstand. Die Luft schmeckte nach Staub.
Er tastete nach dem Wasserschlauch und nahm einen winzigen Schluck. Er dachte an das totgeborene Kind und Myniam und daran, dass er zuerst nicht begriffen hatte, dass das Blut ihres war, nicht das des Kindes. Er erinnerte sich, wie sie vor seinen Augen gestorben war, weinend und schreiend, weil ihr Kind tot war, weil nichts bleiben würde von ihr, und der Schmerz wallte mit solcher Heftigkeit in ihm auf, als sei das alles eben erst geschehen. Warum plagten ihn die Götter jetzt damit? War es nicht genug, ihn in ein Loch zu stürzen?
Er robbte in den Schacht hinaus, um zu sehen, ob die Sonne schon aufgegangen war, aber es herrschte Dunkelheit. Aufmerksam lauschte er in die Stille der Nacht, hörte jedoch nichts. Zu rufen wagte er nicht.
Entschlossen kroch er zurück, packte den Dolch und arbeitete im Dunkeln weiter. Schlafen wollte er nicht mehr, Schmerz und Müdigkeit waren weniger schlimm als seine Träume.
Er sehnte sich nach Wein.
Stein um Stein löste er aus dem Haufen und ließ die Brocken möglichst behutsam zu Boden gleiten, um so wenige Geräusche wie möglich zu machen. Er musste es allein schaffen. Er arbeitete wie in Trance, seine Gedanken kreisten.
Wo waren die verdammten Schädel?
Und wer war der Gaukler? Praktizierte er geächtete Hexerei, wie sie früher ausgeübt worden war? Hexerei wie die, die zum Ende des Kaiserreichs geführt hatte? Oder war er gar kein Mensch, sondern ein Geistwesen, ein Gott oder doch nur eine Einbildung? In Ycena, der hexereiverseuchten Ruinenstadt, war alles möglich. Vielleicht war er auch bloß ein gewöhnlicher Menschenhändler und wollte das Kind einfach weiterverkaufen?
Ein Kind, das es überhaupt nicht gibt!
Der Knöchel schmerzte bei jeder Bewegung mehr.
Gahadh wollte nicht hier unten zugrunde gehen, nicht unbestattet zwischen all den anderen Knochen zerfallen, bis niemand ihn mehr erkennen würde. Er wollte überhaupt nicht sterben, sondern leben.
Leben!
Doch das Geröll wollte kein Ende nehmen.
Gahadh ertappte sich dabei, dass er auf die Ankunft des Gauklers wartete. Natürlich war es verwerflich, sein erstgeborenes Kind zu verkaufen, aber er hatte doch überhaupt keines. Wen wollte er schützen? Warum sollte er für ein Kind sterben, das es überhaupt nicht gab?
Wer hatte etwas davon, wenn er hier verreckte? Wenn ihm die Bestattung verweigert wurde wie einem gehenkten Mörder?
Schmerz und Erschöpfung ließen ihn nicht klar denken, die Dunkelheit und die stickige Luft fraßen an ihm, er wollte nur noch hinaus und leben.
Leben! Immer wieder dachte er: Leben!, während er grub und grub.
Das tote Kind konnte nicht gemeint sein, und was interessierten den Gaukler seine Nachkommen? Gahadh war weder Fürst noch König, er war ein Niemand, über dessen Blutlinie sich niemand Gedanken machte.
Er hatte ja nicht einmal eine Frau, obwohl er fast dreißig Jahre zählte. Seit Myniam hatte es keine mehr mit ihm ausgehalten und er mit keiner. Nie wieder hatte er für irgendwen auch nur annähernd das empfunden, was er für sie empfunden hatte. Bis gestern hatte er nicht daran gedacht, Vater zu werden, und jetzt wollte er sich für ein Kind opfern, das es nicht gab. Warum?
Es ist eine Prüfung, dachte er plötzlich, die Götter wollen mich prüfen, ob ich standhaft bleibe. Aber warum sollten sie gerade ihn für diese Prüfung auswählen? Viel eher war der Gaukler ein Drecksack, der sich einen Scherz auf seine Kosten erlaubte. Es war bedeutend wahrscheinlicher, einem Drecksack zu begegnen als einem Gott.
Gahadh wühlte sich weiter und weiter, dachte an die Frauen, die er nicht geheiratet hatte, und sagte sich, er könne gut ohne Frau auskommen, wenn er nur weiterleben dürfe.
Keine Hochzeit, keine Kinder. Er würde nur noch zu Prostituierten gehen. Sollte eine von ihnen schwanger werden und das Kind tatsächlich austragen, würde niemand wissen, wer der Vater war. Ein solches Kind würde niemand anerkennen, auch Gahadh nicht, ein solches Kind war immer vaterlos, das konnte der Gaukler sich nicht holen. Nicht, wenn er Gahadhs Kind wollte.
Was, wenn er mittels Hexerei doch den Vater erkennen könnte?, flüsterte eine Stimme in ihm. Wenn es ihm allein um Abstammung und nicht um Anerkennung geht? Schnell unterdrückte er die Frage. Der Dolch rutschte ab, und Gahadh quetschte sich den Daumen der rechten Hand.
»Verflucht«, krächzte er und ließ den Dolch fallen. Stöhnend hob er ihn wieder auf und kämpfte weiter. Wenn er es durch das Geröll hindurch schaffte, bevor der Gaukler kam, war alles gut, dann musste er seinen ungeborenen Erstgeborenen nicht verraten.
Innerlich zerrissen grub er weiter. Irgendwann ging die Sonne auf und verdrängte die Finsternis aus dem Schacht. Auch in den Quergang fiel eine Ahnung von Licht. Die Kreaturen hatten ihn nicht gefunden.
Der neue Tag war gekommen, doch der Gaukler ließ sich nicht sehen.
»Hallo!«, krächzte Gahadh, dann trank er gierig den letzten Schluck Wasser. Seine Hände zitterten so stark, dass er ihn beinahe verschüttet hätte.
Tief holte er Luft und schrie, so laut er konnte, denn oft würde er das ohne Wasser nicht mehr können. Und diesmal schrie er: »Hilfe!«
Der Schrei endete in einem Krächzen, und wieder kam keine Antwort.
Draußen wurde es heller und heller, doch unten blieb es dunkel, wenn auch nicht völlig finster. Gahadh kroch zurück und grub, bis er zusammenbrach.
Mit letzter Kraft schleppte er sich in den Schacht vor, wo er sich auf den Rücken legte und in den Kreis Helligkeit sah, der den Ausgang aus dem Schacht markierte. Das Licht tat gut, und trotzdem schloss er die Augen. Nur für einen Moment – oder zwei.
Dann dämmerte er weg.
4
Als Gahadh die Augen wieder öffnete, saß der Gaukler auf der Brüstung, jonglierte mit Münzen und rief fröhlich: »Und, hast du dich entschieden?«
Gahadh, der wieder von Myniam und der Totgeburt geträumt hatte, fragte: »Meinst du das Kind, das nie gelebt hat? Das nie einen Namen bekommen hat?« Er sprach leise.
»Nein. Was sollte ich mit ihm?« Er fragte nicht, von welchem Kind Gahadh redete, er wusste es ganz selbstverständlich, so als wüsste er von allem auf der Welt, so wie er gewusst hatte, wo Gahadh zu finden war.
Gahadh dagegen wusste nur noch, dass er leben wollte. Dass er hier raus wollte und die Schmerzen enden sollten. Alles andere war unwichtig geworden. »Was hast du mit dem Kind vor?«
»Mich um es kümmern«, sagte der Gaukler leichthin. Im Gegenlicht konnte Gahadh sein Gesicht auch jetzt nicht richtig erkennen. »Ihm zu seinem Platz in der Welt verhelfen, ganz so, als wär’s mein eigenes. Was sonst tut man mit Kindern?«
Gahadh nickte. »Aber was, wenn ich nie Vater werde? Was schulde ich dir dann?«
»Das Kind oder nichts, so lautet der Handel. Natürlich kannst du mir in jedem Fall einen Wein spendieren, wenn du magst.« Der Gaukler lachte.
Gahadh schnaubte und zögerte noch immer mit der Antwort. »Wirklich nur das Kind?«
»Ja. Dann ist es also abgemacht?«
»Was?«
»Ich werfe dir das Seil hinunter, und du überlässt mir dein erstgeborenes Kind.«
»Wirst du es herumerzählen, dass ich mein Kind verkauft habe?« Gahadh wollte das nicht, er schämte sich dafür, dass er auf den Handel einging, aber er würde es tun. Er wollte nur noch ein wenig so tun, als überlege er gründlich, als verhandle er, bevor er das Ja letztlich laut aussprach. Er konnte einfach nicht anders, er wollte leben.
»Herumerzählen? Wo denn?«
»In der Siedlung oder sonst wo in den Königreichen.«
»Weshalb sollte ich das tun? Ich glaube nicht, dass ich in der Geschichte besser wegkomme als du. Oder?«
Gahadh nickte. Er war nicht sicher, aber er wollte es glauben. Er war zu erschöpft, um klar zu denken. Irgendetwas an dem Handel war faul, aber er wusste nicht, was.
»Und?«, drängte der Gaukler.
Ich verkaufe mein Kind, das ist hier faul, dachte Gahadh bitter. Und dann wieder: Nein, ich habe doch gar kein Kind! Aber da war noch etwas, etwas anderes, etwas ganz Banales. Er musste nachdenken und Zeit gewinnen. »Wie heißt du eigentlich?«
»Hast du das schon wieder vergessen?« Der Gaukler klang amüsiert.
Hatte er? Er konnte sich nicht erinnern. Die Dunkelheit, die Müdigkeit, die Schmerzen, die Albträume, die Luft hier unten, das alles machte das Denken zäh.
»Was ist jetzt? Soll ich das Seil hinunterwerfen?«
Gahadh seufzte, er konnte nicht mehr. Es würde sonst niemand kommen, um ihn zu retten. »Also gut, abgemacht.«
Einen Augenblick später hing das Ende eines Seils in den Schacht hinab. Gahadh ließ alles liegen, den Rucksack und den leeren Wasserschlauch, er würde es später holen. Nur den Dolch steckte er in den Gürtel. Er packte das Seil, doch er konnte sich nicht hinaufziehen, die Hände wollten nicht mehr, die Finger waren ohne Kraft, die Haut hing in Fetzen, die Wunden brannten. Der rechte Fuß war ein einziger Klumpen dumpfen Schmerzes.
»Kannst du mich hochziehen?«
»Du wolltest ein Seil«, erinnerte ihn der Gaukler fröhlich. »Ein Seil für dein Kind, das war der Handel. Du musst lernen, genau auf die Worte zu achten.«
»Was?«
»Gestern wäre das Seil hilfreicher gewesen, was? Als deine Hände noch greifen konnten.« Der Gaukler kicherte. »Manchmal ist es auch wichtig, bei einem Handel nicht zu zögern.«
»Verreck, du Drecksack!«, krächzte Gahadh. »Verreck doch!«
»Ich glaube, du verwechselst, in welcher Lage wir jeweils sind.« Der Gaukler blickte noch einmal über den Rand, sein Gesicht lag wieder im Schatten.
»Bitte«, sagte Gahadh, »zieh mich hoch.«
»Das war nicht abgemacht.«
»Aber es war so gemeint! Das weißt du.«
»Mhm.«
»Du hast doch, was du willst! Also zieh mich hoch.«
»Kann ich nicht machen.« Er klang fast bedauernd. »Ich halte mich immer an eine Abmachung – zum Guten wie zum Schlechten. Aber ich will nicht so sein. Da. Damit du zu Kräften kommst.« Nachlässig warf er einen Apfel hinunter und verschwand.
Der Apfel zerplatzte auf dem Boden.
»Was?«, schrie Gahadh ihm hinterher. »Und wozu dann der ganze Handel, wenn du mich doch verrecken lässt? Wie soll ich hier unten ein Kind zeugen?«
War es letztlich doch kein Handel gewesen, sondern eine Prüfung der Götter, wie rechtschaffen er war? Oder ein einziger langer böser Scherz?
Der Kopf des Gauklers erschien wieder. »Wieso zeugen? Bist du dir sicher, dass du das nicht längst getan hast? Hast dich doch genug herumgetrieben. Ist es so schwer, sich vorzustellen, dass die Mutter dir einfach nichts gesagt hat?«
Gahadh erstarrte. Er war Vater?
»Hier«, rief der Gaukler noch und schnippte eine Münze hinunter. »Falls der Apfel nicht reicht, um zu Kräften zu kommen, iss das. Ich bestell der Mutter Grüße von dir.« Und damit verschwand er endgültig.
Vater, dachte Gahadh, noch immer völlig gefangen. Die Münze schlug vor ihm auf den Boden, sprang hoch, drehte sich und blieb vor seinen Füßen liegen. Er erkannte einen Drachmon, wie man ihn Toten für den Fährmann ins Jenseits unter die Zunge legte. Sein Obolus für die Überfahrt. Er fasste ihn nicht an, als wäre die Münze verhext.
Der Gedanke an seinen Tod riss ihn aus der Erstarrung. Was hatte er getan?
Voller Angst und Zorn packte er das Seil und versuchte zu klettern, aber er konnte nicht, sein zitternder Griff war zu schwach, er rutschte sofort wieder ab und landete auf dem gebrochenen Fuß. Stechender Schmerz jagte sein Bein hinauf, aber Gahadh blieb stehen. Er hielt sich am Seil, er würde nicht fallen. Er fluchte und tobte, alle dumpfen Überlegungen der Nacht waren hinfällig, wenn er doch Vater war.
Aber das habe ich nicht gewusst!
Und was nützte das? Er wusste, dass es ein Frevel war.
Aber nicht, dass ich Vater bin!
Wer sagte das?
Er! Er hat es gesagt!
Und er wusste alles.
Aber wer war die Mutter? Warum hatte sie ihm nichts erzählt? Das hätte doch alles geändert!
Vielleicht warst du schon gar nicht mehr in der Stadt, als sie es festgestellt hat? Du bist doch ständig weitergezogen!
Warum?
Oder hatte der Gaukler ihn doch belogen, den Scherz gnadenlos auf die Spitze getrieben?
Gahadh glaubte weder an einen Scherz noch eine göttliche Prüfung, das war so grausam, dass es die Wahrheit sein musste. So etwas dachte sich niemand aus!
Er musste den Gaukler aufhalten, bevor der sein Kind erreichte. Hastig sammelte er die Apfelbrocken auf und aß sie mit allem Staub. Er brauchte die Kraft, er musste hinauf. Er musste leben und den Kerl aufhalten.
Hastig schnitt er sich Stoff vom Hemd und umwickelte die offenen Hände. Er würde nur einen Versuch haben.
Dann wand er sich das Seil um die rechte Hand, damit er, wenn er abrutschte, nicht sofort fiel. Er atmete durch und kletterte. Keuchend kämpfte er sich hinauf, angetrieben vom Zorn, der ihn auch ein Jahrzehnt durch alle Kämpfe getragen hatte. Angetrieben von einer Angst, die neu war. Er durfte nicht scheitern. Er würde dem falschen Gaukler das Messer ins Herz stoßen, wenn er denn eines besaß.
Schritt um Schritt kämpfte er sich voran, mehrmals wäre er fast abgerutscht und fing sich wieder. Das Seil schnitt ihm ins Handgelenk, die Stofffetzen sogen sich voll mit Blut, der letzte Fetzen Haut löste sich vom Fleisch, aber er gab nicht auf.
Warum hat sie nichts gesagt?
Mit wem habe ich ein Kind?
Einen Jungen oder ein Mädchen?
Arme und Beine zitterten, sie wollten ihm nicht mehr gehorchen, und doch zwang er sie weiter. Weiter, nur weiter. Der Verband um die linke Hand löste sich, blieb aber im Blut kleben. Dann rutschte er doch.
Weiter, dachte Gahadh verzweifelt, und: Ich bring ihn um.
Zitternd und blutend erreichte er die Brüstung. Er streckte die Hände aus und hielt sich fest. Langsam zog er sich hoch, aber dann durchzuckte ihn ein stechender Schmerz, und er konnte nicht mehr. Die Hände wollten ihn einfach nicht mehr halten, sosehr er es auch versuchte, sosehr er es ihnen befahl, sie waren nur noch schmerzende Klumpen Fleisch, die Finger gekrümmt und steif. Sie rutschten ab, kraftlos und verkrampft, zerschunden und blutend, und Gahadh konnte sich nicht halten.
»Nein!«, schrie er, und beinahe hätte er lachen können über den Unsinn, dass er jetzt schon zum zweiten Mal in den Schacht stürzte, aber er lachte nicht.
Hart schlug er unten auf. Knochen brachen, Haut riss, und Blut quoll auf die Gebeine ringsum. Neuer Schmerz durchfuhr ihn, aber nur für einen Augenblick, dann versank Gahadh in Dunkelheit. Sein letzter Gedanke galt dem Gaukler, der kein Gaukler war und ihm nie seinen Namen genannt hatte. Den er nicht daran hindern würde, sein Kind zu holen, wie es auch immer heißen mochte. Den er nicht einholen würde.
Es tut mir leid, dachte er, und dann dachte er nichts mehr.
Der Bastard des Königs
1
Noch war der Sommer nicht gekommen, doch es war schon unerträglich heiß. Das ganze Frühjahr hindurch hatte es kaum geregnet, und seit vier Wochen zeigte sich nicht die kleinste Wolke am Himmel. Bereits am frühen Morgen flirrte die Luft über den ausgedörrten Wiesen. Die gepflasterten Straßen waren ebenso staubig wie die festgestampften Wege, durch die sich Risse zogen. Überall verkümmerten die angebauten Pflanzen, das Getreide ebenso wie das Gemüse. Sträucher und Bäume trugen nur wenige Früchte, selbst in Lathien, dem fruchtbarsten der dreizehn Königreiche. Käme jetzt endlich der Regen, wäre die zweite Ernte des Jahres noch zu retten, doch jeden Morgen war der Himmel aufs Neue klar und hell.
Auch das vergangene Jahr war ein mageres gewesen, die Speicher waren entsprechend leer, und schon begann der Hunger an den ersten Menschen zu nagen. An denen, die noch zu essen hatten, nagte die Angst. Die einen flehten zu den Göttern, die anderen verfluchten sie, und manch einer machte sich auf die Suche nach einer verborgenen Hexe, der er die Schuld an allem geben konnte.
Doch vergebens, denn Hexerei war seit dem Untergang des alten Kaiserreichs selten geworden und verpönt, und wenn es noch Hexen gab, hielten sie sich bedeckt.
Das Vieh wurde hager, die wilden Tiere wagemutiger. Fett und zahlreich waren nur die Fliegen, die schwarz-grün schillernd überall herumkrochen, summten und brummten.
Tief im Süden vertrockneten zahlreiche Brunnen, und verzweifelte Männer und Frauen schlossen sich zu Räuberbanden zusammen oder wanderten in die Städte ab, wo die meisten sich bettelnd durchschlugen und die Glücklicheren eine einfache Arbeit annahmen, deren Lohn gerade für die täglichen Mahlzeiten und nur manchmal für eine billige Unterkunft reichte. Viele schliefen im Freien, ein Auge stets offen und die Hand am Messer.
Hart traf es auch die Menschen in der fruchtbaren Ebene östlich des Wilden Walds, die als Kornkammer der Kriege bekannt war. Hier erstreckten sich in alle Richtungen Felder, auf denen Jahr um Jahr Hirse, Weizen und Gerste angebaut wurden, und große Mühlen säumten in kurzen Abständen das Ufer des ruhig fließenden Vardoy. Zwei Dutzend Mühlen waren es, die wie Soldaten in Reih und Glied standen und fast wie eine Einheit wirkten. Jede arbeitete für sich, und jede arbeitete für den König.
Hier wurde das Mehl für die Brote des königlichen Heeres gemahlen, und hier gedieh die Hirse für den Brei der Soldaten. Weil König Tiban von Lathien keine hungernden Soldaten gebrauchen konnte, verlangte er die gleiche Menge an Getreide wie in fruchtbaren Jahren, und so blieb den Bauern und Müllern nur wenig von dem, was sie ernteten und verarbeiteten. Zu wenig, um den kommenden Winter zu überstehen.
Hier wie überall sonst in den dreizehn Königreichen rumorte es.
2
Obwohl der Müllergehilfe Ukalion im nächsten Monat gerade erst zwanzig Jahre alt werden würde, zollten ihm alle Gehilfen in der Krampmühle Respekt. Nicht, weil er der Sohn der Müllerin war, sondern weil er geschickt war, hilfsbereit und findig. Im Winter hatte er eine neue Aufhängung für das Mühlrad entwickelt, die Kanten der Zahnräder sorgfältig geschliffen und die Mahlsteine ausgetauscht. Nun war ihre Mühle die schnellste am Fluss und ihr Mehl das feinste, und so kamen die meisten Bauern zuerst hierher, um ihr Getreide mahlen zu lassen.
»Geh angeln, Bursche«, weckte ihn noch vor Sonnenaufgang der Müller Gajus Kramp, der Mann seiner Mutter. Gajus hatte keine eigenen Kinder mit ihr, dennoch nannte er Ukalion nie Sohn, und auch seinen Familiennamen durfte Ukalion nicht führen.
»Es ist noch dunkel.« Ukalion rieb sich über das Gesicht. Vor dem Fenster raunte der Vardoy, ansonsten herrschte Stille.
»Wenn es hell ist, brauche ich dich in der Mühle. Also los.«
Ukalion kroch aus dem Bett, wie der Müller es befohlen hatte. Tag für Tag ließ Gajus ihn schuften wie keinen seiner anderen Gehilfen, und Ukalion schuftete ausdauernd und klaglos. Seine Mutter sagte, das sei nur, damit die anderen nicht auf die Idee kämen, Gajus würde ihn als ihren Sohn bevorzugen.
Nein, auf die Idee käme keiner, dachte Ukalion und hieß sich glücklich, dass Gajus nicht sein leiblicher Vater war, denn wie hätte der erst seinen eigenen Sohn schinden müssen, hätte er denn einen gehabt?
Verschlafen schlüpfte Ukalion in die abgetragene Hose und stopfte sich in der Küche einen frischen Kanten Brot und ein kleines Stück Käse in den Mund. Dann ging er hinter die Mühle, um sich kaltes Flusswasser ins Gesicht zu spritzen. Am Himmel verblassten die letzten Sterne, der Mond war bereits untergegangen, und die ersten Vögel begannen zu singen. Irgendwo schrie ein früher Hahn, und ein Hund antwortete mit Gebell.
Ukalion sprang über das träge laufende Mühlrad hinweg und hockte sich auf die äußere Aufhängung, einen breiten steinernen Pfeiler im Fluss. So saß er noch ein Stück weiter im Wasser, und die schmackhaften Silberbarsche und Riesenelritzen kamen nur selten in Ufernähe. Er warf die Angel weit aus und sah sich verschlafen um.
Neben der gemauerten Anlegestelle rechts von ihm, nicht weit von der Mühle, dort, wo seine Mutter ihm schon früh das Schwimmen beigebracht hatte, wo er sich dann jeden Tag ins Wasser geworfen hatte und wo er mit einem schlichten, selbstgebauten Floß zu immer neuen Abenteuerfahrten aufgebrochen war, nahm er jetzt menschliche Schemen wahr, die am flachen Ufer Wasser aus dem Fluss holten; ausgelaugte Bauern, die verzweifelt versuchten, die Felder mithilfe von Eimern und Bottichen zu wässern, bevor die Sonne zu hoch am Himmel stand. Manche Felder waren zwei oder mehr Meilen entfernt und der Kampf gegen die Trockenheit nicht zu gewinnen.
Als die Sonne über den Horizont stieg und die Welt langsam in helles Licht tauchte, erkannte er viele der Bauern und winkte ihnen knapp zu. Sie grüßten zurück, und der einäugige Orinth Quins rief: »Beißen die Fische?«
»Nicht bei mir.«
»Kurz vor dem Verhungern, aber noch immer wählerisch, diese Fische.« Orinth lachte, so wie er über alles lachte, was er schwer ertragen konnte. Die lustigen Geschichten über sein verlorenes Auge waren so zahlreich, dass niemand mehr wusste, welche davon die Wahrheit war und wie Orinth sein Augenlicht wirklich eingebüßt hatte.
»Oder es gibt keine mehr, weil sie sich aus Verzweiflung selbst aufgefressen haben«, rief die Bäuerin Dagha Kellhen, ohne eine Miene zu verziehen, und wuchtete einen zweiten Eimer auf ihren klapprigen Handkarren. »Immer einer den nächsten und der letzte sich selbst.«
Orinth lachte, andere fielen ein.
»Sie werden schon noch beißen.« Ukalion sah wieder auf den Fluss hinaus, hinter ihm drehte sich scheppernd das Mühlrad. Der Wasserspiegel war niedriger, als er zu dieser Jahreszeit sein sollte. Nahe am jenseitigen Ufer, an dem sich die lichten Ausläufer des Wilden Walds erstreckten, trieben zwei Regenbogenschwäne flussabwärts. Sie reckten die Hälse, berührten einander mit den Schnäbeln und umkreisten einander wie im langsamen Tanz. Ihren Tanz zu sehen verhieß in den alten Geschichten stets Glück, aber was sollte nicht alles Glück bringen?
Ukalion blickte den Schwänen nach, während sie kleiner und kleiner wurden, und fühlte einen inneren Frieden. Anmutig drehten die Tiere sich umeinander, es schien, als bekämen sie von der Welt um sie herum nichts mit. Sonnenstrahlen glitzerten auf dem türkisfarbenen Wasser des Vardoy, und leichter Wind kam auf, er schmeckte nach Staub und Ferne. Die Fische bissen immer noch nicht, und die Regenbogenschwäne trieben auf den Blutfelsen zu, den Ukalion in der nächsten großen Biegung gerade noch ausmachen konnte.
Der Blutfelsen hatte seinen Namen aus dem letzten Jahrhundert, als eine junge betrogene Frau sich auf ihm die Adern aufgeschnitten und den Stein mit ihrem Blut getränkt hatte. Sie wurde gefunden, bevor sie starb, und gerettet. Ihre Mutter ermahnte sie, sie dürfe sich wegen so etwas nicht das Leben nehmen, doch sie stritt es ab, sagte, das habe sie gar nicht gewollt. Bei diesen Worten blickte sie zu Boden, und niemand glaubte ihr. Als am nächsten Tag ihr Mann mit zwei weiteren Männern in einem Boot nah am Felsen vorbeifuhr, kenterten sie plötzlich in den harmlosen Stromschnellen und stürzten aus dem Boot. Zwei fielen ins Wasser, doch der Ehemann schlug mit dem Kopf auf den Fels und verlor das Bewusstsein. Blut quoll aus einer tiefen Wunde und sickerte in zahlreiche Felsritzen, und als seine Begleiter sich endlich gegen die Strömung zu ihm gekämpft hatten, war er tot und bleich, wie ausgeblutet.
Die beiden Überlebenden, sein Bruder und ein Freund, stürmten ins Dorf zurück, nannten die junge Frau eine Hexe und richteten sie, auch wenn sie nun laut beteuerte, sie habe sich nur umbringen wollen.
»Dann tun wir das jetzt für dich, und du bekommst deinen Willen«, riefen die beiden Männer zornig, und das waren die letzten Worte, die die Frau hörte.
Binnen eines Jahres starben auch der Bruder und der Freund im Fluss, und seitdem machten sämtliche Boote einen großen Bogen um den Felsen. Doch unglückliche Frauen, die einen Mann verfluchen wollten, gingen bei Nacht dorthin, um dem Felsen ihr Blut zu schenken.
Als Kind war Ukalion einmal mit zwei Freunden auf dem Floß ganz nah an dem Felsen vorbeigefahren, um seinen Mut zu beweisen. Er war sicher, dass ihn noch keine Frau verflucht hatte und dass ihm nichts passieren konnte, aber als er stolz und strahlend nach Hause kam, drohte seine Mutter, genau das werde sie tun, wenn er noch einmal so einfältig sei, keinen Bogen um den Blutfelsen zu machen. Dann hatte sie ihn fest umarmt, und bei der Erinnerung daran musste er lächeln.
»Weißt du, warum die Bauern alle zu euch kommen?«, erklang plötzlich Priams kratzige Stimme hinter ihm. Sie erklang laut und riss ihn aus allen Gedanken.
Priam Windan gehörte die Mühle gleich nebenan. Sie war die erste am Fluss gewesen, und dank verschiedener Anbauten war sie noch immer die größte, weshalb Priam sich als etwas Besseres wähnte. Doch inzwischen war das Mühlrad alt, einige der schwarzen Schaufelbretter waren morsch und die Mauern verwittert.
»Sie kommen, weil wir gut arbeiten und niemanden betrügen«, erwiderte Ukalion, ohne sich umzudrehen. Er konnte die Schwäne noch immer sehen, wie sie tanzend am hohen Blutfelsen vorbeitrieben.
»Sagst du, ich betrüge?«
»Nein, ich sage nur, dass wir es nicht tun.« Ukalion drehte sich noch immer nicht um.
»Sie kommen nur, weil du ein Bastard des Königs bist. Königliches Blut, pah!« Priam spuckte vernehmbar aus. Er war selbst in guten Zeiten streitlustig. »Dein hochgeborener Vater brockt uns den ganzen Ärger ein, aber du und deine feine Mutter, ihr hungert nicht.«
In aller Ruhe zog Ukalion die Angel aus dem Fluss und legte sie ab. Der Wurm war vom Haken verschwunden. Oder hatte er in seiner Müdigkeit tatsächlich vergessen, einen aufzuspießen?
Langsam drehte er sich um. Er wusste, dass Priam die hohen Abgaben meinte, und trotzdem sagte er: »Der König hat große Macht, aber nicht über das Wetter. Wie soll er uns also das Wetter einbrocken?« Und ohne Priam Zeit für eine Antwort zu lassen, fuhr er fort: »Doch wolltest du eben meiner Mutter etwas unterstellen?«
»Nein, Volera ist eine feine Frau, äußerst fein, etwas anderes werde ich nie sagen.« Priam war ein gewaltiger Mann mit kleinen Ohren, dünnem grauem Haar und einer mehrfach gebrochenen Nase. Er hatte die mächtigen Arme verschränkt und lehnte lächelnd an der Krampmühle.
»Gut.«
»Wie könnte ich es auch anders sehen? Ein König hat schließlich einen exquisiten Geschmack. Auch bei seinen feinen – du weißt schon.« Er verstummte und grinste anzüglich. Die Hitze und die Angst vor dem Hunger schürte selbst bei Friedfertigeren die Lust auf Prügeleien, bei Priam also erst recht. Und jemandes Mutter zu beleidigen, wenn auch nur andeutungsweise, war immer ein guter Anfang, solange die Andeutungen von allen verstanden wurden. Dann war eine Andeutung manchmal sogar wirkungsvoller als eine direkte Beschimpfung wie Königshure.
Eine Handvoll Bauern an der Anlegestelle stellten ihre Eimer ab und sahen neugierig herüber. Der Wind flaute ab, der Geschmack von Staub hing weiter in der Luft.
Ukalion würde nicht einfach klein beigeben, schon gar nicht vor Zeugen und wenn es um seine Mutter ging. In aller Ruhe stieg er über das Mühlrad zurück. Er hatte die ständigen Sticheleien Priams endgültig satt. »Und was hat ein exquisiter Geschmack mit dir zu tun?«
»Willst du Prügel, Junge?« Priam stieß sich von der Wand ab und knackte mit den Fingern. Es waren die stets gleichen Drohgebärden, wahrscheinlich wurden sie überall auf der Welt verstanden. An den Fingern glänzten schwere Ringe aus Eisen, die Priam sicher nicht zum Arbeiten übergestreift hatte. Ein Treffer damit wäre schmerzhaft.
Dennoch fragte Ukalion: »Willst du, alter Mann?«
Der nächste Bauer setzte seinen Eimer ab und sah erwartungsvoll herüber. Hoch über ihnen kreisten hungrige Flusskrähen und krächzten.
»Komm her!« Priam ballte die Hände zu Fäusten und wartete grinsend auf Ukalion. Sein Gesicht leuchtete vor Vorfreude, und er tänzelte auf der Stelle.
In dem Moment trat Gajus aus der Mühle, rein zufällig oder weil er das laute Rufen gehört hatte. Er ignorierte Priam und bellte Ukalion an: »Wie viele Fische hast du, Bursche?«
»Fische?«
»Ja, Fische. Ich hab dich zum Angeln geschickt, falls du dich erinnerst.«
»Keinen«, gestand Ukalion.
»Was schwätzt du dann mit den Nachbarn? Wenn ich angeln sage, dann meine ich auch angeln!«
»Der Junge ist eben unfähig«, sagte Priam, ließ aber die Hände sinken. Die Vorfreude war aus seiner Miene verschwunden.
»Um mir das zu sagen, musst du nicht extra vorbeikommen«, knurrte Gajus. »Also, was willst du?«
»Mutter eine feine Frau nennen«, sagte Ukalion.
»Noch was?« Gajus ließ Priam nicht aus den Augen, sein Blick war stechend wie der eines Bussards.
Priam zögerte kurz, dann sagte er: »Nein.« Mit Gajus wollte er sich anscheinend nicht anlegen.
»Gut.«
»Wir sehen uns wieder.« Priam nickte Ukalion zu und ging.
»Unter Nachbarn ist das leider unvermeidlich«, erwiderte Ukalion.
Sobald Priam außer Hörweite war, fragte Gajus: »Was sollte das?«
»Nichts.«
»Wenn du es sagst.« Er kratzte sich am Ohr. »Und warum hast du nichts gefangen?«
»Weil die Fische nicht beißen.« Von dem fehlenden Wurm auf dem Haken erzählte er nichts.
»Dann geh rein und fette das Gewinde ein, der erste Bauer ist da.«
Ukalion gehorchte.
3
Auch wenn Ukalion es nicht wollte, lagen ihm Priams Vorwürfe schwer im Magen. Nicht die Andeutungen zum Verhalten seiner Mutter, für sie hätte er sich, ohne mit der Wimper zu zucken, geprügelt. Denn was hätte seine Mutter damals anderes tun sollen?
König Tiban, der das hiesige Kastell Weißwasser inspiziert hatte, um den Krieg mit dem südlichen Gybthan vorzubereiten, dem Reich der spitzen Türme, treppenreichen Pyramiden, palmblattkauenden Läufer und kriechenden Sanddrachen, hatte sie auf den Feldern arbeiten gesehen und zu sich befohlen als Gespielin für eine Woche. Sie hatte ihm gesagt, dass sie einem anderen fest versprochen war, dass der Tag der Hochzeit schon feststand, aber das hatte Tiban nicht interessiert. Der König nahm, was er wollte, auch wenn man es ihm nicht freiwillig gab.
Besonders dann, behaupteten manche, aber andere sagten, Lathien sei eben sein Reich, darin gehöre ihm alles. Seine Mutter hatte befürchtet, König Tiban würde Gajus einfach das Leben nehmen, wenn sie sich weiter weigerte, denn damit wäre die Hochzeit vom Tisch gewesen. Sie war nur zum König gegangen, damit nicht alles noch viel schlimmer endete, davon war Ukalion überzeugt. Er glaubte nicht an das Gerede, sie sei innerlich lachend und stolz gegangen und mit der Hoffnung, irgendwann Königin oder zumindest Hofdame zu werden, etwas Besseres als Müllerin eben, dafür war sie zu intelligent.
Nach der Woche war sie aufrecht, aber mit versteinerter Miene ins Dorf zurückgekehrt. Nie hatte sie über die Zeit beim König geredet, sosehr die Leute auch fragten und spekulierten. Die Hochzeit war verschoben worden, doch sie hatte stattgefunden. Gajus liebte sie so sehr, dass er sie noch immer gewollt hatte, obwohl er wusste, dass sie keine Jungfrau mehr war, und obwohl er wusste, dass das auch alle anderen wussten. Selbst als klar wurde, dass sie schwanger war, hielt er an der Hochzeit fest. Er blockte alles Gerede ab, und irgendwann ließ es nach wie auch die Spekulationen und Fragen der Leute, ihre abschätzigen Blicke und das Flüstern. Doch konnte Gajus nicht dagegen an, dass es ihn an manchen Tagen wütend machte, dass ein anderer seine Frau vor ihm gehabt hatte, noch dazu der König, den er nicht zur Rechenschaft ziehen konnte.
Noch viel mehr wurmte es ihn trotz seiner Liebe jedoch, dass seine Frau ihm durch diese Woche vielleicht das Leben gerettet hatte. Er wollte ihr für diese Woche im Bett des Königs nicht dankbar sein müssen.
Natürlich hatte er das alles nicht vor Ukalion zugegeben, aber Ukalion hatte es sich schon als Kind aus den Streitereien zwischen Gajus und seiner Mutter zusammenreimen können.
Für ihn selbst bedeutete die Geschichte, dass es zwei Männer gab, die sich weigerten, sein Vater zu sein, und die dennoch das Bild prägten, das alle von ihm hatten. Er war entweder der ungewollte Sohn der Ehefrau oder der Bastard, er war ein Mann ohne Familiennamen.
Nein, was Ukalion im Magen lag, waren Priams Vorwürfe, die Bauern kämen nur zu ihm, weil er ein Bastard des Königs sei. Nicht weil die Krampmühle gut und ehrlich arbeitete, eine Mühle, die er mit eigenen Ideen und harter Arbeit verbessert hatte, sondern nur wegen eines Vaters, für den er ein Nichts war und der sich um ihn einen Dreck scherte – so wenig wie um die einstige Gespielin. Dessen Unerbittlichkeit bei den Abgaben Ukalion und die Krampmühle ebenso traf wie alle anderen. Diesem Vater, den er selbst niemals Vater genannt hatte und der seine Mutter in sein Bett gezwungen hatte, wollte er nichts verdanken.
Also fragte er Samu Kellhen, den ersten Bauern des Tages, gleich nach der knappen Begrüßung: »Warum kommst du zu uns? Warum gehst du nicht zu Priam?«
Irritiert sah Samu ihn an. »Was ist los? Willst du meine Lieferung nicht?«
Es roch nach Getreide, und überall schwirrten Fliegen. Ein streunender Hund sah zum offenen Tor herein und tappte dann weiter.
»Doch, natürlich. Ich will einfach nur wissen, warum du zu uns kommst.« Ukalion wuchtete den ersten Sack vom Wagen, um zu zeigen, dass er ihn ganz bestimmt annahm.
»Du willst, dass ich dir Honig ums Maul schmiere?«
»Nein, die Wahrheit.« Er stellte den Sack ab und sah den Bauern an.
»Also doch Honig.« Samu lachte und hieb ihm freundlich auf die Schulter, dann erschlug er eine Fliege. »Drecksviecher!« Er spuckte aus. »Du weißt selbst, dass ihr gut arbeitet, und ich weiß, dass ihr mich beim Messen nicht bescheißt. Außerdem ist da die Sache mit dem Wildern.«
Ukalion nickte. Dass er dem ganzen Dorf das Wildern ermöglichen konnte, verdankte er zwar der Tatsache, dass er der Bastard des Königs war, aber das war etwas anderes, weil das Wildern selbst sich gegen den König richtete.
»Schwätzt du schon wieder, statt zu arbeiten?«, knurrte Gajus, der eben die Mühle betreten hatte.
»Nein.« Rasch packte Ukalion den Sack, schleppte ihn die schmalen Stufen zum Trichter hinauf und schüttete die Körner hinein. Sie waren klein und fast gräulich in der Farbe, nicht so golden wie in guten Jahren. Knirschend malten die Steine die Körner zu Mehl, und Ukalion holte den nächsten Sack.
Sack um Sack schleppte er nach oben, Schweiß lief ihm herunter, und es juckte am ganzen Körper. Gajus stand unten und überwachte das herauskommende Mehl und ihn.
So wird es den ganzen Tag gehen, dachte er, doch dann hörte er, wie draußen sein Name gerufen wurde.
»Ja?«, antwortete er, und schon stürmte Mart herein, ein hochgeschossener blonder Bauernjunge von elf Jahren. Angst stand ihm im Gesicht, und er atmete schwer, obwohl er ein guter Läufer war; er musste den ganzen Weg vom Dorf hergerannt sein, fast eine Meile.
»Der Vogt …« Mehr brachte Mart nicht heraus, er stand vorgebeugt, die Hände auf die Knie gestützt.
»Ganz ruhig, Kleiner, verschluck dich nicht. Was ist mit dem Vogt?«
»Er … er …« Keuchend richtete Mart sich wieder auf. »Du musst sofort kommen … Er hat Ckarya mit einem Rehbock erwischt!«
Ukalions Herz krampfte sich zusammen. »Geht es ihr gut? Hat er ihr etwas getan?«
»Nein. Ja. Ja, nein.« Mart wirkte verwirrt. »Sie ist unverletzt, aber er hat sie gefangen genommen.«
»Gefangen?«
»Ja. Auf der Straße. Auf dem Weg nach Hause.«
Er packte den Jungen an der Schulter. »Hat sie gesagt, dass ich es war, der das Tier gejagt hat, und dass sie es nur für mich trägt?«
»Hat sie, aber der Vogt will sie trotzdem mitnehmen! Ich weiß nicht, wohin, zum Turm oder … Er hat gesagt, dass er die Lügen nicht mehr hören kann. Dass es Zeit wird, durchzugreifen.«
»Verflucht!« Natürlich wusste Vogt Farnoh, dass Ukalion den Rehbock nicht gejagt hatte, alle wussten das, aber bislang hatte diese Lüge Farnoh immer genügt. Seit der zweiten Reform des Jagdrechts durch König Tiban gehörten Rehe – so wie fast alle jagdbaren Tiere außer Kaninchen – zum Hochwild, das dem Adel vorbehalten war. Das Hochwild des Wilden Walds war sogar ausschließlich dem König, der königlichen Familie und dem für die Region verantwortlichen Beamten des Königs vorbehalten, dem Vogt.
Wie es sich mit Bastarden verhielt, war im Gesetz nicht geregelt. Auch wenn Ukalion keinerlei Anrecht auf den Thron oder irgendein anderes Erbe besaß, hatte ihn nie jemand dafür belangt, dass er eine Handvoll Tiere jagte, da niemand mit Bestimmtheit wusste, ob er in diesem Fall zur königlichen Familie gezählt wurde oder nicht. Eine Anklage hätte zu einer Gerichtsverhandlung geführt, die wiederum Ukalions Status und Stand genau feststellen musste, und das wollte niemand. Niemand am Hof wollte ihm irgendeinen Status einräumen, ebenso wenig aber wollte irgendein Richter einen Mann bestrafen, in dessen Adern königliches Blut floss. Wer wusste schon, wie der König das aufnahm oder was geschah, wenn er sich plötzlich doch entschloss, Ukalion offiziell anzuerkennen? Nichts deutete darauf hin, doch war es eine Möglichkeit, die jeder im Hinterkopf hatte.
Ukalion hatte sich diese Unsicherheit zunutze gemacht und jede Wilderei im Dorf auf sich genommen. Ihn ließ der Vogt in Ruhe, und die hungernden Bauern kamen so an frisches Fleisch.
Farnoh hatte das immer hingenommen, denn er wusste, dass die Bauern in mageren Jahren nur auf diese Weise genug zum Beißen bekamen, bedachte man die Höhe ihrer Abgaben. Das Fleisch hielt sie davon ab zu rebellieren, und der Wilde Wald beherbergte mehr Tiere, als der König je jagen konnte – selbst mit einer Hundertschaft an Jagdhelfern. Warum hatte Farnoh diese stillschweigende Übereinkunft aufgekündigt? Ausgerechnet jetzt, da es Ckarya traf.
»Ich muss ins Dorf!«, rief Ukalion Gajus zu.
»Ist das Wildern wieder wichtiger als deine Arbeit?«
»Ckarya ist es.«
»Soso«, knurrte Gajus. »Und warum stehst du dann hier noch faul herum? Geh!«
»Zeig’s dem Vogt«, sagte Samu, und die anderen Müllergehilfen nickten, auch wenn das mehr Arbeit für sie bedeutete. Alle mochten Ckarya, und alle waren froh, wenn es im Dorf Fleisch gab.
»Wo ist sie?«, fragte Ukalion und zog Mart zur Tür hinaus.
»Ich weiß es nicht, ich bin sofort losgelaufen.« Der Junge sah ihn unglücklich an, abgekämpft und schuldbewusst. Doch zugleich lag eine verzweifelte Hoffnung in seinem Blick.
»Schon gut. Ich finde sie.«
»Ich komme mit.«
»Dann lauf!«, rief Ukalion und rannte los. Wenn der Vogt durchgreifen wollte, musste er sich beeilen. »Aber ich warte unterwegs nicht.«
4
S