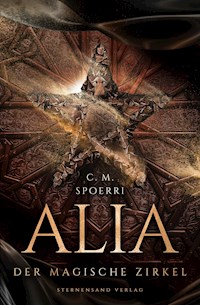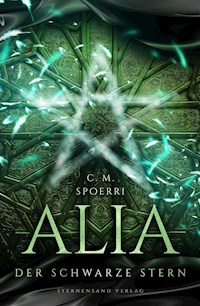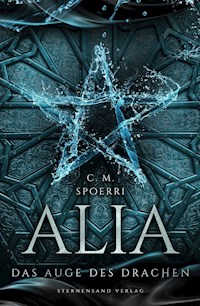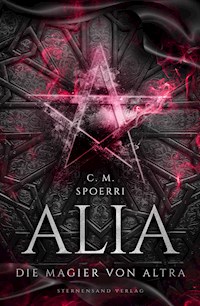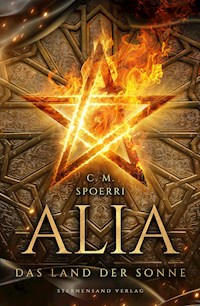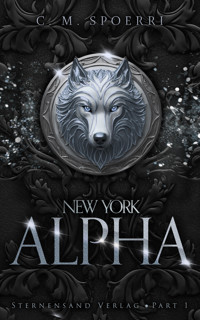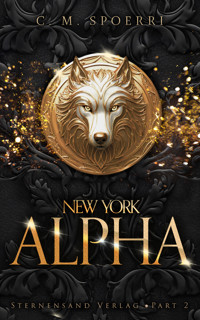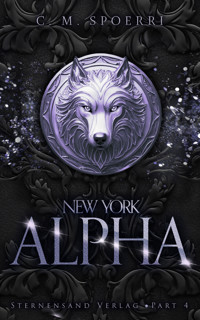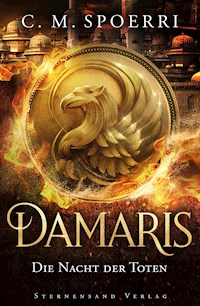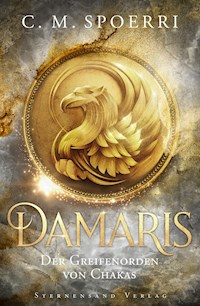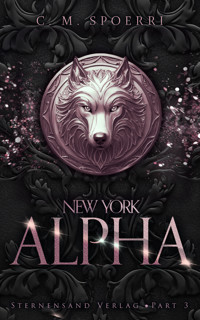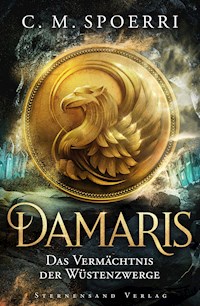Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sternensand Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Davyan
- Sprache: Deutsch
Davyan ist ein Nichts. Ein Niemand. Das hat er in den dreißig Jahren verinnerlicht, die er als Knecht auf dem Weingut seiner Stiefmutter Libella arbeitet. Missgeburt wird er genannt, da sein Äußeres viel langsamer altert als bei anderen Menschen. Libella und ihre beiden Söhne behandeln ihn wie Dreck, Prügel sind an der Tagesordnung. Und doch schafft er es nicht, ihnen den Rücken zu kehren. Denn sein Ziehvater ist seit Jahren bettlägerig und ohne Davyans seltsam magische Kräfte, von denen niemand wissen darf, wäre er längst nicht mehr am Leben. Als der junge Mann eines Tages in die Hauptstadt Fayl geschickt wird, um einen Heiler zu holen, eröffnet sich ihm allerdings eine Welt, wie er sie nie geglaubt hat, kennenzulernen. Nicht nur, dass ein mächtiger Magier ihm das Leben rettet – er trifft auch auf einen Menschen, der seinem Schicksal eine Wendung geben könnte, wie es nur in einem Märchen der Fall ist. Aber Märchen … sind nicht für Aschenprinzen bestimmt, oder?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Informationen zum Buch
Impressum
Widmung
Landkarte Region Fayl
Landkarte Altra
Vorwort
Prolog
Kapitel 1 - Klang der Stille
Kapitel 2 - Das Geheimnis einer Mondnacht
Kapitel 3 - Das Eier-Thema
Kapitel 4 - Trink, Brüderlein
Kapitel 5 - Seltsame Begegnungen
Kapitel 6 - Lass mich dein Held sein, Kleiner
Kapitel 7 - Küsst mich
Kapitel 8 - Ein Meister seines Fachs
Kapitel 9 - Kleider machen Leute
Kapitel 10 - Entschuldigung fürs Bedanken
Kapitel 11 - Hoher Besuch
Kapitel 12 - So viele falsche Fragen …
Kapitel 13 - Ich lass dich nicht im Stich!
Kapitel 14 - Letzte Worte
Kapitel 15 - Besser ein ›Ups‹ als ein ›Was wäre gewesen wenn‹
Kapitel 16 - (Un)erwarteter Besuch
Kapitel 17 - Dunkelheit voller Fragezeichen
Kapitel 18 - Abschiede sind beschissen
Kapitel 19 - Spurensuche
Kapitel 20 - Jagende Bestien
Kapitel 21 - Weinverkostung und Einladungen
Kapitel 22 - Hübscher Feigling
Kapitel 23 - Wirklich nur ein Traum?
Kapitel 24 - Der schlimmste Tag
Kapitel 25 - Eselwitze
Kapitel 26 - Vom Schicksal bestimmt
Kapitel 27 - Ein riskanter Plan
Kapitel 28 - Ballvorbereitungen
Kapitel 29 - Die beste Tarnung für ein Fest
Kapitel 30 - Piraten, Schwäne und Märchenprinzen
Kapitel 31 - Das Versteck der Leseratten
Kapitel 32 - Wie ein Orkan
Kapitel 33 - Zu ernsthafte Gespräche zu früh am Morgen
Kapitel 34 - Zurück im Alltag
Kapitel 35 - Zwei Schweinchen im Verhör
Kapitel 36 - Götter, das war knapp!
Kapitel 37 - Zwei Strohhalme
Kapitel 38 - Eine Lüge mit Folgen?
Kapitel 39 - Dubiose Beobachtung
Kapitel 40 - Der zweite Ball
Kapitel 41 - Verhängnisvoller Streit und zu viele Prinzessinnen
Kapitel 42 - Wenn alles irgendwie schiefläuft …
Kapitel 43 - Die schlimmste Strafe
Kapitel 44 - Stunde der Bestie
Kapitel 45 - Willkommen zurück
Kapitel 46 - Der wahren Liebe Kuss
Kapitel 47 - Eine ziemlich lange Nacht
Kapitel 48 - Start in ein neues Leben
Epilog
Nachwort der Autorin
Glossar
C. M. SPOERRI
Davyan
Band 1: Der Aschenprinz
Fantasy
Davyan (Band 1): Der Aschenprinz
Davyan ist ein Nichts. Ein Niemand. Das hat er in den dreißig Jahren verinnerlicht, die er als Knecht auf dem Weingut seiner Stiefmutter Libella arbeitet. Missgeburt wird er genannt, da sein Äußeres viel langsamer altert als bei anderen Menschen. Libella und ihre beiden Söhne behandeln ihn wie Dreck, Prügel sind an der Tagesordnung. Und doch schafft er es nicht, ihnen den Rücken zu kehren. Denn sein Ziehvater ist seit Jahren bettlägerig und ohne Davyans seltsam magische Kräfte, von denen niemand wissen darf, wäre er längst nicht mehr am Leben.
Als der junge Mann eines Tages in die Hauptstadt Fayl geschickt wird, um einen Heiler zu holen, eröffnet sich ihm allerdings eine Welt, wie er sie nie geglaubt hat, kennenzulernen. Nicht nur, dass ein mächtiger Magier ihm das Leben rettet – er trifft auch auf einen Menschen, der seinem Schicksal eine Wendung geben könnte, wie es nur in einem Märchen der Fall ist. Aber Märchen … sind nicht für Aschenprinzen bestimmt, oder?
Die Autorin
C. M. Spoerri wurde 1983 geboren und lebt in der Schweiz. Sie studierte Psychologie und promovierte im Frühling 2013 in Klinischer Psychologie und Psychotherapie. Seit Ende 2014 hat sie sich jedoch voll und ganz dem Schreiben gewidmet. Ihre Fantasy-Jugendromane (›Alia-Saga‹, ›Greifen-Saga‹) wurden bereits tausendfach verkauft, zudem schreibt sie erfolgreich Liebesromane. Im Herbst 2015 gründete sie mit ihrem Mann den Sternensand Verlag.
www.sternensand-verlag.ch
1. Auflage, August 2023
© Sternensand Verlag GmbH, Zürich 2023
Umschlaggestaltung: Alexander Kopainski
Lektorat / Korrektorat: Sternensand Verlag GmbH | Wolma Krefting
Korrektorat: Sternensand Verlag GmbH
Sensitivity Reading: Lektorat Laaksonen | Stefan Wilhelms
Satz: Sternensand Verlag GmbH
ISBN (Taschenbuch): 978-3-906829-30-2
ISBN (epub): 978-3-03896-279-3
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Etwas Besseres als den Tod findest du überall.
- Gebrüder Grimm -
Altra
Vorwort
Liebe LeserInnen,
es ist so weit: Ihr könnt ein weiteres Mal nach Venera reisen. Dieses Mal in eine Aschenputtel-Märchenadaption der etwas anderen Art. Ich erzähle euch hiermit die Geschichte von Davyan, einem jungen Knecht, der mit seiner selbstlosen, liebevollen Art mein Herz im Sturm erobert hat. Ich hoffe fest, dass es euch genauso gehen wird.
Wir schreiben das Jahr 11 150 der ersten Epoche, der große Umbruch und damit Machtwechsel in Altra steht den Bewohnern noch bevor. Noch sind es die Zirkelleiter, die mit strenger Hand die Regionen Altras regieren – mit ihrem tyrannischen Herrscher Lesath an der Spitze. Diese Reihe spielt knapp hundert Jahre vor ›Alia‹ und ist komplett unabhängig lesbar von allen anderen Geschichten in Venera. Ihr werdet neue Charaktere kennenlernen, neue Orte erkunden – euch neuen Abenteuern und Gefahren gegenübersehen.
Doch erst richten wir den Fokus auf ein kleines Weingut in der Nähe der Hauptstadt Fayl. Ein Weingut, in dem Davyans Geschichte beginnt – und diese … ist zunächst alles andere als märchenhaft.
Ich wünsche euch viel Vergnügen und eine gute Reise!
Herzlich,
Eure Corinne
Prolog
Tag 21, Monat 9, 1 EP 11 122
28 Jahre zuvor …
»Hör zu, Davyan.« Die Frau strich dem kleinen Jungen über die wunderschönen schwarzen Locken, die er von ihr geerbt hatte. »Du wirst jetzt mit diesem freundlichen Mann mitgehen, ja? Keine Sorge, er wird sich liebevoll um dich kümmern und dir der Vater sein, den du niemals hattest.«
»Nein«, murmelte der Kleine schniefend. Er hatte sich auf die Bettkante gesetzt, sah seine Mutter mit Tränen in den Augen an.
Diese Augen … wie sehr sie sie liebte. Links gefärbt wie Gold, rechts wie Kohle.
Sie kämpfte gegen ihre eigenen Tränen an und schluckte die Trauer über die bevorstehende Trennung hinunter. »Du musst jetzt stark sein«, flüsterte sie.
»Warum?« Davyan blickte sie flehentlich an.
»Weil ich nicht länger für dich sorgen kann.« Das war die einfachste Antwort, die ihr auf seine Frage einfiel.
Es hätte noch viele weitere Antworten gegeben. Grausamere.
Aber wie erklärte man einem kleinen Kind, dass seine Mutter bald sterben würde?
»Komm, mein Junge«, erklang die tiefe Stimme des dunkelhaarigen Mannes, der bisher still in der Ecke des Schlafzimmers gestanden hatte. »Es wird Zeit, dass wir aufbrechen.«
»Nein!«, rief der Kleine und klammerte sich mit einem Mal so fest an seine Mutter, dass diese leise aufkeuchte.
»Davyan.« Der Mann trat näher an das Bett. Seine dunklen Augen spiegelten die Trauer des Kindes, das seine Mutter nicht verlassen wollte.
Sie nickte dem Mann stumm zu und er atmete leise durch.
Sanft legte er eine Hand an die Schulter des Jungen, zog ihn behutsam von seiner Mutter weg. Der Kleine schrie, strampelte wie wild, als er hochgehoben wurde. Er ließ seine winzigen Fäuste auf die Brust des Mannes hinunterprasseln, doch all seine Gegenwehr verhinderte nicht, dass dieser ihn fest auf den Armen hielt.
»Ich danke dir, Elzgar«, flüsterte die Frau, während ihr nun selbst Tränen über die Wangen rannen.
»Nicht dafür«, antwortete er. »Was soll ich ihm sagen, wenn er irgendwann nach seiner leiblichen Mutter fragt?«
»Sag ihm, dass sie ihn mehr geliebt hat als ihr Leben.«
Kapitel 1 - Klang der Stille
Tag 4, Monat 6, 1 EP 11 150
Gegenwart
Der vierte Fußtritt schmerzt weniger. Auch weil ich heimlich das Hämmern, das durch meinen Rücken schießt, mit Magie dämme. Doch die Seele vermögen meine Kräfte nicht zu heilen … die vielen eiternden Wunden, die darin klaffen, während ich vorgebe, nicht zu spüren, wie weh sie mir tun. Äußerlich und innerlich.
Ich bin anders. Das war ich immer schon und ich käme im Grunde damit zurecht. Meine Umwelt allerdings weniger.
»Winsle um Gnade, Schweinejunge! Du dreckiger Bastard!«, bellt mich einer der Knechte an, die mich eingekreist haben. Seine Stimme trieft vor Hohn und Abscheu gleichermaßen.
So viel Hass … habe ich ihn verdient? Ich wüsste nicht, womit.
Ich liege im schmutzigen Stroh des Schweinestalls und habe mich zu einem Päckchen zusammengerollt, die Arme schützend um den Kopf geschlungen. Wenn sie mich dort treffen und ich ohnmächtig werde, werden die Qualen so lange dauern, bis ich vor Schmerzen wieder aufwache, das ist mir klar.
Die Knechte des Weingutes wollen ihren Spaß mit mir, mich betteln und winseln hören. Falls ich ihnen das nicht biete, werden sie zu härteren Mitteln greifen, bis ihre sadistische Lust gestillt ist.
»Bitte … hört auf«, nuschle ich trotzdem gegen den Ellenbogen und hasse mich dafür, dass meine Stimme zittert.
Am liebsten würde ich die Peiniger meine Magie spüren lassen, aber die Fußtritte wären nichts gegen die Folgen, die das nach sich ziehen würde.
Keiner weiß, dass ich diese Kräfte in mir trage, seit ich zehn Jahre alt wurde. In den vergangenen zwanzig Jahren habe ich gelernt, meine Fähigkeiten vor anderen zu verbergen, sie nur heimlich einzusetzen und zu üben.
»Oh nein, du eklige Missgeburt, wir fangen gerade erst an!«, höhnt einer der Peiniger und ein weiterer Tritt gegen meinen Rücken lässt mich laut aufkeuchen, was die vier Kerle zum Lachen bringt.
Missgeburt … so nennen sie mich, weil ich trotz meiner dreißig Jahre aussehe wie sechzehn. Ich altere rein äußerlich so viel langsamer als normale Menschen. Keine Ahnung, warum das so ist. In die Schule bin ich aufgrund meiner Andersartigkeit nie gegangen, habe Schreiben und Lesen nur von meinem Vater gelernt – ehe er bettlägerig wurde. Da war ich gerade mal acht Jahre alt.
Er hat von einem Tag auf den anderen einfach aufgehört zu sprechen. Zu essen. Zu … leben. Keiner weiß, warum das geschah, kein Heiler konnte ihm helfen. Seither liegt er im Bett, und wenn ich mich nicht um ihn kümmern und ihm täglich Suppe einflößen würde, wäre er wohl längst tot.
Danach wurde mir keinerlei Ausbildung mehr zuteil, da meine Stiefmutter sich weigerte, einen Lehrer für mich zu bezahlen oder mir gar selbst zu helfen. Alles, was ich nach Vaters Erkrankung lernte, habe ich aus Büchern aufgeschnappt, die ich unbemerkt in der Bibliothek unseres Gutshauses lese. Wenn alle schlafen und ich für ein paar Stunden in die Magie der Geschichten entfliehen kann.
Bücher sind meine Erlösung. Sie helfen mir, weit weg zu reisen. Weg von meinem furchtbaren Alltag. Weg von Momenten wie eben diesen, wenn die anderen Knechte mich drangsalieren.
Ein nächster Tritt gegen mein Steißbein treibt mir die Tränen in die Augen und ich unterdrücke mit Müh und Not ein erstes Wimmern. Heule ich zu schnell, wird alles nur schlimmer, da sie dadurch noch mehr angestachelt werden. Der Zeitpunkt meines Zusammenbruchs muss gut mit ihrem Blutdurst abgestimmt sein.
Es ist ein brutaler Tanz, den ich seit meiner Kindheit trainiere. Eine Überlebenstaktik, zu der ich mindestens ein Mal in der Woche greifen muss, denn niemand kommt mir zu Hilfe. Weder meine Stiefmutter noch ihre zwei Söhne, obwohl sie genau wissen, was im Schweinestall des Gutshofes gerade vor sich geht. Die Knechte machen keinen Hehl daraus, wie sehr sie mich verachten und dass es ihnen Spaß bereitet, mich zu verspotten und zu quälen.
Erneut schicke ich Magie in die Stellen meines Körpers, die mich vor Schmerz fast in den Wahnsinn treiben. Ich mindere hingegen nur das Leid, stille nicht die Blutungen und entferne keine Blutergüsse. Dazu habe ich später noch Zeit. Es gilt, ihnen ein Schauspiel zu liefern, damit sie möglichst schnell wieder von mir ablassen. Und das tun sie meistens, wenn ich so richtig schön aus allen erdenklichen Wunden blute.
Ich halte die Luft an und warte die weiteren Schläge ab, zähle gedanklich mit, wie oft ihre Füße meinen Leib treffen.
Bei einem Dutzend bricht etwas in mir und ich lasse den Tränen freien Lauf, was meine Peiniger mit boshaften Jubelschreien kommentieren. Die Folge sind sechs zusätzliche Tritte, die allerdings weniger stark ausfallen als die ersten.
Der Zeitpunkt war richtig gewählt …
Ich presse die Augen zusammen und versinke in mir selbst, rufe Bilder in meinen Geist, die mir helfen, die Erniedrigung und Misshandlung zu ertragen.
Bilder von den ausladenden Weinbergen, die es hier in Fayl gibt. Von den fruchtbaren Hügeln, den Mohn- und Lavendelfeldern, durch die ich stundenlang gehen könnte – dürfte ich das Weingut denn überhaupt verlassen.
Wie oft ich mir vorgestellt hatte, einfach abzuhauen und mein elendes Leben hinter mir zu lassen. Trotzdem habe ich in all den Jahren noch keinen einzigen Fluchtversuch unternommen.
Aus … Angst davor, erwischt zu werden.
Aus … Überforderung, wohin ich sollte.
Aus … Hoffnungslosigkeit, wozu ich überhaupt tauge, wenn nicht als Knecht im eigenen Haus.
Aus … Zweifel, dass es irgendeinen Ort gibt, an dem es mir besser gehen könnte.
Zudem … wenn ich nicht mehr da bin, wer würde sich um Vater kümmern? Meine Stiefmutter ganz sicher nicht. In den ersten Jahren hat sie ihn noch ab und an am Krankenbett besucht, aber irgendwann einfach ihr Leben weitergelebt. Ohne ihn. Als wäre er längst tot.
»Lassen wir noch etwas fürs nächste Mal übrig, der hat vorerst genug«, ertönen die erlösenden Worte eines der Männer und nach zwei weiteren Tritten gegen meine Oberschenkel lassen sie endlich von mir ab.
»Du gildenlose Ratte!« Ich spüre, wie sie mich bespucken, dann, dass etwas Warmes über meine Unterarme läuft, und ich rieche den Gestank nach Urin, der mich würgen lässt.
Hustend drehe ich den Kopf weg und blende das boshafte Lachen der Kerle aus, warte, bis sie das Finalisieren ihrer Tortur abgeschlossen haben.
Als sie endlich den Schweinestall verlassen und ihre Stimmen leiser werden, hieve ich mich auf den Rücken und bleibe regungslos liegen, versuche, meinen Atem zu beruhigen.
Derweil meine Magie durch den drangsalierten Körper gleitet und mit der Heilung beginnt, wird mein Herzschlag langsamer. Ich nehme die Umgebung nach und nach wieder stärker wahr, höre das leise Schnauben und Grunzen der Schweine, deren Geruch mir in die Nase dringt.
Diese Kombination ist jedes Mal besänftigend. Obgleich viele Menschen den Schweinegeruch hassen oder eklig finden – für mich bedeutet er Frieden. Denn ich rieche ihn nur, wenn ich so daliege wie jetzt. Nicht, während ich gepeinigt werde.
Und das leise Grunzen, das mich umgibt …
Stille.
So klingt für mich die Stille.
Nein, es existiert kein Platz für mich in dieser Welt. Nirgendwo würde es mir besser gehen … überall gäbe es Kerle wie diese, die mich aufgrund meiner Gildenlosigkeit verachten und verurteilen.
Dabei liegt es nicht daran, dass ich keiner der vier Elementgilden beitreten wollte, wie jeder hier in Altra es mit dem Erwachsenwerden zu tun pflegt, sondern, dass ich es nicht durfte.
Meine Stiefmutter verbot es mir, als ich dreizehn Jahre alt wurde und wie alle anderen in meinem Alter zur Gilden-Aufnahmezeremonie in der Hauptstadt hätte gehen sollen. Denn spätestens dann zeigt sich in jedem Menschen eines der vier Elemente: Feuer, Wasser, Erde oder Luft. Viele zeigen bereits im Kindesalter erste Anzeichen, die sich in der Jugend noch stärker manifestieren.
Mit dem Element, das die Götter einem schenken, geht eine Begabung einher, die den Platz in der Gesellschaft weist. So sind Erdbegabte zum Beispiel gute Bauern und Heiler, Luftbegabte widmen sich vor allem der Jagd, sind aber auch hervorragende Händler, Wasserbegabte sind beispielsweise der Fischerei zugetan und Feuerbegabte dem Kampf und dem Schmieden von Waffen. In den vier Elementgilden lernen alle normalen Menschen ab dreizehn Jahren ihre Berufe. Wenn man zusätzlich noch Magie in sich trägt, wird man in die fünfte Gilde, die der Magier, geschickt, die ihren Sitz im Magierzirkel hat. Dieser ist wiederum in vier Zirkel unterteilt: Feuerzirkel, Wasserzirkel, Erdzirkel und Luftzirkel.
Bei der Aufnahmezeremonie, die zur Sommersonnenwende mit großem Tamtam auf den riesigen Gildenplätzen aller Hauptstädte Altras abgehalten wird, erhält jeder Gildenanwärter einen Ring. Dieser verbindet sich mit dem Träger und man kann ihn danach nie wieder ablegen. Was wohl auch an der Rune liegt, die mit ihrer braunen, grünen, blauen oder roten Farbe das jeweilige Element darstellt und in das Metall eingraviert wird. Bei Magiern ist der Ring schwarz, bei nicht-magiebegabten Menschen hingegen golden. So erkennt man auf Anhieb, wer welche Rolle in der Gesellschaft einnimmt.
Wüssten meine Stiefmutter oder ihre beiden Söhne von meinen magischen Fähigkeiten, hätten sie mich allerdings tausendmal eher den Schweinen zum Fraß vorgeworfen als mich in den Zirkel geschickt, damit ich meine Kräfte beherrschen lernen kann.
Zwar ist es in Altra Pflicht, dass man mit dreizehn Jahren einer der vier Elementgilden oder gar dem Magierzirkel beitritt, aber meine Stiefmutter behauptete einfach, es hätte sich kein Element in mir gezeigt. Zudem kam es ihr gelegen, dass ich mit dreizehn Jahren nicht älter als sieben oder acht wirkte und niemand nachhakte, weshalb ich nicht schon in einer Gilde sei.
Sie merkte nämlich, dass ich eine nützliche und vor allem kostenlose Arbeitskraft darstellte, solange ich ihr allein diente, und begann mir immer schwerere Aufgaben zuzuteilen.
Mein Körper hält erstaunlich viel aus. Obgleich ich stets schlank war, besaß ich schon als kleiner Junge gestählte Muskeln und eine Kraft, die andere in meinem Alter niemals gehabt hätten. Nur brachte es mir nichts, denn verprügelt wurde ich trotzdem.
Anfangs wehrte ich mich noch gegen die Attacken, was allerdings bloß dazu führte, dass die Gruppen, die mich misshandelten, größer und die Qualen entsprechend länger und brutaler wurden. Daher gab ich jegliche Gegenwehr auf, und seither verprügeln mich nur noch eine Handvoll Knechte, was besser auszuhalten ist.
Im Grunde hätte ich spätestens mit sechzehn Jahren in den Magierzirkel als Diener gemusst. Doch auch da hatte meine Stiefmutter ihre Finger im Spiel, indem sie mich schlicht und ergreifend auf unserem Hof gefangen hielt und mich vor allen Menschen, die unser Gut besuchten, als ›gildenlos‹ betitelte.
Irgendwann hatte jeder das Gefühl, dass ich einfach in keiner Gilde aufgenommen worden war. Keiner scherte sich um mich, niemand wollte wissen, wer ich bin oder was ich kann. Und meine Stiefmutter kümmert es einen Dreck, ob und welche Begabung ich überhaupt habe.
Ich bin schon mein ganzes Leben lang unsichtbar. Oder eben der Bastard und die Missgeburt, die den anderen Knechten in den Abendstunden als nette Abwechslung nach einem harten Arbeitstag willkommen ist.
Aber selbst wenn ich einer Elementgilde hätte beitreten dürfen … ich hätte keine Ahnung, welcher. Normalerweise trägt jeder Mensch nur ein einziges Element in sich. Ich scheine jedoch mehr als eine Begabung in mir zu vereinen. Nicht nur, dass ich magische Kräfte besitze, ich vermag mich und andere auch zu heilen und kann Flammen in meiner Hand entstehen lassen.
Bin ich ein Mischling? Gibt es so was überhaupt? Kann es sein, dass ich mehr als ein Element besitze? Und obendrein Magie? Davon habe ich noch nie gehört und ich habe mich bisher niemandem anvertraut. Wem auch? Alle, die mich kennen, verachten mich … dafür hat meine Stiefmutter gesorgt.
Wer mein leiblicher Vater ist, weiß ich nicht, und Mutter starb, als ich zwei Jahre alt war. Kurz vor ihrem Tod vertraute sie mich Elzgar an, der mich zu sich nach Hause auf sein Weingut nahm. Ihn nannte ich Vater – so lange, bis er sich in seine Welt aus Stummheit und Schlaf zurückzog und mich mit einer der hässlichsten Frauen Fayls allein ließ. Hässlich nicht äußerlich, das bestimmt nicht. Sie ist eine der gepflegtesten Damen, die ich kenne, und ihre Schönheit wird weitum gepriesen. Aber ihre Seele ist dafür schwarz wie die Nacht.
Waren mein Ziehvater und ich in den ersten Jahren noch allein auf dem Gutshof, so änderte sich alles, als er Libella eines Tages mit nach Hause brachte und kurze Zeit später heiratete. Sie war es, die meinem Vater einredete, dass ich nichts wert sei, ihre beiden Söhne, die sie kurz darauf zeugten, jedoch schon. Immer wieder wies sie auf meine Andersartigkeit hin, da ich so langsam alterte.
Libella war die Erste, die mich als Missgeburt bezeichnete.
Vater verteidigte mich zunächst, doch irgendwann wurde seine Gegenwehr schwächer. Und sobald er bettlägerig wurde, war mein Leben eine einzige Tortur. Meine Stiefmutter nahm mir alles, was ich besaß, verbannte mich aus dem Haus, und so schlafe ich seit über zwanzig Jahren nun abwechselnd im Schweine- oder Pferdestall unseres riesigen Gutshofes.
Ich wechsle meinen Schlafplatz, um so gegen nächtliche Überfälle der anderen Knechte gewappnet zu sein. Manchmal sind sie nämlich zu faul oder zu betrunken, um nach mir zu suchen, und nehmen sich stattdessen eine der Mägde. Was genau sie mit ihnen machen, weiß ich nicht – ich höre dann bloß die Schreie und das Flehen der jungen Mädchen, die von den Knechten zwischen die Weinreben gezerrt werden. Aber ich kann es mir vorstellen. Und auch darüber verliert bei Tag niemand hier auf dem Hof ein Wort.
Es ist einfach ekelerregend …
Dennoch bin ich dankbar, wenn nicht ich das Opfer bin, sondern eine der Mägde. Ist das gemein? Womöglich.
Etwas lernt man, wenn man wie ich jahrelang misshandelt wird: Man wird egoistisch. Man denkt nur noch ans eigene Überleben und legt sich Scheuklappen an, um möglichst wenig von der Umwelt wahrnehmen zu müssen.
Ich muss leben. Das ist alles, was zählt.
Warum mir das so wichtig ist, kann ich an den meisten Tagen selbst nicht begreifen. Aufgeben wäre definitiv die einfachere Option.
Aber wer würde sich um meinen Vater kümmern?
Nein. Ich muss am Leben bleiben. Nur schon für ihn.
Ich spüre, wie meine Magie langsam Wirkung zeigt, die Pein geringer wird, ich wieder besser atmen kann.
Wie oft ich mich schon heilen musste wie gerade jetzt, vermag ich gar nicht mehr zu sagen. Dabei ist stets darauf zu achten, dass ich noch ein paar gut sichtbare Blessuren übrig lasse, damit die Knechte mich am nächsten Tag mit ihren triumphierenden Blicken bedenken können.
Daher stille ich meist nur die schlimmsten Blutungen und heile die Wunden, die ich mit Kleidung bedecken kann, nehme mir die Schmerzen, so gut es geht. Den Rest erledigt mein Körper dann von selbst.
Endlich schaffe ich es, mich vom Boden zu erheben. Meine Kleidung ist zerrissen, aber das ist nichts Neues. Ich werde sie bis morgen flicken, sonst hagelt es weitere Prügel – von meiner Stiefmutter. Und die ist keinesfalls zimperlicher als die Knechte.
Als Erstes gilt es nun, den Dreck von mir zu waschen.
Obwohl der Mond inzwischen aufgegangen ist, fühlt sich die Nachtluft warm an, als ich aus dem Stall trete. Verstohlen sehe ich mich um, bereit, mich sofort wieder zurückzuziehen, sollten die vier Knechte noch in der Nähe sein.
Mit Erleichterung stelle ich allerdings fest, dass sich keine Menschenseele auf dem Hof befindet und auch im Herrenhaus alle Lichter bereits gelöscht sind. Ich muss also nicht zum Brunnen inmitten des Innenhofes und riskieren, dass mich doch noch jemand sieht, sondern kann in Ruhe zum kleinen Teich in der Nähe des Gehöfts gehen und dort eine Runde schwimmen. Die schlimmen Bilder von eben beiseiteschieben.
Das Schwimmen hat mir Vater beigebracht – es war eines der letzten Dinge, die er mich lehrte.
So leise es geht, betrete ich das Gutshaus und hole Nadel und Faden aus einer der Kommoden, die im Eingangsbereich stehen. Wo sich die Nähutensilien befinden, weiß ich inzwischen blind und ich sehe im Dunkeln äußerst gut, daher mache ich kein Licht im Haus, um niemanden zu wecken. Danach verlasse ich schnellen Fußes das Weingut und begebe mich in Richtung Teich.
Der Mond erhellt meinen Weg stark genug, sodass ich keine Fackel benötige. Ich könnte zwar mit Magie ein künstliches Licht erzeugen, aber darauf verzichte ich, wann immer es geht. Zu groß ist die Gefahr, dass meine Kräfte dadurch entdeckt werden.
Der kleine See mit dem Namen Schwertlied-Teich liegt zwar nicht allzu weit von unserem Hof entfernt, ich suche ihn trotzdem nur auf, wenn ich sicher bin, dass niemand mich während der Zeit vermisst, die ich dorthin und zurück benötige. Ich kann es mir äußerst selten leisten, im Weiher zu baden, denn meine Familie überhäuft mich mit so vielen Aufgaben, dass ich manchmal nicht weiß, wie ich das alles schaffen soll.
Im Gegensatz zu anderen Weingütern betreiben wir auch noch eine Schweinezucht, was zusätzlichen Aufwand bedeutet. Ehe Libella auf den Plan trat, gab es bloß die Weinproduktion, doch die neue Gemahlin meines Vaters bestand darauf, einen Schweinestall zu bauen – und Vater gewährte ihr natürlich wie immer ihren Wunsch.
Mit jedem Schritt, den ich vom Gutshaus weg mache, wird mein Herz leichter. Dennoch hallen die Verhöhnungen der anderen Knechte in meinem Kopf wider, aber sie werden zunehmend leiser, bis ich nur noch die Geräusche der Nacht vernehme.
Kapitel 2 - Das Geheimnis einer Mondnacht
Davyan
Schon von Weitem erkenne ich den Schwertlied-Teich, dessen Oberfläche im Mondschein geheimnisvoll glitzert. Er liegt inmitten eines Tals und wird von einigen mannshohen Büschen umsäumt. Ein kleiner Wald befindet sich nicht weit entfernt, der größtenteils aus Birkenbäumen besteht.
Ich trete ans Ufer des Gewässers, bei einer Stelle, wo kein Schilf wächst, und lasse meinen Blick über die Umgebung gleiten. Der Schrei eines Uhus erklingt aus der Nähe, ich lausche dem Quaken von Fröschen und dem Zirpen der Zikaden. Es ist eine ganz eigene Musik der Nacht, die in meinen Ohren klingt.
Auch meine Sinne unterscheiden sich von denjenigen anderer Menschen, wie mir im Verlaufe der Jahre auffiel. Ich höre und rieche besser als sie, kann auch in größter Dunkelheit noch Dinge wahrnehmen, die ihren Augen verborgen bleiben.
Ja, ich bin wirklich anders … aber habe ich deswegen diese Misshandlungen verdient?
Tief atme ich die Luft ein, wittere den Geruch von Gras und Erde. Es ist Sommer und die Temperaturen tagsüber so hoch, dass sie auch jetzt noch nicht gänzlich zurückgegangen sind.
Sorgsam entledige ich mich der zerrissenen und verschmutzten Kleidung und steige ins erfrischende Wasser des Teichs, wate so tief hinein, dass es mir bis zur Brust reicht. Einen Moment bleibe ich ganz still stehen und betrachte mein Spiegelbild auf der mondbeschienenen Oberfläche.
Das leicht gelockte schwarze Haar hängt mir strähnig ins Gesicht, welches seit einigen Jahren endlich Bartwuchs bekommt. Den Bart schabe ich alle paar Tage mithilfe eines Messers ab, habe nur ein paar Stoppeln an Wangen und Kinn.
Normalerweise nehme ich meine Locken zu einem Zopf zusammen, doch der hat sich während der Prügelattacke aus dem Band gelöst.
Seit ich ein Kind war, habe ich mein Haar wachsen lassen, um damit meine Ohren zu verdecken, die ich einfach nur hässlich finde. Sie sind viel zu spitz und zu lang – und haben mir den Namen ›Hasenohr‹ eingebracht. Wie oft ich mir überlegt habe, sie einfach abzuschneiden … einmal habe ich sogar den Versuch gewagt, doch der Schmerz war zu heftig, als ich mir mit dem Messer ins Ohr ritzte. Die Wunde wurde dank meiner heilenden Magie zum Glück umgehend geschlossen, seither verstecke ich allerdings meine Ohren unter den Haaren.
Es gibt genug Schräges an mir … unter anderem auch meine unterschiedlich farbigen Augen – das eine pechschwarz, das andere goldfarben.
Ich hasse das so sehr …
Mein Blick gleitet an meinem Körper herunter, der schlank und muskulös ist und von den täglichen Arbeiten zeugt, die ich erledigen muss.
Mit einem leisen Seufzen hebe ich die Hände und wasche mich mit dem kühlen Wasser. Dabei spüre ich die vielen Schwielen, welche die harte Arbeit an den Innenflächen hinterlassen hat.
Als der Dreck und das Blut weg sind, tauche ich unter, um den Schmutz auch aus meinem Haar zu bekommen. Danach steige ich aus dem Teich und habe endlich wieder das Gefühl, sauber zu sein.
Sorgsam begutachte ich meine Kleidung und beginne, auch sie zu schrubben und auszuspülen. Sie wird mir später klamm am Körper kleben, sollte aber einigermaßen trocken sein, bis ich zurück im Weingut bin.
Nachdem meine Sachen gereinigt sind, fädle ich im Licht des Mondes die Nadel ein und bin einmal mehr froh, so gute Augen zu besitzen, dass ich auch jetzt auf meine Magie verzichten kann.
Im Schneidersitz setze ich mich ans Ufer und schicke mich an, mein Gewand zu flicken. Die Handgriffe geschehen fast automatisch, da ich das schon so oft tun musste. Allzu lange darf ich mir allerdings nicht Zeit lassen, ich muss zurück zum Weingut, ehe jemandem meine Abwesenheit auffällt. Doch ich gehe davon aus, dass das in den nächsten zwei Stunden nicht der Fall sein wird.
Ich bin so vertieft in die Arbeit, dass mich das Wiehern, das mit einem Mal nicht weit entfernt ertönt, heftig erschreckt. Normalerweise höre ich sofort, wenn sich mir jemand nähert, daher hebe ich nun alarmiert den Kopf und schaue mich um.
Ist mir jemand gefolgt? Hat mich jemand entdeckt?
Als hinter einem der Büsche, die das Ufer säumen, eine Gestalt hervortritt, bleibt mein Herz kurz stehen. Sie ist zum Glück weit genug weg, sodass sie mich noch nicht bemerkt haben kann.
So leise es geht, ziehe ich mich hinter einen Busch zurück und streife mir Hose und Hemd über, die wieder einigermaßen heil sind.
Danach betrachte ich die fremde Person, die in einen Kapuzenumhang gehüllt ist und nun zum Ufer schreitet. Ich kann von hier aus nicht sagen, ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelt, da der Stoff die Figur vollkommen verbirgt.
Atemlos beobachte ich, wie die Gestalt sich dem Wasser nähert, sich hinhockt und eine Hand hineingleiten lässt. Dabei rutscht ihre Kapuze etwas nach hinten und jetzt erhasche ich einen Blick auf das betörendste Gesicht, das ich jemals sah.
Es ist definitiv eine junge Frau, die sich dort am Ufer gebückt hat und gedankenversunken mit den Fingern im Wasser spielt. Als sie ihren Umhang zurückschlägt, fällt eine Pracht aus rotem Haar über ihre Schultern, fast bis zur Hüfte.
Bei den Göttern … was für eine Schönheit.
Sie trägt ein helles Kleid, das ihr bis zu den Knöcheln reicht.
Irgendetwas murmelt sie, aber ich kann trotz meines guten Gehörs nichts verstehen.
Da mich die Neugierde gepackt hat, schleiche ich, so leise es geht, näher, verberge mich allerdings weiterhin hinter dem Gebüsch. Doch gerade als ich nur noch ein paar Schritt von ihr entfernt bin, trete ich unbedachterweise auf einen Ast, der so laut knackt, dass mir ein Keuchen entfährt.
Natürlich hat die Fremde sowohl das Geräusch als auch mich gehört und wirbelt herum, starrt in meine Richtung. Es ist zu spät, mich zu verstecken, und da ich ihr keine Angst einjagen will, trete ich hinter dem Busch hervor und gebe mich zu erkennen.
Sie stößt einen leisen Schrei aus, doch ich hebe die Hände behutsam in die Höhe zum Zeichen, dass ich keine Gefahr darstelle. Dabei entgeht mir nicht, dass ein magischer Schutzschild um ihren Körper aufflimmert.
Eine Magierin also …
»Ich tue Euch nichts, Herrin«, beteuere ich so besänftigend ich kann.
»Wer seid Ihr?« Sie weicht etwas zurück. Ihre Stimme klingt melodisch, hell und ist mir auf Anhieb sympathisch. Aus der Nähe betrachtet wirkt ihre Haut so weiß wie Alabaster.
»Ich … mein Name ist Davyan«, erkläre ich und deute eine Verbeugung an. »Es tut mir leid, ich wollte Euch nicht erschrecken.«
»Seid Ihr es, der mir gefolgt ist?« Sie beäugt mich misstrauisch.
Ich lege meine Stirn in Falten. »Gefolgt?«
»Lügt nicht.« Zwischen ihren fein geschwungenen Brauen entsteht eine kleine Vertiefung. »Schickt mein Vater Euch? Sollt Ihr mich in den Zirkel eskortieren? Reicht es nicht, dass mein Bruder wie ein Kindermädchen auf mich aufpasst?«
»Zirkel?« Da fällt mein Augenmerk auf ihre Hand, an deren Ringfinger ein schwarzer Magierring mit einer blauen Rune prangt.
Die junge Frau ist also eine Wassermagierin und wird offenbar im Zirkel noch ausgebildet. Oder lebt zumindest dort.
Im gleichen Moment hat sie meine Hand gemustert und ihr entfährt ein Keuchen. »Ihr seid gildenlos!«, ruft sie fast schon empört und ich vermeine, ihren magischen Schild stärker aufleuchten zu sehen.
»Ich …«, beginne ich, werde allerdings von einer tiefen Männerstimme unterbrochen.
»Wer ist das?«
Verdattert wende ich den Kopf etwas nach rechts, wo aus dem Gebüsch nun ein junger Mann hervortritt. Er mag vielleicht Mitte zwanzig sein, hat dunkles Haar, das einen leichten Rotstich besitzt, wie ich dank des magischen Lichts erkenne, das er gebildet hat. Mittig trägt er es lang und zu einem Zopf zusammengenommen, an der rechten und linken Seite des Kopfes ist es hingegen kurz geschoren.
Mit grimmiger Miene betrachtet er erst die junge Frau, dann mich.
»Sombren, ich …«, beginnt sie, wird aber von einer unwirschen Handbewegung des Fremden gestoppt.
»Seinetwegen verlässt du unser schützendes Lager?!«, fährt er sie an. »Das ist doch noch fast ein Kind! Was denkst du dir eigentlich dabei, du kleine …«
Weiter kommt er nicht, denn sie streckt ihre Hand aus und schleudert einen Eispfeil auf ihn. Noch ehe ich blinzeln kann, hat der Mann ebenfalls einen Schutzschild um sich gebildet. Anscheinend hat er mit einem Angriff gerechnet – und beherrscht gleichermaßen Magie. Der Pfeil zerschellt daran in tausend Stücke.
»Spinnst du?!«, grollt er verärgert und lässt seinen magischen Schild fallen. »Es ist verboten, Magie gegen andere Magier einzusetzen!«
Sie zuckt lediglich mit den Schultern und ihr Schild flackert noch ein Mal, ehe er ebenfalls verschwindet. »Tja, zu dumm, dass außer dir niemand da ist, der den Wächter über irgendwelche Magierregeln spielt.«
»Du kommst auf der Stelle mit mir mit!«, knurrt er.
»Oder was?!« Sie lässt ihre Augen blitzen und das Feuer, das ich in ihrem Gesicht lese, fasziniert mich umgehend.
»Oder ich zerre dich an deinen Haaren zurück zum Lager!«, fährt er sie nicht minder erregt an.
»Das wagst du nicht!«
»Wetten?«
Ich habe ihr Gespräch stumm verfolgt und versuche einzuordnen, in welcher Beziehung sie zueinander stehen. So freundlich und aufgeschlossen die junge Frau wirkt, so düster und wütend ist der Mann.
Sie sind komplette Gegensätze – womöglich sind sie ein Paar, da es ja heißt, dass Gegensätze sich anziehen? Ein kleiner Stich durchfährt mich beim Gedanken, dass eine Frau wie sie sich einen Kerl wie den angelacht hat, doch da werden mit dem nächsten Satz der Frau meine Bedenken auch schon im Wind zerstreut.
»Was, glaubst du, wird Vater zu dir sagen, wenn er erfährt, wie du deine Schwester behandelst?!«
Geschwister. Die beiden sind Bruder und Schwester.
Jetzt fällt mir auch eine gewisse Ähnlichkeit ihrer Gesichtszüge auf, obwohl der Mann seine Schwester gerade voller Zorn anfunkelt. Ja, auch sein Antlitz ist einnehmend, wenngleich kantiger. Ein dunkler Bartschatten lässt ihn noch etwas reifer, aber auch verwegener wirken.
Eben in diesem Moment sieht er mich wieder an und sein Blick geht mir durch Mark und Bein. Dieses Feuer, diese … Energie. Ich hätte mir seinen Ring nicht einmal ansehen müssen, um zu wissen, dass darin eine rote Feuerrune glüht.
»Was stehst du da so blöd rum, Bursche?«, blafft er und verengt die dunklen Augen. »Wer bist du überhaupt, dass du es wagst, meine Schwester mitten in der Nacht an einen Teich zu locken?!«
»Ich habe nicht …«, beginne ich, doch die Frau geht dazwischen.
»Er ist ein anständiger Mann!«, sagt sie und stellt sich vor mich hin. »Er hat mit der Sache nichts zu tun, es war meine Entscheidung, das Lager zu verlassen und ihn hier zu treffen!«
Gerade verstehe ich die Welt nicht mehr, aber ich beiße mir auf die Zunge, um die Frage, die darauf brennt, zu unterdrücken. Anscheinend möchte die Frau ihren Bruder glauben lassen, dass wir ein Liebespaar sind.
Warum auch immer …
Um ihre Worte zu unterstreichen, wirbelt sie zu mir herum und legt eine Hand auf meine Brust, und da ich das Hemd nicht richtig zugeknöpft habe in der Eile, berührt sie direkt meine Haut. Jede ihrer Fingerkuppen brennt sich in meinen Körper, während sie sich auf die Zehen stellt und mir einen Kuss auf die Lippen haucht. Den ersten, den ich überhaupt in meinem Leben bekomme.
Doch ehe ich ihn genießen kann, ertönt hinter ihr ein Knurren und im nächsten Moment wird sie von mir weggerissen. Stattdessen sehe ich mich ihrem wutschnaubenden Bruder gegenüber, der keine Sekunde später seine Faust gegen meinen Kiefer rammt.
Er ist über einen Kopf größer und breitschultriger als ich, und ich bin vollkommen unvorbereitet auf den Schlag. Daher stolpere ich rückwärts und falle der Länge nach ins knöcheltiefe Wasser. Ihr Bruder ist sofort über mir, holt zu einem weiteren Schlag aus und ich schließe reflexartig die Augen.
»Sombren, nicht!«, höre ich die schrille Stimme seiner Schwester, da donnert seine Faust auch schon gegen meine Schläfe und die Welt um mich wird stockdunkel.
Kapitel 3 - Das Eier-Thema
Davyan
Mein Kopf dröhnt, als ich wieder zur Besinnung komme. Noch immer liege ich im Wasser, von den Geschwistern fehlt jede Spur.
Dass ich mir ihre Begegnung nicht eingebildet habe, zeigt ein pochender Schmerz am Kiefer, der vom Faustschlag des Kerls namens Sombren stammt. Mit meinen heilenden Kräften lindere ich das Hämmern und erhebe mich gleichzeitig aus dem Teich, sehe mich aufmerksam um.
Wie viel Zeit wohl vergangen sein mag? Bin ich schon zu lange vom Gutshof weg?
Wenigstens steht der Mond noch am Himmel, was mich beruhigt. Dennoch ist es höchste Zeit, ins Weingut zu eilen und ein paar Stunden im Pferdestall zu schlafen, ehe ich im Morgengrauen wieder meinen Aufgaben nachkommen muss.
Mit einem Seufzen kehre ich zurück zu meinen Sachen und packe sie zusammen. Als ich nochmals einen Blick über den Schwertlied-Teich werfe, vermeine ich, im Wasser eine helle Gestalt zu erkennen – aber mit dem nächsten Blinzeln ist sie weg und die Fläche liegt spiegelglatt vor mir.
Kopfschüttelnd wende ich mich ab. Womöglich war der Schlag des Fremden doch eine Spur zu heftig, wenn ich nun an Sinnestäuschungen leide.
Als ich etwas später im Stroh liege und dem Schnauben der Pferde lausche, kreisen meine Gedanken um die namenlose Schönheit, die mich so unversehens geküsst hat.
Wer ist sie?
Ich wünschte, ich würde ihren Namen kennen, um ihn leise zu flüstern, während ich mir die Berührung ihrer Lippen in Erinnerung rufe.
So sanft … so liebevoll.
Ich glaube sogar, ihren Atem noch auf meiner Haut zu spüren, ihre Finger auf meiner nackten Brust. Nie hat mir jemand so viel Zärtlichkeit entgegengebracht wie die unbekannte Magierin in diesem gestohlenen Augenblick. Noch nie hat mich jemand auf solch innige Weise berührt, und das Kribbeln in meinem Bauch wird stärker, je länger ich daran denke.
Wie es wohl wäre, wenn sie mich nicht nur auf den Mund küssen würde? Sondern … auf meinen Hals? Meine Brust? Meinen Bauch? Meinen …
Das Ziehen in meinem Unterleib überrascht mich und ich stöhne leise auf, als ich merke, wie sich meine Männlichkeit unvermittelt zu regen beginnt.
Es ist kein Geheimnis, dass ich noch nie bei einer Frau lag und mich hat das nicht gestört. Ist Zärtlichkeit doch etwas, das es in meinem Leben schlicht und ergreifend nicht gibt. Es interessierte mich bisher auch nicht sonderlich, was womöglich nicht zuletzt daran liegt, dass mein Körper langsamer altert. Pubertät war lange ein Fremdwort für mich und erst seit Kurzem beginne ich überhaupt, mich damit näher zu beschäftigen.
Es ist nicht so, dass ich nicht wüsste, wie man mit einer Frau Liebe macht – dazu habe ich bereits einiges aus den Büchern unserer Bibliothek erfahren. Vermutlich weiß ich sogar besser Bescheid als die meisten Männer, da ich so viel Zeit mit Lesen verbringe und meine Stiefmutter einen Hang zu dramatischen Liebesschnulzen hat, in denen der sexuelle Akt bis ins Detail beschrieben wird. Aber auch die medizinischen Bücher haben mir Aufschluss über den weiblichen Körper gegeben – und den männlichen, was mir half, zu verstehen, was Adoleszenz bedeutet. Denn niemand sonst hat mir das versucht zu erklären.
Natürlich, in der Realität ist es bestimmt etwas komplett anderes als in diesen erotischen Romanen, bisher hatte ich allerdings nie den Drang, herauszufinden, wie anders.
Doch nun … mit einem Mal wünschte ich mir, diese fremde Schönheit wäre hier bei mir, würde mit ihren Fingern sanft über meinen Unterleib streichen, meinen härter werdenden Schaft von der Kleidung befreien, ihn mit ihren …
Götter, was denke ich da bloß?!
Eher würde ein Oger ein Kelmen beglücken, als dass ich jemals überhaupt in die Nähe einer Frau wie ihr käme. Geschweige denn, dass sie sich für mich interessierte … und trotzdem … trotzdem hat sie mich geküsst.
Bis heute Abend hatte ich keine Ahnung, wie ein Leben außerhalb des Weingutes aussehen könnte.
Aber nun? Nun beginnen sich mit einem Mal in meinem Kopf Alternativen zu bilden.
Was wäre, wenn ich ebenfalls im Magierzirkel Unterricht erhalten würde? Würden wir zusammen Kurse besuchen? Sie und ich?
Würde sie mich als ebenbürtig ansehen, sich vielleicht sogar mit mir einlassen? Und falls ja … würden wir eine Familie gründen?
Eines dieser schönen Stadthäuser der nahe gelegenen Hauptstadt Fayl beziehen, die ich bisher nur auf Bildern sah?
Wäre das mein Leben, würde ich nicht hier auf dem Weingut als geschundener Knecht darben?
Mir ist bewusst, dass ich auf diese Fragen keine Antworten erhalten werde. Dennoch fühlt es sich gut an, diese Gedanken zuzulassen. Auszubauen. Weiterzuträumen.
Ihre weichen feuerroten Haare, das hübsche Gesicht …
Noch lange liege ich wach und starre in die Finsternis, ehe mich dann doch der Schlaf einholt. Und auch da träume ich von ihr: der bezauberndsten Frau der Welt.
»Davyan! Hoch mit dir!«, reißt mich eine Stimme aus dem Land der Träume und ich schrecke umgehend in die Senkrechte.
Vor mir steht eine stämmige Frau mittleren Alters in einfacher Bedienstetenkluft, die Arme vor der Brust verschränkt, den Blick vorwurfsvoll auf mich gerichtet.
»Sag bloß, du hast den Hahn nicht gehört! Der hat sich heute Morgen die Seele aus dem Leib gekräht und du liegst immer noch faul im Stroh herum!« Sie löst ihre Arme und fuchtelt nun mit den Händen wild in der Luft. »Wenn das die Herrin erfährt, macht sie dir Feuer unter dem Hintern – und du weißt, dass das wortwörtlich gemeint ist!«
»Ist ja gut, Ana«, murmle ich und fahre mir mit der Hand schlaftrunken über die Augenpartie. »Musst du so laut rumschreien? Du erschreckst die Pferde.«
»Die Pferde sind mir einerlei!«, echauffiert Ana sich weiter und bläst sich energisch eine rotbraune Haarsträhne aus der Stirn, die sich unter ihrer weißen Dienerhaube hervorgeschlichen hat. »Die Hühner hingegen nicht! Los, auf mit dir in den Hühnerstall! Die Eier fürs Frühstück der Herrschaften holen sich nicht von selbst!«
Auch wenn sie gerade jeden Satz mit einem Ausrufezeichen beendet, so weiß ich, dass hinter ihrer schroffen Art ein Herz aus Gold verborgen ist. Ana ist die gute Seele des Hauses und ihr verdanke ich, dass ich nicht schon längst aufgegeben habe. Obgleich ihre Mittel begrenzt sind, kümmert sie sich, so gut es geht, um das Wohl des Dienstpersonals. Sie selbst ist Erdbegabte und als Köchin sowie Heilerin angestellt. Magie beherrscht sie allerdings keine – das tut niemand hier auf dem Weingut.
Trotz ihrer Fürsorge kann sie jedoch weder die Prügelattacken noch den Missbrauch der Mägde vereiteln, dafür fehlen ihr schlicht und ergreifend die Möglichkeiten. Aber ich weiß, dass sie schon in vielen Nächten bei einem der Mädchen war, es im Arm hielt und ihm gut zusprach, während sie zu verhindern half, ein uneheliches Kind zu empfangen. Und ich weiß auch, dass Ana den grausamen Knechten am liebsten eigenhändig die Kronjuwelen abschneiden würde, hätte sie denn die Kraft und die Gelegenheit dazu.
»Wie siehst du überhaupt wieder aus?«, fährt Ana fort, als ich mich auf die Beine rapple und das Stroh aus meinen schwarzen Haaren zupfe, ehe ich die losen Strähnen zu einem Zopf zusammenbinde, der seitlich die Ohren bedeckt. Sie deutet auf meine Brust. »Dieser Kreuzstich hier … das habe ich dir definitiv anders beigebracht! Heute Abend werde ich dir nochmals gründlich zeigen, wie das geht! So kannst du doch nicht rumlaufen!«
Ich sehe an mir herunter und betrachte den notdürftig geflickten Riss in meinem Hemd.
Eigentlich finde ich meine Nähfähigkeiten ganz passabel, aber anscheinend halten sie dem prüfenden Auge Anas nach all den Jahren immer noch nicht stand.
Als ich den Kopf wieder hebe, legt sie mir unvermittelt eine Hand auf den Oberarm und sieht mich forschend an. »Alles in Ordnung, Junge?«
Ihre Stimme ist mit einem Mal voller Wärme, und in ihren dunklen Iriden lese ich eine Güte, wie ich sie mir von einer Mutter vorstelle. Ein Kloß bildet sich in meinem Hals und ich wende rasch den Blick ab.
»Klar«, murmle ich. »Gab gestern einen … Zwischenfall.«
Ana atmet leise durch und ich muss ihr nicht ins Gesicht sehen, um zu wissen, dass sie gerade die Brauen zusammenschiebt. Sie lässt mich los und ich erkenne aus dem Augenwinkel ein knappes Nicken. »Du wirst mir auch dieses Mal nicht sagen, wer es war. Richtig?«
Ich presse die Lippen aufeinander und schüttle kaum merklich den Kopf, was Ana ein Seufzen entlockt.
Ein einziges Mal habe ich es getan. Habe Namen genannt. Und was darauf folgte … ich wäre in der Nacht danach beinahe gestorben. Sie hatten sich zusammengerottet. Alle Knechte. Mich in die Scheune gezerrt, dort an einen Pfahl gebunden. Anschließend hat jeder von ihnen mich so lange verprügelt und gefoltert, bis ich vor Schmerz schier wahnsinnig wurde und der ganze Boden von meinem Blut getränkt war. Keine Ahnung, wie ich das damals überlebte, doch seither weiß ich, dass ich mir eher die Zunge abbeißen würde, als mich noch einmal solchen Qualen auszusetzen.
»Dann … hol jetzt die Eier und bring sie mir in die Küche«, weist Ana mich an und gibt mir einen Klaps auf den Rücken, der mich unvermittelt aufkeuchen lässt, da sie einen der blauen Flecke getroffen hat. »Entschuldige.«
»Klar«, wiederhole ich und mache mich auf zum Hühnerstall.
»Ist das alles?«, fragt Ana stirnrunzelnd, als ich ihr kurz darauf meine Ausbeute in die Küche bringe.
Ich zucke mit den Schultern und schiebe ihr den kleinen Korb zu. »Nun ja, seit der Fuchs vergangene Woche ins Gehege einbrach und zwei von ihnen tötete, sind einige der Hühner zu verschreckt, um Eier zu legen. Ich denke, das gibt sich in den nächsten Wochen.«
»Wochen?« Ana sieht mich mit schmalen Augen an. »Das wird die Herrschaft aber nicht gern hören.«
»Die Hühner stehen unter Schock«, erkläre ich. »Da ist es ganz normal, dass sie keinen Kopf dafür haben, sich ums Eierlegen zu kümmern. Ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert.«
»Hm.« Sie nimmt die wenigen Eier an sich und wiegt sie prüfend in der Hand. »Das stimmt schon, nur ist die Herrin im Moment etwas sehr … dünnhäutig. Es wäre besser, wir schaffen dieses Eier-Thema schnell aus der Welt.«
Ich nicke und beginne, die Pfannen abzuwaschen, die Ana für das Zubereiten des Frühstücks verwendet hat.
Nachdem das Essen fertig ist, richtet die Köchin alles auf einem großen Tablett an und gibt mir mit dem Kopf ein Zeichen, es hochzuheben. Die Teller und Gerichte wiegen gefühlt so viel wie ein Ochse, und für Ana wäre es schlicht und ergreifend unmöglich, das Frühstück in den Speisesaal zu tragen.
Ich verabscheue diesen Teil des Morgens, da ich ihnen dann gegenübertreten muss: meiner Stiefmutter Libella und ihren beiden Söhnen Baldan und Zabor.
Trotzdem hätte es nichts gebracht, sich zu weigern – das hätte bloß Peitschenhiebe nach sich gezogen. Zumal ich Ana niemals im Stich lassen würde.
Daher straffe ich nun die Schultern und nehme das Tablett, derweil Ana zwei Krüge mit Wasser und Milch ergreift und mir voran die Küche verlässt.
Mit einem Seufzen folge ich ihr und wappne mich innerlich gegen die fiesen Bemerkungen, die gleich kommen werden.
»Warum hat das so lange gedauert?!«, ist das Erste, was ich höre, noch ehe ich den Speisesaal überhaupt betreten habe.
Ana beeilt sich, zu der langen Tafel zu gehen, wo meine ›Familie‹ bereits Platz genommen hat. Meine Stiefmutter am Kopfende, ihre Söhne rechts und links von ihr mit einem Abstand, der unmöglich ein Gespräch in normaler Lautstärke zulassen kann.
»Tut mir leid, Herrin«, entschuldigt sich Ana mit einem kleinen Knicks, während sie die Becher mit Wasser und Milch füllt. »Das wird nicht wieder vorkommen.«
»Das wird es definitiv nicht!«, faucht Libella und ihr Blick trifft auf mich.
Immer wenn ich in ihre eisblauen Augen schaue, durchfährt mich ein unangenehmes Frösteln, das sich in meinem Herzen festsetzt und nicht abklingen will. Ihr langes blondes Haar hat sie hochgesteckt, ein paar Locken ringeln sich verspielt rechts und links von ihrem anmutigen Gesicht, an dem das Alter nicht spurlos vorbeigegangen ist. Sie müsste inzwischen Mitte vierzig sein, so genau weiß ich das nicht – und es interessiert mich auch nicht. Ihr schlanker Körper steckt in einer wahren Explosion aus dunkelrotem Brokat und weißer Spitze. Mir ist es immer wieder ein Rätsel, warum sie sich jeden Tag in solch eine Kluft zwängt, die doch an allen Ecken und Enden zwicken muss. Geschweige denn, wie sie es schafft, keine Vasen umzuschmeißen mit ihrem ausladenden Rock.
Ihre beiden Söhne sind nicht minder adrett angezogen mit ihren langen Beinkleidern und den reich bestickten Westen, die sie über ihren weißen Hemden tragen. Zum Glück besitzt keiner von ihnen Magie – das hätte mein Leben noch mehr beeinträchtigt, da ich mir sicher bin, ihnen würden noch grausamere Foltermethoden einfallen als ohnehin schon. Es ist beinahe ein Segen, dass ich den ganzen Tag mit Arbeit überhäuft bin, sodass ich ihnen aus dem Weg gehen kann.
Eigentlich sind beide mit ihren über zwanzig Jahren längst alt genug, auszuziehen und eigene Familien zu gründen, wie alle in ihrem Alter es zu tun pflegen.
Aber Baldan und Zabor ziehen es vor, ihrer Mutter noch etwas auf der Tasche zu liegen. Warum sich nach einer Frau umschauen, wenn sie hier alles haben, was sie brauchen? Bedienstete, genug zu essen und zu trinken … und für den Kontakt mit dem weiblichen Geschlecht ist im Notfall in Form der Mägde auch gesorgt. Obschon die beiden diese kaum anrühren, laden sie doch lieber regelmäßig irgendwelche Mädchen aus der Stadt aufs Weingut ein und veranstalten mit ihnen rauschende Feste. Oder wohl eher Orgien, so wie es stets ausartet, sobald die Brüder mit Frauen allein sind.
Mein Blick streift jenen Baldans, des Älteren der beiden, und er rümpft die Nase, als würde er den Gestank des Schweinemists bis zu sich riechen. Sein Haar ist ebenso blond wie das seines Bruders und der Mutter, doch im Gegensatz zu Zabor, dessen Locken ihm bis auf die Schultern fallen, trägt er es kurz und lässt sich stattdessen einen Bart wachsen. Das Doppelkinn, das auch die Gesichtsbehaarung nicht verbergen kann, schwabbelt, als er missbilligend den Mund verzieht und sich dann angewidert von mir abwendet.
Keiner von beiden hält es für nötig, sich körperlich in Form zu halten. Sowohl Zabor als auch Baldan besitzen trotz ihrer jungen Jahre schon einen Wohlstandsbauch, der stetig wächst, da sie sich kaum außerhalb ihrer Eskapaden bewegen. Zur Arbeit auf dem Gut taugen sie nicht – oder stellen sich einfach so ungeschickt an, dass niemand ihnen die Tätigkeiten zumutet.
Was sie den lieben langen Tag eigentlich treiben, will ich gar nicht so genau wissen. Hauptsache, sie lassen mich in Ruhe. Meistens.
Rasch stelle ich die Teller, die Ana mit einer silbernen Haube abgedeckt hat, auf den Tisch.
Libella nimmt eine der Hauben ab und inspiziert mit einem despektierlichen Blick die Speise darunter.
»Was soll das sein?«, keift sie.
»Das ist Rührei, Herrin«, antwortet Ana in ruhigem Tonfall.
»Habt ihr euch etwa selbst daran bedient?« Ihre Augen zucken zu mir und ihr Gesichtsausdruck wird verärgert. »Warum ist das so wenig?!«
»Das reicht ja nicht mal für einen von uns!«, echauffiert sich nun auch Baldan, der sich etwas vorgebeugt hat, um den Teller mit dem Rührei ebenfalls zu begutachten.
»Die Hühner … sie legen seit dem Fuchs-Überfall viel weniger Eier«, erklärt Ana entschuldigend. »Es tut mir leid, Herrin, ich …«
»Es tut dir leid?« Libellas Miene gleicht nun einer Gewitterwolke, während sie Ana anfunkelt. »Es tut dir leid?!«, wiederholt sie noch eine Spur lauter. »Dir sollte es leidtun, dass ihr den Fuchs überhaupt zu den Hühnern gelassen habt! Wir erwarten in sechs Tagen hochkarätige Gäste! Was sollen wir ihnen auftischen, wenn wir keine Eier haben?!«
»Wir … wir könnten neue Legehennen dazukaufen, dann …«, beginnt Ana, wird jedoch schroff von meiner Stiefmutter unterbrochen.
»Was erdreistest du dich, mir sagen zu wollen, was ich mit meinem Geld tun soll?«
»Mutter«, fährt Zabor, der jüngere Sohn, dazwischen. »Legehennen könnten das Problem vielleicht wirklich beheben.«
Libella will noch etwas hinzufügen, stutzt aber und sieht ihn mit schmalen Augen an. »Halt dein dämliches Maul!«, fährt sie ihn an. »Wozu gibt es denn in der Stadt Magier?« Ihr Blick gleitet zu mir. »Los, du Nichtsnutz! Geh in die Stadt und hol uns einen Erdmagier her. Er soll die Hühner heilen, damit sie wieder Eier legen.«
»I-ich …«, stammle ich, nicht sicher, warum sie mich mit solch einer Aufgabe betraut.
Noch nie war ich allein in der Stadt und schon gar nicht in einer der Elementgilden, geschweige denn im Heiltrakt, wo viele Erdbegabte ihren Tätigkeiten als Heiler nachgehen. Zumal die Dienste eines Magiers wohl mehr als ein paar Legehennen kosten werden.
»Stottere nicht! Los, hol einen Heiler her. Es ist schließlich deine Schuld, dass der Fuchs in den Hühnerstall einbrechen konnte. Hättest du dich nicht bei deinen stinkenden Schweinen verkrochen, wäre dieses Unglück nicht geschehen.«
Ich senke ergeben den Kopf und nicke. »Wie Ihr wünscht, Herrin Libella.«
»Ich werde die Kutsche …«, beginnt Ana, wird jedoch erneut von meiner Stiefmutter unterbrochen.
»Keine Kutsche! Das wäre ja noch schöner. Die Missgeburt soll zu Fuß in die Stadt gehen. Gib ihm gerade so viel Geld mit, dass er dem Heiler eine Kutsche für die Rückfahrt bezahlen kann. Nicht eine Münze mehr! Verstanden?«
Ana nickt ebenfalls und ich erhasche einen Blick auf das schadenfrohe Grinsen der beiden Brüder.
Nach Fayl ist es zu Fuß ein langer Marsch, quer durch die Weinberge, über Dutzende Hügel bis zum Fluss Rott, wo die Hauptstadt liegt. Mit meinen Schuhen, die an den Sohlen mehrere Löcher aufweisen und so dünn sind, dass ich jeden Stein spüre, wird es eine Tortur sein, den Weg zurückzulegen. Hinzu kommt die sommerliche Hitze, die derzeit das Land beherrscht. Da es bereits später Vormittag ist und ich mich noch um Vater kümmern muss, werde ich erst gegen Mittag aufbrechen können, was bedeutet, dass ich die Stadt nicht vor Schließung der Tore erreiche.
Aber es wird nichts bringen, mich gegen die Aufgabe aufzulehnen. Ein Wort der Widerrede und ich spüre Peitschenhiebe, das ist mir klar. Ein Wunder, dass sie mich nicht bereits hat auspeitschen lassen dafür, dass der Fuchs den Hühnerstall überfiel.
Daher verlasse ich nun zusammen mit Ana stumm den Speisesaal und bemerke den mitleidigen Gesichtsausdruck der Köchin.
Kapitel 4 - Trink, Brüderlein
Davyan
»Keine Sorge, ich kümmere mich um den Herrn, während du weg bist«, sagt Ana liebevoll, als wir in der Küche zurück sind.
Ich schenke ihr ein dankbares Lächeln.
Ana hat nie aufgehört, meinen Vater als ihren Herrn zu bezeichnen, obwohl sie nur ein Jahr in seinem Dienst stand, ehe er von dieser mysteriösen Krankheit befallen wurde, die ihn nach und nach dahinrafft. Sie ist neben mir die Einzige, die sich um ihn sorgt und ihn täglich besucht.
»Ich geh rasch bei ihm vorbei, so viel Zeit werde ich noch erübrigen vor meinem Aufbruch«, murmle ich und greife mir ein Glas mit Orangensaft, das ich ihm einflößen werde. Gegessen hat er schon seit Ewigkeiten nichts mehr, daher bekommt er morgens ein Glas Saft und mittags und abends eine starke Hühnerbrühe. Wie er trotzdem am Leben bleibt, ist mir schleierhaft.
»Tu das.« Sie streicht mir über den Arm. »Ich mache derweil alles bereit für deine Reise. Bis nachher.«
Schnell verlasse ich die Küche und schleiche mich durch das Gutshaus. Eigentlich nicht nötig, so vorsichtig zu sein, denn Libella und ihre Söhne werden noch eine Weile beim Frühstück sitzen. Dennoch habe ich es mir angewöhnt, so unauffällig wie möglich zu sein, wenn ich mich im Herrenhaus bewege.
Erst als ich mich zwei Etagen höher befinde, atme ich durch und gehe eiligen Schrittes auf die Tür zu, hinter der mein Vater seit über zwanzig Jahren liegt. Es hat gerade mal einen Tag gedauert, ehe Libella ihn aus dem gemeinsamen Schlafzimmer verbannte, nachdem er krank wurde. Sie hat die Bettlaken verbrennen lassen, als befürchte sie, sie könnte sich anstecken. Dass dem nicht so ist, beweisen Ana und ich tagtäglich, denn sonst hätten wir uns längst dasselbe eingefangen.
Vorsichtig öffne ich die Tür und trete ein.
Die Vorhänge des Zimmers sind zugezogen und lassen nur durch einen freien Spalt die Sonnenstrahlen herein. Abgestandene Luft empfängt mich – und das leise Schnaufen Vaters, das mich jedes Mal beruhigt.
Ich fürchte mich vor dem Tag, an dem ich eintrete und es still ist …
Schnell stelle ich den Orangensaft auf eine Kommode, durchquere das Zimmer und ziehe die Vorhänge auf, lasse die Sonnenstrahlen ein, die nur darauf gewartet haben. Ich öffne die Fenster ein wenig, um für frische Luft zu sorgen, dann wende ich mich dem Bett zu, in dessen Mitte Vater liegt.
Es ist jedes Mal erschreckend, ihn so regungslos und dünn dort zu sehen. Das große Bett lässt ihn noch schmaler und kleiner erscheinen. Er ist nur noch Haut und Knochen.
Ich erinnere mich gut an die Tage, als Kraft in diesem Körper steckte. Die breiten Schultern sind nun allerdings schmächtig, die Muskeln längst geschrumpft. Er hat die dunklen Augen geöffnet, aber sein Blick ist starr an die Decke gerichtet.
Manchmal frage ich mich, ob er überhaupt etwas wahrnimmt.
Leise trete ich an den Bettrand und lege ihm eine Hand auf den Kopf, lasse meine Magie in ihn fließen. Als ich dies das erste Mal tat, ist er zusammengezuckt – oder zumindest habe ich mir das eingebildet. Vielleicht, weil er nicht erwartet hat, dass ich diese Kräfte in mir trage? Ich war ja selbst erstaunt, als sie eines Tages plötzlich in mir erwachten.
So sehr ich mich bemühte, ich habe nie herausgefunden, woran Vater leidet. Aber das wäre wohl auch ein Wunder gewesen. Libella hat im ersten Jahr gefühlt jeden Heiler Fayls gerufen. Doch keiner konnte ihm helfen. Warum hätte es dann mir gelingen sollen?
Nichtsdestotrotz vermag ich ihm mit meiner Magie Linderung zu verschaffen.
Sanft schenke ich ihm etwas von meiner Wärme, stärke seine müden Glieder, suche seinen Leib nach Schmerzen ab und heile die Stellen, die durch die lange Bettlägerigkeit wund werden könnten.
Um mich besser zu konzentrieren, schließe ich die Lider, fokussiere mich ganz und gar auf ihn.
Meine Magie gleitet durch seinen Körper, ich kann sie verfolgen, schicke sie durch seine schlaffen Muskeln. Auch dank Vater habe ich gelernt, meine Kräfte besser zu beherrschen. Es ist wie ein tägliches Training, ihm mit meiner heilenden Magie zu helfen, und mit den Jahren wurde ich immer besser darin.
Nachdem ich fertig bin, blinzle ich und vermeine zu erkennen, dass seine Wangen etwas weniger blass sind. Dennoch gleicht sein schmales Gesicht dem eines Toten.
Früher war er gut aussehend. Vater war in seinen besten Jahren ein attraktiver Mann. Ansonsten hätte sich eine Frau wie Libella auch kaum für ihn interessiert und mit ihm sogar kurz nach der Heirat zwei Kinder gezeugt – Weingut hin oder her. Seine beiden Söhne haben allerdings nichts von ihm geerbt. Weder die dunklen Augen noch das schwarze Haar, das inzwischen strähnig und grau geworden ist. Ganz zu schweigen von seinem gütigen Wesen, dem ich es zu verdanken habe, zumindest die ersten Jahre meiner Kindheit mit einem richtigen Vater zu verbringen. Auch wenn uns nicht dasselbe Blut verbindet.
»Ich werde heute in die Stadt gehen«, sage ich leise und greife nach seinen Schultern, um ihn im Bett aufzusetzen. Hinter seinen Rücken stopfe ich ein paar Kissen, sodass er nicht gleich wieder zurückfällt. »Weißt du noch, als du mir versprochen hast, sie mit mir zusammen zu besuchen?«
Ich wende mich von ihm ab, um den Orangensaft von der Kommode zu holen. Dann kehre ich zu ihm zurück und setze das Glas an seine Lippen.
»Hier, der ist von Ana frisch gepresst«, erkläre ich und warte, bis er seinen Mund etwas öffnet, ehe ich vorsichtig das Getränk hineinrinnen lasse. »Schmeckt gut, oder?«
Vater antwortet mir natürlich nicht – aber er schluckt den Saft, was mich erleichtert lächeln lässt.
Mit der freien Hand streiche ich ihm ein paar der grauen Strähnen zurück, ordne sein Haar, sodass es nicht in alle Richtungen absteht.