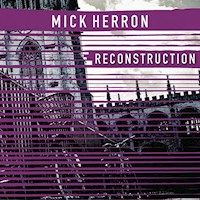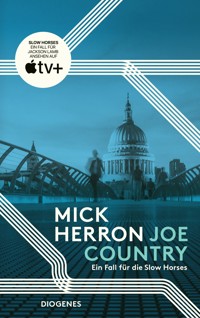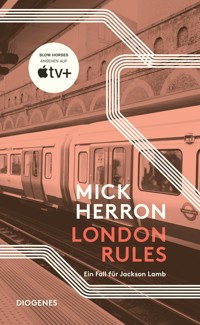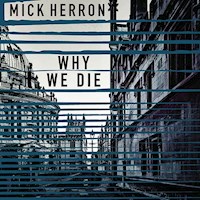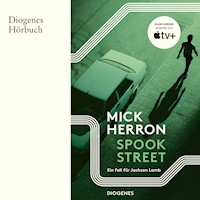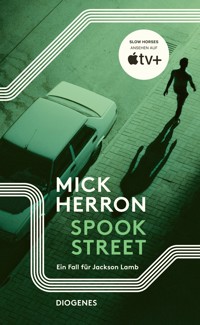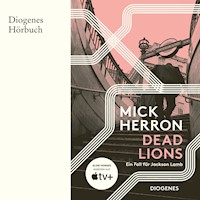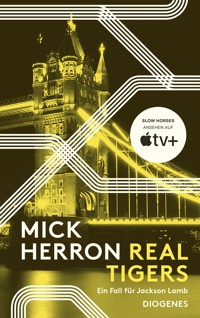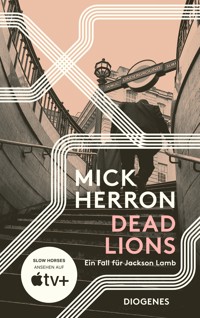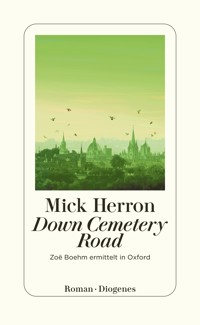
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sarah Tucker lebt in einem beschaulichen Vorort von Oxford, in der Rolle als Hausfrau gestrandet. Als jedoch nach einer Explosion in der Nachbarschaft ein Kind spurlos verschwindet, findet sie keine Ruhe mehr und holt sich Hilfe bei der Privatermittlerin Zoë Boehm. Gemeinsam bringen die beiden Frauen mehr Geheimnisse als Antworten ans Licht – Menschen, die lange für tot gehalten wurden, weilen unter den Lebenden, während sich immer mehr schnell zu den Toten gesellen. Vom ruhigen, abgründigen Pflaster Oxfords in ein Netz aus Verschwörungen von hochoffizieller Seite.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mick Herron
Down Cemetery Road
Zoë Boehm ermittelt in Oxford
Roman
Aus dem Englischen von Stefanie Schäfer Mit einem Vorwort von Emma Thompson
Diogenes
Für meine Mutter
und in Erinnerung an meinen Vater
Vorwort von Emma Thompson
Meine erste Begegnung mit Mick Herrons Werk werde ich nie vergessen. Es war vor gut fünfzehn Jahren an einem sonnigen Tag in der Buchhandlung meines Vertrauens. Ich stöberte im Regal mit den Empfehlungen der Mitarbeitenden – dabei kann man in der Regel nichts falsch machen, da sie offenbar alles lesen, was sie verkaufen, und einen richtig guten Riecher haben. Auf einem Buch klebte ein roter Zettel: »LIESMICHSOFORT,ODERVERPASSDIEPARTY«.
Neugierig, wie ich bin, ging ich direkt zur Kasse und begann zu lesen, noch bevor ich den Laden verließ. Das war in mancherlei Hinsicht ein Fehler. Nachdem ich von mehreren genervten Kunden, die ebenfalls ihre Bücher bezahlen wollten, unsanft angerempelt worden war, tappte ich vollkommen gebannt hinaus auf die Straße. Zwischendurch stieß ich ab und zu ein unkontrolliertes Schnauben aus, wie es entrückten Lesenden entfährt, wenn sie sich amüsieren.
Nachdem mich ein Radfahrer nur knapp verfehlt hatte, lehnte ich mich schließlich an die Wand, zu der ich als Kind immer aufgeblickt und mich dabei gewundert hatte, wie etwas so hoch sein konnte. Ein langsamer Schub der Erkenntnis durchströmte mich, falls so etwas möglich ist.
Zunächst dachte ich: Er muss ein Londoner sein.[1] Aus seinen Worten stieg die schmutzige und schurkenhafte Atmosphäre meines geliebten Heimatviertels auf (das heute, Jahrzehnte später, von hippen Cafés und alternativen Buchläden geprägt ist), ich spürte die ganze Traurigkeit der Nachkriegsjahre in den Straßen, die zynische Erschöpfung seiner Protagonisten (man kann sie kaum als Helden bezeichnen), den Schlendrian der Staatsbediensteten, die Welt meiner ahnungslosen Kindheit, mehr Graham Greene als Ian Fleming, aber irgendwie ohne Greenes allzu traurige Melancholie. Sämtliche Spielarten von Humor waren vertreten. Die Situationen waren lustig, die Sprache war lustig, die Dialoge waren lustig, die Menschen waren lustig, und es gab echte Gags.
Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen – es sind keine Komödien. Sie sind voll mit Dingen, über die wir lachen. Und das sind meistens die schrecklichen Dinge.
Ich las sofort alle seine übrigen Werke.
In seinen Charakteren – den Gescheiterten, den Einsamen, den übel Zugerichteten, den Verwirrten und sogar den ausgesprochen Bösen – glimmt stets ein Funke. Ein Funke des verlorenen Anstands, der in Erinnerung geblieben ist und dessen Verlust vielleicht sogar betrauert wird. Ein Funke in den Herzen derer, die durch seine labyrinthischen Gänge unter und über der Erde wandern, eine Ahnung, dass man nur lange genug suchen muss, um den zutiefst menschlichen Teil in uns allen zu finden.
Seine Welten sind düster und korrumpiert, voller dantesker Wendungen und – weniger poetisch – schwefeliger Gerüche. Manchmal schlagen einem diese Visionen aufs Gemüt und rufen kaltes Schaudern hervor, ja beschwören – besonders in diesen Zeiten – eine beklemmende Ahnung unangenehmer, gewalttätiger Turbulenzen im menschlichen Zusammenleben herauf.
Aber noch nie hat mich eines seiner Bücher hoffnungslos zurückgelassen – und ich habe sie alle immer und immer wieder gelesen.
Kurz gesagt, er bringt trübe Gewässer zum Leuchten.
Als ich viele Jahre später das Angebot erhielt, Zoë Boehm zu spielen, die in dem Buch, das Sie gerade beginnen – oder erneut lesen –, zum ersten Mal auftritt, war es, als würde ich durch diese hohe Mauer der Kindheitserinnerung treten, weg von der sonnigen Straße in seine vertraute, aber seltsame und bittersüße Welt.
Ebenso wie Alice im Wunderland nahm ich die Einladung an und erlebte viele Abenteuer, einige urkomisch, andere schaurig. Zoë war in ihrer Lederjacke, ihren klobigen Stiefeln und mit ihrer gepanzerten Seele eine großartige Begleiterin. Mögen Sie dieses Buch genauso unwiderstehlich finden wie ich vor all den Jahren, und mögen Sie den gemeinsamen Funken der Heiterkeit und des Mitgefühls in der Dunkelheit finden – wie Flecken von Meeresleuchten in der Themse.
Während er die Augen aufschlug, erwartete er, dass alles Licht der Welt erloschen wäre, aber nein: Er war noch am Leben, festgeschnallt an ein Bett in einem sterilen Raum, der Schmerz grub mit wütenden roten Krallen Furchen in sein Fleisch. Sie haben mich gefesselt, damit ich mich nicht selbst in Stücke reißen kann, dachte er in einem Moment der Klarheit. Damit ich mir nicht die Haut von den Knochen ziehe, bis ich tot bin. Ein ermutigender Gedanke: Er setzte voraus, dass sie sein Wohlergehen im Sinn hatten. Aber der Schmerz blieb, als würden Feuerameisen an ihm nagen, und selbst im Schlaf spürte er ihn in seinen Träumen pulsieren. In seinen Träumen war er wieder in der Wüste. Seine Gefährten waren tote Soldaten, denen das Fleisch von den Knochen fiel.
Das lauteste Geräusch der Welt war ein Hubschrauber. Überall um ihn herum zersetzten sich die Kindersoldaten und hinterließen Pfützen im Sand.
Hier gab es, wenn er wach war, andere Geräusche, um ihn abzulenken. Vor seinem Zimmer stellte er sich einen langen Flur mit blanken Fliesen und weißem Licht vor; einen hallenden Tunnel, der Geräusche an seiner Tür vorbeitrug, von denen manche verweilten, um ihn in seiner Langeweile zu verspotten. Der Klang eines fallen gelassenen Besteckteils klirrte stundenlang in seinem Kopf. Er vernahm auch Stimmen, ein leises Gemurmel, das nie zu Sprache gerann, und einmal glaubte er, Tommy zu hören; glaubte, einen Mann auszumachen, den er kannte, in einem Geräusch, das eher tierisch klang: ein immer schrillerer Schrei, der von einer zuschlagenden Tür unterbrochen wurde. Schritte entfernten sich klappernd. Etwas auf Rädern, vielleicht ein Rollwagen. Er versuchte zu rufen, aber seine Stimme verlor sich im tiefroten Schlund seines Schmerzes, und er konnte nichts weiter tun, als stumme Tränen zu weinen, die seine Wangen versengten.
Einmal am Tag kam ein Arzt. Er musste Arzt sein: Er hatte einen weißen Kittel an. Die Krankenschwester, die ihn begleitete, trug ein Tablett; darauf eine präzise Anordnung von Werkzeugen – Nadeln unterschiedlicher Größe, Fläschchen mit farbigen Flüssigkeiten. Sowohl die Krankenschwester als auch der Arzt trugen Handschuhe und OP-Masken, beide hatten olivfarbene Haut und haselnussbraune Augen. Nur der Arzt sprach. Seine Sätze waren kurz und prägnant: Einatmen. Ausatmen. Ich nehmen jetzt Blut ab. Selbst ohne Maske hätte er wohl kaum fließend Englisch gesprochen. Dies war ein weiterer Hinweis darauf, wo er sich befand … Nicht alle Nadeln waren für ihn bestimmt, also war er nicht allein hier; es gab andere Zimmer, andere Patienten, obwohl »Patienten« nicht das richtige Wort war. »Gefangene«, ergänzte sein Verstand. Er war hier Gefangener, aber wo »hier« war, konnte er nicht mit Sicherheit sagen.
Der Arzt befahl: »Schlafen Sie.« Als wäre es ein Zauberspruch und er das Kaninchen, das wieder in den Hut gesteckt würde.
Die Krankenschwester war schön, wie Krankenschwestern nun einmal zu sein haben. Sie kam öfter und fütterte ihn, wischte ihn ab und kümmerte sich um seinen Stuhlgang. Nichts, was er tat, brachte sie zum Sprechen. Selbst eine Erektion, für ihn fast ein Wunder, ließ sie ungerührt. Ansonsten hatte er nur ein paar Phrasen aus Schultagen im Kopf – Parläi vu? Sprecke du Doitch? –, die ihm nicht weitergeholfen hätten, selbst wenn sie geantwortet hätte. Und außerdem war er überzeugt, dass sie, wenn überhaupt, in einer Sandsprache reden würde, deren lange Silben ihn hilflos stranden lassen würden wie einen Reisenden, der zwischen Siedlungen umherirrt. Bald vergaß er, dass sie ein Mensch war. Wenn er sie nicht sehen wollte, wandte er sein Gesicht zur Wand.
Tage vergingen. Es gab keine Möglichkeit, sie zu zählen.
Seine Wunden heilten, aber nur langsam: Rote Striemen bedeckten seine Haut, an allen Stellen, die er sehen konnte, und ein kleiner Teil seines Verstandes – seine Blackbox – sagte ihm, dass es nun für immer so bleiben würde; dass sein Körper für immer vernarbt und abstoßend sein würde, aber zumindest ließ der Schmerz nach. Er wurde nicht mehr festgeschnallt. Allein eine Fußfessel fixierte ihn am Bett. Irgendwann würde er vielleicht etwas dagegen unternehmen.
Einmal stahl er in einem unbeobachteten Moment einen Löffel; er stibitzte ihn vom Tablett, als die Krankenschwester sich wegen eines Geräusches auf dem Flur umdrehte. Er versteckte ihn unter der Matratze, aber es verging keine Stunde, ehe sie kamen, um ihn zu holen – drei Männer, schweigsam, mit dunklen Gesichtszügen. Zwei drückten ihn gegen die Wand, während der dritte seine Beute holte. Sie gingen nicht grob vor, und er wehrte sich nicht. Aber die Anstrengung erschöpfte ihn trotzdem, und er brach zusammen, sowie sie aus der Tür waren. Sein Traum führte ihn zurück in die Wüste und zu den Kindersoldaten. Der Sand knirschte, als er vom Lastwagen fiel, und das Heulen des Hubschraubers war das lauteste Geräusch der Welt. Und die Jungen schmolzen wieder, ihre Gesichter wurden flüssig, während seine Blackbox dies unbewegt aufzeichnete und nichts anderes feststellte als: Es ist, als betrachte man ein nasses Gemälde, das im Wind hängt – aber er schwitzte, als er aufwachte, und war sich sicher, dass er geschrien hatte. Niemand war da, der ihm sagen konnte, ob das stimmte. Genauso wenig, wie ihm jemand sagen konnte, ob es Tag oder Nacht war.
Er hätte seine Seele verkauft für ein Fenster. Für natürliches Licht.
Und dann, eines Tages – vermutlich im Winter, die Luft war kalt und schneidend –, holten sie ihn aus dem Zimmer. Dieselben drei Männer kamen, um ihn am Bett zu fixieren. Man verband ihm die Augen und schob ihn durch die Tür, den Flur hinunter, der bisher nur in seiner Fantasie existiert hatte; man rollte ihn an Fenstern vorbei, durch die – dessen war er sich sicher – weiches Licht in regelmäßigen Abständen auf sein Gesicht fiel. Er stemmte sich gegen die Fesseln, aber sie gaben nicht nach. Als sie ihm die Augenbinde abnahmen, befand er sich in einem Raum, der wie ein Operationssaal aussah. Der Arzt war da, in OP-Maske und -Kittel, und wies die drei Pfleger – die Wachen – an, ihn loszubinden und in etwas festzuschnallen, das einem offenen Sarg ähnelte. Weil er dachte, dass sie ihn endlich töten würden, wehrte er sich nicht. Doch stattdessen wurde er in eine große Apparatur geschoben, wie sie ihm aus Krankenhausfilmen bekannt vorkam. Eine Art Scanner. Dort musste er etwa zwanzig Minuten lang ausharren. Das Geräusch war konstant, aber nicht allzu laut, als summte ein Bienenschwarm in der Nähe. Er wäre fast eingeschlafen.
Danach sagte der Arzt: »Gut.« Man schnallte ihn wieder fest, verband ihm die Augen und brachte ihn zurück in sein Zimmer. Wieder spürte er, wie die Fenster an ihm vorbeizogen, und sein einziger Wunsch war nicht einmal, zu fliehen, sondern einfach nur, im Licht stehen zu können und sich vorzustellen, wie der Wind in Böen über seine verletzte Haut strich.
Danach geschah es regelmäßig. Etwa alle drei Tage, soweit sein Körper wusste … Es gab keine anderen Zeitmesser. Das war eine der Entdeckungen, die er gemacht hatte: dass der Körper eine Art Uhr war. Man konnte sie nicht aufziehen und nicht ersetzen. Wenn sie aufhörte, das Verstreichen der Zeit anzuzeigen, war ihre Aufgabe erfüllt. Alle drei Tage brachten sie ihn in den OP und scannten ihn mit ihrem Gerät. Er stellte nie eine Frage. Das war sein Plan: Sie sollten vergessen, dass er da war, und ihm für einen Moment den Rücken zukehren. Selbst ohne Löffel glaubte er ihnen ein Auge oder eine Zunge nehmen zu können.
Er erfuhr es nie, aber es war an einem Mittwoch, als sich alles veränderte; als er einen Blick auf die Außenwelt erhaschte und sie auf dem Kopf stehend vorfand.
Er schlief, als die Krankenschwester kam. Er schlief tief. Das lag an den Tabletten und den Blutabnahmen: Obwohl er sich kaum bewegte, fühlte er sich oft schwach und müde. Er war immer noch mit einem Fuß ans Bett gefesselt. Sie hielt das wohl für sicher genug, und vielleicht hatten die anderen, die Männer, einen Tag frei. Er erfuhr es nie. Es war auch egal. Die Schwester schob ihn so aus dem Zimmer, nur mit der Fußfessel fixiert.
Es war die Bewegung, die ihn weckte. Er hatte wieder geträumt – der Traum verließ ihn nie, oder vielleicht verließ er nie den Traum –, sein Kopf voller kochender Gesichter, und er zwang sich, die Augen zu öffnen, so wie er immer erwachte. Für einen Moment dachte er, es hätte noch nicht begonnen, er wäre wieder im Lastwagen, und instinktiv warf er sich zur Seite und schlug unter dem Scheppern von heruntergefallenem Metall auf dem Boden auf. Das Bett kam ruckartig zum Stehen. Der Kittel weit auseinandergefallen, der nackte Hintern in der Luft, lag er nur einen halben Meter unter dem Fenster, dessen Jalousien ganz heruntergezogen waren, um das Licht auszublenden. Und er hatte beide Hände frei.
Selbst dann sagte die Krankenschwester nichts. Stattdessen drückte sie auf etwas an ihrem Gürtel, obwohl er keinen Alarm hörte, und als er mit einer Hand nach der Jalousie griff, kam sie, um ihn davon abzuhalten. Er dachte, sie würde sanft zu ihm sein, aber sie schlug ihm auf den Hinterkopf. Es war schon eine Weile her, dass man ihn so grob behandelt hatte, und er fiel zu Boden und riss die Jalousie mit sich. Es klang laut wie ein Hubschrauber. Und dann kamen Füße und ein Stich in seinen Arm, und sie schickten ihn zurück in die Wüste, wo er auf keinen Fall hinwollte, nicht jetzt, wo er das Licht gesehen hatte – nicht jetzt, wo er den Himmel gesehen hatte und die Baumkronen und den Bogen des Gebäudes gegenüber, das mit seinen steinernen Schnörkeln und dem Taubenkot England schrie –, doch dann öffnete die Nadel das Fenster in seinem Kopf, und er flog zurück in die Wüste. Das Licht war nur die Morgensonne, die ihre tödliche Glut entfaltete. Die Kindersoldaten starben wieder, aber niemand hörte ihre Schreie.
EINSBHS
1
Wenn Sie ein Feuer entdecken, so begannen die Anweisungen, schreien Sie »Feuer«!, und versuchen Sie, es zu ersticken. Es war ein zweckdienlicher, nüchterner Ratschlag, der sich fast unbegrenzt anwenden ließ. Wenn Sie entdecken, dass die Gäste Ihres Mannes Arschlöcher sind, schreien Sie »Arschloch!«, und versuchen Sie, sie zu ersticken. Das war ein guter Anfang. Sarah war nur noch ein Glas Wein davon entfernt, es umzusetzen.
Doch diese Anweisungen hatten in ihrem Büro an der Wand gehangen, als sie noch gearbeitet hatte, und galten nicht für die Küche. Hier erwartete Mark, dass jeglicher Notfall ordnungsgemäß bewältigt – Krisenmanagement war sein neuer Spleen – und unverzüglich nach Schwere, Art und karriereschädigendem Potenzial eingestuft wurde: Erdbeben, Großbrand, Nudelknappheit. Seine Gäste standen nicht auf dieser Liste, da sie unter »höhere Gewalt« fielen und als solche zu ertragen waren. Natürlich sind sie Arschlöcher, Sars, würde er sagen, wenn sie weg waren und er sich Ironie wieder leisten konnte. Er ist reich, und sie ist dumm: Was hast du erwartet? Dass sie nett sind? Aber wenn Sarah fragte, wann Reichtum wichtig geworden war, würde seine Ironie verfliegen. Seitdem Reichtum auf meiner Kundenliste steht, würde er sagen. Seitdem wir vom Reichtum profitieren. Selbstvermarktung war sein anderer neuester Spleen. Er hatte jetzt immer zwei davon, um sicherzugehen, dass er nichts verpasste.
Und jetzt kam er in die Küche, um sicherzustellen, dass auch sie nichts verpasste. »Ist der Kaffee fertig?«
»Fast.«
»Kann ich dir helfen?«
»Das solltest du in Zukunft vielleicht zuerst fragen.«
»In Zukunft? Meinst du, ich will das noch mal durchmachen?«
Sie knallte eine Schranktür zu, nicht so laut, dass es nebenan auffiel, aber laut genug, dass Mark es verstand.
»Ich meine«, fuhr er im Flüsterton fort, »Wigwam? Rufus?«
»Du hast gesagt«, erwiderte sie mit zusammengebissenen Zähnen, »ein zweites Paar. Du wolltest unbedingt noch jemanden dabeihaben.«
»Ich dachte an Stephen und Rebecca.«
»Die hatten schon was vor.«
»Oder Tom und Annie. Oder –«
»Keine Zeit.« Sie holte tief Luft. Aus dem Wohnzimmer kam dieses schreckliche, tote Geräusch, das man wahrscheinlich auf Schlachtfeldern hörte, bevor die Bussarde herabstießen. »Und als ich eingewandt habe, dass es sehr kurzfristig ist, hast du gesagt, dann lade doch einfach irgendjemanden ein, der Zeit hat. Egal wen.«
»So habe ich das nicht gemeint.«
»Dann hättest du das vorher sagen sollen. Jetzt ist es ein bisschen spät, meinst du nicht?«
Mark lachte kurz auf, was auch ihm selbst hätte gelten können. Es war eine seiner typischen Kapitulationserklärungen, wobei sie genau wusste, dass das nicht lange anhalten würde. Jedenfalls sagte er als Nächstes: »Du hast doch diese Pfefferminzbonbons geholt, oder?«
»Ja. Mark.«
Also änderte er die Taktik, legte die Arme um sie: »Jetzt komm schon. So schlimm ist es doch auch nicht, oder?«
Er hatte es tatsächlich nicht mitgekriegt. Zwei Stunden lang hatte er mit angesehen, wie in Zeitlupe der Krieg erklärt wurde, und er dachte immer noch, so schlimm sei es nicht gewesen. »Warst du etwa nicht dabei?«
»Er hat eben sehr entschiedene Ansichten. Gerard.«
»Mir war klar, dass du nicht Rufus meinst.«
»Er ist es eben gewohnt, seinen Standpunkt zu vertreten. Eine Art Schlagabtausch …«
»Er ist ein Vampir.« Sie befreite sich und sah als Ausweichmanöver nach, ob der Wasserkocher eingesteckt war. War er. Das Wasser hatte nur noch nicht gekocht. »Geh wieder rein, und pass auf, dass er meine Freunde nicht beißt.«
»Denen mit ihrer Greenpeace-Empfindlichkeit schadet es auch nicht, wenn sie mal aus der Reserve gelockt werden.«
»Aus der Reserve locken ist in Ordnung. Aber er will beweisen, wer den Größten hat, und das geht zu weit.«
»Sarah …«
»Geh einfach. Geh und streichle sein Ego. Nimm meinetwegen die Federboa, wenn du meinst, dass das hilft.«
»Ich habe ihn fast an der Angel«, flüsterte Mark auf dem Weg nach draußen. »Ich bin so nah dran!«
Und du hast ihre Beine angestarrt, fügte sie in Gedanken hinzu. Die der Vorzeigefrau. Du Scheißkerl. Aber Mark war schon weg.
Sie goss das Wasser ein, suchte und fand ein Tablett und gab die Pfefferminzbonbons in eine Schüssel. Es waren in Folie verpackte, mit Schokolade überzogene Pfefferminzbonbons, und sie aß eines, während sie darauf wartete, dass der Kaffee durchlief, und ein weiteres, während sie nach Löffeln suchte. Die Tassen passten nicht zusammen. Ein Kommentar von Mark, und es wäre ein Trennungsgrund. Dann zählte sie die Pfefferminzbonbons: zwei pro Person und eines übrig. Sie aß es und trug das Tablett hinüber.
»Waffen«, sagte Gerard mit der Miene eines Zauberers, der eine Kröte hervorzaubert, wenn die Kinder ein Häschen erwartet hatten.
»Du sammelst Waffen?«, fragte Wigwam, und es klang wie: Du vergreifst dich an kleinen Kindern? Wigwam entschuldigte sich, wenn ihr jemand auf den Fuß trat. Waffensammler waren das Letzte für sie.
»Was dachtest du denn? Dass ich Briefmarken sammle?«
»Na ja, ich weiß nicht …«
»Gerard besitzt ein paar sehr teure Waffen.«
»Von billigen Waffen«, ergänzte Gerard, »sollte man die Finger lassen.«
»Meiner Meinung nach«, sagte Rufus mutig, »ist diese Art von Interesse, du weißt schon, eine Art Kompensation …«
»Hört, wer spricht. Ich für meinen Teil leide nicht unter Penisneid.«
Sarah stellte das Tablett auf den niedrigen Tisch, um den sie saßen: Gerard in einem Sessel, Wigwam auf dem Boden, die anderen teilten sich das Sofa. Gerardbrauchte einen ganzen Sessel für sich, benahm sich aber nicht so, und das ging Sarah auf die Nerven. Übergewichtige sollten sich zu ihrer Situation bekennen und dafür bestraft werden. Aber Gerard bewegte sich wie ein Mann, der nur halb so dick war wie er. Sie hatte von der besonderen Anmut gelesen, die manche dicke Männer an sich haben, und es für Propaganda gehalten, aber seine Gesten waren sparsam und kontrolliert, als wäre ein Teil seines überaktiven Geistes mit Choreografie beschäftigt. Er machte jetzt zierliche Bewegungen mit seiner nicht angezündeten Zigarre und unterstrich Sätze mit kleinen, pointierten Gesten. Er hatte um Erlaubnis gebeten, rauchen zu dürfen, schien jedoch von ihrer Ablehnung kaum enttäuscht zu sein. Jetzt wackelte die Zigarre wie ein Totem gegen das Böse in seinen langen, aber wurstigen Fingern. Mit einem eigenen Kruzifix hätte sie sich sicherer gefühlt. GerardInchon war ein Mistkerl durch und durch.
»Worunter leidest du denn?«, fragte sie.
»Wie bitte?«
Mark sprang in die Bresche und hantierte klappernd mit Kaffeetassen. »Wer möchte Zucker?«
»Ich habe gefragt, worunter du leidest, wenn nicht unter Penisneid? Du hast viel darüber erzählt, wie toll dein Leben ist, aber es läuft doch bestimmt auch mal was schief, oder? Der Aschenbecher im Porsche ist voll, oder dein Schneider hat verschlafen …«
»Gerard bekommt alle seine Anzüge –«
»Sarah hat einen Witz gemacht, Schatz.«
»Wenn alles so perfekt ist, warum musst du dann vor Krethi und Plethi damit protzen?«
»Ich bin ja wohl kaum Krethi und Plethi«, erwiderte Mark.
»Ich meinte nicht dich.«
GerardInchon lächelte. »Ich nehme an, das passiert dir öfter«, sagte er zu Sarah. »Dass Gäste spontan zum Abendessen kommen. Fremde, zu denen man höflich sein soll.«
»Nein, eigentlich nicht. So wichtig ist Mark nicht. Noch nicht.«
»Sarah …«
»Aber das wird er sein. Also musst du dich daran gewöhnen. Denn viele von ihnen werden penetranter sein als ich.«
Das erschien ihr unwahrscheinlich.
»Und sie werden deinen oberflächlichen Small Talk und deine kaum verhohlene Verachtung vermutlich unangenehmer finden als ich. Zum Nachteil der Karriere deines Mannes. Und was machst du dann?«
»Eine Band engagieren«, sagte sie. »Eine richtige Party schmeißen.«
Wigwam sagte: »Meine Güte, ich brauche unbedingt einen Kaffee. Sind das Pfefferminzbonbons?«
»Also hast du gar nichts gegen mich, sondern gegen den Job deines Mannes?«
Mark sagte: »Hör mal, es tut mir wirklich leid …«
»Wage es nicht, dich für mich zu entschuldigen!«
»Eine Entschuldigung ist nicht nötig. Aber ich bin gespannt, wofür Sarah sich entscheiden wird. Für welches Verhalten, meine ich.« GerardInchon ließ seinen Blick durch den Raum schweifen, als erwarte er Vorschläge, und wandte sich dann wieder ihr zu. »Du arbeitest nicht, oder?«
Der Themawechsel überraschte sie. »Ich – nein. Im Moment nicht.«
»Du warst im Verlagswesen, oder?«
Sie warf Mark einen feindseligen Blick zu. »Wenn du es weißt, warum fragst du dann?«
»Ich wusste es nicht. Ich habe geraten. Mal sehen, keiner von den Großen, was Engagiertes. Dritte Welt? Ökologie?«
»Soll das ein Witz sein?«
»Alternative Medizin? Oder gleich alles auf einmal?«
»Green Dolphin Press«, sagte Sarah. »Wenn du es unbedingt wissen willst.«
»Mit einer Auflage von dreihundert Stück, von denen weniger als die Hälfte verkauft wird.«
Es klang, als kenne er die Bücher. »Viele Unternehmen gehen pleite.«
»Und viele nicht. Was hast du dann gemacht, im sozialen Bereich gearbeitet?«
»Mein Gott, was für ein Klischee. Aber das würde dir gefallen, oder? Suppenküchen. Armenhäuser.«
»Ich könnte die Reihe beliebig fortsetzen. Also wo, in einem Obdachlosenheim? Wird von guten Samariterinnen immer gern genommen.«
Wigwam wandte ein: »Ach, es gibt so viele –«
»Lass mich raten«, fuhr Gerard fort. »Sie konnten dich da nicht gebrauchen.«
Sarah schüttelte ungläubig den Kopf. »Was soll das?«
»Tja, ich erlebe das nur allzu oft. Der Ehemann verdient das Geld, und das Frauchen hat nichts zu tun. Wer keine Affäre hat, geht shoppen. Wer nicht shoppen geht, macht auf sozial.«
»Du bist echt widerlich, weißt du!«
»Deshalb sind diese Stellen ja auch so begehrt. Jedenfalls die interessanten. Woran lag es, mangelnde Erfahrung?«
Ihre Bewerbung war abgelehnt worden.
»Und dann bleiben nur die öden Jobs übrig. Einzelhandel zum Beispiel. Um das durchzuhalten, hast du nicht den Mumm.«
Der Oxfam-Laden hatte sie entlassen.
GerardInchon lehnte sich in seinem Sessel zurück. »Ich nenne es gern BHS.«
Hoffentlich fragt keiner, betete Sarah.
»Bored Housewife Syndrome. Die meisten Frauen langweilen sich natürlich gerne, aber es gibt ein paar, die –«
»Du widerlicher Mistkerl!«
»… auf Dinnerpartys mit Wackelpudding schmeißen. Aber das hier genießt du doch, oder?«
»Was?«
»Ein bisschen Aggressivität, ein bisschen Härte.« Er ließ seine Zigarre wie ein Amateurzauberer von einer Hand in die andere wandern. »Ich wette, du hast dich seit Ewigkeiten nicht mehr gefetzt. Du brauchst mehr Aufregung.«
In dem Moment flog das Haus in die Luft.
Der Abend hatte schon übel angefangen. Die Vorzeigefrau kam zuerst, unpassenderweise schon zehn Minuten zu früh: overdressed und sichtlich enttäuscht; offenbar hatte sie eine ganz andere Art von Party erwartet. Sarah hatte gerade eine Küchenkrise und sich ihren Namen nicht merken können; Mark musste einspringen, der Dame etwas zu trinken anbieten und sich nach ihrem Mann erkundigen. Gerard suche einen Parkplatz, er komme gleich. Aus »gleich« wurde eine Dreiviertelstunde: Das war selbst für South Oxford ein Rekord. In der Zwischenzeit tauchte Wigwam ohne Rufus auf, der etwas Nebulöses erledigen musste und bald nachkommen würde. Die meisten Dinge, die Rufus betrafen, waren nebulös, sogar solche, die konkret angefangen hatten. Wigwam war Sarahs älteste, anstrengendste Freundin; Rufus ihr überraschender Neuerwerb, aber nur überraschend, weil er jünger war und bereit, sich auf ihre Kinder einzulassen. In jeder anderen Hinsicht war er ein ganz gewöhnlicher Typ, und um ein Haar hätte Sarah auch seinen Namen nicht behalten.
»Wie schön, dich zu sehen«, heuchelte Mark, der Wigwam für eine antiquierte Kuriosität hielt und normalerweise dringende Angelegenheiten vorschützte, wenn sie sich ankündigte. »Ein Glas Wein? Rot? Weiß?«
Wigwam lehnte ab und zitierte aus einem Artikel über Harnwegserkrankungen durch Alkoholkonsum. Die Vorzeigefrau sah Wigwam an, als wäre sie aus dem Zoo ausgebüxt.
Zwischen ihnen lagen Welten, schon angefangen beim Outfit. Die Vorzeigefrau trug ein rotes Slipdress, das zehn Zentimeter über dem Knie endete, und dazu passenden Lippenstift. Eine Plakatschönheit mit einer Figur wie aus dem Playboy. Mark starrte sie an, als hätte man ihn mit dem Besenstiel eins übergezogen. Vom Sabbern hielt ihn seine gute Kinderstube ab, aber man sah ihm deutlich an, was er dachte.
Neben ihr wirkte Wigwam wie ein Hippie, obwohl sie andererseits auch neben Bob Dylan wie ein Hippie gewirkt hätte. Um zu beschreiben, was sie an diesem Abend trug, hätte man sich mit der Anthropologie der 1970er-Jahre auskennen müssen; wahrscheinlich etwas, das Abba aussortiert hatten, als sie sich für die weißen Hosenanzüge entschieden. Ein lila Schlabber-Onesie, die Reinkarnation eines Sofaüberwurfs. Das übrige Outfit vereinte verschiedene Stilelemente: Schmuck von Friends of the Earth; Haare à la Vogelscheuche. Wigwam besaß ein wunderschönes Lächeln, das sie die meiste Zeit über zeigte. In unbeobachteten Momenten hatte Sarah in ihrem Gesicht jedoch eine fast herzzerreißende Traurigkeit gesehen, als beruhte ihr natürlicher Optimismus auf dem Wissen, dass es in ihrem Leben unmöglich noch schlimmer kommen könnte. Sie war vor sechs Monaten mit Rufus zusammengekommen, und das Lächeln war seitdem nicht verschwunden.
»Kann ich dir in der Küche helfen?«, fragte sie Sarah.
»Da ist nichts mehr zu retten.«
»Kochst du selbst?«, fragte die Vorzeigefrau so erstaunt, als hätte Sarah einen lebendigen Elefanten in der Küche und keinen toten Lachs.
»Das hatte ich vor.«
»Sarah kann toll kochen«, schwärmte Mark, was wahrscheinlich als Zeichen der Loyalität gedacht war. »Nicht wahr, Schatz?«
»Natürlich.«
»Obwohl – weißt du noch, das Rührei?«, fragte Wigwam und konnte sich vor Kichern nicht halten.
»Das Ei war okay, nur die Pfanne war hin.«
Die Vorzeigefrau guckte verständnislos, und Mark schenkte Getränke nach. Er war nervös; es war ein wichtiger Abend für ihn. Dieser Inchon war ein potenzieller Kunde von Der Bank Ohne Namen; dass er die Einladung zum Abendessen angenommen hatte, war fast so, als erscheine der King zur Gartenparty. Zwei Tage zuvor hatte Mark seine Frau vor vollendete Tatsachen gestellt und darauf gedrängt, dass sie ein zweites Paar einlud – er hatte Inchon gegenüber behauptet, sie erwarteten Freunde und es ginge keinesfalls, absolut nicht, um Geschäftliches. Natürlich hatte Mark an Tom und Annie oder Stephen und Rebecca gedacht, die sich benehmen und höchstens hinterher lästern würden. Sarah hatte sich gerächt, indem sie stattdessen Wigwam und Rufus eingeladen hatte. Zwischendurch hatte sie überlegt, ob das gemein gewesen war. Gemein gegenüber Mark. Jetzt wurde ihr klar, dass eher Wigwam und Rufus die Dummen waren.
»Hast du dein ganzes Leben in Oxford verbracht?«, fragte die Vorzeigefrau.
»Bis jetzt noch nicht«, antwortete Sarah.
»Wir haben vorher in Birmingham gewohnt«, warf Mark ein. »Wir sind vor gut zehn Jahren hierher gezogen, oder, Schatz?«
Ihre Rolle an diesem Abend bestand darin, zu allem Ja und Amen zu sagen.
»Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht«, sagte Wigwam. Dann fiel der Groschen, und sie fing wieder an zu kichern.
Sarah entschuldigte sich, sie habe in der Küche zu tun, und nahm sich ausgiebig Zeit für die Salatsoße. Währenddessen traf Rufus ein, was die Stimmung nicht merklich hob. Immerhin hatte er sich die schmuddelig-blonden, offenbar selbst geschnittenen Haare gewaschen. Rasiert hatte er sich allerdings seit Tagen nicht, ganz der trotzig-stolze Proletarier unter Spießern, und damit auch sein einziger Versuch, einen Eindruck zu hinterlassen. Die weißen Flusen vorne auf seinem Sweatshirt vom vielen Naseputzen mit Klopapier waren wohl keine Absicht. Ein Heuschnupfen-Märtyrer, der sein Kreuz tapfer trug.
Die Vorzeigefrau war sichtlich erleichtert, als ein Klingeln an der Tür die Ankunft ihres edlen Ritters ankündigte. Allein und unbewaffnet hatte er den Porsche geparkt. Als Sarah aus der Küche kam, kriegte sie gerade noch ihre Begrüßungs-Bussis mit: »Du hast ja ewig gebraucht.«
»Hier ist überall Anwohnerparken. Ich musste den Wagen auf der anderen Seite des Parks abstellen und von da aus zu Fuß gehen.«
»Wo ist deine Aktentasche?«
»Die habe ich im Auto gelassen.«
»Aber ich dachte …«
»Im Kofferraum, Liebling. Da ist sie sicher.« Er wandte sich Sarah zu. »Sie hat Angst, in eurer Gegend könnte das Auto aufgebrochen werden. Du musst Sarah sein. Es ist mir eine Freude.«
Und dies war ihre erste Begegnung mit GerardInchon, einem Mann, von dem sie schon viel gehört hatte; gelegentlich las sie sogar in der Zeitung über ihn, in gut recherchierten Artikeln im Wirtschaftsteil. Er war erst Mitte dreißig, sah aber aus wie vierzig oder älter: dicker Bauch, feistes Gesicht, und mit dem wenigen, nach hinten gekämmtem Haar, dem spitzen Haaransatz und dem Doppelkinn konnte er ohne Umwege ins mittlere Alter eintreten. Mark hatte ihn wohl zu Recht als »dicken Fisch« bezeichnet, aber hinzugefügt, Inchon expandiere im Osten, wenn alle anderen den Schwanz einkniffen, was auch immer das bedeutete. »Er ist ein Spieler, ein Macher, und sehr einflussreich«, hatte Mark erklärt. Früher hätte er Wichser gesagt und dasselbe gemeint. Und für Sarah genügte dieser erste Eindruck: Der Mann trug die dünne Lackschicht der Zivilisation, unter der sich ein Höhlenmensch verbarg. Die zivilisierte Version spielte »Beggar Your Neighbour«. Der echte GerardInchon fraß seinen.
Und er machte keinen Hehl daraus. »Nette Hütte hast du hier, Mark. Aber das Kaff ist ja furchtbar. Wann ziehst du nach London?«
»Also, bis jetzt haben wir nicht vor –«
»Mann, hier draußen in der Pampa kannst du unmöglich bleiben. In der Feuchtigkeit verrostet dir ja der Computer. Hallo, und du bist …?«
»Ich bin Wigwam, und das ist Rufus.«
»Wie bitte?!?«
»Entschuldigung«, sagte Mark, »ich hätte euch vorstellen sollen.«
»Schon gut, es sind nur sehr schräge Namen. Ihr könnt mich Gerard nennen. Ein herkömmlicher Vorname, falls er euch nichts sagt. Wigwam und Rufus, was? Klingt wie zwei Goldfische.«
»Kann ich dir etwas zu trinken anbieten?«, fragte Sarah. Arsen?, fügte sie in Gedanken hinzu. Quecksilber?
»Wodka Mart, wenn ihr so was dahabt. Ansonsten nehme ich Wein. Weißen.«
Da sie keinen Mart hatten, was auch immer das war, schenkte Sarah ihm ein Glas Chardonnay ein, und er versuchte gottlob nicht zu benennen, was für einer es war. Währenddessen horchte er Wigwam aus. »Du hast vier Kinder?«
Als wäre er von der Bevölkerungskontrolle, und sie hätte gegen das Gesetz verstoßen.
»Von meinem Ex.«
»Oh. Sind also nicht von Rufus.«
»Nein. Aber er hat mich trotzdem geheiratet.«
»Verdammt mutig von ihm«, sagte Gerard. Vermutlich in Bezug auf die Kinder.
»Rufey war ein Waisenkind«, erklärte Wigwam. »Er hat sich immer eine große Familie gewünscht.«
Rufey widersprach nicht. Er ging Sarah auf die Nerven. Er ließ das Gespräch über sich hinwegrauschen wie ein Fluss über einen Kiesel, und er ragte nie heraus, egal wie seicht das Gespräch war. Wie hatte er es geschafft, Wigwam zu bezirzen? Vielleicht einfach, indem er verfügbar war.
Das war ein boshafter Gedanke, aber GerardInchon hatte sie in boshafte Stimmung versetzt. Er wandte sich jetzt ihr zu. »Und was ist mit Sarah?« Sie hasste es, in der dritten Person angesprochen zu werden. »Habt ihr Pläne für Nachwuchs?«
»Keine, die nicht privat wären«, antwortete sie honigsüß.
»Natürlich wollen wir Kinder«, sagte Mark. »Ehrlich gesagt, so bald wie möglich.«
»Ist das wahr?«
»Na ja, nicht ganz«, erwiderte Sarah. »Mark möchte Kinder. Und zwar so bald wie möglich. Das stimmt.«
Mark starrte sie finster an. Wigwam sagte: »Ach, wenn du erst mal welche hast, kannst du dir ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen.«
»Das sagen alle. Aber was ist, wenn es bei mir anders ist?«
»Betrachte es als Investition«, sagte Gerard. »Für Kinder bekommt man in manchen Teilen der Welt viel Geld.«
Das schien der richtige Moment für einen Ortswechsel zu sein, da es unwahrscheinlich war, dass in nächster Zeit vor einem Waisenkind und einer Öko-Mutter etwas noch Taktloseres gesagt werden könnte. Weil sie im Wohnzimmer essen würden – einem großen, durchgehenden Raum, der den größten Teil des Erdgeschosses einnahm –, dauerte es nur knapp fünf Minuten, alle von einer Seite zur anderen zu lotsen, wobei Wigwam und Rufus am schwierigsten zu platzieren waren. Wigwam wollte es immer allen recht machen und konnte sich nicht für einen Stuhl entscheiden, und Rufus wirkte, als hätte er am liebsten aus einer Schüssel in der Küche gemampft. Sarah kam zu dem Schluss, dass ihr ein kleines Teufelchen – ihr persönlicher Dämon – sie dazu gebracht haben musste, diese beiden einzuladen.
Das Menü hatte sie einfach gehalten, zum Teil aus gesundem Menschenverstand, aber auch aus dem Wunsch heraus, Mark zu zeigen, dass sie nicht sechsunddreißig Stunden in der Küche verbringen würde, um ihn gut dastehen zu lassen. Also: gefüllte Paprika zum Auftakt, dann Lachs mit Limettensaft und Apfel. Avocadosalat. Obstsalat. Einige der edleren Käsesorten vom Markt. Nichts Spektakuläres, aber es war auch nichts daran auszusetzen, es sei denn, Gerard erwartete rohes Fleisch, aber dann würde er wohl einfach in seinen Tischnachbarn beißen.
Gerard erwies sich als unkompliziert und aß alles, was man ihm vorsetzte; der Knigge konnte ihm dabei gestohlen bleiben. Ihn zum Schweigen zu bringen war schwieriger. Sarah dachte, dass erfahrene Gäste – und Inchon schien es gewohnt zu sein, sich bei anderen durchzufuttern – doch darin geübt sein sollten, Fremde auszuloten und eine gemeinsame Basis zu definieren, auf der man sich unterhalten konnte. Aber Inchon betrat Neuland, nur um Minen zu legen und sich dann zurückzuziehen; er taxierte die Leute und wählte dann die Waffe, die sie zu Fall bringen würde. Mark gegenüber war er vollkommen umgänglich und unterhielt sich mit ihm in einem für den Rest der Gesellschaft unverständlichen Finanzkauderwelsch; Sarah behandelte er mit schleimiger Höflichkeit. Wigwam und Rufus dagegen provozierte er bis aufs Blut.
Mit dem Krieg zum Beispiel. Oder besser: dem Beinahe-Krieg. Denn im Nahen Osten spitzte sich die Lage zu; die Unnachgiebigkeit des Irak gegenüber den UN-Inspektionen führte zu Säbelrasseln in der gesamten westlichen Welt. Politiker hielten tiefernste Pressekonferenzen ab, während sie sich insgeheim die Hände rieben; die Boulevardblätter kreischten, die großen Zeitungen donnerten. Auslandskorrespondenten überprüften ihre Designer-Khakis. Und die Wigwams dieser Welt warfen vor Scham und Entsetzen die Hände in die Luft, während die Inchons das Kabelfernsehen einschalteten, die Fernbedienung in der einen und die Börsenkurse in der anderen Hand.
»Nichts kurbelt die Wirtschaft so an wie ein ordentlicher Krieg.«
»Ist das dein Ernst?«
»Natürlich. Und dabei rede ich nicht vom Preis einer Dose Bohnen, meine Liebe. Ich meine großes Geld. Aufträge für Hubschrauber, Arbeitsplätze für ganze Städte. Der Medienrummel reißt die Leute mit.«
»Und was ist, wenn wir verlieren?«
»Das ist keine Option.« Er lächelte herablassend. »Die Gegenseite hat nichts als einen zusammengewürfelten Mob mit veralteten Waffen, während die westlichen Armeen über den neuesten Hightech-Schnickschnack verfügen, den sie sicher gerne mal ausprobieren würden. Die Leute da unten leben ja praktisch noch in der Steinzeit. Sie hatten einfach Glück mit dem Öl.«
»Bei einem Atomkrieg gibt es keine Gewinner«, unkte Wigwam.
»Das ist eine naive und dumme Einstellung. Die Seite, die über nukleare Waffen verfügt, gewinnt gegen die, die keine hat. Es ist nur eine Frage der Öffentlichkeitsarbeit.«
»Das ist widerlich«, sagte Sarah.
Inchon lächelte selbstgefällig. »Das ist realistisch. Wobei es so weit wohl nicht kommen wird. Es gibt schnellere und sauberere Wege. Was nützt es, einen Krieg zu gewinnen, wenn man danach eine riesige Entschädigungsrechnung präsentiert bekommt? Was denkst du?« Er wandte sich an Rufus.
»Ich – ich weiß nicht …«
»Vielleicht solltest du deine Frau fragen, was du meinst. Sie wird es wahrscheinlich wissen. Könnte ich noch etwas Wein haben, Mark? Vielen Dank.«
Rufus war rot geworden. »Es wird keinen Krieg geben«, sagte er.
»Ach, nein? Warum nicht?«
»Weil die Leute zur Vernunft kommen werden«, sagte Rufus. »Niemand will das noch mal durchmachen. Verkohlte Leichen und –«
Gerard warf den Kopf zurück und lachte. »Großartig«, stieß er hervor. »Großartig.« Er leerte sein Glas Wein zur Hälfte. »Die Leute werden zur Vernunft kommen«, wiederholte er, inzwischen mit leicht verwaschener Aussprache. »Sehr klug analysiert.«
Rufus errötete zwei Nuancen tiefer. »Was meinst du denn? Glaubst du, die machen das einfach?«
»Die machen das einfach. Klingt fast wie ein Slogan. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht machen sie es, vielleicht auch nicht. Ich kann mir ein halbes Dutzend Szenarien denken für beide Seiten. Aber keines enthält Menschen, die zur Vernunft kommen. Hier geht es um Geopolitik, nicht um einen Streit im Sandkasten.«
»Es geht um Menschenleben«, entgegnete Wigwam. »Man kann nicht so tun, als ginge es dabei nicht um Menschen.«
Gerard sah Mark an. »Das Problem bei Diskussionen wie dieser ist, dass Frauen jedes Mal sentimental werden. Man kann mit ihnen nicht über Krieg oder Sport diskutieren, weil sie einfach nicht kapieren, wie entscheidend das Ergebnis ist. Sie haben immer Mitleid mit den Verlierern.«
Mark sagte: »Tja, äh, offensichtlich –«
»Offensichtlich was?«, fragte Sarah.
»Offensichtlich spricht viel dafür, den menschlichen Faktor mit einzubeziehen. Aber langfristig gesehen –«
»Was ist langfristig gesehen?«
»Langfristig gesehen sind es nicht die Betroffenen selbst, die die wichtigen Entscheidungen fällen. Möchte noch jemand Wein?«
»Du willst dich also nicht für eine Seite entscheiden?« Die Vorzeigefrau hatte schon lange nichts mehr gesagt. »Ich hätte gerne noch etwas Wein.« Mark bemühte sich, nicht vor Dankbarkeit zu strahlen, und verschwand in der Küche, um eine weitere Flasche zu holen.
Sarah wandte sich Gerard zu. »Was hast du überhaupt damit zu tun?«
»Wie bitte?«
»Ich habe keine Ahnung, was du machst, außer dass du diverse Kunden mit Waren belieferst. Ich meine, du produzierst doch nichts, oder?«
»Ich mache Geld, meine Liebe. Und zwar sehr viel.«
Sie war ins offene Messer gelaufen. »Und das wirst du auch weiterhin tun, wenn es Krieg gibt, oder? Mit den Toten Profit machen?«
»Bei dir klingt das so, als würde ich auf Schlachtfeldern Leichenfledderei betreiben.«
»Weit davon entfernt ist das nicht, oder?«
Er sah sie an. »Nein, in der Tat. Mein ›Anteil‹ daran ist der gleiche wie deiner. Ich werde Mitglied einer beteiligten Nation sein. Ansonsten habe ich keine unmittelbaren Interessen. Aber ich nehme an, im Gegensatz zu dir werde ich tatsächlich die Truppen unterstützen, die in meinem Namen ausgesandt werden. Denn je weniger von ihnen sterben, desto mehr freut es mich. War es das, worauf du hinauswolltest?«
Sarah biss sich auf die Zunge. Gerissener Mistkerl.
Gerard sah Rufus an. »So viel zum Weltgeschehen. Und was machst du so?« Er legte einen leichten Akzent auf »machen«, als müsse Rufus doch irgendetwas tun, so schwer es auch vorstellbar war.
»Ich, äh, arbeite freelance.«
»Freebase? Hat das nicht etwas mit Drogen zu tun?«
Rufus hüstelte. »Ich bin Freiberufler.«
»Ah, freiberuflich. Als was? Kostenplaner? Fensterputzer?«
Mark kam mit einer offenen Flasche zurück und wedelte verlockend damit.
»Ich unterrichte«, antwortete Rufus. »Erwachsenenbildung«, fügte er hinzu.
»Wie faszinierend«, hauchte Gerard.
Sarah hatte genug. Wenn sich GerardInchon nicht zurückhielt, würde ihm gleich ihr Besteck aus dem Rücken ragen.
»Äh, möchte jemand noch Wein?«, fragte Mark schließlich.
»Ich gehe Kaffee kochen«, sagte Sarah.
Die Explosion setzte dem Gespräch ein Ende. Sie schien in zwei Phasen zu verlaufen, obwohl Sarah sich später nicht mehr genau daran erinnern konnte, in welcher Reihenfolge das geschah. Das Zimmer bebte, nicht heftig, aber mehr als bei einer durchschnittlichen Dinnerparty üblich; die Bilder an den Wänden klapperten in ihren Rahmen, und die Lampe begann zu schaukeln, sodass die Schatten aus ihren Ecken huschten. Und dann, oder vielleicht auch kurz zuvor, gab es einen dumpfen Knall, gefolgt von einem Geräusch wie von einem Erdrutsch, aber hier, in Oxford? Wigwam ließ ihr leeres Weinglas fallen; die Vorzeigefrau riss die Augen auf. Mark sprang auf und blickte automatisch zu Gerard, als wäre er als der Reichste am Tisch der Experte für alles. Zu ihrem Ärger merkte Sarah, dass sie dasselbe getan hatte. Gerard stellte ganz vorsichtig sein Glas ab und drehte sich zum Fenster um, vor dem die Vorhänge zugezogen waren. Dann nickte er wissend und wandte sich wieder Sarah zu. »Das war eine Bombe«, sagte er.
»Eine Bombe?«
»Unverkennbar. Eine Gasexplosion würde …«
Rufus stürmte an ihm vorbei zur Eingangstür.
Es entstand eine kurze Verwirrung – sollten sie Rufus folgen oder auf Gerard hören? Dann setzte ein allgemeiner Exodus in Rufus’ Kielwasser ein. Wahrscheinlich war es Rufus’ einzige Chance, Inchon jemals die Schau zu stehlen, aber dieser Gedanke kam Sarah erst später. In diesem Moment befand sich ihr Verstand in jenem Ausnahmezustand, in dem alles hell und klar erscheint und sich zugleich in Zeitlupe abspielt, ohne dass man Worte dafür findet. Hinterher wünschte sie sich, sie hätte den Ausdruck auf Gerards Gesicht genießen können, aber sie musste sich damit begnügen, ihn sich vorzustellen.
Die Explosion hatte sich in mehreren hundert Metern Entfernung ereignet, vielleicht sogar hinten am Flussufer, und selbst vor dem nachtschwarzen Himmel konnte man erkennen, dass Rauch die Luft trübte wie ein Tintenfisch das Wasser in großer Tiefe. Aber Flammen sah man kaum, und wenn sich nicht bereits eine Menschenmenge unter den Straßenlaternen versammelt hätte, hätte Sarah nicht gewusst, wohin sie schauen sollte. Zu hören war nur noch der Nachhall: eine Art gedämpftes Dröhnen, das von den Häuserwänden zurückgeworfen wurde. Sarah biss sich auf die Lippe, schmeckte Blut, gemischt mit Minze, und ein Teil von ihr wollte wissen, was passiert war, der Rest lieber nicht. Sie standen in einer Gruppe beisammen, nur Rufus hielt sich etwas abseits, ein paar Meter näher am zerstörten Haus, als ob dieser kleine Vorsprung ihm eine andere Perspektive verschaffen würde. Durch das Getöse hörte Sarah das Gemurmel der Menge vor sich; den anerkennenden Unterton wie bei einem Freudenfeuer. Denn es brannte durchaus. Wenn man genau hinschaute, sah man durch ein Fenster im oberen Stockwerk einen Schimmer, als würde ein Drache gegen die Scheibe hauchen.
»Das muss eine Gasleitung sein«, meinte Rufus.
»Was sollen wir machen? Wir können doch nicht einfach hier rumstehen!«
Mark legte einen Arm um sie. »Wir können gar nichts tun. Wir müssen auf die Einsatzkräfte warten.«
»Wem gehört denn das Haus?«, fragte Wigwam. »Kennt ihr die Leute?«
Als ob das etwas ändern würde, dachte Sarah. Als ob das jetzt wichtig wäre.
»Ich glaube, da kommt die Feuerwehr«, sagte die Vorzeigefrau. Sarah wünschte, sie könnte sich an ihren Namen erinnern. »Hört mal, die Sirenen!«
Jetzt hörten sie sie auch: ein schrilles Jaulen, das über die Dächer wirbelte und die Straße entlang hallte.
Gerard zündete sich eine Zigarre an. Die Flamme seines Feuerzeugs warf einen teuflischen Schatten auf sein rundes Gesicht und betonte seine Stirnglatze. »Ein bisschen Spannung zum Schluss«, bemerkte er. »Hast du das extra inszeniert, Mark?«
»Ach, halt doch die Klappe«, fauchte Sarah.
Sie wusste nicht, wem das Haus gehörte, aber es lag nah am Flussufer. Die Menge hielt Abstand; keine Amateurheldentaten um diese Uhrzeit. Vielleicht war das Haus auch tatsächlich leer gewesen. Aber Sarah wünschte sich, jemand würde etwas unternehmen, und sei es nur, um den Rest von ihnen von den lähmenden Gewissensbissen zu befreien, bei einem Unglück tatenlos zuzusehen. Sie trat einen Schritt von Mark weg, dessen Arm von ihrer Schulter fiel. Und jetzt kam die Feuerwehr um die Ecke gebraust, ohne die Sirenen abzuschalten, um die Dringlichkeit des Einsatzes zu unterstreichen. Nichts Ernsthaftes geschah jemals leise. Jedenfalls nicht, wenn Männer am Steuer saßen.
»Hier gibt es nichts zu sehen«, sagte Mark, unabsichtlich einen Polizisten imitierend. »Schaulustige sind hier nicht erwünscht.«
»Wo bleibt der Notarzt?«, fragte Wigwam.
»Da kommt er schon.«
Der Krankenwagen folgte den Löschfahrzeugen; sein Blaulicht schimmerte zwischen den Häusern hindurch. Ein Rettungswagen musste noch lange nicht heißen, dass jemand verletzt war, dachte Sarah. Aber diese Mutmaßungen waren sinnlos. Sie hatte keinen blassen Schimmer – es konnte sich genauso gut eine Schar Kleinkinder im Haus befinden. Die Löschfahrzeuge bezogen neben dem Haus Position, und alle möglichen effizienten Routinen spielten sich ab. Schläuche schlängelten sich aus den Rückseiten der Fahrzeuge, während Männer mit gelben Helmen sich gegenseitig Anweisungen zuriefen. Die Menge wich ehrfürchtig oder gehorsam zurück, während zwei Männer in Weiß Tragen aus dem Rettungswagen zogen. Aus dieser Entfernung wirkte alles unwirklich, als würde Sarah eine nicht ganz akkurate Darstellung einer kleinen Katastrophe beobachten. Sie hörte Glas zerbrechen, dann rauschte Wasser aus einem Schlauch, der auf die Überreste des oberen Stockwerks gerichtet war. Aus diesem Winkel war es schwer zu sagen, aber das Haus sah schief aus, als ob ein Teil von ihm von der Nacht und dem Schatten verschluckt worden wäre oder von etwas mit einem noch größeren Appetit. Es musste das Eckhaus sein, dachte Sarah, also war vermutlich das, was davon eingestürzt war, in den Fluss gefallen.
»Sollen wir näher rangehen?«, fragte Wigwam besorgt. »Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich weiß, wer da wohnt.«
»Wir wären nur im Weg«, erwiderte Mark schroff.
Rufus streckte die Hand aus und packte Wigwam am Ärmel, entweder um sie zu trösten oder um sie aufzuhalten, Sarah wusste es nicht. Wieder gab es einen lauten Knall, und uniformierte Männer sprangen vor den herabfallenden Trümmern beiseite.
»Ich kann das nicht mit ansehen«, sagte Sarah. »Gehen wir ins Haus.«
Alle drehten sich um, nur Gerard sträubte sich. Vielleicht fand er Gefallen an den Tragödien anderer, aber wahrscheinlicher war, dass er seine Zigarre zu Ende rauchen wollte. Sarah fand den Stumpen am nächsten Morgen, fünf Zentimeter lang und aufrecht auf den Torpfosten gedrückt, wie die Hinterlassenschaft eines besonders akrobatischen Pudels.
Alle waren still und bedrückt, und mindestens zwei sehr bestürzt über das, was geschehen war. Mark verarbeitete den Schrecken auf typisch männliche Art und holte den Brandy hervor, den er für private Notfälle reserviert hatte. Er und Gerard genehmigten sich einen; alle anderen lehnten ab. Rufus trank prinzipiell keine harten Sachen. Gerard fand das wenig überraschend, aber ansonsten herrschte von nun an ein Waffenstillstand, der bis zum Ende des Abends andauerte. Zu Sarahs Überraschung war es zwölf, bis sich alle verabschiedeten. Sie hatte geglaubt, jede Minute unerträglich bewusst wahrgenommen zu haben, aber die letzte Stunde war völlig an ihr vorbeigezogen.
Die Dankesworte ihrer Gäste klangen gekünstelt in ihren Ohren. Die eine Hälfte wollte sie nie wiedersehen, die andere hätte sie besser nicht eingeladen. Obendrein hatte Mark als Ehemann nicht gerade Punkte gesammelt. Sie schützte Kopfschmerzen vor und zog sich in die Küche zurück, noch bevor sich die Haustür geschlossen hatte. Die Küche lag zum Garten hinaus, und dort konnte sie so tun, als wäre der Lärm draußen eine Party und es täte ihr höchstens leid, dass sie nicht eingeladen war.
Sie hörte, wie Mark nach oben ging. Früher hätte er ihr beim Aufräumen geholfen; jetzt schien das ihre Aufgabe zu sein. Er würde zwar eher sein Abonnement für den Guardian kündigen, als den Ausdruck »Frauensache« zu verwenden, aber er hatte garantiert eine Ausrede parat. Anstrengender Tag im Büro, lange Rückfahrt, musste den ganzen Weg von Paddington aus stehen. Außerdem war sie seinen Gästen gegenüber bissig gewesen, was seiner Karriere kaum förderlich war. Und ganz abgesehen von seinem stressigen Tag oder was sie zu wem gesagt hatte, ging ihr dieser fiese kleine Jingle nicht aus dem Kopf, den sie in letzter Zeit ständig hörte, obwohl er ihn noch nicht laut ausgesprochen hatte:
Es ist ja nicht so, als hättest du etwas anderes zu tun. Oder, Sarah?
Sie stapelte das schmutzige Geschirr. Es war nur eine Viertelstunde Arbeit, aber sie war müde. Morgen früh, dachte sie. Sie würde es morgen früh erledigen. Dann überkam sie plötzlich die schreckliche Vision, dass sie beide im Schlaf in die Luft fliegen könnten und es kein Morgen mehr geben würde. Aber das würde nicht passieren, nicht zweimal in derselben Straße. Nicht zwei Gasexplosionen so dicht beieinander, obwohl sie vielleicht lieber die Heizung warten lassen sollte, wenn sie schon vom Schlimmsten ausging …
Gerard hatte es für eine Bombe gehalten, fiel ihr ein.
Etwas bewegte sich vor der Hintertür, erschreckte sie und riss sie aus ihren Gedanken. Wahrscheinlich eine Katze, entschied sie schnell. Richtig.
Als sie sich näherte, sah sie, wie das Tier auf der Terrasse saß und sich putzte; eine bekannte schwarze Katze aus der Nachbarschaft, das Gegenteil einer Straßenkatze, sie wurde von etwa sechs verschiedenen Haushalten gefüttert. Auf keinen Fall würde sie da mitmachen. Aber sie blieb stehen und beobachtete sie eine Weile, bis es ihr zu schwerfiel, sich auf die Welt jenseits ihres eigenen Spiegelbildes zu konzentrieren, das in dem Dutzend Glasscheiben, aus denen die Hintertür bestand, zerstückelt und vervielfacht wurde. Betrachte dich so, wie Picasso dich sehen würde, dachte sie. In ihrem Fall: schwer. Schlaffes, schulterlanges Haar. Ein Hauch zu viel Make-up an diesem Abend … Diese Frau hat ein geringes Selbstwertgefühl. Weshalb sie noch lange nicht unrecht hat, dachte Sarah bitter. Fragen wir doch mal Mark nach seiner Meinung.
Aber er war nicht verfügbar. Die Katze unterzog sie jedoch einer peinlich genauen Prüfung; ihre Augen spiegelten das Licht in der Küche wider, ihr Blick war fest und unnachgiebig, und es schien Sarah, als würde sie von ihr auf einer Art Katzenwaage gewogen; sie prüfte ihr Überlebenspotenzial auf der anderen Seite der Scheibe, bei den wilden Wesen. Sie schnitt nicht gut ab. Zu alt, zu langsam, zu fett. Erst dreiunddreißig. Noch nie besonders schnell gewesen. Ja, sie könnte ein paar Kilo abnehmen. Die andere SarahTucker hätte sich ganz gut gemacht. Aber bei dir bin ich mir nicht sicher. Es war das Urteil eines überlegenen Wesens, das fühlte sie; eines Wesens, das nie eine Dinnerparty für den schrecklichen Kunden seines Partners würde ertragen müssen oder seine Gefühle an den Haushalt verschwendete.
Aber was soll’s, dachte Sarah Trafford, geborene Tucker, es ist schließlich nur eine Katze.
2
South Oxford hatte seine guten Seiten. North Oxford hatte die Parks, die Häuser und ein oder zwei kleinere Colleges; East Oxford hatte Tesco’s und eine erhöhte Polizeipräsenz. West Oxford hatte den Bahnhof. South Oxford hatte den Fluss.
Na schön, zwar nicht den ganzen, aber immerhin einen langen Abschnitt zwischen zwei Schleusen: den Old Lag River. Zwischen Osney und Iffley schlängelte er sich dahin, wobei die Fußgängerbrücke bei Friars Wharf die Mitte markierte: ein unauffälliges, ja unattraktives Bauwerk, dessen Metallgerüst mit einfallslosen Graffiti besprüht war. Zweimal am Tag herrschte hier reger Verkehr, da die Kinder aus der Siedlung mit dem Auto in die Schule am anderen Ufer gebracht und von dort wieder abgeholt wurden. Sarah benutzte die Brücke normalerweise als Abkürzung in die Stadt und konnte von da aus am nächsten Morgen das explodierte Gebäude erkennen, ein Reihenendhaus, dessen freie Seite zum Fußweg am Fluss hin stand. Oder besser: gestanden hatte, denn das Haus hatte sich wie ein leerer Pappkarton ineinandergefaltet, und von der Wand war nur noch ein schwacher Umriss zu sehen, den das Auge ergänzte, als wären Ziegel und Mörtel auf einen Bauplan reduziert worden. Die Eingangstür stand noch, in einem hellen, kessen Rot, als forderte sie eine Explosion geradezu heraus. Aber alles links von ihr war eingestürzt und stellte das Innere den Gaffern zur Schau, darunter Sarah und eine Schar von Frauen, die zwei Stunden nachdem sie ihre Kinder zur Schule gebracht hatten, immer noch auf dem Nachhauseweg waren. Sie standen zusammen, rauchten und behaupteten, die Explosion gesehen zu haben, während am Flussufer ein paar Polizisten so ziemlich dasselbe taten, nur dass sie reflektierende Overalls trugen. Der Fußweg war abgesperrt, ebenso wie der obere Teil der Straße, die zum Fluss führte; gelbes Absperrband flatterte im Wind. Das zweite Stockwerk des Hauses war verschwunden, und im Erdgeschoss lagen zertrümmerte Möbel und geborstene Mauerreste verstreut, als wäre eine ganze Sammlung weltlicher Güter aus großer Höhe heruntergefallen. Die Tapete an der noch übrigen Wand war versengt und verschrumpelt, und Sarah erkannte darauf den Schatten eines Stuhls, den es nicht mehr gab, den die Explosion zu Kleinholz zersplittert hatte. Was vom Dach übrig war, hing durch, und in unregelmäßigen Abständen fielen immer noch Ziegel herunter. Das Nachbarhaus war jetzt das Gebäude, das dem Fluss am nächsten stand. South Oxford war um eine Adresse kleiner geworden.
Ein Polizeitaucher platschte wie ein Seehund ins Wasser. Eine der Frauen löste sich von ihrer Gruppe und kam herüber. »Sie haben drei rausgeholt. Ich habe die Tragen gesehen.«
Sarah wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie hatte noch nie mit dieser Frau gesprochen und hatte keine Ahnung, ob drei unter diesen Umständen viel oder wenig waren. »Äh …«
»Dabei hat sie allein gelebt. Nur mit ihrem Kind.«
»Wer war dann –«
»Das weiß keiner.«
Von unten ertönte ein Ruf. Der Taucher kam an die Oberfläche, in einer Hand etwas, das wie eine intakte Teekanne aussah.
»Ich habe sie gar nicht gekannt.«
»Sie hieß Maddie. Maddie Singleton.«
Der Name sagte ihr nichts. »Und das Kind?«
»War noch ganz klein. Es hätte genauso einen von uns treffen können.«
»Was?«
»So was wie hier. Es soll die Hauptleitung gewesen sein. Schauen Sie, wir wohnen da drüben.« Sie deutete auf ein Mietshaus ein Stück entfernt. »Wenn es da hinten passiert wäre, dann bumm! Und gute Nacht, Marie.« Die Frau war ungefähr in Sarahs Alter, aber das Rauchen hatte Spuren in ihrem Gesicht hinterlassen. »Gute Nacht, Marie.«
»Sind beide umgekommen?«
»Was denken Sie denn? Bei der Explosion?«
Ein Kollege des Tauchers hatte die Teekanne angenommen und versuchte, sie in einen Plastikbeutel zu stecken. Der Taucher glitt erneut unter Wasser; seine Flossen durchbrachen kurz die Oberfläche und verschwanden dann, fast ohne das Wasser zu kräuseln. Die Frauen auf der Brücke tuschelten, als würden sie Punkte für künstlerischen Ausdruck vergeben. Es war ein seltsamer neuer Zuschauersport: Katastrophen-Scuba. Der Taucher sammelte ein, was einmal ein Leben gewesen war, und packte es in Plastiktüten, damit die Experten es wieder zusammensetzen konnten.
»Furchtbar! Die Stadt muss dringend etwas unternehmen.«
»Was denn?«
Das wusste die Frau auch nicht.
Sie kehrte zu den anderen zurück, man tauschte sich aus, gab Informationen weiter. Sarah hatte das Gefühl, im Gespräch mit der Frau irgendetwas falsch gemacht zu haben, aber ihr fiel nicht ein, wie sie es wiedergutmachen konnte. Außerdem fühlte sie sich unbehaglich dabei, hier so zu stehen und das Unglück anderer zu betrachten. Dann entdeckte sie den Mann auf der anderen Seite des Flusses, auf dem Grasstreifen unterhalb der Wohnungen. Auch er war ein Voyeur. Aber irgendetwas an ihm fesselte ihren Blick.
Er sah aus wie vierzig, aber das war eine reine Vermutung. Er schien ein Leben geführt zu haben, das ihn früh hatte altern lassen, obwohl Sarah nicht hätte sagen können, worauf diese Vermutung basierte. Sein langes Haar fiel ihm unordentlich in die Stirn und war hinten zu einem Knoten zusammengebunden, und er hatte einen unregelmäßigen, dünnen Bart. Outfit von Oxfam, dachte Sarah: Jeansjacke, zerschlissene Jeans, schmuddeliges weißes T-Shirt; er hätte einer der unzähligen Obdachlosen sein können, die vor sich murmelnd im Stadtzentrum herumstapften und Zeitungsbündel und mit Müll gefüllte Plastiktüten herumschleppten, aber irgendetwas passte nicht; sie kam nicht drauf, was. Vielleicht seine konzentrierte Ausstrahlung. Irgendetwas jedenfalls. Sie würde es herausfinden. Und während Sarah ihn die ganze Zeit anstarrte, schaute er kein einziges Mal auf, obwohl sie sicher war, dass er sich ihrer Anwesenheit genauso bewusst war wie der aller anderen auf der Brücke, so intensiv, dass er sie noch in einer Woche einzeln würde beschreiben können … Vielleicht hatte sie gestern Abend doch mehr getrunken, als sie gedacht hatte.
Jedenfalls so viel, dass sie Wigwam nicht bemerkte, bis sie fast neben ihr stand. Oder besser: Sie erkannte sie nicht, denn unsichtbar war Wigwam nicht. An diesem Vormittag trug sie leuchtend gelbe Shorts und ein pinkfarbenes, eng anliegendes T-Shirt, das auf einem schmalen Grat zwischen gewagt und bescheuert balancierte; es verwandelte eine Figur, die man als üppig bezeichnen konnte, in eine unförmige. Obwohl sich Wigwam, wie Sarah längst wusste, nicht um ihr Aussehen scherte.
»Alles klar mit dir?«, lautete ihre typische Begrüßung.
»Tut mir leid, ich war mit den Gedanken ganz woanders.«
»Armes Ding.«
Aber Wigwam meinte nicht sie, erkannte Sarah.
»Hast du sie gekannt?«, fragte sie.
»Maddie? Ja, natürlich. Du nicht?«
»Nein, ich glaube nicht.«
»Doch, ganz bestimmt. Groß, blond. Ihre Tochter ist noch ganz winzig.« Wigwams Augen füllten sich mit Tränen.
Sarah erinnerte sich flüchtig – volles Haar, ein Umriss ohne Stimme. »Roter Overall?«
»Maddie?«
»Nein, das Kind.«
»Dinah. Ja, kann sein.«
Sie hatte auf dem Treidelpfad gesessen und die Schwäne mit altem Brot gefüttert. Sarah erinnerte sich jetzt an sie; ein blondes Kind mit Zöpfen, schmutziger Kleidung und leuchtend gelben Wassersandalen. Sie konnte nicht viel älter als drei gewesen sein. »Schwäne«, hatte sie zu Sarah gesagt und auf sie gezeigt. Es war eine Mutter dabei gewesen, aber sie hatte keinen bleibenden Eindruck in Sarahs Erinnerung hinterlassen.
Es war eine einmalige Begegnung gewesen, aber jetzt fiel es ihr trotzdem auf einmal schwer, sich den Treidelpfad ohne ein schmuddeliges blondes Kind vorzustellen, das altbackenes Brot ins Wasser warf.
»Armes Ding. Jetzt ist sie ganz allein, auch wenn sie –«
»Sie hat überlebt?«
»Ja, Dinah hat es geschafft.«
»Ich dachte, sie wäre –«
»Sie wurde anscheinend von einem Schrank oder so geschützt. Vor der Explosion. Sie lag im Bett, und das Bett ist einfach durchgefallen, als der Boden nachgab. Sie ist sogar drin liegen geblieben.«
»Woher weißt du das alles?«
»Rufus hat mit einem der Feuerwehrleute gesprochen. Sie waren heute Morgen noch hier.«
»Und was ist mit Maddie?«
»Oh, die ist tot.« Wigwams Gesicht verzerrte sich. »Sie war unten, als es passierte …«
Sarah umarmte ihre Freundin. Sie war selbst den Tränen nahe, nachdem sich ihr dieses Bild eingeprägt hatte: ein blondes Kind, ein Paar gelbe Gummisandalen; die Art von Bild, auf das sich Zeitungen stürzen, aber in dem Fall real. »Komm, lass uns gehen.« Sie waren überflüssig, Schaulustige bei einer Tragödie, und das war keine Rolle, in der Sarahsich gefiel. Aber auf der Suche nach Mitschuldigen bemerkte sie, dass der Mann am anderen Ufer verschwunden war und an seiner Stelle nun ein paar Polizisten standen. Das war nicht unbedingt eine bedeutende Entwicklung. Aber Sarah wurde das Bild des Mannes nicht los, und es blieb ihr im Gedächtnis, als sie und Wigwam in die Stadt gingen.
Am Morgen hatte sie die Überreste der Dinnerparty beseitigt, das Wohnzimmer gesaugt, die Bettwäsche gewechselt und das hölzerne Geländer entlang der Treppe poliert; sie hatte die Spiegel im Badezimmer geputzt, den Weg vor dem Haus gekehrt und lange mit sich gerungen, ob sie den Kühlschrank abtauen oder bis zum Wochenende warten sollte. Sie hatte zwei Schüsseln Müsli, fünf Vollkornkekse und alle vier Pfefferminzbonbons gegessen, die vom Abend zuvor übrig geblieben waren. Sie hatte die Stellenangebote im Guardian geöffnet, wieder geschlossen und stattdessen die Fernsehzeitung aufgeschlagen; sie hatte die zweite Hälfte einer Sendung gesehen, in der sie lernte, wie man auf Italienisch den Bahnhof findet, und die erste Hälfte einer Sendung über die Anfänge der Kolonialverwaltung in Australien. Sie hatte ernsthaft darüber nachgedacht, die restlichen Vollkornkekse zu futtern und zur Strafe nachmittags den Kühlschrank abzutauen, bis der gesunde Menschenverstand sie dazu veranlasste, stattdessen aus dem Haus zu gehen.
Jetzt aß sie ein Stück Erdbeerkäsekuchen, während Wigwam ihr die Familienverhältnisse der Singletons erklärte:
»Maddies Mann ist vor ein paar Jahren ums Leben gekommen.«
Sarah hätte nicht gedacht, dass es in South Oxford so viele Todesfälle gab. »Wie denn?«
»Er war Soldat«, antwortete Wigwam so endgültig, als wäre schon die Zugehörigkeit zum Militär an sich ein tödlicher Zustand. »Er hat im Golfkrieg gekämpft, kannst du dir das vorstellen?«
Sarah konnte es sich vorstellen. Es war nicht so ungeheuerlich, wie Wigwam zu denken schien: Irgendjemand musste dort gekämpft haben, sonst wäre es schneller vorbei gewesen. »Und da ist er umgekommen?«
»Nein, natürlich nicht. Dinah ist erst vier. Etwas über vier. Nein, er hatte irgendeinen Unfall mit einem Hubschrauber oder so. Ich glaube, auf Zypern.«
»Das glaubst du nur, Wigwam? Du lässt nach.«
Sie streckte ihr die Zunge heraus. Dann sagte sie: »Es ist jetzt vier Jahre her. Mehrere Soldaten sind dabei ums Leben gekommen. Es war noch vor Dinahs Geburt.«
»Hast du ihn gekannt?«