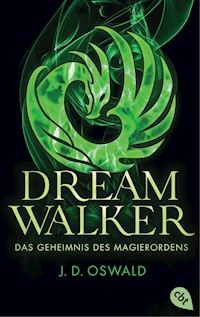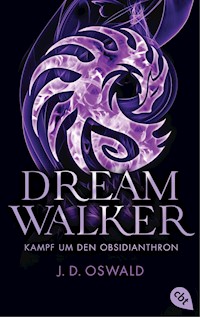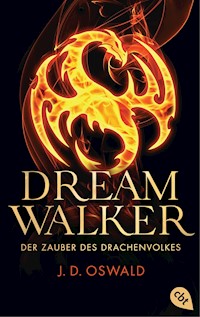
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Dreamwalker-Reihe
- Sprache: Deutsch
Errol Ramsbottom ist wissbegierig, magisch begabt und wünscht sich nichts sehnlicher, als in die Elitetruppe von Gwlad aufgenommen zu werden. Als Inquisitor Melyn ihn tatsächlich auserwählt, geht ein Traum für ihn in Erfüllung – der sich jedoch bald als Albtraum entpuppt … Währenddessen wird der Drache Benfro von seiner Mutter in die Kunst der Magie eingeweiht, nicht ahnend, dass er eine ganz besondere Gabe besitzt – und schon bald die Verantwortung für seine gesamte Spezies tragen wird … Zwei ungleiche Helden, deren Schicksal sich untrennbar miteinander verknüpft, als Melyn zur grauenvollen Jagd auf die Drachen ansetzt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
© Thomas James Vallely
AUTOR
J. D. Oswald verfasste bereits während des Studiums der Psychologie erste Comics. Es folgten Kurzgeschichten, diverse Blog-Posts und eine Fantasy-Reihe. Neben dem Schreiben betreibt er heute eine Farm in der schottischen Grafschaft Fife. Mit seinen ersten beiden Thrillern wurde J. D. Oswald für den renommierten Debut Dagger Award nominiert und stürmte auf Anhieb die britischen Bestsellerlisten. Mit der »Dreamwalker«-Trilogie legt er seine ersten Jugendbücher vor.
J. D. Oswald
DREAMWALKER
Der Zauber des Drachenvolkes
Aus dem Englischenvon Gabriele Haefs
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Kinder- und Jugendbuchverlagin der Verlagsgruppe Random House
Im Gedenken an Dot Lumley, die als Erste erkannte, was alles in dem kleinen Drachen steckt J. O.
Erstmals als cbj Taschenbuch Oktober 2015
© 2015 der deutschsprachigen Ausgabe cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House, München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
© 2012 James Oswald
Die Originalausgabe erschien 2013
unter dem Titel »Dreamwalker«
bei Penguin Books Ltd, London
Übersetzung: Gabriele Haefs
Lektorat: Andreas Rode
Umschlaggestaltung: init | Kommunikationsdesign, Bad Oeynhausen
unter Verwendung einer Illustration von © Sam Headley
MP · Herstellung: CB
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-16347-1
www.cbj-verlag.de
Prolog – Geburt
Wenn Balwens letzter Spross sitzt auf dem gestohlenen Thron,
Wenn Drachenbrut schläft neben nie gebornem Kind,
Wenn Finsternis die Vögel des Waldes zu Mittag verstummen lässt,
Wird Gulad sich in Blut und Feuer abermals erheben.
Die Weissagungen Goronwys der Wahnsinnigen
Wind toste durch die Bäume wie eine Kriegsmacht, riss die letzten Herbstblätter von den gequälten Zweigen und peitschte sie über den Pfad. Regenschwere Wolken jagten über den Nachthimmel, verdeckte Fetzen des von Sternen besäten Firmaments und legte sie dann wieder frei. Der trübe Schein einer verdreckten Laterne vorn auf dem Wagen beleuchtete den Weg nur unzureichend. Ab und zu zerschlugen Regengüsse den Boden, peitschten die hart getrampelte Erde kurzfristig brodelnd auf und erschreckten die Pferde, die müde ihre Last zogen.
Father Gideon zitterte und zog mit einer Hand den Umhang fester um seinen Hals zusammen, während er mit der anderen sanft die Zügel betätigte. Er flüsterte den Pferden beruhigend zu und versuchte, ihnen ein Gefühl von Frieden zu geben, auch wenn seine Worte vom Wind weggerissen wurden und niemals bei den gespitzten Ohren ankamen, die am Rande der Panik hin und her zuckten. Es war schwer, in der Finsternis die Entfernung einzuschätzen, unmöglich zu sagen, wie lange er schon in diesem tückischen Sturm unterwegs war, aber er war sich ziemlich sicher, dass ihr Ziel nicht mehr weit entfernt war. Ein leises, wehes Schluchzen hinter ihm erinnerte ihn daran, warum er unterwegs war und sich diesem üblen Wetter stellte, während er in der Burg hätte sein können, bei einem Krug Bier und einer Schale Suppe vor dem großen Feuer im Speisesaal.
Father Gideon schlug die triefnasse Leinenplane zurück und warf einen Blick in den hinteren Teil des Wagens. Die einzige verdreckte Öllampe konnte das Innere nur trübe mit flackerndem, gelbem Licht erhellen, während sie im Rhythmus der Räder auf dem Waldboden hin und her schwang.
Mitten im Wagen, umgeben von Decken und Kissen, schlief die Prinzessin. Sie wirkte ausnahmsweise fast friedlich, auch wenn der Schlaf nicht verbergen konnte, wie verhärmt ihr früher so schönes Gesicht jetzt aussah. Nicht einmal der Schlaf konnte darüber hinwegtäuschen, welche Mühe jeder Atemzug ihr machte, oder darüber, dass immer wieder krampfhafter Schmerz ihren Körper von Kopf bis Fuß durchzuckte. Die Wölbung ihres Leibes, Prinz Balchs Same, übertraf alle Proportionen der winzigen abgemagerten Gestalt, die diese Last trug. Father Gideon wusste, dass nicht das Kind Prinzessin Leyns Leben bedrohte. Ihr starker Wille und Wunsch, diese Schwangerschaft zu Ende zu bringen, waren vielleicht das Einzige, was sie noch am Leben erhielt. Und trotz seines gesamten Wissens, das er in einem Leben voller Studien und Reisen, voller Krankenpflege und Fürsorge für die Bedürftigen erworben hatte, hatte er doch keine Vorstellung, was seinen Schützling so leiden ließ.
Das schrille Wiehern eines der Pferde riss Father Gideon aus seinen Gedanken. Er wandte sich von der Prinzessin ab und sah ein schwaches Licht weiter vorn am Weg, und bald fuhr der Wagen über eine kleine Lichtung auf die Hütte zu, die er seit fünfzehn Jahren nicht mehr besucht hatte.
Es war ein seltsames Gebäude, viel größer, als der erste Eindruck vermuten ließ. Zwei Fenster, eines auf jeder Seite einer breiten Tür, blickten auf ein gepflegtes Gemüsebeet. Das Haus hatte nur ein Stockwerk, aber die Spitze des schlichten Dachs ragte mehr als zehn Meter in die Höhe. Der steinerne Schornstein ließ einen dünnen Rauchfaden in die Nacht aufsteigen, und hinter den geschlossenen Vorhängen leuchtete tröstliches Licht.
Als Father Gideon näher kam, änderte der wirbelnde Wind seine Richtung und kam jetzt direkt von der Hütte her. Sofort blieben die Pferde stehen, warfen nervös die Köpfe hin und her, voller Unsicherheit und Angst. Father Gideon stieß eine Verwünschung aus, dann fiel ihm ein, wo er war und an wen er sich wenden musste. Mit einem kurzen Schlagen der Zügel drehte er den Wagen auf dem breiten Weg, sodass er zwischen der Hütte und den Pferden stand. Die Pferde beruhigten sich sichtlich. Father Gideon ließ sie die Köpfe ins Gras senken, legte aber die Bremse vor, damit sie nicht zu weit wegwandern könnten.
Die Prinzessin wog fast nichts, aber Father Gideon merkte doch, dass er kein junger Mann mehr war, als er sie die letzten Dutzend Meter zur Hütte trug. Als ob jemand sein Kommen gespürt hätte, wurde die Tür geöffnet, sowie er die ersten hölzernen Stufen der breiten Veranda hochstieg, die sich um das gesamte Haus herumzog. Eine kräftige Gestalt stand in der Türöffnung und füllte sie so aus, dass kaum Licht nach draußen dringen konnte. Für einen Moment überkam ihn eine irrationale Furcht.
»Gideon«, sagte die Gestalt, ihre Stimme war tief und doch unverkennbar weiblich. »Ich habe schon mit dir gerechnet. Bring sie herein.«
»Danke, Morgum«, sagte Father Gideon. Er wusste, es hätte keinen Zweck zu fragen, woher sie von seiner Reise gewusst hatte, wenn doch niemand in der Burg ahnte, dass er sich auf den Weg gemacht, oder gar, dass er die Prinzessin mitgenommen hatte. Morgum die Grüne war ihm immer ein Rätsel gewesen, aber ihre medizinischen Kenntnisse waren in ganz Gulad unübertroffen. Nur die kleinlichen Vorurteile der Menschen hinderten sie an der Erkenntnis, welche Schätze an verborgenem Wissen Morgum und ihresgleichen in sich trugen.
Morgum trat zurück, um ihn das vordere Zimmer der Hütte betreten zu lassen, und abermals staunte er darüber, wie gewandt ein so riesiges Wesen sich bewegen konnte. Ihr Schuppenschwanz sah aus wie ein Stück Ballast, aber er bewegte sich mit ihr und wich allen Hindernissen aus, als ob er seinen eigenen Willen hätte. Ihre mit Krallen besetzten Füße hätten eigentlich den polierten Holzboden aufreißen müssen, aber sie lief mit solch eleganter Vorsicht, dass nicht ein einziger Kratzer zu sehen war.
»Du starrst schon wieder, Gideon«, sagte Morgum, und die hellen Schuppen um ihre Augen funkelten im Feuerschein.
»Es tut mir leid«, sagte Father Gideon, und vor Verlegenheit wurden seine Wangen rot, als wäre er ein Junge, der versuchte, ein Mädchen anzusprechen, das seine Aufmerksamkeit erregt hatte. »Es ist nur, ich hatte vergessen …«
»Dass ich ein Drache bin?«, fragte Morgum mit der Andeutung eines Kicherns in der Stimme. »Ich wünschte, alle Menschen könnten so anständig sein. Aber komm, lege sie hierhin.« Sie zeigte auf einen niedrigen Tisch vor der Feuerstätte, den sie mit dicken Decken belegt hatte. »Wollen mal sehen, was mit deinem Mädchen nicht stimmt.«
Father Gideon legte seinen Schützling auf den Tisch. Die Prinzessin hatte die ganze Zeit geschlafen, auch wenn immer wieder schmerzhafte Krämpfe ihren Leib durchzuckten und ein Film aus grauem Schweiß ihr Gesicht bedeckte und ihre früher so glänzenden Haare an die Seiten ihres mageren Schädels klebte.
»Sie wurde vor einigen Monaten krank«, sagte er und trat zur Seite, um Morgum durchzulassen. »Nicht lange nachdem man erstmals etwas von ihrer Schwangerschaft sehen konnte. Ich habe alles versucht, was in meiner Macht steht, aber dennoch geht es ihr von Tag zu Tag schlechter.«
Der Drache bückte sich über die Prinzessin, und seine Tatzen wanderten vom Kopf zum Hals zu der gewaltigen Wölbung des Leibs, rasierklingenscharfe Krallen so dicht auf der zarten Haut, und doch niemals gefährlich. Morgum ließ ein vages leises Summen hören, während sie die Kranke untersuchte. Father Gideon wandte seinen Blick ab, da er doch nicht helfen konnte. Er stand auf der einen Seite der Feuerstätte, neben der ein riesiger Kessel voller Wasser leise vor sich hin köchelte. Auf der anderen Seite stand ein großer Korb, gerade nah genug an den Flammen, um gewärmt, aber nicht verbrannt zu werden.
Brotteig, der gehen soll, dachte er für einen Moment, aber es hätte dann ein riesiger Laib sein müssen, sogar für einen Drachen. Dann bemerkte er einen Spalt in den zusammengelegten Decken und sah dadurch etwas Glattes, Blasses und mit winzigen braunen Flecken Überzogenes. Er fuhr zusammen, als er erkannte, dass es sich um ein Ei handelte. Dann stellte sich eine eiskalte Angst ein. Morgum musste doch mit einer furchtbaren Strafe rechnen, wenn sie erwischt würde.
»Leinkraut«, sagte Morgum, und eine Welle von Schuldgefühlen durchflutete Father Gideon, als ihm einfiel, warum er hergekommen war.
»Leinkraut?«, fragte er. Eine Erinnerung regte sich, aber er konnte sie nicht unterbringen.
»Ein übles kleines Gift. Ihr Menschen habt so stumpfe Sinne, ihr schmeckt es nicht heraus und riecht es auch nicht. Dein Mädchen stinkt geradezu danach. Jemand gibt ihr schon seit Monaten regelmäßige Portionen.«
»Wer sollte so etwas denn tun?«, fragte Father Gideon, obwohl in seinem Hinterkopf bereits ein grauenhafter Verdacht Gestalt annahm.
»Ich dachte, das könntest du mir sagen«, erwiderte Morgum. »Und wer ist sie, die so ein seltenes, mächtiges und teures Gift wert ist?«
»Du hast sie nicht erkannt?« Father Gideon war überrascht, unbewusst hatte er angenommen, der Drache wisse alles. Aber andererseits war es doch unwahrscheinlich, dass Morgum jemals Angehörigen der königlichen Familie begegnet war. »Das ist Prinzessin Leyn, die Erbin des Obsidianthrones.«
Er sah, wie für einen Moment Angst die Augen des Drachen verdunkelte, Morgums Hände fuhren unwillkürlich von dem vor ihr ausgestreckten Körper zurück. Dann senkten sich ihre Schultern in müder Resignation und sie drehte sich wieder zu ihm um.
»Na ja, ich fürchte, ich kann hier nichts mehr ausrichten«, sagte Morgum. »Prinzessin Leyn wird sterben.«
Morgum sah ihren alten Freund an, der jetzt beim Feuer stand. Die Jahre seit ihrer letzten Begegnung hatten bei ihm offenbar ihre Spur hinterlassen, und ihre Diagnose schien etwas Lebenswichtiges in ihm zerstört zu haben. Sie drehte sich wieder zu der Prinzessin um und legte eine Hand auf die angespannte Haut des gewölbten Bauches. Ihre Finger konnten einen Herzschlag spüren, langsam und schwach wie der eines Greises kurz vor seinem Tod. Das passierte eben bei Leinkraut. Es saugte einem Menschen langsam das Leben aus. Wenn Leyn wirklich schon seit Monaten krank war, dann musste sie vorher eine lebhafte, überaus gesunde Person gewesen sein. Normalerweise tötete Leinkraut innerhalb weniger Wochen, und das ohne die zusätzliche Belastung einer Schwangerschaft. Welch ein Jammer, so hart zu kämpfen, um dann ein totes Baby auf die Welt zu bringen. Denn eine andere Möglichkeit konnte es doch nicht geben.
Ein furchtbarer Krampf riss die Prinzessin nach vorn. Morgum streckte die Hand aus und versuchte, sie wieder auf die Decken zu drücken, aber mit fast unmenschlicher Kraft setzte sich Leyn kerzengerade auf. Ihre Augen waren weit aufgerissen und gelb wie ihr versagender Leib. Sie streckte einen Arm aus, packte Morgums und zog den Drachen an sich, wobei sie gar nicht zu bemerken schien, was für ein Wesen hier als Krankenpflegerin vor ihr stand.
»Mein Prinz. Oh, Balch, es tut so weh. Bitte, rette das Kind«, flüsterte sie. Dann verzerrte sich ihr Gesicht in einem neuen Krampf, sie ließ Morgum los und sank zurück auf die Decken. Father Gideon stand neben ihr, als Morgum eine Hand an Leyns Hals legte, dann auf ihre Stirn. Die einst so schönen Augen starrten blind zum dunklen Deckengewölbe hoch. Mit einer sanften Bewegung drückte Morgum sie zu.
»Es tut mir leid, Gideon, wirklich. Selbst, wenn du gleich am Anfang zu mir gekommen wärst, hätte ich ihr nur das Ende erleichtern können. Sie war vom ersten Gifttropfen an dem Tod geweiht.«
Father Gideon schaute auf die leblose Gestalt der Prinzessin hinunter, seine Augen füllten sich mit Tränen und sein Gesicht wurde leichenblass. Morgum hätte ihn gerne berührt, ihn getröstet, aber der arme Mann sah aus, als ob seine Knie unter ihm nachgeben würden, wenn auch nur eine Feder auf seiner Schulter landete, und deshalb wandte sie sich der Aufgabe zu, den Leichnam zurechtzumachen. Im Tod sah Leyn ruhiger aus, weniger gequält, auch wenn nichts verbergen konnte, wie schrecklich mager sie geworden war. Ihre Muskeln schienen jetzt entspannt, ihre Arme lagen an ihren Seiten auf dem Tisch, ihre nackten Füße wiesen ein wenig zur Seite. Nur ihr hochgewölbter Leib sah noch gespannt und zitternd aus. Morgum legte eine Hand darauf und registrierte durch den dünnen Stoff, wie die letzte Wärme verflog. Nicht nur ein Tod an diesem Tag, sondern zwei.
Dann fühlte sie es. Einen winzigen trotzigen Tritt, und dahinter, so schwach, dass er kaum zu entdecken war, ein regelmäßiges rhythmisches Pochen. Ein Herzschlag.
»Das Kind. Es lebt noch«, sagte Morgum. »Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Das Gift hätte es vor Monaten töten müssen. Wir müssen schnell handeln.«
Ohne auf Gideon zu warten, der noch immer ratlos Leyns ruhiges Gesicht anstarrte, zog Morgum ihr das Nachtgewand über den runden angespannten Bauch. Obwohl sie noch keine zwanzig Jahre zählte, hatte die Prinzessin den Körper einer alten Frau. Ihre Haut hing schlaff über fleischlosen Rippen und ihre Beine waren wie mit weichem Leder umwickelte Stöcke. Morgum achtete nicht auf diese vom Gift verursachte Verwüstung, sondern betastete den runden Bauch und versuchte, sich ein Bild von der Lage zu machen. Endlich, mit einer rasierklingenscharfen Kralle, machte sie einen raschen Schnitt in die Haut, zog die Öffnung mit behutsamen Fingern auseinander und griff hinein.
Father Gideon stieß einen kurzen erstickten Schrei aus, als Morgum das kleine, blutverschmierte Baby aus dem Leib seiner Mutter hob. Morgum riss die Nabelschnur durch und band einen kleinen feinen Knoten hinein, dann nahm sie das Kind an den Füßen und verpasste ihm einen raschen Klaps auf den Rücken. Einmal, noch mal. Das Baby hustete, ballte die winzigen Fäuste und stieß ein lautes Geheul aus.
»Heißes Wasser, Handtücher, los«, kläffte Morgum, und Father Gideon fuhr hoch wie von einer Nadel gestochen.
Bald war das Baby sauber. In Decken gewickelt lag es nun auf einer niedrigen Bank, die dicht an das Feuer geschoben worden war.
»Ein Junge«, sagte Gideon und schaute in das Gesicht mit den großen Augen. »Er ähnelt seinem Vater. Das wird ihn später im Leben verfolgen.« Das Baby gurgelte zufrieden. Als Morgum sich über es beugte, quiekte es aufgeregt.
»Was soll ich mit ihm machen?«, fragte Gideon und sah staunend zu, wie der riesige Drache das winzige Kind wiegte. »Wie soll ich ihn ernähren? Wie soll ich ihn nennen?«
»Ganz ruhig, Gideon, sonst machst du dem Kind Angst.« Morgum legte das Bündel wieder auf die Bank und ging in ihre Vorratskammer. Kräuter und Gewürze waren sorgfältig in zahllosen Schachteln und Krügen untergebracht, aber sie brauchte nicht lange zu suchen. Jedes Teil hatte seinen Platz, und sie wusste genau, wo es lag.
Sie goss Wasser aus dem Kessel, mischte einen klebrigen Brei und ließ ihn neben dem Feuer ziehen. Danach nahm sie etwas weißes Pulver und verrührte es in einer weiteren Schüssel voll heißem Wasser, wobei sie immer wieder kaltes Wasser zugab, bis die richtige Temperatur erreicht war. Dann nahm sie das Kind auf den Arm und fing an, es mit dem kleinsten Löffel zu füttern, den sie finden konnte.
»Muttermilch ist die beste Nahrung für ein Neugeborenes. Darin ist das meiste, was er braucht. Dieses Pulver stellt einen brauchbaren Ersatz dar, aber je früher wir eine Amme finden können, desto besser. Und dann müssen wir unsere Spuren verwischen.«
»Wieso denn das?«, fragte Father Gideon. »Die Prinzessin ist tot.« Morgum konnte die Qual in seinen Augen sehen, sie in seiner Stimme hören. Aber Gideon war ein praktisch gesinnter Mann, der seine Trauer abschütteln konnte, wenn es sein müsste.
»Das stimmt schon«, erwiderte Morgum. »Aber wir müssen den Eindruck erwecken, dass das Kind mit ihr zusammen gestorben ist. Ich gehe davon aus, niemand weiß, dass du sie hergebracht hast?«
Gideon nickte.
»Gut. Du musst den Leichnam mit zurücknehmen. Ich werde es so aussehen lassen, als ob die tote Prinzessin das Kind noch immer in sich trüge. Es tut mir leid, Gideon, aber dir wird vermutlich die Schuld für beide Todesfälle zugeschoben werden.«
Father Gideon senkte den Kopf, sein Körper sackte unter der Last der Verantwortung in sich zusammen. »Als ihr Arzt trage ich diese Schuld bereits«, sagte er. »Aber was ist mit dem Kind? Wir können ihn nicht nach Ystimtien bringen.«
»Nein, das geht nicht. Er würde innerhalb einer Woche umgebracht werden. Ich kann den Jungen in ein einige Tage von hier gelegenes Dorf bringen. Die weise Frau dort holt ab und zu meinen Rat ein. Sie wird dafür sorgen, dass er ein gutes Heim bekommt.«
Morgum griff nach dem Topf mit der Salbe und ging damit zu der toten Prinzessin hinüber. Mit einer komplizierten Handbewegung ließ sie aus der Luft einen Homunkulus herbei und legte ihn an die Stelle, wo vor Kurzem noch das Kind gelegen hatte. Dann nahm sie eine Nadel und einen feinen Faden und vernähte den Schnitt, wobei sie leise und beschwörend vor sich hin sang.
»Die Salbe wird die Farbe ihrer Haut annehmen.« Sanft schob sie das Nachtgewand der Prinzessin wieder nach unten, um ihre Blöße zu verdecken. »Niemand wird die Wunde sehen.«
Sie hob den fast gewichtlosen Leichnam vom Tisch und reichte ihn Father Gideon. »Jetzt musst du gehen.«
»Was sollen wir dem Kind erzählen?«, fragte Gideon. »Er ist der rechtmäßige Erbe des Obsidianthrones.«
»Du sollst ihm gar nichts erzählen«, sagte Morgum. »Wenn er Glück hat, wird er zu einem glücklichen und gesunden jungen Mann heranwachsen. Und nur dann, wenn es wirklich unumgänglich ist, werden wir ihm von seinem Geburtsrecht erzählen.«
Morgum saß die ganze Nacht und bis in die Morgenstunden hinein wach und dachte über die jüngsten Ereignisse nach. Sie wusste, dass Gideon das Ei gesehen hatte, wusste, dass er ihr Geheimnis niemals verraten würde. In aller Stille, um das schlafende Kind nicht zu stören, kniete sie neben dem Korb nieder, schob die Decken zurück und legte eine Hand auf die warme Schale.
Ihr eigener Schlüpfling, der erste neugeborene Drache seit Jahrzehnten, jedenfalls in diesem Teil der Welt. Jahrtausendelang waren die Drachen von den Menschen gejagt worden, aber das war nicht der einzige Grund, warum es nur so wenige gab. Vor Tausenden von Jahren, noch ehe sie selbst geschlüpft war, hatten ihre Herzen Schaden genommen, und das Leben der Drachen war jetzt nur noch ein bleicher Schatten ihrer früheren Pracht.
Einst hatten die Drachen die Welt beherrscht. Das behaupteten jedenfalls Sir Frynwys Geschichten. Morgum dachte manchmal, dass das Leben vielleicht immer schon so gewesen sei, dass Drachen sich nur selten vermehrten und bei diesem Versuch oft auch noch versagten. Vielleicht waren die alten Geschichten einfach nur fantasievolle Ausschmückungen, um das Elend des Alltagslebens zu erleichtern.
Das Ei zitterte ein wenig, als das winzige Wesen darin auf die Nähe seiner Mutter reagierte. Es war im Laufe der Tage langsam stärker geworden und würde sehr bald schlüpfen. Aber nun gab es eine neue Komplikation. Das Kind musste nach Pullpeiran gebracht werden, und das bedeutete einen Gewaltmarsch von zwei Tagen, wenn man den direkten Weg nahm. Sie würde vermutlich noch länger brauchen, denn sie würde einen Bogen um alle Straßen machen müssen, auf denen Menschen unterwegs waren. Der Tod der Prinzessin würde sie in Scharen nach Ystimtien locken, wie Gänse auf die Winterweiden. Nein, sie würde die Waldwege nehmen müssen, und da würde sie mindestens eine Woche unterwegs sein.
Es sei denn, natürlich, sie benutzte die Grym.
Morgum seufzte, als sie das Ei wieder zudeckte. Sie überzeugte sich davon, dass das neugeborene Kind in seiner improvisierten Wiege vor dem Feuer friedlich schlief, und machte sich dann an die Vorbereitungen zu ihrer Reise.
Als Morgum ihren Gemüsegarten durchquerte, sah sie, dass der Himmel sich verdüsterte. Kälte senkte sich über die Lichtung. Sie war sicher gewesen, dass der Sturm vorübergezogen war – es war so ein klarer Morgen gewesen. Als sie nun zur Sonne hochschaute, die am späten Morgenhimmel immer höher stieg, versagte ihre sonstige Selbstbeherrschung. Mit geöffnetem Mund und dümmlichem Gesichtsausdruck stand sie da.
Es war doch noch zu früh. Es konnte erst in einer Woche so weit sein. Oder war sie so in ihre Arbeit vertieft gewesen, dass sie die Tage nicht gezählt hatte?
Eine halbrunde Scheibe fraß sich jetzt in die leuchtend gelbe Sonnenkugel. Wie betäubt starrte Morgum den dunkler werdenden Himmel an, während die Sonne langsam vom Mond verdeckt wurde. Tief in ihren Knochen konnte sie die Ekstase dieser gewaltigen Paarung spüren.
Auf der Lichtung erhob sich ein gewaltiger Lärm, als alle Vögel in die Bäume flogen und sich dort zur bevorstehenden Nacht niederließen. Obwohl seit der Morgendämmerung nur wenige Stunden vergangen waren, verstummten Zwitschern und Gesang viel schneller, als das je an einem Abend der Fall war. Der Wind, der wie ein ungehorsames Kind auf der Lichtung herumgetollt war, legte sich völlig, als habe ihn jemand ausgescholten. Es wurde immer kälter und die Dunkelheit nahm zu. Eine seltsam unwirkliche Finsternis, die an den Rändern leuchtete, als ob ein auf irgendeine Weise gefangenes hauchfeines Licht durch die Luft zischte. Langsam, Zoll für Zoll, legte der dunkle Mond sich über die empfangsbereite Sonne, bis, mit einem kaum hörbaren Geräusch, die Deckung vollständig war.
Morgum stand in der fast vollständigen Dunkelheit und starrte zu dem Rund hoch, das von einem Glorienschein aus flackerndem Weiß umgeben war. Sie war gefesselt von der Schönheit dieses Anblicks, und eine tiefe Ruhe überkam sie, als ob ein vor vielen Zeitaltern begangenes Unrecht endlich wieder gutgemacht worden wäre. Die vielen Sorgen und Belastungen ihres langen Lebens waren in diesem einen vollkommenen Augenblick alle vergessen.
Dann riss ein furchtbarer Knall sie aus ihrer Träumerei, gefolgt vom Geschrei einer gesunden Lunge. Das Kind! Sie hatte den Kleinen total vergessen!
Morgum rannte zurück in die Hütte. Die Stille, die sich nun wieder über die dunkle Lichtung senkte, machte ihr Angst. Morgum fegte durch die Tür und erfasste die Lage mit einem einzigen Blick, zum zweiten Mal an diesem Tag war sie überrascht, zum zweiten Mal in einem halben Leben.
Der Korb vor dem Feuer war umgekippt, und der Rand des Korbes war versengt, der bittere Geruch verbrannter Haare füllte die Hütte. Stücke von Eierschalen waren auf dem Boden verstreut, und für einen furchtbaren Augenblick stellte Morgum sich vor, wie das Kind, das sich auf irgendeine Weise bewegt hatte, obwohl es doch erst wenige Stunden alt war, den Korb umgestoßen und dessen unbezahlbaren Inhalt auf den Boden geworfen hatte.
Aber auf dem Boden lag kein toter Schlüpfling, kein unfertig entwickeltes Eigelb war dort verschmiert. Und das Kind lag noch immer in seiner improvisierten Wiege, es gurgelte zufrieden unter dem Knäuel aus Decken.
Verwirrt und noch immer mit hämmerndem Herzen trat Morgum näher, ihre riesigen Füße wichen den Schalenstücken aus, als ob es dem Drachenkind, das noch immer darin hätte liegen sollen, auf irgendeine Weise schaden könnte, wenn sie darauf träte. Die Augen des kleinen Jungen waren offen und sein Gesicht öffnete sich zu einem strahlenden Lächeln, als Morgum näher kam. Dann stieß er einen glücklichen Schrei aus und etwas viel Größeres als sein winziger Leib bewegte sich unter den Decken. Morgum riss die Decken weg. Eigentlich wusste sie schon, was dort lag.
Es war ein Drache, doppelt so groß wie der kleine Junge, aber noch immer winzig. Perfekt geformt, seine Haut noch glatt, die ersten Schuppen waren nur leichte Grübchen, die auf seiner Brust spielten, wenn er atmete. Er lag auf dem Rücken, den Hals an die Seite des Babys geschmiegt, und suchte Wärme und Gesellschaft, zum offenkundigen Entzücken des Kindes. Winzige Krallenfüße bewegten sich hin und her und die für den winzigen Körper übergroßen Flügel flatterten sanft.
Langsam, zaghaft streckte Morgum die Hand aus und streichelte den Bauch des kleinen Drachen. Seine Augen öffneten sich und er schaute träge ins Gesicht seiner Mutter. Ein Lächeln huschte über seinen Mund und legte scharfe Zähne bloß. Dann rülpste er, ein absurdes kleines Geräusch, das den Jungen neben ihn vor Begeisterung zappeln ließ. Morgum schloss die Hand um ihren Schlüpfling und hob ihn aus der Wiege. Seine winzigen Hände griffen mit überraschender Kraft nach ihren Fingern, und sie hob ihn ins Licht, um besser sehen zu können, was sie und Sir Trefalduin da zustande gebracht hatten.
Eine seltsame Traurigkeit erfüllte sie, weil sie das Schlüpfen verpasst hatte, aber die Traurigkeit musste der Erkenntnis weichen, dass der Kleine zweifellos auf dem Höhepunkt des Zusammenflusses geschlüpft war. Das hier war also wahrlich ein Kind von Sonne und Mond. Und sie konnte ihre Erregung kaum beherrschen, als sie den Drachling sorgfältig auf Defekte untersuchte und ihr Kind mit der kühlen Fachkenntnis einer Heilerin in Augenschein nahm. Es war vollkommen.
Er war vollkommen.
Er.
Der erste männliche Drache seit einem ganzen Jahrtausend.
1
Wir wissen nicht viel über den natürlichen Tod der Drachen, denn es wurde kein Drache fortgeschrittenen Alters beobachtet. Wie andere Tiere der Wildnis werden sie aller Wahrscheinlichkeit nach eines gewaltsamen Todes sterben, wenn sie nicht mehr stark genug sind, um sich zu verteidigen. Es wurden jedoch niemals verwesende Drachenkadaver gefunden, und deshalb ist es möglich, dass sie, wie die sagenumwobenen Elefanten, einen geheimen Friedhof aufsuchen, um dort zu sterben. Sollte das der Fall sein, dann wird der, der diesen Ort entdeckt, zu unvergleichlichem Reichtum gelangen, denn der Boden wird zweifellos übersät sein von den nicht mehr benutzten Edelsteinen, die im Gehirn eines jeden Drachen heranwachsen.
Barrod Sheepshed:Wilde Tiere des Frydlands
Benfro verbarg sich im Gestrüpp am Rand der Lichtung und beobachtete die Hütte aus seiner Entfernung von vierzig Metern. Dünne Rauchfäden kräuselten sich über dem Kamin und die Tür wurde von einem schweren hölzernen Stuhl offen gehalten. Benfro schärfte seine Sinne und versuchte, die Witterung dessen aufzunehmen, was im Haus offenbar gekocht wurde.
Er roch die würzige laubreiche Erde in seiner Nähe, wo sicher früher an diesem Tag die Kartoffeln ausgegraben worden waren. Der Kohl roch nach Schwefel und die Blumen wurden von einer wilden Duftmischung umwabert, doch das alles war nur eine Ablenkung. Benfro musste üben, den leisesten Geruch aus der überwältigenden Masse von Düften herauszuspüren. Also konzentrierte er sich noch stärker.
Der Rauch aus dem Schornstein wurde von einem ganz leichten Wind abwärtsgeweht, fort von Benfro auf die andere Seite des Hauses. Benfro wusste, dass hier Buchenholz verbrannt wurde, denn der scharfe Zitronengeruch war unverkennbar. Einen Moment lang beherrschte dieser Geruch all seine Sinne, aber er blendete ihn aus und suchte weiter.
Es gab ein Aroma von Zedern, sehr zart, fast wie ein Pulver. Der Duft von Gewürzen präsentierte sich seiner Nase: Nelken, Zimt, Kaneelbaumrinde. Während er jede Zutat identifizierte, konnte Benfro die Behälter in der Vorratskammer sehen, wo sie aufbewahrt wurden. Er konnte die sorgfältige Handschrift lesen, die ausführlich alle Inhalte aufführte. Er kannte diese Vorratskammer besser als alles andere in seinem Leben, wusste genau, wo alles hingehörte. Es war unendlich wichtig, das hatte seine Mutter ihm an jedem Tag in seinem noch kurzen Leben mindestens zwanzigmal erklärt, dass er wusste, was wo war. Er war zwar noch zu jung, um zu wissen, wozu diese ganzen Dinge gut waren, aber er hätte mit verbundenen Augen alles an seinem angestammten Platz finden können.
Dieser Trank aber war ihm neu und stachelte seine Neugier an. Er schnaubte energisch, um seine Nase von den zahllosen Duftnoten zu befreien, dann stieg Benfro aus dem Busch und trabte über die Lichtung zurück zum Haus.
»Ich hab mich schon gefragt, wie lange du wohl noch in dem Busch sitzen willst«, sagte Morgum, als er mit leichtem Schritt durch die Tür kam. Benfro lächelte. Er versuchte vor seiner Mutter zu verbergen, was er unternahm, aber sie wusste es trotzdem immer.
Sie saß an dem großen Tisch beim Fenster und vermischte in einem steinernen Mörser allerlei Zutaten. Die Messingwaage stand neben einer Sammlung von Krügen, die polierten Silbergewichte glänzten in der Sonne. Es musste ein wichtiger Trank sein, denn bei neun von zehn Malen verließ sich Morgum beim Mischen auf ihr Augenmaß.
»Was machst du da?«, fragte er und setzte sich zum Zuschauen auf die Bank.
Über die breite Holzfläche hinweg lächelte seine Mutter ihn an, aber ihre grünen Augen waren traurig, ihre Schultern hingen ein wenig nach unten.
»Ach, Benfro, du bist wirklich zu jung, um mit solchen Dingen belastet zu werden.«
Benfro seufzte. Er war zwar schon zehn Jahre alt, aber seine Mutter und alle Leute im Dorf behandelten ihn weiterhin wie ein Kind. Er wollte schon aufstehen, weil er glaubte, an diesem Tag nichts mehr lernen zu können, aber seine Mutter streckte den Arm aus und berührte seinen.
»Bleib, Kleiner«, sagte sie. »Es ist eigentlich nicht richtig, dass du das hier lernen musst, aber ich fürchte, früher oder später wirst du es brauchen.«
»Also, was machst du?«, fragte Benfro noch einmal, jetzt wieder gespannt.
»Vitae mortis, das Extraktionspulver«, sagte Morgum und senkte erneut den Blick. »Der alte Ystrad ist heute Morgen gestorben. Wir müssen die Zeremonie durchführen, damit sein Geist in die nächste Welt weiterziehen kann.«
Benfro klappte das Kinn hinunter. Ystrad. Tot. Aber er hatte doch noch vor zwei Tagen mit dem alten Drachen gesprochen. Er war zwar langsam und kurzsichtig gewesen, aber das waren die meisten hier im Dorf. Bedeutete das, dass sie alle bald sterben würden? In seiner Kehle bildete sich ein Kloß, bei der Vorstellung, seine Freunde zu verlieren, seine Familie. In jedem Augenwinkel sammelte sich eine Träne und fiel auf die Schuppenhaut seiner Wangen.
»Ach, um jemanden zu weinen, den du nur so kurze Zeit gekannt hast. Aber andererseits war es ja dein Leben lang, und für mich nur ein winziger Teil des meinen.«
»Wie ist er gestorben?«, fragte Benfro. Er wusste nicht, wie er reagieren sollte. Sollte er düster und still sein, oder Fragen stellen? Seine Mutter hatte ihn immer aufgefordert, alles zu hinterfragen. Dennoch kam es ihm nicht richtig vor in diesem Moment.
»Er hat beschlossen, nicht mehr weiterzuleben«, sagte Morgum, und ihr alltäglicher Tonfall passte nicht ganz zu der Traurigkeit in ihren Augen. Sie schüttete den Inhalt des Mörsers in einen kleinen Glaskrug und verstaute den in dem Lederbeutel, der neben ihr auf dem Tisch lag. »Jetzt lauf und räum das hier weg.« Sie zeigte auf die Töpfe mit den Zutaten. »Und bring mir eine von den Amphoren mit Delyn-Öl.«
Als Benfro mit dem Öl zurückkam, stand seine Mutter in der Tür. Sie hatte sich den Beutel über die Schulter geworfen. In der Hand hielt sie ihren langen Wanderstock mit dem schweren Knauf. Benfro wollte ihr den schweren Tonkrug reichen, aber sie winkte ab.
»Nein, du solltest den ins Dorf tragen, um deinen Respekt zu zeigen«, sagte sie. »Auch damit die Leute im Dorf sehen, dass du bereit bist, einige der Verantwortlichkeiten eines Heilers zu übernehmen.«
Benfro sagte nichts dazu, doch als er seiner Mutter aus dem Haus und über die Lichtung folgte, drei rasche Schritte für jeden der ihren, war ihm vor Stolz richtig schwindlig.
Errol wusste, als er um die Ecke bog, dass es ein schlimmer Nachmittag werden würde. Die Meute wartete schon auf ihn.
»He, Hexenjunge! Wo willste denn hin?«
Er wusste nicht, wer das gesagt hatte, eigentlich war es ihm auch egal. Es war manchmal schwer, den einen Jungen aus dem Dorf vom anderen zu unterscheiden, auch wenn er sie seit seiner frühesten Kindheit kannte. Sie hatten alle das gleiche runde, kerngesunde Gesicht, den gleichen strohblonden Schopf mit dem gleichen Topfschnitt. Nur Stoff und Schnitt ihrer Kittel und Hosen gaben einen Hinweis darauf, wer wessen Sohn war. Aber hier in Pullpeiran waren sowieso alle miteinander verwandt. Es war nämlich so ein Ort.
»Hab dich was gefragt, Hexenjunge.« Aus der Nähe konnte Errol jetzt sehen, wer sich diesmal aufspielte. Es war Dorfvorsteher Clusters Sohn, Trell. Trell trug teure Stoffe: eine kräftige Cordhose, die bis zu seiner halben Wade reichte, ein zwei Nummern zu großes Hemd aus dickem Drillich und eine weiche braune Rehlederjacke. Errol, dessen Hose und Hemd aus Sackleinen schon oft geflickt worden waren, erkannte so den reichsten der Bande, die immer gemeinsam auf Bäume kletterte, sich durch Hecken zwängte oder durch Bäche watete. Sie hatten offenbar die Abkürzung von der Schule aus genommen, um ihn auf seinem Heimweg abzufangen. Errols Herz wurde schwer. Wenn das der Fall war, dann war es vielleicht besser, die Schikanen gleich hinter sich zu bringen.
»Ich muss nach Hause, Trell«, sagte er. »Du weißt schon, zu Hennas Hütte ein Stück weiter die Straße rauf, wo deine Mam vorigen Herbst deine Schwester hinbringen musste. Um sie von ihrem kleinen Problem zu befreien.«
Trell machte ein wütendes Gesicht. Sein Gesicht wurde noch röter und er ballte die Fäuste. Jetzt kommt der schlimme Teil, dachte Errol. Zum Glück dauerten die Prügel nie so lange. Als die Meute näher kam, spielte er für einen Moment mit dem Gedanken, zu fliehen. Aber die bittere Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass Weglaufen die Qual nur verlängerte. Seine Verfolgung schien die gewalttätigen Neigungen der Bande nur zu verstärken. Errol blieb stehen, als sie noch näher herankamen, und wurde mit einem unsicheren Flackern in Trells Augen belohnt. Wie die meisten Schinder war der Junge in seinem Herzen ein Feigling.
»Du wolltest etwas von mir, Trell?«, fragte Errol und versuchte, seine Stimme ruhig klingen zu lassen, obwohl er das Gefühl hatte, am ganzen Leib zu zittern. »Ich kann gern meine Ma bitten, noch so einen Trank zusammenzurühren, wenn ihr das braucht.«
Ein Schock durchlief seinen Körper, als ihn ein Schlag wie aus dem Nichts seitlich im Gesicht traf. Er hatte mit einem Tritt gerechnet, oder zumindest zuerst mit einem Schlag in den Magen, aber bis Errol so weit gedacht hatte, gaben seine Knie schon nach, und er lag auf dem festgetrampelten trockenen Staub der Landstraße. Die Meute umstand ihn lachend, als Trell ausholte und Errol einen heftigen Tritt in den Bauch versetzte. Der sich krümmende Errol sah, dass seine lederne Schultasche ungefähr einen Meter von ihm entfernt auf dem Boden lag, ihr Inhalt im Straßenschmutz verteilt, wurde sie von den Jungen im Kreis hin und her gekickt. Sein Preis, das Buch, das er den ganzen Sommer lang gelesen hatte, lag mit gebrochenem Rücken da und wurde zertrampelt, als sei es ohne Wert. Ein weiterer achtloser Tritt riss einige Seiten entzwei und verteilte sie auf dem Weg, und in Errol flammte eine bisher ungekannte Wut auf.
Ohne nachzudenken oder auch nur zu wissen, wie er das schaffte, packte er den nächstbesten Fuß und riss ihn zu sich heran, wobei er sich zur Seite rollte. Mit erschrecktem Aufschrei ging krachend ein Knäuel von Körpern neben ihm zu Boden. Als Errol mitten im Gewühl Trells Gesicht sah, holte er mit dem Fuß aus und verspürte eine grausame Befriedigung, als sein weicher Absatz mit Übelkeit erregendem Knirschen auf das Nasenbein seines Gegners traf.
»Aaaaah! Du hast bir die Dase gebrochek!«, schrie Trell und umklammerte sein Gesicht, während dickes rotes Blut zwischen seinen Fingern hervorquoll. Er trat hastig den Rückzug an, rutschte dabei wie ein Baby auf dem Hintern. Errol musste einfach lachen. Die restliche Meute rappelte sich nun auch auf, schaute hinüber zu Trells jämmerlicher Gestalt und stimmte ein. Jemand packte Errol am Arm und einen Moment lang wartete er auf eine weitere Grobheit. Stattdessen spürte er nun, wie er auf die Füße gezogen wurde, wie sein verstaubtes Hemd von rauen, aber nicht unfreundlichen Händen abgeklopft wurde. Jemand versetzte ihm einen Schlag auf den Rücken und hätte ihn fast wieder zu Boden geworfen. Als er sich umdrehte, sah er Clun, den Sohn des Kaufmanns, mit einem breiten Grinsen im Gesicht.
»Gut gemacht, Wicht«, sagte der Junge mit ehrlicher Belustigung im Gesicht. »Vielleicht bist du ja doch nicht so ein Weichei.«
Errol war verwirrt. Er begriff einfach nicht, was hier passiert war. Er starrte benommen den schluchzenden Trell an, der noch immer auf seinem Hintern im Staub saß und die Hände gegen sein blutendes Gesicht presste, während seine Tränen sich auf seinen Wangen mit Blut und Staub vermischten. Die anderen Jungen achteten jetzt überhaupt nicht mehr auf ihn, sie plapperten darüber, was sie jetzt machen wollten. Für diese Woche lag die Schule hinter ihnen, die Ernte war fast eingebracht, und zwei Tage herbstlichen Sonnenscheins lockten. Sie hatten allerlei zu erforschen, mussten Abenteuer erleben und Spiele spielen.
Errol ging auf, dass er zum Mitmachen aufgefordert wurde. Jemand drückte ihm seine Schultasche in die Hände, die zerrissenen Seiten des Buches waren achtlos oben hineingestopft worden.
»Was sagsten du, Hexenjunge? Willste auffer Heuwiese Schlacht spielen?«, fragte Clun.
»Errol«, sagte Errol verwirrt angesichts dieser Wendung seines Schicksals. »Ich heiße Errol.«
»Auch egal. Du bist der Junge vonner Hexe. Also biste der Hexenjunge. Kommste mit?«
Errol wog seine Möglichkeiten ab. Er hatte in früheren Sommern gesehen, wie auf den Wiesen »Schlacht« gespielt worden war. Diese Spiele waren rau, meistens wurde am Ende jemand so schwer verletzt, dass Errols Mutter gerufen wurde, um den Verletzten zu heilen. Alle, die mitmachten, bekamen eine Menge Ärger, weil sie so viel Schaden anrichteten. Errol hätte so gern mitgemacht, eine Weile sorglos umhergetollt. Aber eine endlose Menge von Aufgaben musste erledigt werden, und seine Mutter war nicht mehr jung, falls sie das jemals gewesen war. Andererseits: Würde sich ihm jemals wieder eine solche Gelegenheit bieten, wenn er jetzt ablehnte?
Er schaute auf seine Tasche hinunter, und auf die jämmerlichen Reste, die von seinem Buch übrig waren. Dann sah er zu Trell hinüber. Der Sohn des Dorfvorstehers war jetzt sehr bleich und noch immer tropfte Blut von seiner Nase. Sein grünes Hemd war vorn schwarz und schmierig, seine teure Hose befleckt und das weiche Wildleder seiner Jacke verdorben.
»Ich kann nicht«, sagte Errol und drehte sich widerstrebend zu Clun um. »Ich muss wohl Trell zu meiner Mam bringen, ehe er verblutet. Und wenn ich erst zu Hause bin, komm ich da nicht mehr weg.«
»Wie du willst«, sagte Clun mit kurzem Schulterzucken. Dann versetzte er einem anderen Jungen einen harten Schlag auf den Hinterkopf und rannte johlend davon, verfolgt von der restlichen Meute.
Errol lud sich seine Tasche auf die Schulter und bückte sich dann, um Trell auf die Füße zu helfen. Soeben war etwas Seltsames passiert. Ihre Rollen schienen vertauscht worden zu sein. Wie lange hatte der Sohn des Dorfvorstehers ihn schon schikaniert? Viel zu viele Jahre lang. Und es war nur ein Tritt ins Gesicht nötig gewesen, um alles auf den Kopf zu stellen.
»Labbich i’ Ruh!«, fauchte Trell und Errol trat unwillkürlich einen Schritt zurück. Ein Rest von der alten Angst war noch vorhanden.
»Dann leg wenigstens den Kopf in den Nacken und drück auf den Nasenrücken«, sagte Errol, »sonst kannst du verbluten. Komm mit zu unserer Hütte, und meine Mam bringt das im Nu in Ordnung.«
»Ich geh dnich mal idde Dnäe voddem Stinkloch«, brüllte Trell. Blut sickerte aus seinen Mundwinkeln, als er sich auf die Füße mühte. »Das wirste bezahled, Errol Rabsbottob!« Und mit diesen Worten rannte er zurück ins Dorf.
Errol beobachtete mit einer gewissen Befriedigung, dass Trell dabei den Kopf in den Nacken gelegt hatte und mit einer Hand nach seinem Nasenrücken fasste.
2
Das Wissen und die Kenntnisse eines ganzen Lebens sind in den Edelsteinen eines Drachen gelagert. Alle Erfahrungen, Gedanken, Taten; jeder Verlust und jedes Bedauern sind in diesen edlen und faszinierenden Juwelen gesammelt. Und doch beginnen diese Erinnerungen in dem Moment, wenn ein Drache stirbt, zu versickern, sie kehren zur Erde zurück, aus der alle Kraft kommt. Um diese Erinnerungen für die Ewigkeit zu retten, um eine Erinnerung an eine längst vergangene Größe zu erhalten, müssen diese Edelsteine extrahiert werden. Und nur die lebende Flamme kann einen Edelstein gegen die Verwüstungen der Zeit versiegeln.
Heiler Trefnog: Das Apothekarium
Der alte Drache sah im Tod etwas größer aus als im Leben; befreit von den Fesseln seiner Existenz lag er unvorstellbar riesig auf dem wackligen Holzbett in seiner winzigen Hütte.
Benfro sah verstohlen zu seiner Mutter hinüber, dann starrte er die tote Gestalt Ystrads an. Von allen Drachen, die im Dorf lebten, war er vielleicht der gütigste und ganz bestimmt der nachsichtigste gewesen. Benfro erinnerte sich an unzählige frühere Besuche in diesem Zimmer. Er hatte immer am Feuer gesessen und den Geschichten über die Welt jenseits des Waldes gelauscht, über sagenhafte Orte, deren Namen allein schon exotische Bilder hervorriefen: das Meer von Tegid und das jenseits dieses Meeres liegende Land Fro Afon und die Zwillingstürme von Idris. Er hatte viele Stunden hier gesessen und gebannt den endlosen Sagen und Legenden zugehört. Benfro vermutete, dass Ystrad einsam gewesen war und sich über die Gesellschaft gefreut hatte, aber er war auch freigebig gewesen und hatte ihn mit Zuckerwerk und anderen Leckerbissen zu immer neuen Besuchen verlockt.
Und jetzt war er tot. Seine Schuppen waren matt und trübe, sie schienen sich von seiner Haut fast lösen zu wollen. Seine Flügel lagen da wie zerknitterte Laken, am Rand verschlissen und an den Gelenken von der Gicht knotig geworden. Sein Gesicht mit den Narben eines längst vergessenen Kampfes, dessen Einzelheiten Benfro niemals hatte ergründen können, sah friedlich aus, nicht mehr gequält von den Schmerzen, die alle seine Bewegungen begleitet hatten.
Morgum ging weiter in den Raum hinein. Benfro folgte ihr und presste den Tonkrug dabei an seine Brust. Der Krug war schwer, aber die Verantwortung, ihn zu tragen, kam ihm noch schwerer vor. Er bemerkte, dass das Feuer im Kamin ausgegangen war und dass sich in dem kleinen Raum eine Kälte verbreitete, wie er sie noch nie erlebt hatte. Das bedeutet also Tod, dachte Benfro. Es geht nicht um bewegungslos herumliegende Körper, oder Drachen, die keinen Lebenswillen mehr haben, es geht um ein Feuer, das erlischt, und darum, dass es keine Geschichten mehr gibt.
»Benfro! Was machst du denn hier? Du solltest das nicht sehen müssen. Oh!« Benfro fuhr herum und sah, dass ein weiterer Drache hinter ihnen die Hütte betreten hatte. Sie hielt sich mit einer steifen Förmlichkeit, die nicht mit ihrem wirklichen Wesen zu tun hatte, das wusste er. Meirions Gesicht wirkte freundlich und war früher einmal schön gewesen. Ihre Schuppen funkelten noch immer in zahllosen Farbtönen, aber das Alter hatte schon begonnen, Meirion etwas von ihrer Lebenskraft zu rauben. Sie trat neben ihn und kraulte ihn auf ihre freundliche Weise zwischen den Ohren, aber er konnte die Qual in ihrem Gesicht sehen.
»Es tut mir leid, Morgum. Mir war nicht klar, dass du schon hier bist«, sagte sie.
»Ist schon gut, Meirion«, erwiderte Morgum. »Benfro wird mir bei der Großen Flamm helfen. Das muss er schließlich lernen.«
»Wahr gesprochen«, sagte Meirion mit einem Hauch von Traurigkeit in der Stimme. »Ich hätte aber nie gedacht, dass er noch so jung sein würde, wenn es passiert.«
»Ystrad ist schon seit Jahrhunderten von uns geglitten«, sagte Morgum. »Nicht einmal meine kräftigsten Kräuter konnten die Fäulnis aus seinen Knochen vertreiben.« Sie richtete sich nun an Benfro. »Meirion und ich müssen den Leichnam zurechtmachen«, sagte sie. »Bring bitte diese Amphore in die große Halle. Wir kommen dann nach.«
Benfro wollte schon protestieren, aber er sah die Miene seiner Mutter und entschied sich dagegen. Außerdem machte das kalte Zimmer ihm jetzt wirklich bange. Etwas an diesem leblosen Körper jagte ihm kalte Schauer sein langes Rückgrat entlang. Er drehte sich um und wollte gehen, doch Meirion hielt ihn auf.
»Sei nicht so düster, Benfro«, sagte sie lächelnd. »Natürlich ist es ein trauriger Anlass. Aber Ystrad hätte nicht gewollt, dass wir so traurig sind. Denk an etwas, das mit ihm zu tun hat und dich glücklich macht, und halte dich an diese Erinnerung. Du wirst sie später brauchen.«
Benfro nickte und verließ die Hütte mit eingezogenem Kopf. Er ging mit vorsichtigen Schritten weiter zu dem großen Gebäude in der Dorfmitte, wo sich alle Drachen zu ihren Abendmahlzeiten versammelten. Unterwegs erinnerte er sich daran, wie Ystrad im Halbdunkel am Kamin gesessen und wunderbares Drachengarn über seine Reisen durch die Eisfelder des gefrorenen Südens gesponnen hatte, während er große Stücke kandierten Ingwers mit Benfro teilte, die er aus einem offenbar bodenlosen Krug auf dem Tisch neben sich zog. Bald war das Lächeln in Benfros Gesicht zurückgekehrt.
»Wieso bist du denn so zufrieden mit dir selbst, Wicht?« Die Stimme fegte durch Benfros Träumerei wie ein Wind im Monat Yonaw. Er drehte sich um und sah, dass die Dorfgenossin, die er am wenigsten mochte, ihn düster anstarrte.
»Guten Morgen, Mistress Frecknock.« Er versuchte, eine höfliche Verneigung zu machen, ohne die Amphore fallen zu lassen oder etwas von ihrem kostbaren Inhalt zu verschütten.
»Ein Drache ist tot«, fauchte Frecknock. »Was ist daran gut? Und was hast du da überhaupt bei dir?«
Nervös hielt Benfro ihr die Amphore hin, wollte sie aber nicht aus der Hand geben. »Das ist Delyn-Öl«, sagte er. »Für die Extraktion.«
Frecknock stieß ein verächtliches Geräusch aus, als ob sie Benfro für einen miesen Lügner hielte. Sie hatte sich die Schuppen poliert, wie er jetzt sah, sie mit etwas getönt, bis sie schwarz glänzten und nicht wie sonst gräulich schillerten. Sie hatte auch etwas mit ihren Flügeln angestellt und sie mit einer Art Rahmen aus Draht in eine überaus unbequeme Stellung gezwungen. Auf diese Weise sahen sie viel größer aus, als sie wirklich waren. Benfro wusste, dass Frecknocks Flügel sogar noch kleiner waren als seine, und dabei war er erst zehn. Die Vorstellung, dass sie vortäuschen wollte, ihre Flügel könnten sie vom Boden abheben lassen, erfüllte ihn mit schwer zu unterdrückender Heiterkeit.
»Was grinst du denn so, du widerlicher Drachling«, schrie Frecknock. »Gib mir den Krug, ehe du ihn zerbrichst und allen den Tag verdirbst!«
Jahre der Erfahrung mit Frecknocks Art ließen Benfro ihren gierigen Händen geschickt ausweichen, als sie nach ihm griff. Einen furchtbaren Augenblick lang glaubte er, er werde die Amphore fallen lassen und ihren unbezahlbaren Inhalt im Gras verschütten, aber er konnte sie festhalten, als er auf die große Halle zu rannte.
»Komm sofort zurück, du kleine Missgeburt!«, brüllte Frecknock hinter ihm her, aber Benfro achtete nicht auf sie. Zweifellos würde sie schon bald genug ihre kleinliche Rache an ihm nehmen.
Die restlichen Drachen aus dem Dorf hatten sich auf dem Rasen vor der Halle versammelt, als Benfro einige Momente später dort eintraf. Sie sahen ernst und traurig aus, aber das war ja nur normal. Er schlüpfte zwischen den geduldig wartenden Gestalten hindurch und ging nach vorn, wo Sir Frynwy und Ynys Môn in eine tiefe Diskussion versunken waren. Er fragte sich, warum sie alle draußen standen, obwohl das Herbstwetter ja noch recht gut war, aber als er näher kam, konnte er sehen, dass die vielen schweren Holztüren verriegelt und abgeschlossen waren.
In seinem kurzen Leben hatte Benfro diese Türen noch nie geschlossen gesehen. Die Verwandlung des sonst so einladenden Gebäudes war total. Während es ihm immer ein Gefühl glücklicher Spannung eingeflößt hatte, Vorfreude auf das gemeinsame Essen, die Geschichten und die Gesellschaft der anderen Drachen, wirkte der Eingang zur Halle jetzt abweisend, wie die Front einer Festung.
»Ach, Benfro, da bist du ja.«
Er wandte sich von den furchtbaren Türen ab und schaute ins freundliche Gesicht Sir Frynwys auf. Der Dorfälteste sah müde aus und wirkte vielleicht sogar noch ein wenig trauriger als sonst.
»Ich bringe das Delyn-Öl«, sagte Benfro nervös lächelnd und hielt ihm die Amphore hin. Sir Frynwy schüttelte den Kopf und bedeutete Benfro, sie zu behalten.
»Nein, nein«, sagte er. »Wenn Morgum dich als Träger des Öls ausgesucht hat, will ich dir diese Ehre nicht nehmen.«
»Ehre?«, fragte Benfro.
»Die Extraktion ist eine traurige Sache für uns alle«, sagte Ynys Môn, »und doch ist sie auch eine Zeit des Jubels. Ystrad war nicht der Älteste hier, aber dennoch hat er ein langes und fruchtbares Leben gelebt. Du hast seine Geschichten gehört, du weißt etwas über die Orte, die er besucht hat. Jetzt hat er beschlossen, seine letzte Reise anzutreten, hinüber auf die andere Seite. Ehe er das tun kann, müssen alle seine Bindungen an diese Welt gekappt werden. Das ist die Aufgabe der Extraktion, und alle, denen diese Aufgabe anvertraut wird, sind wahrlich geehrt.«
Benfro starrte die beiden alten Drachen und dann die Amphore an, die sich in seinen Händen plötzlich sehr schwer anfühlte. Er wollte schon weitere Fragen stellen, aber ein quietschendes Stöhnen verkündete das Öffnen der schweren Eichentüren. Er drehte sich um und sah seine Mutter und Meirion in der Türöffnung stehen.
»Kommt alle herein«, sagte Morgum. »Es ist so weit.«
Benfro ging mit den anderen Drachen in die Halle und staunte darüber, wie sehr diese sich seit dem Vortag geändert hatte. Da hatte noch ein großer Tisch den Raum dominiert, um den sich die meisten Dorfbewohner zusammendrängten. Er hatte am Kamin gesessen, in dem jetzt, in dem immer noch lauen und sonnigen Herbst, noch kein Feuer brannte, und zugehört, wie Sir Frynwy Auszüge aus den Historien vortrug, von denen Benfro niemals genug bekommen konnte. Jetzt war der Tisch verschwunden. Stattdessen war ein niedriges Podium aus Stein mitten in der Halle aufgebaut worden, auf dem der Leichnam von Ystrad lag.
Er war vorsichtig gewaschen worden, seine lockeren Schuppen waren gerade gerückt und poliert worden, sodass ein wenig vom Glanz seiner Jugendjahre zurückgekehrt war. Er lag wie im Schlaf da, die Augen geschlossen und die Arme friedlich gefaltet. Benfro sah voller Staunen zu, wie die anderen Drachen ihre üblichen Plätze um den Leichnam herum einnahmen, als ob sie sich zu Tisch setzen wollten und sich hier einfach zum Abendessen getroffen hätten. Er blickte aus der Tür, über den Rasen und durch die breite Straße zu Ystrads Haus. Erst vor wenigen Augenblicken hatte er dieses Haus verlassen, und niemand hätte den Leichnam unbemerkt an ihm vorübertragen können. Wie also war er hierhergelangt? Und wie waren seine Mutter und Meirion an ihm vorbeigeschlüpft?
»Komm, Benfro. Jetzt brauche ich deine Hilfe.« Er wurde aus seinen verwirrten Überlegungen gerissen, als seine Mutter sanft seine Schulter berührte. Benfro ließ sich durch den Kreis aus Dorfbewohnern zum Podium führen. Er blieb unsicher stehen. Dann räusperte sich Sir Frynwy und alle verstummten.
»Freunde, es ist ein trauriger Tag«, sagte der alte Drache und seine ausgebildete Vorleserstimme erscholl laut und deutlich. »Aber es ist auch ein glücklicher Tag. Wir haben uns hier versammelt, um die sterblichen Überreste unseres geliebten Ystrad zu extrahieren, der beschlossen hat, sich auf seine letzte Reise zu begeben. Er hatte ein langes Leben, voller Abenteuer und Erlebnisse. Und doch muss sogar ein Volk, das so lange lebt wie wir, sich am Ende den Verwüstungen der Zeit ergeben. Und deshalb ist es nur gut und richtig, dass der Jüngste unter uns ihm als Erster auf den Weg hilft. Benfro, bitte, das Öl.«
Panik erfasste Benfro, als sich die Augen aller Dorfbewohner auf ihn richteten. Er presste die Amphore gegen seine Brust, unsicher, was jetzt von ihm erwartet wurde. Seine Mutter hatte es ihm gesagt, als sie von der Lichtung im Wald ins Dorf gegangen waren, aber zum ersten Mal in seinem Leben hatte er ihre Worte vollständig vergessen. Das erwartungsvolle Schweigen lastete schwer auf ihm. Es war ein geheiligter Augenblick und er würde durch seine Unwissenheit alles verderben. Verzweifelt schaute er sich um, sah die ausdruckslosen Gesichter, und in seiner Kehle bildete sich ein verlegener Kloß. Dann sah er, wie Meirion das Ausschütten des Kruges mimte, und ihre Stimme schien in seinem Kopf zu sagen: »Gieß es über ihn. Alles, von Kopf bis Fuß. Langsam, damit nichts auf den Boden läuft.«
Das Öl war dick, fast wie frisch aus der Wabe geholter Honig. Es blieb an Ystrads Brust und Gesicht haften, tropfte zwischen seine Schuppen und überzog seinen Schwanz, als Benfro ihn vorsichtig begoss. Er musste auf das niedrige Steinpodium treten, um auch den Bauch des toten Drachen erreichen zu können, und dabei war er sicher, einen leisen Tadel in Frecknocks unverkennbarem nasalen Schnaufen zu hören. Es waren einige nervenzermürbende Minuten voller Konzentration. Aller Augen waren auf ihn gerichtet, und er hätte so leicht stolpern, den Krug auf den Boden fallen lassen oder, schlimmer noch, den sorgfältig aufgebahrten Leichnam aus der Stellung vollkommener Ruhe reißen können. Das Delyn-Öl hatte einen würzigen, schweren Duft, der Benfros Kopf mit seltsam diffusen Bildern füllte und drohte, ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Er war erleichtert, als endlich alles aus der Amphore getropft war und er von dem jetzt nach Öl riechenden Leichnam zurücktreten konnte.