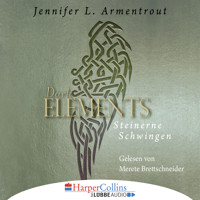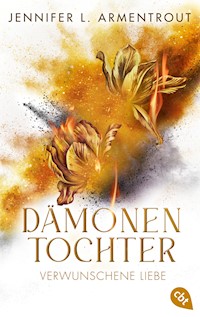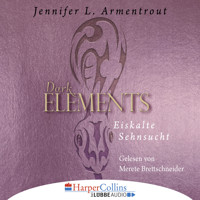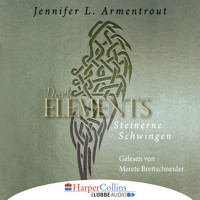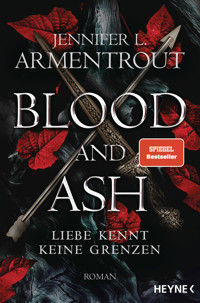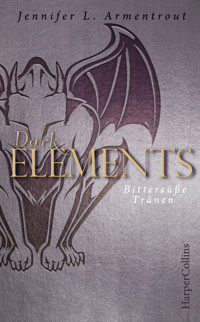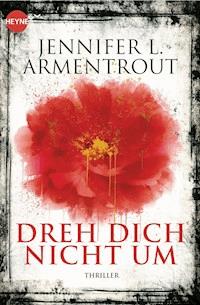
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Eine Geschichte, die unter die Haut geht
Samantha ist schön. Sie ist mit dem coolsten Jungen der ganzen Schule zusammen. Sie hat alles, wovon die anderen Mädchen träumen. Dann verschwindet sie für vier Tage zusammen mit ihrer besten Freundin Cassie. Als Samantha wieder auftaucht, ist nichts mehr, wie es einmal war: Sie hat ihr Gedächtnis verloren und kann sich an absolut nichts erinnern – weder an das, was in den vier Tagen passiert ist, noch an ihr Leben davor. Allmählich kommt sie zu einer schockierenden Erkenntnis: In ihrem alten Leben war sie
offenbar ein echtes Miststück. Wen wundert es da, dass die Polizei immer wieder auftaucht und sie wegen Cassie verhört? Denn ihre Freundin ist und bleibt verschwunden. Eine furchtbare Frage steigt in Samantha auf: Fiel Cassie einem Verbrechen zum Opfer? Und trägt sie etwa die Schuld daran? Samantha bleibt nur wenig Zeit, ihr Gedächtnis zurückzugewinnen. Denn jemand hat es auf sie abgesehen. Jemand, der genau weiß, was passiert ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
JENNIFER
ARMENTROUT
DREH DICH
NICHT UM
ROMAN
Aus dem Amerikanischen
von Karl-Heinz Ebnet
Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel
Don’t look back bei Disney Hyperion, New York.
Copyright © 2014 by Jennifer L. Armentrout
Copyright © 2014 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: t.mutzenbach design, München,
unter Verwendung einer Illustration von © shutterstock
Redaktion: Annika Ernst
Satz: Leingärtner, Nabburg
ePub-ISBN: 978-3-641-13159-3
www.heyne-fliegt.de
1
Der Name auf dem Straßenschild sagte mir nichts. Die Land-straße hatte nichts Vertrautes, nichts Freundliches an sich. Hoch aufragende Bäume und hohe Gräser, die den Eingang zu dem verfallenen Haus überwucherten. Die Fenster waren mit Brettern vernagelt. Wo die Haustür gewesen war, klaffte ein Loch. Ich zitterte und wollte fort – nur weg von hier, wo auch immer ich gerade sein mochte.
Das Gehen fiel mir schwer, ich stolperte, torkelte auf dem kalten Teer und zuckte zusammen, als mir der scharfe Schotter in meine nackten Füße schnitt.
Nackte Füße?
Ich blieb stehen und sah an mir herunter. Abgeblätterter rosaroter Nagellack im Staub … und Blut. Auch die Hosenbeine waren völlig verdreckt, der Saum war ganz steif. Das war logisch, da ich keine Schuhe trug, aber das Blut? Warum waren die Knie meiner Jeans blutverschmiert? Das kapierte ich nicht.
Dann wurde mein Blick trüb, als hätte sich ein Grauschleier über meine Augen gelegt. Ich starrte auf den verwitterten Asphalt, und aus den kleinen Steinchen wurden große glatte Felsen. Etwas Dunkles, Öliges lief über die Felsen und sickerte durch Spalten.
Ich atmete ein, blinzelte, und das Bild war verschwunden.
Ich hob die zitternden Hände. Auch sie waren verdreckt und zerkratzt, die Fingernägel eingerissen und blutig. An meinem Daumen steckte ein verschmutzter Silberring. Es schnürte mir die Kehle zu, als mein Blick über meine Arme wanderte. Die Ärmel des Pullovers waren zerfetzt, die nackte Haut darunter war übersät mit Abschürfungen und Schnitten. Meine Beine zitterten, ich wankte weiter und versuchte mich zu erinnern, wie das alles passiert war, aber mein Kopf war leer – nicht als schwarze Leere darin.
Ein Wagen fuhr vorbei, wurde langsamer und hielt wenige Meter vor mir an. Irgendwo in den Tiefen meines Unbewusstseins erkannte ich die blinkenden roten und blauen Lichter als etwas, was Sicherheit versprach. Auf der schwarz-grauen Wagenseite standen die Worte »Adams County Sheriff’s Department«.
Adams County? Eine Erinnerung blitzte auf und verschwand wieder.
Die Fahrertür wurde geöffnet und ein Deputy stieg aus. Er sagte etwas ins Mikro an seiner Schulter, dann sah er zu mir.
»Miss?« Mit bedächtigen Schritten ging er um den Wagen herum. Er wirkte jung für einen Deputy. Irgendwie fand ich es nicht richtig, dass jemand, der gerade die Highschool hinter sich gebracht hatte, schon eine Waffe tragen durfte.
War ich in der Highschool? Ich wusste es nicht.
»Bei uns sind wegen Ihnen einige Anrufe eingegangen«, sagte er mit weicher Stimme. »Alles in Ordnung?«
Ich wollte etwas erwidern, es kam aber nur ein heiseres Krächzen aus meinem Mund. Ich räusperte mich und zuckte zusammen. Es kratzte im Rachen. »Ich … ich weiß es nicht.«
»In Ordnung.« Der Deputy hob die Hände, als er sich mir näherte, als wäre ich ein scheues Reh, das jeden Moment davonspringen könnte. »Ich heiße Deputy Rhode, ich will Ihnen helfen. Wissen Sie, was Sie hier draußen machen?«
»Nein.« Mein Magen krampfte. Ich hatte noch nicht einmal eine Ahnung, wo hier draußen war.
Er lächelte angestrengt. »Wie heißen Sie?«
Wie ich hieß? Jeder wusste doch, wie er hieß. Aber ich starrte den Deputy nur an. Ich konnte seine Frage nicht beantworten. Die Magenkrämpfe wurden stärker. »Ich … ich weiß nicht, wie ich heiße.«
Er blinzelte, sein Lächeln war jetzt völlig verschwunden. »Können Sie sich an irgendwas erinnern?«
Ich versuchte es noch einmal, konzentrierte mich auf die Leere in meinem Kopf. Mehr schien dort nicht zu sein. Ich wusste, dass das nicht gut war. Tränen traten mir in die Augen.
»Keine Sorge, Miss. Wir kümmern uns um Sie.« Er nahm mich ganz sanft am Arm. »Wir kriegen das schon wieder hin.«
Deputy Rhode führte mich zu seinem Streifenwagen. Ich wollte nicht hinter der Glasscheibe sitzen, weil ich wusste, dass nur schlechte Menschen in einem Streifenwagen hinter der Glasscheibe saßen. Aber bevor ich etwas sagen konnte, hatte er mich schon auf die Rückbank gesetzt und mir eine grobe Decke über die Schultern gebreitet.
Ehe er mich im üblen Teil des Wagens einschloss, beugte er sich vor und lächelte beruhigend. »Alles wird gut.«
Ich wusste, dass er log. Er wollte nur, dass es mir besser ging. Aber so funktionierte das nicht. Wie sollte alles gut sein, wenn ich mich noch nicht einmal an meinen eigenen Namen erinnerte?
Ich kannte meinen Namen nicht, aber ich wusste, dass ich Krankenhäuser hasste. Sie waren kalt und steril, sie rochen nach Desinfektionsmittel und Verzweiflung. Deputy Rhode ging, als die Ärzte mit ihren Untersuchungen anfingen. Meine Pupillen wurden geprüft, ich wurde geröntgt, mir wurde Blut abgenommen. Man verband mir die Schläfe und säuberte zahlreiche Wunden. Man gab mir ein Privatzimmer, hängte mich an einen Tropf, der Flüssigkeiten in mich hineinpumpte, »damit geht es Ihnen besser«, dann ließ man mich allein.
Eine Krankenschwester schob schließlich einen Wagen ins Zimmer, auf dem eine Reihe unheilvoll aussehender Instrumente und eine Kamera lagen. Warum die Kamera?
Schweigend packte sie meine Sachen in eine Tüte, nachdem sie mir einen kratzigen Krankenhauskittel zum Anziehen gegeben hatte. Dann sah sie mich an und lächelte, wie es der Deputy getan hatte. Ein falsches, aufgesetztes Lächeln.
Ich mochte dieses Lächeln nicht. Es war mir nicht geheuer.
»Wir müssen noch einige Untersuchungen vornehmen, solange die Röntgenbilder entwickelt werden.« Sanft drückte sie meine Schultern gegen die harte Matratze. »Wir brauchen auch Bilder von Ihren Verletzungen.«
Ich starrte an die weiße Decke und bekam kaum noch Luft. Als sie mich aufforderte, mit angewinkelten Beinen nach unten zu rutschen, wurde es noch schlimmer. Es war mir furchtbar peinlich. Das ist alles ein Albtraum. Ich stutzte. Diesen Gedanken hatte ich nicht erst jetzt gehabt, sondern schon vorher. Aber wann?
»Entspannen Sie sich.« Die Schwester ging zum Wagen. »Die Polizei erkundigt sich bei den anderen Countys nach Vermisstenmeldungen. Man wird Ihre Familie sicherlich bald finden.« Sie nahm etwas Langes, Dünnes zur Hand, das in dem grellen kalten Licht glänzte.
Nach ein paar Minuten liefen mir Tränen übers Gesicht. Die Schwester schien das gewohnt zu sein, sie erledigte ihre Arbeit und ging, ohne noch irgendetwas zu sagen. Ich rollte mich unter der dünnen Decke zusammen und zog die Knie an die Brust. So blieb ich mit meinen leeren Gedanken liegen, bis ich einschlief.
Ich träumte, dass ich falle – dass ich endlos durch die Dun-kelheit falle, immer, immer wieder. Schreie waren zu hören, ein schrilles Kreischen, bei dem ich Gänsehaut bekam, und dann nichts mehr, nur ein leises, einlullendes Geräusch, das mir guttat.
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, beschloss ich, ganz klein anzufangen. Wie lautete mein Name? Ich musste einen haben, aber ich hatte nicht den leisesten Anhaltspunkt. Ich drehte mich auf den Rücken und heulte auf, als der Schlauch vom Tropf an meiner Hand zerrte. Neben mir stand ein Plastikbecher mit Wasser. Vorsichtig setzte ich mich auf und griff danach. Meine Hände zitterten, und ich verschüttete das Wasser auf der Decke.
Wasser – da war etwas. Dunkles, öliges Wasser.
Die Tür wurde geöffnet, und die Schwester erschien mit dem Arzt, der mich vergangenen Abend untersucht hatte. Ich mochte ihn. Sein Lächeln war echt, er hatte etwas Väterliches an sich.
»Können Sie sich noch an meinen Namen erinnern?« Als ich nicht sofort antwortete, fiel sein Lächeln in sich zusammen. »Ich bin Doktor Weston. Ich wollte Ihnen ein paar Fragen stellen.«
Er fragte das Gleiche wie die anderen. Wie hieß ich? Wusste ich, wie ich auf diese Straße gekommen war oder was ich davor gemacht hatte, bevor der Deputy mich aufgesammelt hatte? Die Antwort war immer dieselbe: Nein.
Erst als er zu anderen Fragen überging, hatte ich Antworten parat. »Haben Sie Wer die Nachtigall stört gelesen?«
Meine trockenen Lippen rissen auf, als ich lächelte. Ich wusste die Antwort! »Ja. In dem Buch geht es um Rassismus und um Tapferkeit.«
Doktor Weston nickte. »Gut. Wissen Sie, welches Jahr wir haben?«
Ich zog die Augenbrauen hoch. »2014.«
»Und welchen Monat?«
»März.« Ich befeuchtete die Lippen und wurde nervös. »Aber ich weiß nicht, welcher Tag heute ist.«
»Heute ist Mittwoch, der 12. März. Was ist der letzte Tag, an den Sie sich erinnern können?«
Ich zupfte an der Decke und riet. »Dienstag?«
Auf seinen Lippen erschien wieder ein Lächeln. »Es muss länger her sein. Sie waren dehydriert, als man Sie eingeliefert hat. Können Sie es noch mal versuchen?«
Ich könnte es, aber wozu? »Ich weiß es nicht.«
Es stellte einige weitere Fragen, und als ein Pfleger das Mittagessen brachte, entdeckte ich, dass ich Kartoffelbrei hasste. Mit dem Tropfgestell, das ich wie ein Gepäckstück hinter mir her zog, starrte ich auf die fremde Person im Spiegel.
Ich hatte ihr Gesicht noch nie gesehen.
Aber es war meines. Ich beugte mich vor und inspizierte das Spiegelbild. Kupferfarbenes, völlig verfilztes Haar, hohe Wangenknochen und ein etwas spitzes Kinn. Die Farbe meiner Augen war eine Mischung aus Braun und Grün. Meine Nase war klein. Das war eine gute Neuigkeit. Also war ich wahrschein-lich ganz hübsch, wäre nicht der purpurrote Bluterguss, der sich vom Haaransatz über das gesamte rechte Auge zog. Die Haut am Kinn war aufgescheuert. Als hätte ich dort einen riesigen Himbeerfleck.
Ich drehte mich am Waschbecken um und zog meinen Tropf zurück in das winzige Zimmer. Als ich draußen im Flur laute Stimmen hörte, blieb ich stehen.
»Was soll das heißen, sie kann sich an nichts erinnern?« Die dünne Stimme einer Frau.
»Sie hat eine schwere Gehirnerschütterung, die ihr Gedächtnis beeinträchtigt«, erklärte Dr. Weston geduldig. »Der Gedächtnisverlust kann temporär sein, aber …«
»Was aber, Doktor?«, fragte ein Mann.
Als ich die Stimme des Fremden hörte, tauchte ein Gespräch aus den schattenhaften Tiefen meiner Erinnerungen auf – wie eine Fernsehsendung, die man hören, aber nicht sehen konnte.
»Mir wäre es wirklich lieber, wenn du nicht so viel Zeit mit diesem Mädchen verbringen würdest. Sie macht nichts als Ärger, außerdem gefällt mir nicht, wie du dich in ihrer Gegenwart aufführst.«
Es war die Stimme des Mannes auf dem Flur, aber ich wusste weder, worum es bei dieser Erinnerung ging, noch konnte ich irgendwas damit verbinden.
»Der Gedächtnisverlust könnte auch dauerhaft sein. Das lässt sich nur schwer vorhersagen. Im Moment wissen wir es nicht.« Dr. Weston räusperte sich. »Ihre übrigen Verletzungen sind lediglich oberflächlicher Natur. Wie unsere Untersuchungen ergeben haben, scheint sie in keiner Weise misshandelt worden zu sein.«
»O mein Gott«, rief die Frau. »Misshandelt? Sie meinen …«
»Joanna, der Doktor sagt, sie ist nicht misshandelt worden. Beruhige dich!«
»Ich habe alles Recht, mich aufzuregen«, blaffte die Frauenstimme. »Steven, sie war vier Tagen vermisst.«
»Die Polizei hat sie in der Nähe des Michaux State Forest aufgegriffen«, erklärte Dr. Weston. »Wissen Sie, warum sie dort war?«
»Wir haben in der Gegend ein Sommerhaus, aber das haben wir seit letztem September nicht mehr benutzt. Es ist verriegelt, wir haben nachgesehen. Nicht wahr, Steven?«
»Aber es geht ihr gut, oder?«, fragte der Mann. »Es ist nur ihr Gedächtnis, das ist das einzige Problem?«
Ich trat von der Tür zurück und legte mich ins Bett. Wieder hatte ich Herzklopfen. Was waren das für Leute, und warum waren sie hier? Ich zog die Decke bis zu den Schultern hoch und hörte einige Fetzen von dem, was der Arzt sagte. Etwas von extremem Schock in Verbindung mit Dehydrierung und Gehirnerschüt-terung – eine durch mehrere Faktoren hervorgerufene medizi-nische Ausnahmesituation, in der sich mein Gehirn von meiner Identität abgekoppelt hatte. Klang kompliziert.
»Ich verstehe nicht ganz«, hörte ich die Frau sagen.
»Das ist so, als hätten Sie etwas auf Ihrem Computer geschrieben und die Datei abgespeichert, aber jetzt wüssten Sie nicht mehr wo«, erklärte der Arzt. »Die Datei ist noch vorhanden, aber sie hat keinen Zugang mehr dazu. Vielleicht findet sie sie auch nie wieder.«
Erschrocken zuckte ich zusammen. Wo hatte ich die Datei abgelegt?
Dann ging die Tür auf, und ich zuckte erneut zusammen, als diese Frau wie eine Urgewalt in mein Zimmer stürmte. Die rostroten Haare waren zu einem eleganten Zopf geflochten, ihr Gesicht war kantig, aber schön.
Abrupt blieb sie stehen und musterte mich. »O Samantha …«
Ich starrte sie nur an. Samantha? Der Name sagte mir nichts. Ich blickte zum Arzt. Er nickte. Sa-man-tha … nein, das sagte mir nichts.
Die Frau kam näher. Ihre Leinenhose und ihre weiße Bluse hatten keine einzige Knitterfalte. Goldene Armreife baumelten an ihren beiden schlanken Handgelenken, als sie mich in ihre Arme schloss. Sie roch nach Freesien.
»Meine Kleine«, sagte sie, fuhr mir durchs Haar und sah mir in die Augen. »Mein Gott, ich bin ja so froh, dass du gesund bist.«
Ich wurde ganz steif.
Die Frau blickte über die Schulter zu den anderen. Der fremde Mann war blass und wirkte erschüttert. Seine schwarzen Haare waren zerzaust. Dichte Bartstoppeln bedeckten sein freundliches Gesicht. Anders als die Frau konnte er nicht verbergen, wie sehr ihn das alles mitnahm. Ich starrte ihn an, bis er den Blick abwandte und sich durch die Haare fuhr.
Dr. Weston trat an mein Bett. »Das ist Joanna Franco – Ihre Mutter. Und das ist Steven Franco, Ihr Vater.«
Mir wurde eng um die Brust. »Ich … ich heiße Samantha?«
»Ja«, antwortete die Frau. »Samantha Jo Franco.«
Mein zweiter Vorname war Jo? Im Ernst? Ich schaute die beiden abwechselnd an. Gern hätte ich tief ein- und ausgeatmet, aber ich konnte nicht.
Joanna, meine Mom – wer immer sie sein mochte –, schlug die Hand vor den Mund und sah zu dem Mann, der nicht nur völ-lig durch den Wind, sondern anscheinend auch mein Dad war. Dann schaute sie wieder mich an. »Du erkennst uns wirklich nicht?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein. Es … es tut mir leid.«
Sie trat vom Bett zurück und fragte Dr. Weston: »Wie kann es sein, dass sie uns nicht erkennt?«
»Mrs. Franco, geben Sie ihr etwas Zeit.« Dann wandte er sich an mich: »Sie machen das ganz großartig.«
Der Meinung war ich überhaupt nicht.
Er drehte sich zu ihnen – meinen Eltern – um. »Wir würden sie gern noch einen Tag zur Beobachtung hierbehalten. Im Moment braucht sie viel Ruhe und Sicherheit.«
Ich sah wieder zu dem Mann. Er starrte mich wie betäubt an. Dad. Vater. Ein völlig Fremder.
»Und Sie meinen, es könnte wirklich dauerhaft sein?«, fragte er und rieb sich das Kinn.
»Es ist noch zu früh für eine Prognose«, erwiderte Dr. Weston. »Aber sie ist jung und im Übrigen gesund, die Voraussetzungen sind also denkbar günstig.« Er ging zur Tür, blieb aber dann noch einmal stehen. »Denken Sie daran, man sollte sie nicht allzu sehr unter Druck setzen.«
Meine Mom wandte sich wieder mir zu. Sie riss sich sichtlich zusammen, als sie sich auf die Bettkante setzte, meine Hand nahm, die Handfläche nach oben drehte und mir über das Handgelenk strich. »Ich erinnere mich noch, wie wir dich das erste und bislang einzige Mal ins Krankenhaus bringen mussten. Da warst du zehn. Siehst du das?«
Ich schaute auf mein Handgelenk. Eine dünne weiße Narbe verlief direkt unterhalb des Handtellers. Ha! Das war mir noch gar nicht aufgefallen.
»Du hast dir beim Turnen das Handgelenk gebrochen.« Sie schluckte und blickte auf. Nichts in ihren haselnussbraunen Augen, die meinen so ähnlich waren, nichts an ihren perfekt geschminkten Lippen weckte irgendetwas in mir. Dort, wo meine Erinnerungen, meine Gefühle hätten sein sollen, war nur ein großes dunkles Loch.
»Es war ein ziemlich übler Bruch. Du musstest operiert werden. Wir waren alle ganz krank vor Angst.«
»Du wolltest auf dem Schwebebalken angeben«, erklang die raue Stimme meines Vaters. »Dabei hatte die Lehrerin gesagt, du sollst das nicht machen – was war es noch gleich?«
»Ein Handstandüberschlag rückwärts«, sagte meine Mom leise.
»Ja.« Er nickte. »Aber du hast ihn trotzdem gemacht.« Jetzt schaute er mir in die Augen. »Du kannst dich tatsächlich an nichts erinnern, mein Engel?«
Das Atmen fiel mir schwer. »Ich würde gern, wirklich. Aber ich …« Weiter kam ich nicht. Ich riss die Hand los und fasste mir an die Brust. »Ich erinnere mich an nichts.«
Meine Mutter lächelte gequält und verschränkte die Hände im Schoß. »Schon gut. Scott hat sich große Sorgen gemacht. Dein Bruder«, fügte sie noch hinzu, als sie meinen leeren Blick bemerkte. »Er ist zu Hause.«
Ich hatte einen Bruder?
»Und alle deine Freunde haben bei der Suche mitgeholfen, sie haben Zettel aufgehängt und mit Kerzen Nachtwachen abgehalten. War es nicht so, Steven?«
Mein Vater nickte, aber seinem Blick nach zu urteilen war er tausend Meilen entfernt. Vielleicht war er dort, wo auch diese Samantha Jo war.
»Del war ganz verzweifelt, er hat Tag und Nacht nach dir gesucht.« Meine Mutter strich sich eine Strähne aus der Stirn, die sich gelöst hatte. »Er wollte mitkommen, aber wir haben es für besser gehalten, wenn er nicht dabei ist.«
Ich runzelte die Stirn. »Del?«
Mein Vater räusperte sich und konzentrierte sich wieder auf uns. »Del Leonard. Dein fester Freund, mein Engel.«
»Mein fester Freund?« O mein Gott. Eltern. Bruder. Und auch noch einen festen Freund?
Meine Mom nickte. »Ja. Ihr beide seid, na ja, seit Ewigkeiten zusammen. Du wolltest im Herbst mit Del nach Yale, genau wie eure Väter.«
»Yale«, flüsterte ich. Ich wusste, was Yale war. »Das klingt gut.«
Sie sah meinen Vater flehentlich an. Er machte einen Schritt auf uns zu, aber in dem Moment kamen zwei Deputys ins Zimmer. Meine Mom erhob sich und strich ihre Hose glatt. »Ja?«
Ich erkannte Deputy Rhode, aber der Ältere der beiden war mir fremd. Was mich eigentlich nicht überraschen sollte. Er nickte meinen Eltern zu. »Wir müssen Samantha ein paar Fragen stellen.«
»Kann das nicht warten?«, entgegnete mein Vater, der plötzlich aus seiner Versunkenheit zu erwachen schien. Jetzt strahlte er eine unverkennbare Autorität aus. »Da findet sich doch sicherlich ein besserer Zeitpunkt.«
Der ältere Deputy lächelte gezwungen. »Es freut uns, dass Ihrer Tochter nichts zugestoßen ist, aber es gibt noch eine zweite Familie, die sich um ihre Tochter Sorgen macht.«
Ich setzte mich auf und sah abwechselnd zu meiner Mutter und meinem Vater. »Was?«
Meine Mom nahm wieder meine Hand. »Die Rede ist von Cassie, meine Liebe.«
»Cassie?«
Sie lächelte, was aber eher wie eine Grimasse aussah. »Cas-sie Winchester ist deine beste Freundin. Sie ist ebenfalls verschwunden.«
2
Cassie Winchester. Meine beste Freundin. Ein Begriff, der et-was ganz Wichtiges bezeichnete, mit dem für mich aber genau wie bei den Wörtern »Mutter« oder »Vater« keinerlei Erinnerungen oder Gefühle verknüpft waren. Ich sah die Deputys an und hatte den Eindruck, dass ich irgendein Gefühl zeigen sollte, aber ich kannte dieses Mädchen doch gar nicht– diese Cassie.
Der ältere Polizist stellte sich als Detective Ramirez vor und hatte die gleichen Fragen, die ich auch schon von anderen zu hören bekommen hatte. »Wissen Sie, was geschehen ist?«
»Nein.« Ich beobachtete, wie die Flüssigkeit im Tropf durch den Schlauch in meine Hand sickerte.
»Was ist das Letzte, woran Sie sich erinnern können?«, fragte Deputy Rhode.
Ich schaute ihn an. Er hatte die Hände hinter dem Rücken verschränkt und nickte, als sich unsere Blicke trafen. Es war eine ganz einfache Frage, und ich wollte sie wirklich korrekt beantworten. Es war mir wichtig. Ich sah zu meiner Mutter. Sie machte den Eindruck, als würde ihre kühle Fassade jeden Moment bröckeln. Ihre Augen waren feucht, die Unterlippe zitterte.
Mein Dad räusperte sich. »Kann das nicht warten? Sie hat einiges durchgemacht. Wenn sie irgendwas wissen würde, würde sie es Ihnen doch sagen.«
»Woran können Sie sich als Letztes erinnern?«, fragte Detective Ramirez erneut, ohne meinen Vater zu beachten.
Ich schloss die Augen. Irgendetwas musste es doch geben. Ich wusste, ich hatte Wer die Nachtigall stört gelesen. Höchstwahrscheinlich in der Schule, aber ich sah weder die Schule noch einen Lehrer oder eine Lehrerin vor mir. Ich wusste noch nicht einmal, in welche Klasse ich ging. Grauenhaft.
Deputy Rhode trat näher, was sein Kollege mit einem Schnauben quittierte. Er griff in seine Brusttasche, zog ein Foto heraus und zeigte es mir. Ein Mädchen. Sie sah genauso aus wie ich. Nur waren ihre Haare nicht so rot wie meine. Ihr Haar war braun, und sie hatte fantastische grüne Augen, viel schöner als meine. Davon abgesehen hätten wir aber Schwestern sein können.
»Erkennen Sie sie?«
Frustriert schüttelte ich den Kopf.
»Schon gut. Der Arzt hat gesagt, dass es noch eine Weile dauern kann, bis Ihr Erinnerungsvermögen zurückkommt, und dann…«
»Halt!« Ich fuhr aus dem Bett auf, ohne auch nur einen Gedanken an den verdammten Tropf zu verschwenden, der an meiner Hand riss, wobei sich die Nadel fast gelöst hätte. »Halt, mir ist da etwas eingefallen.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!