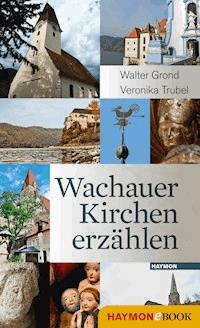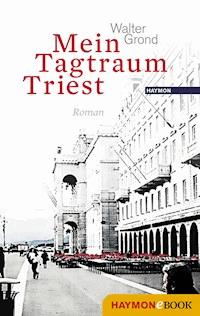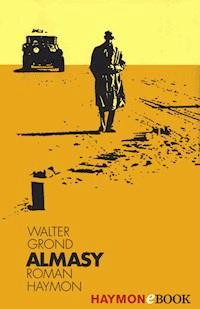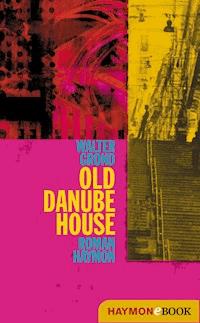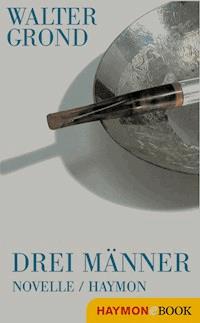Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
VON DER MONDÄNEN ORIENTALISCHEN METROPOLE BAKU INS PARIS DER 1920ER Sommer 1917: Hermann Opitz beschließt, sein altes Leben hinter sich zu lassen, sein Heimatdorf, seine Ehe - und meldet sich freiwillig zum Kriegsdienst. Ein Jahr später strandet er in Baku, das in den Jahren des Ölbooms zur mondänen orientalischen Metropole geworden war, und begegnet dort Jale, der Tochter eines Ölbarons. Wenig später gerät das junge Liebespaar in die Wirren der Russischen Revolution und flieht nach Paris. SPURENSUCHE IN DER FAMILIENGESCHICHTE UND DAS GLÜCK DER VERBUNDENHEIT Zwei Generationen später begibt sich der Enkelsohn von Hermann Opitz auf eine Spurensuche in der Geschichte seiner Familie. Er erkundet das Leben seiner Großeltern, die ihm stets wie die modernen Erben von Philemon und Baucis in Erinnerung waren; er besucht das Heimatdorf seines Großvaters, wo ihm seine Tante Sophie von ihrem Leben und Lieben im Wien der Nazi-Jahre erzählt; und schließlich begegnet er Rita, an deren Seite er das Glück der Verbundenheit erlebt, das er einst in den Augen seiner Großeltern gesehen hat - und gleichzeitig zu ahnen beginnt, dass das private Glück untrennbar mit den Zeitläuften der Weltgeschichte verknüpft ist. DREI LIEBESGESCHICHTEN VOR DEM PANORAMA DER WELTGESCHICHTE Schlicht und unsentimental erzählt Walter Grond die Geschichten dreier Liebespaare, die auf rätselhafte Weise ineinander verwoben sind - und lässt zugleich die grenzenlose Kraft der Liebe spürbar werden, die unbeirrt von allen Schrecken der Geschichte des 20. Jahrhunderts wirkt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Grond
Drei Lieben
Roman
Sie hat ganz leise gesprochen, und Tonio spürt, dass sie ihn in eine neue Welt mitnehmen will, in eine Welt, die für ihn zu groß ist und auch zu geheimnisvoll, tiefer als das Meer, und dass er trotz allem Lust hat, ihr zu folgen.
Hervé Le Tellier, „Neun Tage in Lissabon“
Jale
Sophie
Rita
Jale
Ich erinnere mich an meinen Großvater als einen besonnenen Mann, der mich freundlich an der Hand führte und zum Markt mitnahm. Ungemein stattlich, wenn er samstags vor der Kirche Saint-Médard in der Rue Mouffetard mit alten Weggefährten über Gott und die Welt resümierte. Ich habe ihn nie verbittert, vielmehr stets gelassen und gütig erlebt. Seine Heiterkeit kam überraschend und doch nie beunruhigend.
Vielleicht hatte er einst durch das Fegefeuer gehen müssen, um in einem für ihn so ungeahnt reichen Leben landen zu können. Zuerst in Baku, wohin es ihn in den Wirren des Ersten Weltkrieges verschlagen, und wo er meine Großmutter Jale kennengelernt hatte. Und dann, da die Russische Revolution auch Baku, die Öl-Metropole am Kaspischen Meer, erreichte, hier in Paris, wohin er mit seiner neuen Familie Anfang der 1920er Jahre geflüchtet war, und wo er ein langes und glückliches Leben führte.
Unerklärlicherweise schien mein Großvater keine Verwandten oder alten Freunde zu haben. Ich wusste zwar, dass er einst mit einer anderen Frau in Österreich verheiratet gewesen war. Es galt aber als ungeschriebenes Gesetz, ihn nicht danach zu fragen, und für meine Großmutter Jale, die gerne einen Mantel aus Geheimnissen um ihn wob, begann sein wirkliches Leben erst im Ersten Weltkrieg, mit seiner Einberufung an die russische Front.
Wann immer ich an meine Großmutter Jale denke, fällt mir sofort der Lehnstuhl ein, auf dem sie die meiste Zeit über saß und majestätisch Anweisungen gab. Sie konnte ausschweifend Geschichten über meinen Großvater erzählen, die mit jedem Mal märchenhafter, aber auch schauriger wurden. Flüchtete ich aus Angst vor diesen Geschichten in den Schoß meiner Mutter, beruhigte mich diese mit der Erklärung, Großmutter Jale sei außergewöhnlich einfühlsam. Vielleicht war es in ihrer besonderen Liebe zu meinem Großvater begründet oder aber Teil ihres besitzergreifenden Wesens, dass sie sich in seine Geschichte derart hineinlebte. Sie bezog alles auf sich, war fantasievoll, und eine gewisse Lust an Leid und Schmerz dürfte ihr nicht fremd gewesen sein.
Gegen Ende des Ersten Weltkrieges, erzählte sie jedenfalls, hatte das Schicksal meinen Großvater zu ihr nach Baku verschlagen. Sechs Monate davor war er – verheiratet mit einer gewissen Maria – aus einem kleinen Dorf im österreichischen Voralpenland nach Brzeżany, einer Stadt in Galizien, aufgebrochen. In jener Stunde des Abschieds von seinem österreichischen Dorf, so meine Großmutter Jale, war die Welt für ihn verdorrt, und etwas bedrohlich Lautloses hatte sich breitgemacht. Seine Gliedmaßen hatten sich wie vom Körper gelöst, und alles Feste in ihm war verdampft. Dann starb sogar die Erinnerung ab. Er sah sein Leben hinter dem Horizont verschwinden, und er dachte noch, dass es so ist, wenn ein Mensch vergeht.
Meine Großmutter Jale erzählte von seiner Verzagtheit, vom ganzen Unglück an jenem Tag seines Abschieds vom Dorf im Frühsommer 1917, der für ihn das Ende des Lebens bedeutet haben mochte. Im Zug nach Brzeżany glich sein Schmerz in den Schläfen, der ihn schon seit Monaten plagte, der Landschaft, die im Fenster an ihm vorbeizog und doch stillstand, grau und eben und horizontlos. Nur manchmal blitzte das Grün von ein paar Sträuchern auf, oder riss ihn das Holpern des Waggons aus seiner Erstarrung. Menschen waren das Schlimmste. Räusperte sich einer der Soldaten im Abteil, glaubte er, unsäglicher Lärm hinter seiner Stirn erdrücke ihn. Die ganzen elf Tage über, die es bis Brzeżany dauerte, blieb er von der Frage gefangen, wie viel ein Mensch aushalten muss und wie viel er aushalten kann.
Brzeżany gehörte damals zu Österreich. Da aber die Front gegen das Zarenreich weit im Osten verlief, hieß es im Dorf, Hermann Opitz, wie mein Großvater damals hieß, sei nach Russland gegangen. Im Frühsommer 1917 sprach niemand mehr von Kriegseuphorie. Die Menschen waren erschöpft und hatten ihre Lust auf das Morden verloren.
Mein Großvater hätte nicht sagen können, durch welche Gegend der Zug fuhr. Die Bilder des Abschieds aus dem Dorf legten sich über die Landschaft. Vielleicht erschienen dann und wann ein Brunnen, eine Scheune, eine Bahnstation? Auf dem flachen Land kamen ihm schon die seltenen Verwerfungen wie Hügel vor. Alles erwies sich als weit und verloren, während das Tal seines Dorfes eng und begrenzt war.
Damals im Zug nach Brzeżany, als er hinausfiel in ein weites Land, begann sich mein Großvater zu häuten, aber es fühlte sich an wie ein entsetzliches Würgen. Etwas wie Geografie konnte ja nicht beschreiben, wo hindurch der Zug seine Spur zog. Dieses Land verhielt sich, wie sich Menschen verhalten. Es gab nur ein Entweder-Oder. Entweder erhob sich aus einer Talsohle etwas Steiles und ragte in den Himmel, und es verhieß also das Bergland die ersehnte Heimkehr. Oder das Land war flach und verschluckte alles, auch das Sanft-sich-Erhebende, und verwandelte alle Lebewesen in Untote.
Ob seine Frau Maria ahnte, dass er sich freiwillig an die Ostfront gemeldet hatte? Er ging in ein wüstes Land, dort wäre jeder für sich und allein. Gott war verschwunden. Die Aussicht im Krieg zu sterben, quälte meinen Großvater weniger, als ihn der Wunsch trieb, sich selbst ungeschehen zu machen. Es ging darum, in die eigene Hölle hinabzusteigen. Der Filz der Uniform, das Bajonett, die Stiefel sagten ihm das.
Er konnte die Gegend, durch die der Zug fuhr, im Grunde gar nicht beschreiben. Es handelte sich um eine Leerstelle, in die sich die verlorenen Seelen verirren. Niemand könnte erfassen, was mit Menschen geschieht, die an diesen absurden Unort verfrachtet werden, und die mit den Gräueln des Krieges ihren eigenen Abgründen begegnen. Die zerfetzten Leiber, zwischen denen er sich hindurchwühlte, hielten die Zeit an. Oder war alle Zeit durcheinandergeraten? War die Anfahrt zur Schlacht von Brzeżany schon die Erinnerung an sie? Erlebte er die Gräuel bereits, als er noch gar keinen Fuß auf das Schlachtfeld gesetzt hatte? Und wenn er auch auf der Reise nach Brzeżany durch das Land der Donauschwaben, ein Land wie das seine, grün und überschaubar, gefahren sein musste, existierten in seiner Erinnerung nur flache Ebenen, Formloses. Das Endlose bestand aus lauter Übergängen.
Der Zar hatte eine letzte Offensive gegen das Heer aus Deutschen, Österreichern und Türken angeordnet. Ob er aus der Stadt Brzeżany einen Eindruck vom Ringplatz mit seinen habsburgischen Häusern mitnahm, die bei seiner Ankunft noch existiert hatten? Von der Kirche, vor der Frauen in ruthenischen Trachten posierten, oder vom Leben im jüdischen Viertel? Oder blieb ihm Brzeżany, das bald nach dieser Schlacht zur neu gegründeten Ukraine gehören würde, nur als Inferno aus zerbombten Häusern, verätzten und verstümmelten Leichen, die auf den Straßen lagen, in Erinnerung?
Mein Großvater ließ kaum ein Wort über den Krieg fallen. Er sprach nicht über die Schreie der Männer, die im Artilleriefeuer, durch Gasgranaten oder Bajonette fielen. Nicht über die Kälte, den Hunger und die Angst. Er erwähnte nur, dass zu Kriegsende kein Österreicher, der in den Schützengräben vor Brzeżany verschanzt war, zu sagen wusste, aus welchem Grund sich die russischen Soldaten von einem Tag auf den anderen zurückzuziehen begannen. Dann sei von einem Umsturz die Rede gewesen. Aber als sich die Deutschen und Österreicher zum Rückzug aufmachten, verlor die Truppe meines Großvaters den Anschluss, und erst nach Wochen wurde ihm klar, dass er mit einem Haufen Verlorengegangener nicht in Richtung Westen, sondern durch das südöstliche russische Reich geirrt war.
In den Ebenen schien es keine Himmelsrichtungen zu geben. Er verstand nicht, ob man in dem Land, in das es ihn verschlagen hatte, gerade die Waffen niederlegte oder wer gegen wen und aus welchem Grund sie erhob. Bedeutete ihm jemand mit Händen und Füßen oder mit ein paar deutschen Worten etwas von Revolution, die das Land erfasst habe, dachte er an Allerseelen. Es gab die Liebe und es gab die Hoffnung der armen Seelen, nach überstandenem Leid im Paradies zu landen.
Das Schänden und Quälen und Töten ging weiter. Mein Großvater taugte nicht mehr zum Feind, war überflüssig geworden, jemand, der nicht auffiel. Die Jagd auf die Klassenfeinde hatte das Blickfeld derart verengt. Ihm schien, niemand habe mehr Zeit dafür, ihn zu ermorden. Er sah viele dahinsterben. Nur der Tod machte alle gleich.
Es mochte ihn von einem ins andere Inferno verschlagen haben, aber er überlebte sie alle, meinte meine Großmutter Jale. Wie ein Kater, der sich duckt, zugleich zusammenzieht und abstößt, Pirouetten schlägt und schließlich mit den Pfoten auf dem Boden landet. Stets auf den Pfoten, aus welcher Höhe immer er auch fällt.
Irgendwann war er nur mehr allein, ging weiter, und gelangte schließlich an die Kaspische See, im heutigen Aserbaidschan. Das Meer, das ferne, das unendliche, von dem die Bücher erzählt hatten, und das er nun mit eigenem Auge sah. Die Wege dorthin zwar beschwerlich, tiefer Sand im Licht einer Sonne, die über seinem Kopf zu verglühen schien, greller als alles, was er bisher für hell gehalten hatte. Vom Hochplateau aus gesehen, von dem er kam, ging das Wasser zugleich in den Himmel über und brach am Horizont ab oder fiel gar ins Leere. Am weißen Strand aber schimmerte es wie ein Spiegel, der den Himmel in sich aufnahm, und kräuselte sich merkwürdig.
Was er dort sah, auf den einstigen Wegen des Marco Polo, überwältigte ihn. Es glich den kühnsten Träumen in den Büchern der Bibliothek, die er einmal besessen hatte. Er wusste nicht, wo er sich befand, aber alles erinnerte ihn an die Erzählungen des venezianischen Kaufmanns – die orientalischen Männer, die jener einst beobachtet hatte, wie sie Öl aus kleinen Lachen schöpfen, die Fontänen, die aus der Erde schießen, die mit Öl gefüllten Sickergruben, die Schlammvulkane und die ewigen Feuer von Abşeron, wie die Zarathustra-Menschen die brennenden Hänge genannt hatten.
Dann stand er vor Baku. Vor dem satten Leben einer Stadt, deren Reichtum sich aus eben jenen Erdölquellen nährte, die Marco Polo vor siebenhundert Jahren beschrieben hatte. Als mein Großvater sie betrat, verirrte sich ein kleines Lächeln auf seine Lippen. Und genau in jenem Augenblick, so meine Großmutter Jale, machte sich ein flaues Gefühl in ihrem Bauch und ein leichtes Ziehen in ihrer Brust breit, und legte sich ein Rumi-Liedchen auf ihre Lippen: Ich sah sie ungesehen, und Schöneres sah ich noch nie; ich sah des Mondes Aufgang in ihrem Angesicht.
Wie unwirklich ihm Baku vorkam! Wie er staunte über die Palais und Boulevards, die er in Paris oder Madrid erwartet hätte. Über die Villen und modernen Geschäfte zwischen der mittelalterlichen Stadt mit ihren engen Gassen und Basaren und den Ölfeldern mit ihren bizarren Türmen, die zum Meer hin aus dem Boden ragten, wie auf einem Schachbrett eng aneinandergedrängt.
So erzählte es meine Großmutter Jale und baute eine große Spannung auf für die märchenhafte Geschichte ihrer Liebe, die nun folgen sollte. Dass sie längst über die wahre Herkunft meines Großvaters Bescheid wusste, spielte dabei keine Rolle. Sie schlüpfte einfach in die Rolle der jungen Frau, die sie damals gewesen war, malte sich ihre Begegnung mit dem lang ersehnten Prinzen aus, sprach einmal träumerisch über das Geschehene, um einen Augenblick später schonungslos wie eine Chirurgin die Rolle meines Großvaters in ihrem Leben und auch die heiklen Seiten ihrer selbst freizulegen.
Gerade zu der Zeit, als mein Großvater in ihrer Stadt ankam, hatte sie also oft Wie sie mein Auge füllte, so war ich voller Tränen vor sich hin gesungen, im Haus ihres Vaters, einer prächtigen Villa im besten Viertel von Baku. Ihre Vorahnung wollte es zwar, dass ihr ersehnter Prinz vor ihrem Fenster auftauche, traumwandelnd! Tatsächlich traf sie ihn aber in der Erlöserkirche, im Stadtzentrum, er fiel ihr auf, als er gerade eine Kerze anzündete.
Mein Großvater hatte um eine Kloster-Suppe bitten wollen. Die evangelische Kirche mit ihrem spitzen Turm war ihm katholischer erschienen als die orthodoxen Zwiebeltürme, die Kuppeln der Moscheen und die Tempelquader der Synagogen. Jale aber ging gern in die kircha der Deutschen, die für ihre muslimische Großmutter wie alles Russische von den teuflischen Christen kam.
Seine Augen waren schon trüb vor Erschöpfung, und in den ihren blitzte etwas Übermütiges auf. Sie fiel in die graugrünen Augen eines Mannes, der gerade, von ihrem Blick beseelt, in die Welt der Lebenden zurückkehrte. Er räusperte sich verlegen, sagte etwas Ungeschicktes, für sie aber hörte sich sein Deutsch wie die erwartete Botschaft an. Frech antwortete sie in der Sprache ihrer Gouvernante, das passiere Männern so, und fragte ihn dann, woher er denn komme.
So wie ihn der Reiz des Fremden in der Gestalt dieser jungen Frau zu fesseln begann, war auch Baku ein Mysterium für ihn. Ein Mysterium, das ihn anzog, in sich hineinriss, ihn durcheinanderwirbelte und ihn in ein rauschhaftes und ebenso verstörtes Staunen versetzte. Die Pracht des alten Bakú, das sich bei seiner Ankunft zwar schon in vorrevolutionärer Auflösung befand, aber noch den Eindruck der geschäftigen, mondänen wie auch rätselhaft islamischen Stadt in ihm hinterließ.
Sie war die Frau, die ihn rettete, und war zugleich die Stadt, die ihm so märchenhaft erschien. Sie war beides, die Frau und die Stadt, und beides machte den geheimnisvollen Ort aus, der ihn in die verschlungenen Gassen mit den Teeläden und Händlerkarren lockte, wo hinter den Häuserfassaden und oben auf den Dächern ein verborgenes, aber ebenso reiches und geschäftiges Leben herrschte. Unauffindbar, allgegenwärtig.
Meine Großmutter Jale hatte schon lange von ihrem Prinz, doch eigentlich Retter, geträumt. Ihr Großvater war ein Bauer gewesen und hatte, durch das Öl auf seinen Feldern reich geworden, seinen Jugendstilpalast unweit der Villa Petrolea der Brüder Nobel errichten lassen. Die Leute sprachen ihn als Aga an, wie es jedem guten Muslimen zusteht, und doch hatte er sich, wie es einem Ölbaron entsprach, einen russischen Namen, Abd Rasur Jabrail Hasanow, zugelegt. Mutiger und unternehmungsfreudiger als seine Nachbarn hatte er seine Kühe verkauft und ein Stück Land an der Küste erworben, um den harten Boden mit Baumwolle zu bepflanzen und geduldig auf sein Glück zu warten. Es war nicht Schicksal, sondern weise Voraussicht gewesen, die Allah belohnte und also eines Morgens zwischen den Pflanzen schwarze Fontänen aus seinem Boden quellen ließ, die ihn zu einem reichen Mann machten. Unbestritten war er auch geizig, zwar darauf stolz, in den Häusern der Europäer zu verkehren, in seinem Herzen aber war er ein misstrauischer Bauer geblieben, zugleich den Lockungen der Christen gegenüber aufgeschlossen und doch ein gehorsamer Sohn seiner schiitischen Mutter. So aufbrausend, streitsüchtig wie auch gelassen demütig, da er es mit stoischer Ruhe ertrug, alle zwei Jahre von Straßenbanden verschleppt und gegen Lösegeld wieder freigelassen zu werden. Denn die Entführer fühlten sich nicht nur durch den Koran zu ihrer Erpressung berechtigt, sondern genossen hohes Ansehen unter den Armen. Als die zwei Seiten derselben Medaille betrachtete er es also, dass die Entführer die Armen großzügig an ihrer Beute beteiligten und ihn, den Verschleppten, nach Begleichung der Lösegeldforderung geradezu gemästet ihrer Familie zurückerstatteten – am Ende also alle zufrieden aus diesem Handel hervorgingen.
Ihr Vater schwärmte von Europa. Zwar hätte er niemals seiner Mutter widersprochen, ging aber über ihre strengen Ansichten hinweg. Daher war sie, seine Lieblingstochter, nicht an einen alten Patriarchen verheiratet worden. Bald dreiundzwanzig Jahre alt, schlug sie immer noch die Zeit mit ihren Studien der Musik und der Sprachen tot.
Einen großen Einfluss übte Umn el-Banu auf sie aus, ein Mädchen aus dem Geschlecht Asadullah. Von ihr hatte sie die spitze Zunge über das ostwestliche Tollhaus, in dem sie lebten. Umn el-Banu, mit der sie gern schwimmen ging, war eine charmante Wortführerin und provozierte mit ihrer französischen Orientierung. Meine Großmutter Jale erzählte ihrem Vater nach jedem Besuch, bei den Asadullahs – der Familie eines der reichsten muslimischen Ölbarone Bakus – wehe ein Pariser Flair, seitdem Umn el-Banus Vater eine frankophile Türkin geheiratet habe. Jales Vater, Witwer wie Herr Asadullah, wies dann zwar auf den guten deutschen Einfluss in seinem eigenen Haus hin, ließ aber doch jedes Mal etwas Französisches heranschaffen.
Seit den Tagen der Hidschra, da der Prophet Mohammed mit seinen Getreuen aus Mekka geflohen war, thronte hingegen Jales Großmutter auf einem alten Stuhl, der als besonders robust galt, und kontrollierte jede menschliche Regung auf ihre Korantauglichkeit. Ihr Gemach lag gleich am Eingang des Hauses, daher gab es kein unbemerktes Vorbeikommen an ihr. Die Tür zu ihrem Zimmer stand Tag und Nacht offen, und auch von ihrem Bett aus konnte sie überblicken, wer das Anwesen betrat und wer es verließ. Ihr mächtiger Leib flößte Respekt ein, ja ihre ungewöhnliche Korpulenz verlieh ihr Würde. Sie verlangte von allen, ihr penibel zu berichten, was man den Tag über getrieben und was man vorhatte zu tun. Die meiste Zeit kommandierte sie die Dienstboten herum, die restliche Zeit ihre Kinder und Enkelkinder, und nicht zu vergessen, sämtliche Frauen der Verwandtschaft, vor allem die Nebenfrauen ihrer Brüder, Söhne, Cousins und Neffen. Alles, was sie von sich gab, war grob, und sie fluchte ständig.
Meine Großmutter Jale hingegen muss von ungewöhnlicher und bedrohlicher Schönheit gewesen sein. Ihre grazile Erscheinung und ihre besondere Ausstrahlung sind auf den Fotos jener Zeit zu erahnen, und sie sah jedenfalls anders aus als ihre Schwestern. Ihr Körper war hochgewachsen, nicht klein und gedrungen. Ihre langen Glieder wie auch ihr schlanker Hals, die hohe Stirn, der fein geschwungene Nasenrücken, die schmalen und etwas abgeflachten Backen und ihre großen Augen und Lippen passten so gar nicht in das Bild eines aserbaidschanischen Mädchens.
Als sie, gerade elf geworden, das Gesetz der Reinlichkeit auf sich aufmerksam machte und seitdem im Hamam nicht nur gewaschen, sondern am ganzen Körper enthaart wurde, offenbarte sich an ihr, was ohnehin ihre Großmutter seit ihrer Geburt vermutet hatte, an jedem vierzigsten Tag. Zwar ein Kind eines frommen Muslimen der Zwölfer-Schia, die Azarica sprach, Piti und Dolma und Pilaw aß und Schärbät aus Milch und Minze trank, war nämlich etwas falsch und sündig an ihr.
Dabei empfand sie genauso wie jedes gute aserbaidschanische Kind große Lust auf den armenischen Massenmord. Dieses Spiel war das Feiertagsvergnügen im Elternhaus ihrer Freundin Umn el-Banu. Ein Nachbarsmädchen aus armenischem Haus, das im Garten geduldet wurde, hielt dafür her, nicht nur einfach hingerichtet, sondern wieder und wieder geköpft oder aber zuerst gefesselt zu werden, damit ihr die Glieder abgehackt, die Zunge herausgeschnitten, das Herz und die Gedärme herausgerissen, sie von den Jungen geschändet und von den Mädchen besudelt werden konnte. Ja nichts war Jale selbstverständlicher, als dass jenes armenische Mädchen schwieg, kein Wort gegen das Morden erhob oder gar Erwachsenen davon erzählte. Regelmäßig getötet und entehrt zu werden, konnte schließlich nicht schlimmer sein, als allein und einsam und ohne die Gesellschaft anderer Kinder aufwachsen zu müssen.
Nun aber, seitdem sie unrein geworden war, eiferten die Tanten im Dampfbad über ihre sogar zwischen den Beinen sündige Haut, die samtig und auch ohne ihre schmerzhafte Behandlung beinahe glatt war, und auf der das Henna, mit dem man ihren Körper bis in den letzten Winkel färbte, bronzefarben glänzte.
Bei all ihrer Lust an Indiskretionen, mit der sie das Waschen, Enthaaren und wortreiche Einfädeln neuer Ehen im Dampfbad zu schildern pflegte, äußerte sich meine Großmutter Jale nur widerstrebend zum Gerücht, sie sei das Produkt einer Affäre ihres Vaters mit einer Frau aus dem Jemen. Sie wollte nichts dazu sagen und hatte doch selbst das Gerücht gestreut, im Haman sei ihre Herkunft verflucht worden.
Vielleicht hatte es sie gekränkt und ebenso stolz gemacht, eine Fremde zu sein, und vielleicht hatte sie selbst ein Geheimnis daraus gemacht, weil das Ungewisse sie noch außergewöhnlicher machte. Ihr Vater bestand darauf, sie müsse eine europäische Erziehung erfahren, und sie selbst zelebrierte schließlich den Gedanken, eines Tages von einem europäischen Prinzen erlöst zu werden. In ihren Träumen ließ sich das Beste von allem miteinander verbinden.
Um ihren Traummann nach Baku zu locken, zündete sie jeden zweiten Tag eine Kerze an, und es gab keinen besseren Ort für das Feuer, das sie in ihm entfachen würde, als die Erlöserkirche, in der es still und andächtig zuging. Hier empfand sie das Brennen in ihrem Körper als die Sehnsucht einer sinnlichen Göttin.
Und so, eines Tages, während die Russische Revolution näher rückte und die ersten Ölbarone nach Westen aufzubrechen begannen, stand mein Großvater vor ihr, und sie fiel in seine Augen so wie er in die ihren. Ein Mann in Lumpen, mit Beulen und Krusten im Gesicht, bis auf die Knochen abgemagert, mit tiefen Rändern um die Augen und etwas Trübem im Blick. Viel älter als sie und wie aus dem Grab entstiegen. Ihre Träume aber hatten ihn zu ihrem Prinzen erkoren. Nichts konnte sie von dieser Idee abbringen. Flüchteten ihre Nachbarn aus Baku, hatte dieser Herr aus Europa allen Reichtum hinter sich gelassen und jede Mühe auf sich genommen, um sich bis zu ihr vorzukämpfen. Ja er hatte sich, von Banditen beraubt, mit letzter Kraft nach Baku geschleppt, durch nichts von seinem Wunsch abbringen lassen, in ihre Arme zu sinken und ihr König zu sein. Er würde sie erlösen, und nur sie konnte ihn aus seiner Not, in die er ihretwegen geraten war, retten.