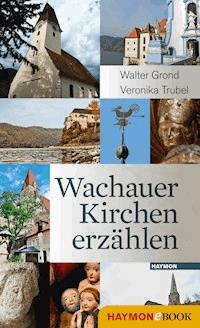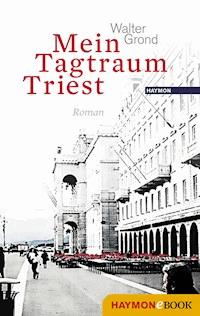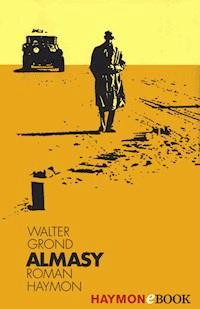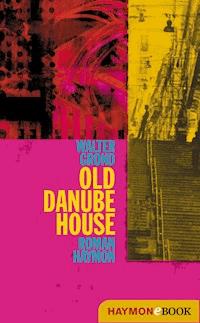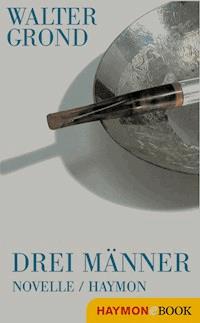Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Walter Grond knüpft im vorliegenden Essayband an seine in "Der Erzähler und der Cyberspace" dargelegten Thesen an, denenzufolge der Gebrauch der digitalen Informationsnetze nicht unbedingt einen Kulturverlust bedeutet, sondern vielmehr auch eine Zerstörung bestehender Hierarchien und damit einen Gewinn an Freiheit beinhalten könnte. Jetzt geht der Autor zusammen mit mehreren Gesprächspartnern diesen Überlegungen weiter nach: Auch in der Art der Diskursführung trägt Grond der Komplexität des Netzes Rechnung. In den Gesprächen und E-Mail-Dialogen wird vernetzt gedacht, die Eindimensionalität des seine Gedanken Mitteilenden wird aufgebrochen. Dabei ist die Bandbreite der angeschnittenen Themen beachtlich und reicht von einer Diskussion zur Mythenbildung um Thomas Bernhard über mentalitätsphilosophische Debatten bis zum Konnex zwischen Naturwissenschaft und Literatur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Grond knüpft im vorliegenden Essayband an seine in „Der Erzähler und der Cyberspace“ dargelegten Thesen an, denenzufolge der Gebrauch der digitalen Informationsnetze nicht unbedingt einen Kulturverlust bedeutet, sondern vielmehr auch eine Zerstörung bestehender Hierarchien und damit einen Gewinn an Freiheit beinhalten könnte.
Jetzt geht der Autor zusammen mit mehreren Gesprächspartnern diesen Überlegungen weiter nach: Auch in der Art der Diskursführung trägt Grond der Komplexität des Netzes Rechnung.
In den Gesprächen und E-Mail-Dialogen wird vernetzt gedacht, die Eindimensionalität des seine Gedanken Mitteilenden wird aufgebrochen. Dabei ist die Bandbreite der angeschnittenen Themen beachtlich und reicht von einer Diskussion zur Mythenbildung um Thomas Bernhard über mentalitätsphilosophische Debatten bis zum Konnex zwischen Naturwissenschaft und Literatur.
Walter Grond
VOM NEUEN ERZÄHLEN:GIPFELSTÜRMER UND FLACHLANDGEHER
Essays, Gespräche, E-Mail-Dialoge
© 2001HAYMON verlagInnsbruck-Wienwww.haymonverlag.at
Ungekürzte E-Book Ausgabe 2014.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7099-7364-6
Cover: Benno PeterSatz und Umbruch: Haymon Verlag
Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.haymonverlag.at.
Inhalt
ESSAYS
Vom neuen Erzählen. Nachsatz zuDer Erzähler und der Cyberspace
Gefährliche Wegkreuzungen
Kulturelles Gedächtnis und Evolution
Gipfelstürmer und Flachlandgeher
Ein Wurf kann in allen Gewässern Wellen schlagen
GESPRÄCHE
Die Partner der Gespräche
Über Thomas Bernhard und die Mythen der Intellektuellen.Gespräch mit Klaus Zeyringer
Über Europa, die Gelehrtheit und eine Poetik der Mentalitäten.Gespräch mit Dzevad Karahasan
Über die Medien, den Orient und das Internet.Gespräch mit Tarik A. Bary
E-MAIL-DIALOGE
Die Partner der E-Mail-Dialoge
Über das Internet, die Kommunikation und die Literatur.Dialog mit Susanne Berkenheger und Tilman Sack
Über die Neue Ökonomie, den Aberglauben und das ernste Leben.Dialog mit Christian Eigner und Christine Maitz
Über die Vereinsamung, die Klischees und die Mehrsprachigkeit.Dialog mit Dragana Dimitrijevic, Martin Krusche und Wessam El Ghayat
Über die Wissenschaft und die Literatur für Autoren, Nicht-Leser und Leser.Dialog mit Harald Kollegger und Kurt Lanthaler
Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag
ESSAYS
Vom neuen Erzählen
Nachsatz zu Der Erzähler und der Cyberspace*
Über den Zeitraum eines knappen Jahres konnte man von Februar 1998 bis Jänner 1999 auf der Website www.goetz.de einem Tagebuch-Experiment von Rainald Goetz folgen. Der am Ende achthundertseitige Text erschien ein Jahr später unter dem Titel Abfall für alle in Buchform. Goetz betonte, die häppchenartige Form dieses Romans eines Jahres gehe auf das Internet zurück, in dem das Buch, in täglichen Eintragungen publiziert, Stück für Stück entstanden war. Sein Internet-Roman stelle das Abenteuerliche der Gattung Roman überhaupt zur Diskussion.
Bei jungen Lesern stieß die weitschweifige Montage aus alltäglichen Beobachtungen, Gedankensplittern, Aufzeichnungen innerer und äußerer Geschehnisse, kritischen Zwischenrufen und Versuchen einer zeitgemäßen Literaturtheorie auf viel Kritik. Die Leser der Internetgeneration, auf deren kulturelle Gewohnheiten sich das Buch immerhin berief, beklagten das Fehlen einer Fabel, eines linearen Erzählbogens und der Konzentration auf ein Thema. Hatte Goetz das Ideal seiner Sprache auf das World Wide Web bezogen und als alltäglich, zugänglich und lebensnah bezeichnet, so störte seine jungen Kritiker das Ausufernde, Bekennerische und Privatistische seiner Ästhetik, in dem keine nachvollziehbare Geschichte entlang vorstellbarer Figuren erzählt werde.
Erweist sich Rainald Goetz damit als der radikale Modernist, dem gegenüber seine jungen Leser als hausbackene Traditionalisten zurückbleiben? Oder hinkt Goetz mit seinem Sprachexperiment den technologischen Umgestaltungen unserer Lebenswelten so sehr hinterher, daß er für die geübten Bewohner der virtuellen Realität wie ein antiquierter Textbastler, ein Amateur im Mediengebrauch erscheinen muß?
An diesem Beispiel läßt sich vor allem zeigen, wie prekär es geworden ist, von literarischer Gültigkeit zu sprechen, ohne zu bedenken, wie die Medien und der Computer die Lesegewohnheiten verändert haben. Mit den neuen Kommunikationstechnologien entstehen neben neuen literarischen Formen insbesondere neue Milieus: Menschengruppen, die nicht mehr gegen das Alte rebellieren, sondern Erfolg in ihrem eigenen Leben wünschen und einen demgemäß anderen Kulturbegriff praktizieren.
Wer versucht, den gegenwärtigen Kulturwandel zu beschreiben, fühlt sich ständig dabei ertappt, auf dem falschen Fuß zu landen, genau im Augenblick, da er meint, sein Gewicht auf den richtigen verlagert zu haben. Rainald Goetz sieht sich ja nicht postfaschistischen Kollaborateuren gegenüber, wie die Modernisten nach dem Zweiten Weltkrieg, die ihre ästhetische Selbstfindung auf die Befreiung von erdrückenden Traditionen beriefen. Nicht weniger vehement läßt sich behaupten, daß Rainald Goetz seit den achtziger Jahren der deutschsprachige Autor ist, der das Ineinandergreifen von popkulturellem Verhalten, literarischem und kritischem Bewußtsein betreibt. Warum stößt also sein Abfall für alle, den doch die etablierte Literaturkritik als versöhnlichen Weg zwischen literarischer Qualität und Medienbewußtsein lobt, auf so wenig Gegenliebe bei denen, die er betreffen soll?
Es gilt, den Kontext zu untersuchen, aus dem beide sprechen, um die Kluft zu begreifen, die heute zwischen avanciertem Schreiben, wie Goetz es betreibt, und avanciertem Lesen klafft, wie seine jungen Kritiker es verstehen.
Ob Goetz ein Internet-Tagebuch oder ein herkömmliches Tagebuch schreibt, seine tägliche Selbstentblößung also in einem Medium oder in privater Zurückgezogenheit ausübt, so tut er es doch offensichtlich stets, um sich in einer bestimmten Tradition des Literatur-Schreibens zu behaupten. Wenn er einen Roman schreibt, schreibt er einen Anti-Roman, will er sich doch als Mehr-oder- weniger-Modernist der Mythen der bürgerlichen Welt erwehren. Sein Anti-Roman als Protest gegen die Welt, wie sie ist, steht im Kontext der Geisteswelt der Moderne, in der der Dichter als Rebell gegen das Mittelmaß über einen bevorzugten Weltzugang verfügt – also etwas so sagt, wie es noch nie gesagt worden ist.
Wie vor ihm die Dichter der klassischen Moderne betreibt Goetz auch unter den Bedingungen des Internets eine Enthemmung der Sprachgefängnisse. Das Sprachspiel stellt seine verbliebene Grenze dar. Mit dem Sprachspiel erklärt sich auch das Privatistische seiner Ästhetik, die doch als Gegenentwurf zur gesellschaftlichen Wirklichkeit gedacht ist. Wenn Goetz von Abfall für alle spricht, meint er einen Abfall hin zu seiner Alternative. Ästhetik liefert in seiner geistesgeschichtlichen Tradition einen Ersatz für Moral, die dichterische Sprache ist die Sprache der besseren Menschen, zu der sich der Autor in seiner Sprachmühe hinbewegt.
So wie diese Tradition die Literatur als eine Art bessere Wissenschaft vorstellt und ihrem Anspruch nach als experimentell zu bezeichnen ist, erwarten diese Texte der experimentellen Literatur eine Art wissenschaftlichen Leser. Autor und Leser wissen sich in der Weltbibliothek aufgehoben – der Text ist ein Text ist ein Text, schreibt der Autor, also ein selbstbezügliches Gebilde, das sich auf Beispiele in der Weltbibliothek bezieht, sie zugleich zitiert und verschlüsselt. Die Selbstbezogenheit der Literatur muß der Autor immer wieder betonen, um den Leser nicht vergessen zu lassen: In der Weltbibliothek ist nicht nur der Trost aufgehoben, dort sind auch die Ideologien verwahrt! Schütze dich gegen die Mythen einer Welt, die deinem Geist Böses sinnt! Geschichten sind nicht wahr und werden nur erzählt, um deinen wachen Geist einzuschläfern!
Der Versuch von Rainald Goetz, seinen Roman eines Jahres im Zwischenraum der Buch- und der Computerkultur zu positionieren, will sich an alle Mitbewohner und Sprecher im Raum des Medialen wenden. Sein Schreiben schließt damit an das Beste an, was die Moderne verantwortet, nämlich die Loslösung des Geistes von den Grenzen der Ideologien. Mit dem Raum der Kunst, ihrer Autonomie, thematisiert Goetz die Haltung eines Individuums, das nach geistiger Freiheit strebt – indem es nicht aufhört, die Fesseln der Ideologien zu benennen.
Diese geistesgeschichtliche Tradition weist der Dichtung universelle Gültigkeit zu. Nichts ist für Rainald Goetz daher naheliegender, als die neuen Kulturtechniken, die mit dem Computer verbunden sind, für die Zwecke der Befreiung zu kolonisieren.
Dagegen sprechen seine jungen Kritiker aus dem Kontext einer technischen Welt, in der die Literatur eines von vielen Verfahren zur Herstellung medialer Oberflächen ist. Literatur verweist wie alles Mediale auf Sinn und steht, was die Aufmerksamkeit für sie betrifft, in Konkurrenz zum Film, zur Musik, zum Lebensstil, ja zum Ereignis schlechthin.
Mit dem Bekenntnis zu einer Ökonomie der Aufmerksamkeit ist ein Übereinkommen in Frage gestellt, das während des Monopols der Schriftkultur galt – Autoren befinden sich mit ihrer Nähe zum Wort in der Nähe der Wahrheit, paradoxerweise indem sie Sprachkritik üben. Medienbenutzer wissen sich selbst an einem bevorzugten Ort in einer Welt des vielfältigen und globalen Zeichentransports, in dem selbst Zeit und Raum problematisch geworden sind – Erreichbarkeit scheint für den Medienbenutzer stets und überall herstellbar.
Jegliches Wissen und die Kommunikation über dieses Wissen sind für die Bewohner der virtuellen Welt rascher denn je verfügbar. Wer das Wissen der Weltbibliothek hütet, ist im besten Fall, so er es zu vermitteln versteht, ein Dienstleister. Der Autor als Dienstleister ist nicht mehr als ein Programmierer, jedenfalls kein Demiurg, dessen Spuren wegen es sich lohnt, sich über die Maßen abzumühen. Im Zentrum der Informationsgesellschaft wird der Wunsch nach Freiheit mehr und mehr zur Befreiung des Körpers von seinen biologischen Grenzen verschoben – der Universalismus, den Autor in bezug auf die Entgrenzungen der Ideologien zu formulieren, wirkt für Medienbenutzer rudimentär.
In einer medialisierten Welt zählt die Unterscheidung zwischen Inhalt und Form einer Botschaft zum Alltagswissen. Von Kindheit an lernt der Bewohner einer Welt der Kommunikationstechnologien, daß mediale Wirklichkeiten in beliebig großer Anzahl herstellbar sind. Gerade weil heute junge Menschen ihren Alltag mit einem exzessiven Mediengebrauch verbinden, sind sie darin Stoiker, cool, als Schutz vor der Gefahr, in die Fallen von medial gebrochenen Erfahrungen zu tappen. Betrachten sie im Fernsehen Werbung, interessiert sie weniger der Inhalt als die Art und Weise, wie die Geschichte, der Plot, gebaut ist. Sie kaufen das Produkt, weil sie damit einen bestimmten Lebensstil, den des Werbeplots, simulieren, und sie tun es wieder als Stoiker, flexibel. In gewissem Sinn praktizieren sie in ihrem Alltag, was experimentelle Autoren in ihren Texten vorführen: Bilder, Töne, Wörter dekonstruieren; mediale Fallbeispiele als Lebensentwürfe zitieren; Botschaften montieren – und einen erfolgreichen Mix aus Leben und Gelebtem und Gezeigtem zu versuchen. Sie sind cool, weil sie Experten des Alltags in einer Informationsgesellschaft sind. Sie sind so infantil wie rational, angepaßt an eine Welt, die ihren Erfolg aus dem Verhältnis von Spiel und Vernunft bezieht – die Benützerfreundlichkeit der mit dem Computer erzeugten virtuellen Welten.
Während Rainald Goetz im weitesten Sinn eine experimentelle Literatur schreibt, erinnert das Verlangen seiner jungen Kritiker nach einer klaren und übersichtlichen Geschichte an Methoden vormodernen Schreibens. Sie fordern damit aber kein altes, sondern ein neues Erzählen ein. Während Goetz gemäß dem, was das Internet ist, die vielen Möglichkeiten der Welt im Schreiben aufzublättern versucht, ziehen seine jungen Kritiker in ihrem Leseverhalten die Konsequenz aus der Erfahrung, in der unendlich verzweigten Welt des Dokuversums oft genug in Sackgassen gelandet zu sein. Die Hypertextstruktur des Internets hat sie gelehrt, was die Wissensgesellschaft so problematisch erscheinen läßt. Zwar rückt das Wissen auf den Oberflächen der Bildschirme immer näher zusammen, offenbart damit aber auch, wie fragmentiert und unvollständig es ist.
Will Goetz den menschlichen Geist im weitschweifigen Text quasi zerfließen lassen, um seine Möglichkeiten vor dem ideologischen Zugriff zu bewahren, verlangen seine jungen Kritiker nach einer Konzentration, einer Sammlung, die es ihnen ermöglicht, sich in der Informationswelt zu orientieren. Paradox daran ist, daß Goetz in seinem Versuch der Entgrenzung ein demiurgischer Autor geblieben ist, während seine jungen Kritiker mit ihrem Wunsch nach Benützerfreundlichkeit den Welterschaffer durch einen Navigator ersetzt haben wollen.
Geschichtenerzähler sind Navigatoren schlechthin. Wer nach einem neuen Erzählen unter den Bedingungen der Informationsgesellschaft verlangt, weiß um die mediale Gebrochenheit gegenwärtiger Existenz, um die Selbstbezogenheit jedes Textes, um die Problematik des Kontextes jeden Wissens. Er will den Subtext von Literatur, die Versuchsanordnung des Experiments Text nicht mehr vorgeführt bekommen. Er knüpft an traditionelles Geschichtenerzählen an, um beispielhafte Wege durch den Dschungel medialer Wirklichkeiten zu erfahren.
Weder ist das ästhetische Verfahren von Rainald Goetz überkommen, noch bezeichnet das Verlangen seiner jungen Kritiker, daß wieder erzählt werde, einen Rückfall. Vielmehr drückt dieses Verlangen eine hinzugewonnene Möglichkeit aus.
Zu den Erscheinungen der Informationsgesellschaft zählt, daß sie zur Öffnung einer Definitionsgewalt beiträgt, die nur eine Ästhetik auf dem endzeitlichen Weg der Moderne zur absoluten Kunst gelten lassen will. Damit kann die Langeweile wieder zur ästhetischen Kategorie werden.
Ein neues Erzählen, was kann es meinen?
Ein Erzählen ohne Zentrum, ohne ideologische und ohne formale Mitte. Ein Navigieren in realen und virtuellen Räumen, im Wissen der Komplexität und ihrer Unauflösbarkeit. Einen linearen Entwurf von Geschichte, der dem selbstbewußten Surfen im Internet ähnelt. Ein kühles, ökonomisches Verfahren der Sprache, ein Kalkül der Emotionen, die geweckt werden wollen.
Wir haben ja keineswegs aufgehört zu leben, zu lieben und zu sterben, will damit gesagt sein. Das alles ähnelt dem alten authentischen Erzählen zwar dem Schein nach. Das neue Erzählen ist jedoch ein Remixen, wie in der Musik üblich. Authentizität wird simuliert, ein Verfahren zur Verbesserung, zur Intensivierung des Lebensgefühls.
Neues Erzählen kann also eine Literatur meinen, die entlang von Stoffen geschrieben wird, die Figuren, Beziehungsgeflechte und Handlungsbögen entwirft und die Fiktion als eine erprobte und erfolgreiche Kulturtechnik einsetzt und damit einen Brückenschlag zwischen der Geistesgeschichte und der technischen Rekombination im Zeichen der digitalen Codes versucht.
Virtuelle Welten tendieren zum Krieg der Gegenwart gegen alle anderen Zeiten. Das Gedächtnis geht dabei nicht verloren, wird aber im andauernden Mix der Zeiten und Räume entkräftet. Wenn ein neues Erzählen die historischen Zusammenhänge wiederentdeckt, stiftet es jedoch nicht traditionelle Identität. Medienkonvergenz bewirkt ja nicht nur eine Vereinheitlichung des Informationsflusses, sondern bringt ebenso und ständig eine neue Vielfalt hervor. Einen Dialog nicht nur zwischen sich fremden Kulturen, sondern auch zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Feldern der eigenen Kultur.
Mehr und mehr entsteht etwas wie Mehrsprachigkeit im kulturellen Verhalten. Neues Erzählen gibt zwar den Anspruch auf den Universalismus der Literatur auf, wagt jedoch den Versuch, über die Milieus hinweg jene Mehrsprachigkeit zu artikulieren.
*Walter Grond: Der Erzähler und der Cyberspace. Essays. Haymon 1999
Gefährliche Wegkreuzungen
Nicht wenige Autoren nennen den Begriff der Information, seine Flatterhaftigkeit und vergängliche Aktualität, literaturunwürdig. Polemisch setzen sie multimediale Kulturtechniken als Inbegriff des Postmodernismus mit Kunstfeindlichkeit gleich und bezeichnen eine essentielle Literatur als Trost und Rettung der Menschheit. Diese collagiere nicht historische Stoffe, gebe also nicht tradierte Literatur als Konsumenten-Erinnerung spielerisch wieder, wie es einer multimedialen und computergestützten Kulturtechnik entspräche. Vielmehr heilige ein literarisches Verfahren Geschichte durch den besonderen Autorenblick, also im Sinn einer Politik der Identität.
In einer MTV-Talk-Sendung hörte ich kürzlich ein Interview mit einem deutschen Rapper. Nach der Erläuterung von Grundzügen der poetischen Technik des Rappen, äußerte er die Überzeugung, anspruchsvolles zeitgenössisches Erzählen ereigne sich hauptsächlich im Feld der Popmusik. Nun wurden in den letzten Jahren Hiphop, afrikanischer Pop oder Bad-Girls-Pop oft als multikulturelle Chimären des Neoliberalismus kritisiert. Und doch, unzweifelhaft kursieren mit der weltweiten Warenzirkulation auch Ideen und Vorstellungen unterdrückter und marginalisierter Kulturen, befördert also die Entwertung der Produktionsstandorte durch die elektronischen Kommunikationstechnologien auch das Entstehen einer neuen – multimedialen wie multikulturellen – Kulturmatrix.
Was für die Weltmusik gilt, gilt auch für postkoloniale Literatur. Sie erfreut sich in ihren Ursprungsländern wie auch in Europa großer Beliebtheit, nicht zuletzt ihres Rufes wegen, eine Literatur „von unten“ zu sein und „etwas zu erzählen“. Romane von García Márquez, Toni Morrison, Salman Rushdie, Tahar Ben Jelloun, Arundhati Roy oder Hanif Kureishi erinnern daran, daß wir in einer Epoche der Vertreibung und Migrationen leben, einer des Multikulturalismus wie der Vielsprachigkeit, einer der gespaltenen Identitäten und der gespaltenen Loyalitäten. Und: ihre Autoren verkörpern ein Verhalten, das die Warenkultur als gegeben hinnimmt und trotzdem mit einer kulturellen Praxis aufwartet, die politische Ansprüche hat. Postkoloniale Autoren entsprechen nicht dem Bild des radikalen Autors, eher dem von Popstars. So kommt denn auch der amerikanische Ethnic-Studies-Forscher George Lipsitz in seiner Untersuchung der kulturellen Dimensionen einer globalisierten Wirtschaft zum Schluß, daß die heute spannendsten Entwicklungen paradoxerweise dort geschehen, wo auch die größten Gefahren lauern: an den Wegkreuzungen, wo sich Markt und Kunst begegnen, den Dangerous Crossroads von Ökonomie und Kultur. Gerade Künstler unterdrückter Völker hätten den Kapitalismus am eigenen Leib begriffen und seien daher Wegweiser in die postindustrielle Welt.
Postkoloniale Literatur hat ebenso wie Popmusik den gigantischen Austausch von Bevölkerungen und von Kulturwaren rund um den Globus zum Hintergrund. Sie schafft vielfältige kulturelle Querverbindungen und führt zu eben jenen gefährlichen Wegkreuzungen, die die vielschichtigen Beziehungen zwischen Kunst und Kommerz sichtbar machen. Damit angezeigt ist auch die gigantische Umwälzung der Beziehungen zwischen Zentrum und Peripherie. Und: in einer Welt des andauernden Austausches von Informationen entlarvt sich die Pose des radikalen Künstlers als das, was sie attackiert und zugleich selbst ist: Inszenierung von Elitarismus.
Die literarische Moderne hatte sich an Modellen einer künstlerischen Avantgarde versucht, um von Freiräumen und autonomen Feldern aus gegen die bürgerliche Welt ideologisch mobil zu machen und einen radikalen Wandel der Gesellschaft vorzubereiten. Dagegen wirkt ein Autor wie Salman Rushdie geradezu angepaßt: seine Satanischen Verse predigen eine ironische Praxis des Kulturmixes und vielstimmigen Mischmasches.
Postkoloniale Strategien reagieren auf die Erfahrung der totalitären Katastrophen des 20. Jahrhunderts, wollen deswegen pragmatisch sein und innerhalb der Marktgesellschaft wirken. Über den Zusammenhang von Postkolonialismus und Popkultur hat George Lipsitz etwas Entscheidendes geäußert: War im Zeitalter der Industralisierung die Geschichte das große Thema der Literatur, verleiht die Reichweite und Bandbreite der elektronischen Kommunikation sowohl der Produktion wie auch dem Konsum ein weltweit gleiches, rationalisiertes Gesicht. So wird der Ort zum grundlegenden Problem der postindustriellen Ära. Popkultur stärkt das Gefühl für den Ort, indem sie zeigt, daß der gemeinsame kulturelle Ort nicht mehr unbedingt der gemeinsame geographische Ort ist.
Wer sich über gegenwärtige Befindlichkeiten informieren will, schaut fern, hört Musik oder surft im Internet. Ein Gefühl für die Dringlichkeit der Welt durchzieht die populäre Musik, schreibt George Lipsitz, und etwas Derartiges läßt sich auch von einer Literatur sagen, die sich wie die Kriminalromane von Henning Mankell wohl auch deswegen so großer Beliebtheit erfreut, weil aus ihr eben diese Dringlichkeit der Zukunft spricht.
Kulturelles Gedächtnis und Evolution
Im Forschungsbericht, dem sechzehnten von 22 Bänden seiner Geschichte der Empfindlichkeit, läßt Hubert Fichte den Schriftsteller Jäcki und die Fotografin Irma nach Dangriga/Belize in die Karibik reisen. Dabei stenografiert er, wie Fichte bemerkt, stur den Tageslauf zweier Ethnologen vom 4. bis 14. Februar 1980, muß aber am Ende feststellen, daß die europäischen Versuche, engagiert auf die Herausforderung durch das Elend in der Dritten Welt zu reagieren, allesamt gescheitert seien. Fichtes Diagnose betrifft nicht nur das politische Engagement, sondern auch die wissenschaftliche Forschung und damit seinen eigenen Erkenntnisanspruch. Sein Protagonist hatte als schlichter Reporter in der Nachfolge Herodots die Verhältnisse schildern wollen und bezeichnet nun resigniert Herodot, den ersten abendländischen Historiker, als den ersten Romancier. Herodot habe geschrieben, wie er sich Ägypten vorstellte und wie die Ägypter ihm Ägypten vorlogen. Lügen und Lügen aufzeigen, die der Ägypter wie auch die eigenen. Die Wissenschaften selbst seien Romane – über Helden wie Hegel, Freud oder Lacan.
Fichte schreibt in kurzen Sätzen, protokollartig, in der Art von Botschaften, wie man sie im Seefunk überträgt. Tatsächlich liegen dem Roman Tonbandaufzeichnungen zugrunde, Fichtes Material seiner ethnologischen Feldforschung. Der Fluß von Informationen, den Fichte in Gang bringt, ist einem strengen Code unterworfen, einem Ordnungsprinzip, das sich schlichter Sätze bedient, um sich selbst weiterzutragen und ein vielschichtiges Bild unser Welt zu erzeugen. Fichte beschreibt nicht nur, wie sich europäische und außereuropäische Kulturen durchweben, sondern führt vor, wie Kultur in Natur eingebettet ist; immer wieder schimmert durch, daß ein grundlegendes Prinzip das komplexe System Erde am Laufen hält, dem nachzuspüren Fichtes Motor für seine Forschungen zu sein scheint.
Benennt Hubert Fichte jenes grundlegende Prinzip? Unmißverständlich ruft er im Forschungsbericht einmal aus: Ich bin Darwinist! Demnach meint er wohl die Fähigkeit der Replikation, der Selbstverdoppelung. Biologisches Leben entsteht in seiner üppigen Vielfalt aufgrund dieser Fähigkeit, was die Existenz von Replikatoren voraussetzt, und so drehen sich naturwissenschaftliche Auseinandersetzungen auch um die Frage, ob Replikatoren Individuen sind, die sich durch Kopie vermehren, ob dahinter eine vielgestaltige Kraft steht, die alles am Laufen hält, oder reduktionistisch betrachtet, ob Gene im Sinn einer Schablone am Werken sind.
Freilich äußert sich Fichte nicht über genetische Replikatoren. Seine Sprache aber geht gewissermaßen darwinistisch vor. In seinem Roman entsteht ein kulturelles Universum aus einem Fluß von Informationen, die sich wiederholen und auf der Grundlage berechenbarer Größen hierarchisch kombinieren und anordnen. Sein Thema ist das kulturelle Gedächtnis, das er in zweierlei Hinsicht naturwissenschaftlich betrachtet: zum einen, indem er es in den größeren Zusammenhang der belebten und unbelebten Natur stellt, und zum anderen, indem er sich methodisch naturwissenschaftliche Perspektiven zunutze macht. Fichtes Sätze entwickeln als Erinnerungsskripten selbst das Gefüge (was an die Fähigkeit lebender Mechanismen, sich zu replizieren, erinnert); als Autor tritt Fichte in der Gestalt Jäckis dann auf, wenn es darum geht, den freien Willen zu äußern, sich also als Mensch mit seiner Fähigkeit zum Dialog zu behaupten. Das bedeutet auch: Fichtes Protagonist scheitert zwar in der Nachfolge Herodots (als Europäer), aber es steht ihm trotzdem frei, weiterzuschreiben.
Zu den am meisten diskutierten Interpretationen des Darwinismus gehört Richard Dawkins These, das Leben fristen bedeute soviel wie in DNA codierte Texte in die Zukunft weiterzutragen; das Leben sei ein Fluß aus DNA, der durch die geologischen Zeiträume fließe und sich verzweige, und die Metapher von den steilen Ufern, die den genetischen Spielraum der einzelnen Arten begrenzen, erweise sich überraschenderweise als wirksames, nützliches Mittel zur Erklärung. Die Vervielfältigungsmaschine, die wir Leben nennen, sei als ein Fluß der Gene in Gang gekommen, und dieser Urfluß der genetischen Information habe sich inzwischen in dreißig Millionen Arme, die heute bekannten Arten, geteilt; ein biologisches Alphabet von nur vier Buchstaben habe also das gesamte Wörterbuch des Lebens mit seiner faszinierenden Vielfalt entstehen lassen. Die von Generation zu Generation weitergegebenen Gene würden uns aber nicht nur formen, sondern auch steuern und dirigieren, um sich selbst zu erhalten; die biologischen Organismen somit vor allem dem Überleben und der Unsterblichkeit der Erbanlagen dienen, unsere Körper seien etwas wie Überlebensmaschinen der egoistischen Gene. Letztendlich manipuliere ein digitaler Code, genannt Information, die Welt um ihn herum zum Zwecke seiner eigenen Reproduktion.
Richard Dawkins Theorie der egoistischen Gene hat ihn oft dem Vorwurf eines gefräßigen Reduktionismus ausgesetzt, eine schlimme Form von Unmenschlichkeit, da sie den Menschen und seine Fähigkeit zur Menschlichkeit als Ziel der Evolution außer acht lasse. Zum Beispiel meint Oliver Riepel, viele Aspekte unserer Gestalt seien nicht in den Genen, sondern in thermodynamischen Prozessen grundgelegt, was zumindest eine Pluralität an Erklärungsebenen fordere. Oder wie Douglas Hofstatter es postuliert: Ein Teilphänomen wie das Gen lasse sich nicht von einem Gesamtphänomen wie dem lebendigen Körper isolieren, um im nachhinein alles von unten her zu erklären. Richard Dawkins widerspricht solchen Bedenken auch gar nicht. Er spricht von einer Hierarchie der Erklärungsebenen, und sein Versuch, in der großen Geschichte der Natur die kleinste Erzählung zu finden, auf der sich alles aufbaut, will offenbar der Pluralität von Wirklichkeiten nicht widersprechen.
Woran war nun der Schriftsteller Jäcki im Forschungsbericht gescheitert? Fichtes europäischer Blick hatte sich alles – die Welt – mit einem Blick der Synthese, alles zusammenschauend, aneignen wollen; und was er fand, waren kleinste Scherben, die über die Zeiten und Orte hinweg nicht nur andauerten, sondern Strukturen vorgaben. Und so zitiert Fichte Empedokles, mehrfach und in mehreren Übersetzungsvarianten: Einst bin ich ein Knabe, ich bin auch ein Mädchen gewesen, Busch und Vogel und Fisch, der warm aus den Wassern emporschnellt. Daß sein Protagonist Jäcki auf diese eindrückliche Erfahrung hin den Roman Raubvogel und Seefische nennen will, bedenkt Fichte zwar vier Zeilen später mit der Feststellung, der blanke Kolonialismus, weitet aber nach wenigen Seiten Jäckis Vision abermals aus, diese nun zwischen dem klassischen Text und schamanischer Praxis ansiedelnd: Ich erinnere, als ich ein Stein war. Ich war ein Schatten an den ersten Kratern und Gischt über meiner Schwester, der Lava. Ich wurde gerollt. Lange. Algenzeit. Die Lange Zeit, in der alles verwandelt wird. Als Dorsch tauchte ich wieder hinab, fraß rohe Daphnen, der Raubvogel fraß seinen Onkel, den Dorsch. Ich wohnte über den Wolken, und ich kannte nur das Geräusch meiner eigenen Flügel. Spät erst wurde ich Knabe und Mädchen. Waldläufer. Das erinnere ich gut. Ich baute einen Anlegesteg mit einem Palmendach. Kurze Zeit bestellte ich Acker. Das habe ich fast schon wieder vergessen. Die Schlacken. Die Messer. Der Rest ist flüchtig. Ich lerne ihn immer wieder. Lerne, ihn aufzuschreiben. Ich vergesse ihn immer wieder. Einmal stürzte ich mich in den Ätna zurück.
Selbstbefragung und Erkenntnis bleiben in diesem Roman, den Fichte letztendlich Forschungsbericht nennt, seltsam in Schwebe, vielleicht in Trance, in der ein afrokaribischer Schamane dem Schriftsteller seinen Weltzugang vorführt. Die eigene kulturelle Matrix zu überschreiten, bedeutet denn auch, eine universelle Gesetzmäßigkeit zu erahnen und doch keine Totalität einzufordern; Fichte begnügt sich trotz Kritik des Eurozentrismus nicht mit der Erkenntnis, alles sei relativ. Vielmehr zeigt er den Umschlag zwischen den Geschlechtern, wenn er homosexuelle Praktiken beschreibt; den Umschlag zwischen den Generationen, wenn er von Subkulturen, und zwischen den Kulturen, wenn er von Schamanismen berichtet; den Umschlag zwischen den Orten, wenn er die Folgen des Kolonialismus benennt, und zwischen den Zeiten, wenn er Synkretismen in religiösen Riten dokumentiert. Sein niederschmetternder Befund am Ende des Forschungsberichts bezeichnet ein so umfassendes Scheitern des Universalismus, wie er den Anspruch auf ein umfassendes Programm aufrechterhält.
Mit seiner Geschichte der Empfindlichkeit gelang Hubert Fichte nicht nur ein gewaltiger Speicher von kulturellem Gedächtnis, sondern auch ein Modell einer Praxis, die zeigt, wie Sprache im technischen Zeitalter zwar beschädigt, aber doch weiterhin handlungsfähig bleibt. Gescheitert sind viele Phantasmen des europäischen Geistesmenschen, stellt Fichte fest, und so spricht er bedachtsam von Empfindlichkeit und nicht von Empfindsamkeit, verwehrt sich die künstlerische Emphase, die er als kolonialistische Vereinnahmung von sich weist: Ich bin Darwinist, schreibt er, außerdem sind Tiervergleiche meistens für die Tiere beleidigender als für die Menschen.
Daß er wenige Seiten nach dieser Feststellung sich selbst als Stein denken kann, meint also nicht das Abfeiern des Wilden, Unzivilisierten als Mittel gegen den Zivilisationsüberdruß, sondern eine Methode des Forschens, mit der Fichte an die fremden Kulturen herangeht, um das, was er wahrnimmt, als Experiment an sich selbst zu überprüfen. Sich als Stein Denken meint, man müsse durch alle Bewußtseinsebenen – Hierarchien – hindurch, um in einer fremden Realität, Kultur, auftauchen zu können. Damit überschreitet Fichte nicht nur die Grenze zwischen dem Fremden und dem Eigenen, was ihn schließlich zum Selbstvorwurf bewegt, entgegen seiner Absicht nun doch auch ein Kolonisierer geworden zu sein. Dieses Dilemma läßt ihn ebenso die literarische Methode überschreiten, das Regelwerk der Disziplinen, die Grenze zwischen Wissenschaft und Poesie, und schließlich auch die Grenze zwischen Kultur- und Naturwissenschaft. Was Hubert Fichte in seiner Geschichte der Empfindlichkeit vorführt, ist interdisziplinäre Praxis. Ich Geistesmensch! Ich Darwinist! ruft er. Was für eine Selbstbehauptung 1980, zu einem Zeitpunkt, als die Vorstellung des modernen Menschen, der in einer endzeitlich angelegten Geschichte zur Freiheit strebt, wenn er sich nur auf die richtige Seite stelle, noch beinahe ungebrochene Konjunktur hatte! Was Fichte zur Erkenntnis umfassenden Scheiterns veranlaßt hatte, betraf nicht nur das Scheitern einer umfassenden Lösung, wie sie die großen Ideologien versprochen hatten, sondern auch seine eigenen Darstellungsweisen, nämlich schlicht wie Herodot dokumentieren zu wollen. Die Abbildung selbst war in Frage gestellt. Der objektive Blickwinkel war mit dem Scheitern des objektiven Anspruchs hegelianischen Weltenlaufs ebenfalls gescheitert, indes schimmert durch die Fragmente, die vielen oszillierenden Skripten, die Fichte sammelt und kombiniert, eine Eigenschaft, die so harmlos wie folgenschwer ist: Selektion. So zerstreut die Erfahrungen wirken, sie sind, da sie im Gedächtnis haftenbleiben, immer schon ausgewählt. Sie waren, da sie im Gedächtnis haftengeblieben sind, immer schon ausgewählt, was etwas Unausweichliches nach sich zieht: der Träger des Gedächtnisses hat nicht unbeschränkte Wahlmöglichkeiten.
Ich bin Darwinist! – Jener für den Geistesmenschen gefährlich anmutende Ausruf, da mit der natürlichen Auslese die Selektion an der Rampe mitschwingt, wollte womöglich heißen, was für den interdisziplinären Autor Fichte selbstverständlich geworden war: Alles befindet sich in einer Entwicklung, die zwar nicht auf Fortschritt ausgerichtet ist, in der aber Widerstreit herrscht und die keinen bevorzugten Standpunkt kennt, als diesen einen: jeder Lebende hat ausschließlich erfolgreiche Ahnen. Nur der hat überlebt, dessen Ahnen die Informationen über das Lebendige weitergegeben haben. Das Lebendige im biologischen Sinn, weil die Ahnen es geschafft hatten, sich vor dem Zugrundegehen fortzupflanzen, und womöglich auch im kulturellen Sinn, weil die Speicher es geschafft haben, ihre Ideen von einer Generation auf die andere übergehen zu lassen. Nun sichert aber das biologische Erfolgreichsein in der Vergangenheit nicht unbedingt den Erfolg in der Zukunft. Sehr wahrscheinlich wird in Zukunft sogar ein Überkompensieren von physischem Makel durch besondere intellektuelle Fähigkeiten ökonomischen, also biologischen Erfolg versprechen.
Nachdem nun die Gene, mutmaßt Richard Dawkins, ihre Überlebensmaschinen – die Körper – mit einem Gehirn ausgestattet hatten, das zu rascher Imitation fähig sei, wäre auf dem Planet Erde eine neue Art Replikator aufgetreten, das Mem, eine lebendige Struktur, die die menschliche Kultur im technischen Sinn weitertrage, eine Informationseinheit ähnlich den Genen. Beispiele für Meme seien Melodien, Gedanken, Schlagworte, Kleidermoden, die Art, Töpfe zu machen oder Bögen zu bauen. Meme würden von Gehirn zu Gehirn überspringen, die einen erfolgreicher als die anderen, was dem Prinzip der natürlichen Auslese entspreche. Wie die Gene handle es sich bei den Memen um einen digitalen Code, dessen einziges Ziel es sei, für sich selbst von Nutzen zu sein. Egoistische Fragmente würden also unser Leben beherrschen, wir seien als Genmaschinen gebaut und als Memmaschinen erzogen, indes hätten wir als einzige Geschöpfe auf der Erde die Macht, uns unseren Schöpfern entgegenzustellen. Als einzige Lebewesen auf der Erde könnten wir uns gegen die Tyrannei der egoistischen Replikatoren auflehnen.
Die Beantwortung der entscheidenden Frage bleibt freilich auch Dawkins schuldig: Wie funktioniert das Überspringen einer Idee von einem Gehirn zum anderen? Vielleicht gerade über dieses Problem der Intersubjektivität nachsinnend, ruft denn Fichte aus, ich bin Geistesmensch! Ich bin Darwinist! Jener Ausruf läßt gewahr werden, was den Physiker und Science-Fiction-Autor C. P. Snow 1959 nach einer dritten Kultur verlangen ließ, die die Kommunikationslücken zwischen literarischen Intellektuellen und Naturwissenschaftern überbrücken würde. Bestimmte nicht diese Sehnsucht gerade das Denken eines Autors wie Hubert Fichte, gerade eines Autors, der ein Leben zwischen den Kulturen führte und eine Welt beschrieb, die zwischen den Kulturen zu vermitteln versucht?
Nun ist in der Geschichte der Empfindlichkeit nicht nur der historische Ort problematisch geworden – die Entwicklung der Kulturen zu dem, was sie heute darstellen –, sondern längst auch der geographische Ort. Fichtes Schweben zwischen den Hafenvierteln von Hamburg, der Karibik, Afrika und Brasilien benennt die Folgen von Globalisierung, die Migrationen, ebenso wie das Fluktuieren von Zeichen. Der gemeinsame Ort eines kulturellen Gedächtnisses entspricht nicht mehr unbedingt dem gemeinsamen geographischen Ort, und die Erfahrungen einer wandernden Welt rücken in die Nähe von Netzwerk- und Selbstorganisationsmodellen, wie sie vom Neodarwinismus ebenso angeschlagen werden wie von Systemtheorie, Computer-, Kognitions- und Künstlicher-Intelligenz-Forschung.