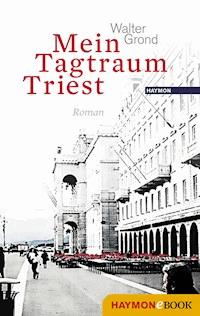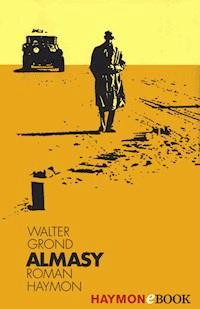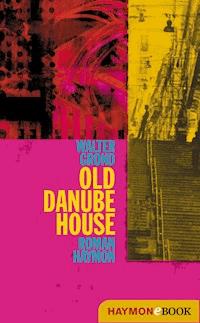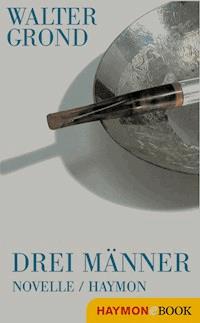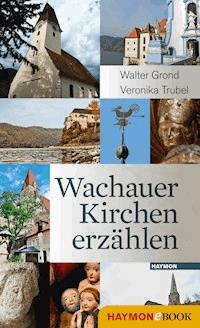
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
EIN LITERARISCHER AUSFLUG ZU DEN KIRCHEN DER WACHAU. Einzigartiges Kulturgut: die Wachauer Kirchen Stift Melk und Stift Göttweig zählen zu den meistbesuchten religiösen Stätten in Europa. Ihre einzigartige Lage über der Donau und ihre einzigartige Bauweise versinnbildlichen die barocke Idee, Religiosität architektonisch prachtvoll zu inszenieren. Melk und Göttweig sind aber auch das Tor zu einer außergewöhnlichen Flusslandschaft und zu einer der ältesten Kulturlandschaften Europas. Durch ihre bewegte Religions- und Kirchengeschichte ist diese Kulturlandschaft - die Wachau - geprägt von zahlreichen Kirchen und Kapellen. Eine literarische Spurensuche bei Menschen und Gemäuern "Wachauer Kirchen erzählen" macht sich auf die Suche danach, wie Kirchen in der Wachau entstanden sind und was sie für Menschen bedeuten können. Welche Wirkung haben diese religiösen Räume? Was erzählen Menschen, die mit diesen Kirchen verbunden sind? Und was erzählen die Kirchen über jene Menschen, die sie einst erbauten, und über die, die sie heute erhalten? Welche kleinen Geheimnisse geben sich nur Eingeweihten preis? Walter Grond und Veronika Trubel haben sich auf Spurensuche in die Wachau begeben, sich mit Kirchen und Kapellen vertraut gemacht. In persönlichen und literarischen Porträts erzählen sie von Kirchen, Kapellen und Klöstern - etwa von Melk und Göttweig, Schönbühel, Aggsbach, St. Johann, St. Lorenz, Mautern, der Göttweiger Hofkapelle in Krems, Dürnstein, Spitz, St. Michael, Oberranna, der Emmersdorf-Kapelle, der Ruine in Gossam, Maria Laach und Maria Langegg. Und sie erzählen jene Geschichten, die diese Kirchen und Kapellen am Fluss denen erzählen, die zuzuhören verstehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Grond und Veronika Trubel
Wachauer Kirchen erzählen
Herausgegeben von Wachau Dunkelsteinerwald Regionalentwicklung und Stift Melk
Mit Fotos des „Kirchen am Fluss“-Projektes der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt Wien
Bildauswahl und Bildtexte Gustav Bergmeier
Annäherungen
Veronika Trubel
Von Menschen und Kirchen im Fluss der Zeit
Es gibt auf der Welt Gegenden und Orte, an denen sich Menschen durch alle Jahrtausende gerne ansiedeln. Die Wachau ist so ein Ort. Warum, habe ich mich als Nicht-Hiesige, als Stadtmensch gefragt. Nach vielen Gesprächen und Recherchen vor Ort liegt folgender Schluss drängend nahe:
Es ist offenbar einfach so, dass die Genusssüchtigen aller Zeiten die italienisch-umbrische Landschaft, das bekömmliche Klima und die Qualität des hier Gewachsenen für sich entdeckt haben und es sie also hierher gezogen hat. Die ganz frühen Genießer hatten Mammutknochen dabei, wie man sie in Aggsbach Markt und Willendorf gefunden hat.
Wer in der Wachau spazieren geht und weiß, wo (etwa hinter Aggsbach Dorf, Hofarnsdorf oder sonst entlang des Römischen Limes), findet Tonscherben aus der Keltenzeit. Auch an den Donaustränden ist manchmal etwas dabei. Wobei schon allein die schönen runden, teils reizvoll gemusterten und gefärbten Steine die Wanderung am Uferstrand entlang wert sind.
Dazu empfehlen sich (abgesehen von einer Haube, wenn außerhalb der Saison) die ersten feinen, leisen Takte des Donauwalzers. Am Ufer der Wachauer Donau steht man da, und Schiffe fahren auf und ab vorbei. Gar nicht so wenige, wenn man länger bleibt. Das Sonnenlicht glitzert auf der Wasseroberfläche und auch in dem feinen Flirren der Geigen ganz zu Beginn des Donauwalzers, es sind die allerersten Takte nur. Hier beginnt mein persönliches Ahnen von der Ewigkeit dieser Region und ihrer Menschen. Wer dann, vielleicht mit einem Sack Marillen, am Donaustrand rastet, wird sehr wahrscheinlich irgendwo eine kleine Kirche sehen. Ein Kircherl, wie man in Österreich sagt. Inmitten von Wäldern und Felsen hinab zum Donaustrand, umgeben von Weinbau und Marillenhainen, findet man in der Wachau immer wieder sakrale Gebäude – ein Gebeinhaus hier, eine Kapelle da, dort gar eine Kartause oder sonst ein altes Kloster. Sie zeigen uns: Hier haben Menschen gelebt, hier gibt es Zeugnisse ihres Glaubens, ihres Lebens, ihrer Wichtigkeiten, Ängste, ihrer Zuversicht.
Geheimnisvoll und wissenswert erschien mir immer schon die Alltagswelt unserer Vorfahren und im Speziellen das, was sie besonders, also: zu Persönlichkeiten machte. Hier wurzelt die Motivation zu meinem Geschichtestudium, auch als Journalistin hätte ich früher gern einen Menschen aus zum Beispiel der frühen Neuzeit interviewt. Die vielen Fahrten in die atemberaubend veränderliche Wachau im Spätsommer und Herbst, im stillen Winter und Mandelblüten-Frühling waren ursprünglich so angelegt: mit Menschen von heute über alte Kirchen sprechen, dabei Zugang zu den Bewohnern der frühgeschichtlichen Vergangenheit finden, zum Kirchenvolk des frühen und hohen Mittelalters oder der Neuzeit.
Geheimnisse sind ja nicht immer etwas so ungeheuerlich Geheimes. Manchmal ist man so sehr auf der Suche, dass man die Antwort übersieht, die schon längst dasteht, an dich gelehnt; oder die versonnen im Lichtspiel auf den Wellen der Donau glitzert.
In meinen Texten geht es um Menschen und Kirchen, oder: Kirchen und Menschen. In einem Text steht die Person im Vordergrund, ein anderes Mal ein Bau, dann wieder ein Aspekt, ein Zugang, oder einfach eine unwiderstehliche Geschichte wie die vom kapriziösen heiligen Albin in Sankt Johann. Mir ging und geht es um das ursprünglich Menschliche, das sich in den Kleinodien der Wachau offenbart, um das, was einmal pulste.
Na ja, und was soll ich sagen: Ich bin fündig geworden. Völlig überraschend und unerwartet bin ich ihnen allen leibhaftig begegnet und muss sagen: Jede Arroganz gegenüber Menschen früherer Epochen, jegliches Zoogefühl beim Anschauen, wie sie lebten, ist fehl am Platz.
Die Menschen der vergangenen Jahrhunderte sind keine ausgestorbene Spezies. Sie sind auch nicht sehr geheimnisvoll. Sie sind nämlich alle noch hier: Jäger und Jägerin, Sammlerin und Sammler, Pilgerin und Pilger; Weinbaufamilien, Künstlerinnen und Künstler, Intellektuelle, mystische Weltwissende, Glaubenskriegerinnen und -krieger, Friedensstifterinnen und -stifter; Kennerinnen und Kenner magischer Orte, Wissende um heilende Kräuter oder Rituale.
Sie sind alle noch da. Und wie, denn sie leben wahrhaft und tatsächlich in uns weiter, wie es in der Kirche heißt. In unseren Ängsten, Eitelkeiten, Aberglauben, Begegnungen und Lieben.
Jetzt ist damals ist jetzt.
Nur die Lebensbedingungen sind andere geworden.
Wir sind wie diese alten Kirchen, in denen man so viel Übertünchtes, in vielen Schichten Übermaltes, Vergrabenes und Zugeschüttetes findet. Es ist alles noch da, in uns da.
Wir sind keineswegs besonders erhaben über den vermeintlich viel abergläubischeren Mittelaltermenschen und seine von kirchlichen Bildern (die bibula pauperum, die Bibel der Armen) dominierte Wertewelt. Nur einmal Werbung schauen. Bilder, die arbeitende Menschen in einer Weltordnung halten sollten, waren damals in den Kirchen, heute sind sie überall. Der Mensch des Mittelalters ist also keine mystische Erscheinung, die unbedingt krauser gedacht hat als wir, die unbedingt roher oder abergläubischer oder weniger aufgeklärt kritisch war als wir. Wir sind nicht besonders voraus, wenn überhaupt. Wer eine Salbe kauft, weil Fühl-dich-wohl-Creme daraufsteht, ist nicht so wahnsinnig weit weg vom mittelalterlichen Aberglauben. Gar nicht so weit entfernt von den alten Kelten sind Talisman und Sternzeichen, Glücksbringer und diese kleinen Dingerchen, die vielleicht am Schlüsselbund baumeln. Dass alte Dinge und Vergrabenes auch wenigstens ein bisschen mystisch, kraftplatzmäßig und geheim sein sollen, leuchtet ein. Spätestens hier kommen dann die Ritter des Templerordens ins Spiel, und manche andere Rätsel, denen Jäger verlorener Schätze damals wie heute nachjagen. Vermutlich verhält es sich mit vielen Funden einfach ähnlich wie heute vielleicht mit olivgrün-braunen Küchenfliesen aus den 1970er-Jahren: Es ist im damaligen Sinne Müll, also vor hunderten Jahren irgendwann vermeintlich unansehnlich und unmodern Gewordenes, das einfach zugeschüttet und durch vermeintlich Gefälligeres ersetzt wurde.
Auch spätere Entwicklungen haben ihr Echo im Heutigen. Ob Joseph II. und seine Reformen oder Reformation und Glaubenskriege: Immer wieder sehen wir in der Geschichte intellektuelles Aufbäumen, das anfangs vielleicht befreit und in weiterer Folge immer schneller einen Schritt nach dem anderen setzt, sodass das Volk nicht mehr mithält und also erst zurück- und dann abfällt. Und natürlich die immer gleiche Reaktion der Systembewahrer auf das vermeintlich oder real die Macht Bedrohende im Neuen, schon den Urchristen ist es so ergangen.
Das war übrigens auch eindrucksvoll auf unseren Touren durch die Wachau: zu schauen, wie unterschiedlich strukturiert in Kirchen die Manifestation von Glauben sein kann und wie sehr das Thema Macht ins Kunsthistorische oszilliert. Aber nicht nur dorthin. Denn: Wo die Ewigkeit denn nun tatsächlich liegt, das definieren nicht die Mächtigen. Nehmen wir die von Pater Martin erwähnte Berührungsreliquie des heiligen Koloman, ein Stein, in den sich nach Jahrtausenden – nach Berührungen durch Millionen Hände – ein sanfter und doch ungeheuer kräftiger Handabdruck gelegt hat. Wie recht Pater Martin hat, wenn er sagt: »Was ist ein Stein gegen Millionen Hände?« (Fußnote: Der Kolomanistein ist nicht in der Wachau, sondern im Wiener Stephansdom).
Im Austausch mit unseren Gesprächspartnerinnen und -partnern ist mir das immer mehr bewusst geworden. Die Menschen früherer Zeiten waren im Wesentlichen wie wir. Der Mensch des Mittelalters lebt in uns selbst und um uns weiter.
Eine Fahrt durch die Wachau mit Blick auf diesen inneren, heutigen Kontakt zu den Vorfahren öffnet den Blick neu. Begreifen, was war, macht die Sicht frei auf das, was tatsächlich ist und vielleicht sein kann.
Walter Grond
Die Wachau und das Religiöse
Obwohl ich als Kind jeden Sommer aus der Obersteiermark in die Ferien zu meiner Tante an die Donau, also ins nördliche Österreich, fuhr, war für mich die Wachau immer ein südlicher Ort. Ich kam aus dem Sattgrün der Alpen ins Olivgrün der Hänge und Hügel am Fluss. Ich hielt die Wachau für einen mediterranen Landstrich. Sie war mein Ithaka und stillte mein Fernweh. Bis heute sitze ich gern auf dem Felsen unter dem Servitenkloster in Schönbühel und habe das Gefühl, in einer griechischen Bucht über dem Meer zu hocken. Oder ich stelle mir den mächtigen Bau des Stiftes Melk als eine Sphinx vor, und den Felsrücken, auf dem er steht, als den Sockel dieses antiken mythischen Wesens.
Ich habe die Wachau nie für eine liebliche Gegend gehalten. Vielmehr fällt mir das Wort archaisch ein, wenn ich an dieses Stück Donautal denke. Sie zeigt das Archaische besonders im Winter, wenn die Bäume und Weinstöcke entlaubt sind und die Niederwasser führende Donau durch ein breites Kiesbett fließt. Im Herbst freilich, wenn an einem sonnigen Tag die Gelb- und Rottöne des Laubes leuchten, nimmt sie etwas Malerisches wie eine barocke Kirche an. Die exakt gezogenen Linien der Weinterrassen kontrastieren das Wilde der Wälder, und alles liegt unter einem blauen Himmel, der mit watteartigen Wölkchen geschmückt scheint. Kehrt erst das Unwirtliche mit dem Novembernebel zurück, wird die Wachau wieder archaisch, ich möchte sagen, sie wird philosophisch.
Am einen wie am anderen Ende der Wachau stehen hoch oben auf Felsrücken die zwei barocken Kirchenpaläste Melk und Göttweig. Die Kirchen unten am Fluss zwischen Melk und Göttweig wirken dagegen steinern, wie zerklüftete Wegmarken. Das Neben- und Ineinander des Schroffen und Kargen mit dem Prunkvollen, Prallen und Goldigen fand ich immer erstaunlich.
Auch die Donau scheint sich an diesem Theater der Gegensätze zu beteiligen. Nieder- und Hochwasser könnten nicht unterschiedlichere Phänomene sein, die sowohl die Natur als auch Technik und Kultur in diesem Tal prägen.
Ich glaube, es ist das Canyonartige und es sind die Kirchen, welche die Wachau so besonders machen. Weinterrassen und Marillengärten sind die gleichsam barocke Ausstattung dazu. Einst drängten sich in diesem 35 Kilometer langen, engen und schwer passierbaren Talabschnitt der Donau 42 Klöster, besiedelt von 38 verschiedenen Ordensgemeinschaften. Eine unglaubliche Ansammlung, ein spiritueller Sammelort wie etwa der Berg Athos in Griechenland.
Was ich in der Wachau sehe, sind die Folgen eines Naturschauspieles, das in dieser Region vor Urzeiten passiert sein muss. Der Fluss kommt aus dem flachen Westen und stellt sich in Melk quer, gräbt sich in Richtung Norden durch vulkanisches Gestein bis nach Krems und Göttweig und fließt von dort in den flachen Osten weiter. Die Wachau liegt wie unter dem Meeresspiegel ihres Umlandes. Die Verdrehung macht es aus. Der Fluss schafft sich damit Abhänge, steile Abbrüche, Hügel. Drei Wetterscheiden prägen das besondere Mikroklima. Im einen Dorf regnet es, während im anderen die Sonne scheint. Die Kirchen sind das Abbild dieses ständigen Wechsels, zugleich Zeugen des Beständigen.
Diesem sonderbaren Mix aus verschiedenen Landschaftsformationen, Stimmungen und verschiedenen Architekturen in der Wachau stehe ich einmal fasziniert gegenüber, dann wieder bedrückt es mich. Eben aus diesem Grund ist die Wachau für mich nie ausschließlich schön, ich finde sie ebenso schroff, nicht nur fruchtbar, sondern ebenso karstig, im Sommer einladend, im Winter depressiv stimmend. Auch die Donau hat dieses zugleich Harmonische und Bedrohliche an sich.
Ich habe seit meiner Jugend viel und oft mit Zweifeln gehadert, ob es Götter gibt, ob den einen Gott, den rechtmäßigen, ob er tot ist oder nie da gewesen, und welchen Unterschied es macht, Gläubiger, Ungläubiger oder Gottloser zu sein. Ich habe als junger Mann Gott durch die Kunst ersetzt. Und habe dann ebenso gehadert mit Zweifeln, ob es viele Künste, ob es die eine, die rechtmäßige gibt, ob sie ausgedient hat oder immer schon geknechtet war, und welchen Unterschied es macht, Kunstanbeter, Kunstzweifler oder Kunstverachter zu sein. Im Grunde ging es bei all diesen Zweifeln immer um die Sehnsucht nach dem Transzendenten.
In der Wachau ist das Überirdische auf besondere Weise irdisch inszeniert. Alles scheint wie ein Gesamtkunstwerk, das vom Empfinden des Wetters, des Lichts, der Farben und des Stils erzählt. Seit frühesten Zeiten drängte es Menschen, in diesem Stück Donautal kultische Bauten zu errichten. Die Landschaft, der Fluss und die Kirchen gehören untrennbar zusammen. So jedenfalls meine Vorstellung.
Vor und unter den Kirchen
Veronika Trubel
Lebensmotiv Ei, oder: Übergänge
Kapelle St. Margarete Mautern
»Früher waren hier viel mehr Marillenbäume«, erzählt Elfriede Kristament vom Goldhaubenmuseum in Mautern und zeigt weithin in die Gegend rund um Mautern, »aber jetzt ist überall Wein.« Wer den vielen Wein wohl aller trinkt, fragen wir uns später gemeinsam in der relativ sehr kühlen, uralten Margaretenkapelle. Marille und Wein sind bei weitem nicht die einzigen Kulturen, die an diesem uralten Ort verschmelzen, ineinander übergehen.
In der schlichten, winzigen Margaretenkapelle ist es sehr angenehm, dass ein derart vor Geschichte strotzender Ort sich leise, unaufdringlich präsentiert. Das gilt übrigens auch für das im gleichen Bau schräg gegenüberliegende Trachten- und Goldhaubenmuseum. Verwaltet und umsorgt wird das alles vom Ehepaar Kristament: Werner Kristament ist Kustos des Römermuseums, seine Ehefrau Elfriede hat gemeinsam mit der Tochter das Goldhaubenmuseum hochgezogen. Die beiden Damen fertigen übrigens auch neue Hauben an und sind weit und breit die einzigen Goldhaubnerinnen der Wachau. Mariandl schickt Grüße.
Nicht oft findet man Stellen, wo Geschichte über Jahrtausende ineinander überfließt, wo gleichzeitig leibhaftig Römerzeit ist und Frühmittelalter, und wo viel später französische Gefangene aus dem Zweiten Weltkrieg ihre Spuren hinterließen. Sie hatten bei Bauern der Umgebung zu arbeiten und malten heimlich – was wohl? – eine Trikoloreflagge an die Wand der Kapelle, jeweils nachts, als sie hier eingesperrt waren. Und weil auch das Geschichte von Mautern ist, wurde die Zeichnung bei der Restaurierung belassen. Sogar die Schaukästen stammen aus den 1950er-Jahren, aus dem ehemaligen Römermuseum, und sind somit auch schon wieder Geschichte.
Alles ist da, neben- und miteinander. Die härteste Aussage zum Thema Lauf der Zeiten liefern die Bodenfliesen, aber irgendwie passt sogar dieses moderne Statement. Denn insgesamt ist diese kleine, schlichte Kapelle ein klares, ruhiges, außerordentlich stimmiges memento mori, das dem, der in Stille zuhört, vom Werden und Vergehen erzählt, vom jahrtausendelangen Ineinanderfließen der Kulturen und Generationen, der Alltagswelten und Lebensgeschichten der Menschen am Fluss in dieser einzigartig lebenswerten, liebenswerten Landschaft, der Wachau.
So ist das rohe Mauerstück rechts vom Eingang ein Originalteil der Südmauer eines der römischen Kastelle an der Donau. Die Kirche steht auf den Resten des Kastells »Favianis«. Überbleibsel eines römischen Burgus, eines Wachturms, und diesen Mauerteil hat man beim Bau im 9./10. Jahrhundert in mühe- und kostensparender Weise gleich stehen gelassen. Zur zeitlichen Einordnung: Als Richard Löwenherz im Winter 1192/93 in der Wachau gefangen saß, stand die romanische Urversion der Margaretenkapelle hier seit bereits rund 200 Jahren. Es vergingen weitere hundert Jahre nach Löwenherz und Sänger Blondel, da wurde die Margaretenkapelle zu einer Spitalskirche ausgebaut, an der Ostseite des Chors zeugt davon noch ein Maßwerkfenster aus dem frühen 14. Jahrhundert. (Die Jahreszahl 1554 befindet sich noch gleich nebenan im Goldhaubenmuseum.) Etwa 200 Jahre nach diesem Neubau wurde Amerika entdeckt, es war die Zeit von Reformation und Gegenreformation, im Eiltempo surrt die Geschichte über Aufklärung und Nationalstaatenbildung, über zwei Weltkriege, Tschernobyl ins Zeitalter der EU und hinauf ins sich rasant verändernde digitale Zeitalter. Die Margaretenkapelle steht immer noch hier, eine stumme Zeugin vieler Generationen und Jahrhunderte.
Die Schaukästen hier in der Margaretenkapelle stammen geschätzt aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts (aus dem ehemaligen Römermuseum), wie übrigens auch der ehemalige Stadtrat Werner Kristament, der sie gestaltet und beschriftet hat. Kristament verwendete die restaurierte Kapelle immer wieder für Ausstellungen.
Übrigens: Werner Kristament ist sich relativ sicher über eine Stelle, an der er ebenfalls Überreste der Römer vermutet, die aber bisher nicht ausgegraben wurden: Konkret geht es um die Johanniskirche in Hundsheim. Diese Kirche steht genau eine Römische Meile vom Kastell Favianis entfernt und ist Johannes dem Täufer geweiht. Den Schlüssel bietet seiner Ansicht nach (die auch von manchen Historikern geteilt wird) ein uralter Text über den heiligen Severin, die »Vita Sancti Severini«: Dort kann man lesen, dass sich der heilige Severin eine Römische Meile weit vom Kastell zurückzog und dass er eine Reliquie Johannes des Täufers besaß. Warum wohl, fragt sich nicht nur Werner Kristament, ist die Hundsheimer Kirche Johannes dem Täufer geweiht? Und warum steht sie genau eine Römische Meile vom Kastell entfernt? In den Grundmauern dieser Kirche wird eventuell auch ein römischer Wachturm vermutet, denn diese wurden auch immer nach einer Römischen Meile errichtet.
Was ihrem Mann die Kapelle und das Museum ist, ist für Elfriede Kristament und ihre Tochter Karin das Trachten- und Goldhaubenmuseum gleich daneben. Die beiden sind die Einzigen in der gesamten Wachau, die heute in traditioneller Weise Goldhauben herstellen können. Beibringen konnte ihnen das niemand, weil es nämlich keine einzige Goldhaubnerin mehr gab, als man für die damals kleine Enkelin eine Kopfbedeckung zum Volkstanzen suchte. »Traditionellerweise wurden Goldhauben früher immer nur in Spitz hergestellt«, erzählt Elfriede Kristament, »aber dort macht das niemand, obwohl sogar der Bürgermeister einmal darum gebeten hat. Also machen wir das.« Rund 160 Stunden sitzt ihre Tochter Karin an einer einzigen Haube, die von feinen Goldfäden durchzogen ist und kunstvoll gefältelt wird. Sie macht das nebenbei, im Hauptberuf ist sie Lehrerin. Prächtigere Exemplare sind mit dunkelrot glitzernden böhmischen Granaten und Flussperlen bestickt. Von den Schaustücken im längst zu kleinen Museumsraum sind nur die wenigsten selbst gemacht. Die meisten der 68 Hauben aus 7 Bundesländern wurden durch die Familie Kristament angekauft. Einige Familien haben sie dem Museum sogar geschenkt – froh, das altehrwürdige Familienerbstück auslagern zu können oder am richtigen Ort zu sehen. Im Verkauf gehen Kinderhauben relativ am besten. Die Generation 40+ kennt die Wachauer Goldhaube übrigens noch von der Zehn-Schilling-Münze.
Was das Ehepaar Kristament hier in aller Stille und Leidenschaft für den Heimatort Mautern leistet, erkennt man klarer, wenn man bei Kristaments zu Hause einen übrigens köstlichen Kaffee trinken darf.
Mautern (ehemalige Margaretenkapelle. Einige Bereiche sind schon vor 1000 errichtet worden)
Langhaus mit Kreuzgratgewölbe und den reichen Wandmalereien um 1300, die erst wieder ab 1959 freigelegt werden konnten
Das Martyrium des hl. Laurentius. Es stellt die Folter des Heiligen auf einem Grill dar, um 1320.
Trinität (Gnadenstuhl) an der Ostwand um 1300
Gekreuzte Fahnen, die wahrscheinlich von französischen Soldaten aufgemalt wurden
Menschen und ihre Leidenschaften, ein ewiges Thema. Manche dümpern ein Leben lang im Nicht-Hören auf das, was sie eigentlich wollen; andere können Leidenschaft und Leben nicht vereinbaren; wenigen ist es vergönnt, dauerhaft zu zweit darin zu schwelgen wie das in dieser Hinsicht zweifellos begnadete Ehepaar Kristament. Hier haben zwei Sammlerherzen zusammengefunden, und wer ihr Haus betritt, dem präsentieren sich fein säuberlich: 2000 von Elfriede Kristament kunstvoll bemalte Ostereier (»Ich male alles an, was man auf Kunsthandwerksmärkten verkaufen kann«), 600 Teddybären, 50 Puppen, dazu an einer Wand ein Schwarm, geschätzte 30 Bilder von der Wiener Karlskirche, Bierkrüge mit Deckel, Porzellanfiguren und eine Gläsersammlung. Die Eier hängen an Schnürchen und faszinieren, auch Wachteleier hat sie mit winzigen Bildern verziert. »Das Ei ist ja ein Lebensmotiv«, sagt sie. Wir essen Nussstrudel.