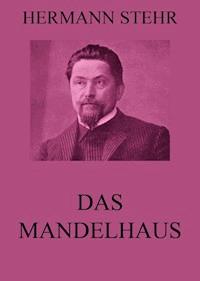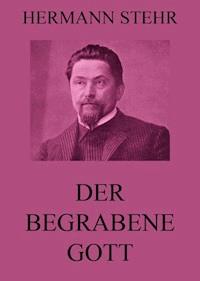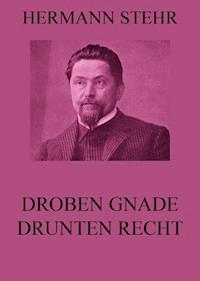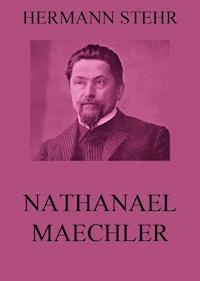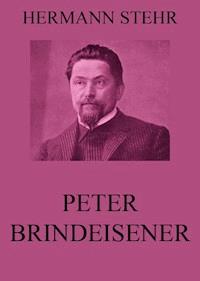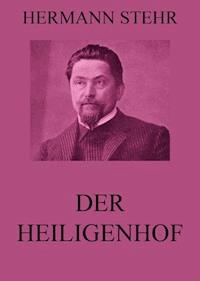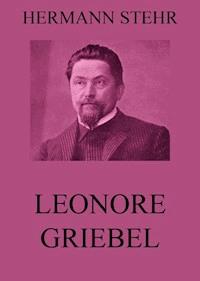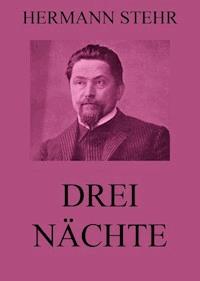
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein neoromantischer und stark autobiografischer Roman, der bereits die Figur des Franz Faber, der auch im "Heiligenhof" spielt, vorstellt.
Das E-Book Drei Nächte wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Drei Nächte
Hermann Stehr
Inhalt:
Hermann Stehr – Biografie und Bibliografie
Drei Nächte
Die erste Nacht
Die zweite Nacht
Die dritte Nacht
Drei Nächte, Hermann Stehr
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849636586
www.jazzybee-verlag.de
Hermann Stehr – Biografie und Bibliografie
Deutscher Schriftsteller, geboren am 16. Februar 1864 in Habelschwerdt, verstorben am 11. September 1940 in Oberschreiberhau im Riesengebirge. Sohn eines Sattlers. Arbeitete von 1887, nach Ablegen der zweiten Lehrerprüfung, bis 1911 als Volksschullehrer. Begann schon 1893 mit der Veröffentlichung erster Gedichte, fünf Jahre später folgte die erste Prosa. In der Frühzeit der Weimarer Republik unterstützt er Walter Rathenau als Redner. Ab 1911 arbeitete S. ausschließlich Schriftsteller, 1926 war er Gründungsmitglied der Preußischen Akademie der Künste.
Wichtige Werke:
Auf Leben und Tod. Zwei Erzählungen. Berlin, S. Fischer, 1898Der Schindelmacher. Novelle. Berlin, Fischer, 1899Leonore Griebel. Roman. Berlin, Fischer, 1900Das letzte Kind. Novelle. Berlin, Fischer 1903Meta Konegen. Drama in fünf Akten. Berlin, Fischer, 1904Der begrabene Gott. Roman. Berlin, Fischer, 1905Drei Nächte. Roman. Berlin, Fischer, 1909Geschichten aus dem Mandelhause. Berlin, Fischer, 1913Das Abendrot. Novellen. Berlin, Fischer, 1916Der Heiligenhof. 2 Bände. Berlin, Fischer, 1918Lebensbuch. Gedichte aus zwei Jahrzehnten. Berlin, Fischer, 1920Die Krähen. Novellen. Berlin, Fischer 1921Wendelin Heinelt. Ein Märchen. Trier, Friedrich Lintz Verlag 1923Der Schatten. Novelle. Chemnitz, Gesellschaft der Bücherfreunde 1924Peter Brindeisener. Roman. Trier, Friedr. Lintz Verlag, 1924Der Geigenmacher. Eine Geschichte. Berlin, Horen-Verlag 1926Nathanael Maechler. Roman. Berlin-Grunewald, Horen-Verlag 1929Das Haus zu den Wasserjungfern. Leipzig, Paul List Verlag 1929Das Märchen vom deutschen Herzen. Drei Geschichten. Leipzig, Paul List Verlag 1929Mythen und Mähren. Leipzig, Paul List Verlag 1929Meister Cajetan. Berlin, Horen-Verlag 1931Über äußeres und inneres Leben. Leipzig und Berlin, Horen-Verlag 1931An der Tür des Jenseits. Zwei Novellen. München, Albert Langen/Georg Müller 1932Die Nachkommen. Leipzig, Paul List Verlag, 1933Gudnatz. Leipzig, Insel-Bücherei, Insel-Verlag 1934Das Stundenglas. Reden/Schriften/Tagebücher. Leipzig, Paul List Verlag 1936Der Mittelgarten. Ausgewählte frühe und neue Gedichte. Leipzig, Paul List Verlag 1936Der Himmelsschlüssel. Eine Geschichte zwischen Himmel und Erde Lpz., Paul List 1939Von Mensch und Gott. Worte des Dichters. Ausgewählt von Emil Freitag, Paul List, Leipzig 1939Droben Gnade drunten Recht Das Geschlecht der Maechler. Roman einer Deutschen Familie. Leipzig, List 1944Drei Nächte
Die erste Nacht
Mein Leben ist still geworden wie ein gefangener Vogel, der seine Freiheit vergessen mußte. Die Zeit, in der das Erhabene uns so nahe steht wie die große Torheit, liegt schon zehn Jahre hinter mir. Ich bin weder dem einen erlegen, noch hat mich das andere verlockt. Der Mittelweg führte mich in die breite Menge, und die meisten Blüten setzten keine Frucht an, und sinne ich jenen ungebärdigen Jahren nach, scheint's mir schon manchmal, als erinnerte ich mich an den Traum eines Fremden.
Das Merkwürdigste in meinen Brausejahren ist auch wirklich nicht mir, sondern einem andern begegnet. Von diesem schönen aber schweren Schicksal, das damals mein Leben berührte, will ich nun erzählen, und zwar möglichst so, wie ich es frisch unter dem Eindruck niedergeschrieben habe. Nur weniges ergänze ich zur Abrundung und Klarheit aus dem Gedächtnis und dem Geist jener Begebenheiten und Menschen.
Es war im Jahre 1898. Ich hatte dazumal mein Lehramt noch nicht lange angetreten. Aber schon in jener Zeit besaß ich die glückliche Hartnäckigkeit, durch mein Leben meiner Seele zum Ausdruck verhelfen zu wollen, ohne viel Rücksicht auf die dumpfen Gewohnheiten des Alltags und die kümmerlichen Ängstlichkeiten zu nehmen, von denen die Mehrzahl meiner Kollegen sich schrecken ließen. Darum geriet ich gar bald in ein unerfreuliches Verhältnis zu meiner Behörde. Zum Lohne für die Achtung vor den Notwendigkeiten meiner Persönlichkeit wurde ich in rascher Folge versetzt und zwar in absteigender Güte, so daß ich mich in jenem Jahre in dem weltverlassenen Raspenau befand. Allein ich war guten Mutes. Denn von der Erde konnte man mich, Gott sei Dank, nicht verschwinden lassen, und überall, wohin ich kam, hatte ich das Beste, was ein Mensch nur haben kann: meine sehnsüchtige Seele, die Wunder der Natur und mein Amt. Denn das war mir in jenen jungen Tagen zu allen Stunden noch ein Kostbares.
Nachdem ich Schrank, Kommode, Waschgerät, Bettstatt und Tisch aufgestellt, in der Kahlheit meines engen Stübchens heimisch geworden war und mich überzeugt hatte, daß mein älterer Kollege ein erstorbener Mensch sei, der im Kampf mit der Not ums Brot alles Schwingende in sich verloren hatte, begann ich meine gewohnten Entdeckungsfahrten unter den Menschen und in der Umgebung. Raspenau, ein Dorf, das 750 Seelen zählte, lag am Fuße des schlesischen Gebirges so, daß nur seine letzten Häuser die sanfte Anhöhe hinangestiegen waren, mit der das Land sich zum Aufschwung einer vielgliedrigen Bergwand rüstete. Dahinter lauerte das ärmliche Weberdörflein Wecknitz, ohne Kirche, ohne Turm, ohne Geläut, stumm und abgeschlossen an den steinigen Fuß des Gebirges gepreßt und an stillen Abenden, wenn die Luft schimmernd in dem Laube der Birken stand, ertönte das dumpfe Stoßen der Webstühle bis in die Gasse von Raspenau herüber, daß es war, als zöge in der Ferne eine Prozession Schwerkranker vorüber, die außer dem trockenen Husten eines unheilbaren Leidens kein Geräusch verursachte. Ein paarmal stieg ich bis in das Birkenwäldchen, das an der Grenze der Feldfluren lag, und blickte hinunter in das Gewirr der geduckten Hütten, in deren Mitte das Schulhaus stand, das sich durch seine größeren Fenster und die weitläufigere Anlage als solches kennzeichnete. Aber Armut war auch der Stempel seines Wesens. Dieser gemeinsame, trostlose Zug lastete über allem und ward noch erhöht durch den Schatten, den die Bergwand fast zu allen Tagesstunden über die Hütten rinnen ließ, wie um sich zu entschädigen, daß sie vor hundert Jahren mit rauhen Winden und allen Unbilden unfruchtbarer Öde diese Niederlassung der Armut nicht hatte hindern können. Der einzige Weg nach Wecknitz war ein Steig; denn außer Karren und Hundewägelchen gab es kein Gefährt im Dorfe. Auf dem Rücken schleppten die Weber das Garn hin und das Gewebe her, und noch nie war das Gepolter eines bespannten Fuhrwerks gegen die Schrotwände der Häuschen gestoßen. Ich empfand Mitleid mit dem Manne, der da drunten in der Schule hauste, und den ich noch nie zu Gesicht bekommen hatte. Denn obwohl ich mich über der Ungunst der Verhältnisse erhaben fühlte, kam mir doch gar nicht der so natürliche Gedanke, daß andere und selbst ohne diese geheime Eitelkeit, sich dieselbe Freiheit erwerben könnten. Unter allerhand Gedanken, die dies Erbarmen immer neu variierten, trat ich stets den Rückweg nach Raspenau an, und obwohl ich mir immer vornahm, nach dem Wesen des abgesägten Kollegen Umfrage zu halten, unterließ ich es doch immer in einer unbegreiflichen Herzensträgheit. An einem Sonntage, beim Abstieg vom Chor der Kirche, fragte ich mehr zerstreut als neugierig meinen ersten Lehrer, was es mit dem Kollegen von Wecknitz doch für eine Bewandtnis habe, daß er sich nie in der Kirche blicken lasse. Mein älterer Kollege war ein sehr vorsichtiger Mann, und nur von Menschen, die ihm durchaus nicht schaden konnten, sprach er in scharfen Ausdrücken. Hier aber mußte ein besonders günstiger Fall für seinen Mut vorhanden sein, denn er stieß im Hinabschreiten über die steile, dunkle Holzstiege nur ein verächtliches Lachen aus, blieb, nachdem wir durch das Turmpförtchen auf den Kirchplan getreten waren, stehen, zog mit der Rechten die verwehten, grauen Haarsträhnen über seinen kahlen Vorderkopf, wandte sich zu mir und tippte mit dem Zeigefinger der Linken an seine Stirn.
"Verrückt?" fragte ich. Er drückte den Zeigefinger noch stärker gegen die Stirn und sagte kopfschüttelnd: "Nein, das nicht, aber wahnsinnig."
Nach dem Mittagmahl erzählte er mir, so viel er von dem Kollegen Franz Faber wußte. Es war wenig. Er verkehre mit keinem seiner Amtsbrüder, wiewohl er noch jung und unverheiratet sei, gehöre keinem Verein an, treibe sich nur immer im Walde umher und habe überhaupt die seltsamsten Gewohnheiten. So sei beobachtet worden, daß er, der Lehrer, einem erwachsenen Mädchen die Garnhucke den Berg hinaufgetragen habe, was doch kein Mann so ohne gewisse Gegenleistungen tun könne. Er, Christoph Dünnbier selbst, darauf leiste er seine sämtlichen feierlichen Eide auf einmal, habe beobachtet, wie er in einer hellen Mondnacht im Mai in der Mitternachtsstunde, Schlag zwölf, auf dem Kirchhof zu Raspenau promeniert sei. Das tue doch kein gescheuter Mann. Und wenn er noch so viel Bücher lese, der saubere Herr Faber, er werde schon sehen, wohin das führe. Die Geistlichkeit sei ihm, wegen der Verachtung der kirchlichen Pflichten, so wie so auf dem Nacken. Was nutzen ihm denn seine guten Revisionsprotokolle? fragte er, wenn er immer und immer wieder unter Hintansetzung jeglicher Subordination bei den amtlichen Konferenzen dem lieben, guten Erzpriester widerspreche und widerspreche, als habe niemand außer dem Lehrer von Wecknitz einen Kopf?! Das sei doch Wahnsinn. Dann kam Christoph Dünnbier auf die Geschichte von seines Vaters Brudersohn, der sich auch durch übermäßigen Genuß schwarzen Kaffees, Einsamkeit und unmäßiges Bücherlesen in jungen Jahren um den Verstand gebracht habe und nun vom Wahn getrieben, er sei Geistlicher geworden, von Pfarrhof zu Pfarrhof durchs Land streife.
Ich fand es für geraten, dem alten Manne nicht zu gestehen, daß seine Erzählung gerade mein Interesse an dem seltsamen Menschen geweckt habe, und hielt unauffällig Umfrage bei anderen, die mir zum Teil ähnliches erzählten, sich zum Teil sehr gewunden vorbeidrückten, zum Teil die Geschichten über Faber um tragische, brutale oder komische Szenen vermehrten, je nach dem Wesen ihrer Seele, nach ihrem Alter oder dem Grade ihrer Bildung. Alle aber stimmten darin überein, daß er am längsten Lehrer gewesen sei. Das sagten seine Amtsbrüder. Ein alter Bauer, mit dem ich über Faber von ungefähr in einen Disput geriet, aber meinte, er sei ein zweitüriges Haus, während fast alle anderen Menschen nur Wohnungen mit einem Zugang seien.
Von all den geheimen Erkundigungen ward ich nicht klar über ihn, noch weniger froh in mir. Denn es bedrückte mich, daß ich durch eine Anteilnahme, die schon auffällig wurde, die Schmähsucht der breiten Masse unterstützt hatte. So nahm ich mir vor, eine persönliche Bekanntschaft herbeizuführen. Ich trieb mich in der Umgebung von Wecknitz in der Hoffnung umher, ihm einmal zu begegnen, saß auch wohl in der dumpfen Schenke des Weberdörfleins und trank tapfer Schoppen um Schoppen des matten Bieres. Ich bekam ihn nicht zu Gesicht. Je hartnäckiger mir das Geschick die Erfüllung meines Wunsches versagte, um so eigensinniger bestand ich darauf. Endlich begünstigte mich das Glück. Es war am Ausgange von einem der kleinen Engtäler, durch die die Bergwand ihre vielen kleinen Wässerlein in die steinige Mulde rinnen läßt, in der Wecknitz lagert. Da höre ich nicht allzuweit von mir von geschulter Baritonstimme ein uraltes Volkslied singen, eines von jenen Liedern, die noch nicht gedruckt sind. Ich gehe dem Klange der Stimme nach. Aber da mußte ich auch schon stehen bleiben. Ganz eigensinnig verharrte der Sänger auf einem Ton, ließ ihn leise hinwehen wie ein seidenes Tüchlein, schlug ihn prall an, stieß ihn zornig von sich und löste ihn endlich aus sich los mit einem schluchzenden Piano, und ich hatte die Empfindung, als suche eine Seele vergeblich nach Erinnerungen, mit denen dieses Lied verknüpft sei, und lasse endlich traurig ab. Nach einer Pause erhob sich von derselben Stelle eine wehmütige Kadenz, die immer wiederholt wurde und nur ihre Betonung wechselte. Ein ganz widersinniger Rhythmus wurde endlich mit Hartnäckigkeit festgehalten. Der Sänger schien sogar darin eine tiefe Befriedigung zu finden. Dann entstand abermals eine Pause. Ich tat indessen einige lautlose Schritte. Da sah ich den Mann endlich. Er saß auf einem Haufen großer Steine am Bach, den Hut im Nacken, baumelte mit den Beinen und fuhr dabei träumerisch mit dem Stock in dem klaren Bergwasser umher. Der Glutdunst des Sommers zitterte über ihm. Nun reckte er sich aus, nahm den Stock aus den Wellen, stützte ihn auf einen Stein des felsigen Ufers. lehnte den Kopf auf seine Krücke und schien gegen die Erde zu sinnen. Gleich darnach ließ er das Lied, an dem er soeben so absonderlich herumgestimmt hatte, wieder aus sich herauswandeln. Es ging bedächtig an mir vorüber, seine Tonwellen formten in der Sommerluft ein greisenhaftes Weiblein mit jener süßen Züchtigkeit, die manchmal mit den weißen Haaren über Frauen kommt. Mit niedergeschlagenen Augen, einer buntblumigen Bänderhaube auf dem mageren Kopfe, die abgearbeiteten Hände auf der Brust gefaltet, so schwebte das Wesen des Liedes vor den Stämmen hin.
Dann war es still.
Nur das Bergwasser redete mit leisem Wellen eintönig, immerzu...
Ich wußte, der Sänger war der Langgesuchte, und mit ein paar langen Schritten über das Wiesenstreiflein war ich bei ihm angelangt.
Er schrak zu mir herum. Ein Paar brauner, blitzender Augen packten mich, daß ich schüchtern meinen Gruß sprach.
"Guten Tag!" klang es unwirsch zurück.
"Verzeihen Sie, ich bin in dieser Gegend nicht bekannt."
"Ich auch nicht. Bedaure, mein Herr! Adieu!"
Scharf schnitt er die unbeholfene Anknüpfung ab, erhob sich und verließ mich mit einem stolzen Neigen seines scharfgeschnittenen Kopfes. Ein wenig ärgerlich strebte ich in einem Bogen um Wecknitz der Birkenlehne nach Raspenau hin zu, und als ich von der halben Höhe her noch einmal hinuntersah, erblickte ich ihn gerade die Stufen zum Schulhause emporschreiten. So war es also doch der Faber gewesen.
Aber es gibt auf Erden keinen sichereren Weg, etwas in unsere Gewalt zu bekommen, als daß es sich uns versagt. Und ob ich auch, meinem Dorfe zuschlendernd, unwirsch die Steine des Weges mit dem Fuße wegschleuderte und immer wieder vor mich hinmurmelte: "Bin ich denn ein Hund?", je näher ich Raspenau kam, um so mehr nahm eine geheime Sicherheit Besitz von mir, zwischen seiner und meiner Seele sei trotzdem ein Kontakt geschlossen worden, dessen Kraft uns auf irgendeine Weise nun zusammenführen müsse. Die Stärke dieses Glaubens bestand eben darin, daß ich keine wirklichen Gründe, als nur die Empfindung der Ähnlichkeit unserer Wesenheit besaß. Genug, ich vertraute der Unzerreißbarkeit des mystischen Bandes zwischen uns und unterließ von nun an jeden Versuch einer Annäherung. Indessen ward das Wetter zwischen mir und meinen nächsten Vorgesetzten erst launisch, dann trübe; ich hielt mich für unnötig gegängelt; das Mißbehagen mit manchen meiner Extravaganzen wurde mir mit beißender Schonung nahegelegt; meine Amtstätigkeit fand immer weniger Gnade, und ehe der Herbst das erste Gelb durch das Geblätter des Waldes geblasen hatte, begann ein immer lebhafteres Geplänkel intimer Feindseligkeiten zwischen mir und meiner nächsten Instanz. Die Kollegen, die so unendlich feine hygroskopische Organe für derlei Veränderungen besitzen, erlitten eine merkliche Einbuße an Sympathie zu mir. Christoph Dünnbier lächelte peinlich, wenn ich nur Alltägliches zu ihm sprach, beschützte die grauen, spärlichen Haarsträhnen seines kahlen Vorderhauptes mit der Rechten wie vor einem anziehenden Winde und ging immer von mir, als habe ich ihn um eine Summe Geldes betrogen. Ich regte mich über diese mir nur zu geläufig gewordenen Vorgänge nur sehr wenig auf. Nein, ich fand eine große Genugtuung darin, denn diese Wolke feiger Scheelsucht, die sich immer dichter um mich zusammenzog, brachte die Empfindung einer immer stärkeren Annäherung an Faber in mir hervor, so daß ich oft aus diesem Grau um mich leibhaftig das Paar seiner braunen, blitzenden Augen auf mich gerichtet sah, ein wenig überlegen zwar, doch mit einem Interesse, das nicht allzu spöttisch war.
Dann kam der Winter und ich saß Tag und Nacht in meinem Stübchen und bemühte mich, diesen Kontakt mit einem Fremden zu zerbrechen. Zu diesem Zwecke wählte ich das Studium von Taines Geschichte der Entstehung des modernen Frankreichs. Das Versenken in die Vielfältigkeit äußeren Geschehens sollte mich heilen von dieser seelischen Monomanie. Denn, vielleicht zum größten Teil aus Trotz oder Stolz, ich hatte mir die Ansicht gebildet, diese nebelhafte Beziehung zu Faber sei nichts als ein Beweis der beginnenden Zersplitterung meiner Persönlichkeit. So sollte mich eine Wanderung durch die blutigen Zerklüftungen der französischen Revolution ablenken und innerlich zusammenschweißen. Aber die Vorstellung der Wirkung eines Buches auf uns ist immer anders als die Wirkung selbst. Dieser Krankheitsbericht über einen riesigen Wahnsinn, in dem alle Dramatik abgeschliffen ist, alle Tatsächlichkeit zu abstrakter Feststellung erniedrigt wird, wirkte in Verbindung mit der rhetorischen Monotonie einer nur geistreichen Dialektik niederdrückend und lähmend auf mich. Zugleich zerrieb er den Glauben an die Selbstkraft des Individuums ganz und machte mein Dasein abhängig von dem Spinnengewebe zufälliger Zweckmäßigkeiten. So legte sich eine beklemmende, unbewegliche Atmosphäre auch um meine innerste Seele, die mehr als vorher mit geheimer Feindseligkeit gegen allen äußeren Zwang erfüllt wurde.
Wenn ich dann in der Nacht, die mich oft durch ein Rütteln oder einen undeutlichen Angstruf aus dem Schlummer riß, von meinem einsamen Lager aus das Auge auf die Finsternis um mich richtete, tauchte wohl ganz aus der Tiefe das Gesicht Fabers auf. Aber dann war kein Trotz und zorniger Stolz in ihm, sondern es lag die Verhärmtheit und Blässe über seinen Zügen, die jenes Grübeln über Menschengesichter bringt, das so lange dauert, bis es in machtlose Wehmut endet. So stand es eine Weile in der Nacht, leise geneigt und unbeweglich wie ein Bild tiefen Erdenkummers und zerging dann gleich einer weißen Wolke, nichts zurücklassend als ein Beben in der Nacht um mich und ein Gefühl der Reue in mir über meine Gemütsverhärtung einem Menschen gegenüber, von dessen verborgener Not mir diese geheimnisvolle Kunde geworden war. Immer nahm ich mir vor, diesem Zustand durch einen Versuch der Annäherung ein Ende zu machen, und immer wurde dieser löbliche Vorsatz von dem Staubgeriesel kleinlicher Tage verschüttet und erstickt.
Gegen das Ende des März hin war mir Faber wieder einmal in der Nacht "erschienen", und nach dem Verschwinden seines Bildes hatte ich aus der Tiefe der Finsternis ein schmerzliches Aufstöhnen zu hören vermeint. Ich war sogleich ganz wach, setzte mich auf und wartete auf die Wiederholung des Rufes. Es blieb still, das Beben in der Luft verging, und ich legte mich wieder hin, ganz verstört von dem Gedanken, daß der unglückliche Kollege vielleicht vor dem seelischen Zusammenbruch stehe, indessen ich trotz dieser wiederholten Warnungen in Gleichgültigkeit hinlebe. Ich schenkte am anderen Morgen einer Ausflucht meiner Trägheit, die mir zuflüsterte, Faber sei wohl nicht mehr als ein gewöhnliches Rauhbein, keinen Glauben, sondern warf mich nach Klassenschluß in andere Garderobe. Nach dem Mittagessen eröffnete mir jedoch Herr Christoph Dünnbier unter Überreichung der Verfügung die Festsetzung einer amtlichen Bezirkslehrerkonferenz für den Anfang des nächsten Monats. Gegenstand der Tagesordnung: ein Vortrag des Lehrers Franz Faber aus Wecknitz über Hilfsmittel bei der Erziehung der Kinder. So beschloß ich, meine Annäherung diesem Tage zu überlassen.
Die Amtshandlung ging am 9. April, vormittag um 10 Uhr, in dem Klassenzimmer III b der Kreisstädtischen Schule vor sich. Das Gebäude war ein gewöhnlicher viereckiger Kasten, der sich nur von den vielen seinesgleichen dadurch auszeichnete, daß er ein wenig abseits gelaufen war, um sich hinter dem breiten Rücken einer unförmlichen Kirche zu verbergen, deren Größe durch nichts als eine Sammlung der Geschmacklosigkeiten von Jahrhunderten gebildet wurde. Die Schule aber stand in einiger Entfernung und bemühte sich, durch ein schüchternes Türmchen über der Front ihre willige Abhängigkeit vor dem heiligen Unding anzudeuten. Der Platz zwischen diesen ungleichen Nachbarn war kahl und baumlos, und man konnte wohl meinen, mitten im bescheidenen Verkehr der Kleinstadt hier fern vom Leben zu sein. Nie knirschte ein Wagen seine Spur in den Kies, selten überschritt ein Erwachsener das Plätzchen. Kinder aber stoben fluchtartig vorüber und erhoben, wenn sie glücklich entronnen waren, jenseits der niedrigen Mauer ein Geschrei der Freude.
Heute wandelten die so leicht erblassenden Lichter des Vorfrühlings über den feuchten Sand, und es war ergötzlich anzusehen, wie sie neckisch und lose über die würdigen Rücken der Männer glitten, die in einem Schritt dem Aufgang zur Schule zustrebten, der einer gewissen Feierlichkeit nicht entbehrte. Von beiden Seiten, entweder aus dem Inneren der Stadt oder rechts von der Landstraße her fanden sich die Teilnehmer ein, stauten sich vor den Stufen wohl zu kleinen, flüchtigen Gruppen und stiegen nach einem sichernden Seitenblick nach dem Pfarrhof unter gemäßigtem Geplauder die wenigen Stufen empor. Ich hielt mich auf dem Vorplatz auf, um Faber noch vor Beginn der Versammlung nahezutreten und ein Zusammensein in irgendeinem Gasthause mit ihm zu besprechen. Er kam nicht, und als nach Ablauf der zehnten Stunde aus der Tür des geistlichen Heims die schwarze Gestalt des Dr. Pfister trat, mußte auch ich das Klassenzimmer aufsuchen. Dort hockte die ganze Lehrerschaft der Umgegend schon mit seitwärts gedrückten Knien und ließ bei meinem eiligen Eintritt sofort von ihrem Geplauder ab. Eine Weile nach mir, noch ehe das Gespräch sich wieder erholt hatte, schritt durch die weit geöffnete Tür der geistliche Herr. Alle erhoben sich, so gut es ging, zum Zeichen der Achtung, und als nach dieser kleinen Aufregung jeder in den Marterbänken die bequemste Stellung wieder eingenommen hatte, saß vor mir in der ersten Bank Franz Faber. Er mußte unmittelbar hinter dem Konferenzleiter hineingeschlüpft sein und nahm so ruhig seinen Platz ein, als sitze er schon seit langem da, die linke Hand zwanglos um einige Blätter geschlossen. Dr. Pfister ernannte einen der städtischen Lehrer, der lang und mager war und ein spitzbübisches Slavengesicht hatte, mit einer wehmütigen Weiberstimme zum Protokollführer, nachdem er unter einem stereotypen Lächeln, als erzähle er Witzchen, die Konferenz eröffnet hatte. Während er stehend sprach, streckte er hin und wieder seine Fetthand über die Brüstung des Katheders und hob dabei den Zeigefinger, an dem der Ring der geistlichen Räte mit dem großen blauen Steine steckte. Bald danach stand Faber vor uns, sah einen Augenblick sinnend in sein Manuskript und begann dann, seine Arbeit vorzulesen. Das war nicht die volle und mutige Baritonstimme, mit der er mich vor dem Walde abgeschüttelt hatte, sie klang müde, wie erschöpft von langem, schnellen Laufen, hatte keine Tragkraft mehr, und alle Sätze wurden wie eine ganz belanglose Gleichgiltigkeit durch sie laut. So, als habe eine Krankheit von ihm Besitz genommen, klang sie. Still und bescheiden stand er da, die Schultern gesenkt, das scharfgeschnittene Gesicht blaß, mit dem Ausdruck einer bitteren Weichheit. Der Eindruck dieser Resignation fiel um so mehr auf, weil er in schroffem Widerspruch zu dem Geiste des Vortrages stand. Dieser begann mit der Feststellung der vollkommenen Rätselhaftigkeit des Lebens und der Seele des Menschen. Dann zeichnete er mit scharfen, sicheren Strichen die Stückhaftigkeit und den Widerspruch verschiedener philosophischer Systeme, um im Anschluß daran vor der urteilslosen Verhimmelung von Lehren zu warnen, deren alte Sätze nur durch rücksichtslosen Zwang als Wahrheiten aufrecht erhalten werden, und die nur durch Anwendung von Gewalt die große Zahl der Anhänger bei ihren Standarten erhalte. Denn auch sie ist wie aller Menschenwahn nur ein Weg zur Wahrheit. Ihre Wahrheit ist Suchen, und sie bringt nur jenen Ruhe, die bereit sind, sich innerlich zu töten. Ein unhörbarer Ruck ging bei diesen Worten durch die Zuhörer, viele senkten verschämt das Gesicht, als hätten sie eine Blasphemie gegen "die heilige Mutter Kirche" ausgesprochen, andere bekamen jenes blicklose Auge, womit feige Männer in den Augenblicken der Entscheidung sich wappnen, die mutigste Servilität aber räusperte sich ostentativ. Dr. Pfister langte mit mildem Lächeln seinen Bleistift her und schrieb etwas in sein Taschenbuch, darauf nahm er sein Haupt so in die Hand, daß uns der Ausdruck seines Gesichtes entzogen wurde. Die Luft war stockend und beklemmend von der Feindseligkeit der Seelen und schwer zu atmen. Faber sammelte mit einem flüchtigen Blick den Erfolg seiner Worte, bekam davon den Ansatz zu einem ironischen Lächeln um seinen Mund und las unbeirrt weiter, nur ein wenig gelassener, nein, demütig. Seine Arbeit beschäftigte sich nun mit dem Schlendrian der Ansichten innerhalb der gültigen Pädagogik, die weniger der Ausdruck des gegenwärtigen Standes der Wissenschaft, als vielmehr der Standpunkt der staatlichen Auffassung von dem Zwecke des Menschen sei. Mit bitterem Sarkasmus sprach er von dem niemals existierenden Typus, den die Lehrer zwangsweise in das Kind hineinkonstruieren müssen, ohne mehr als sentimentale Aussicht auf das wirkliche Wesen des Kindes zu nehmen, das, jedes für sich, eine einzigartige Offenbarung des Universums, eine nie sich zum zweiten Male wiederholende Schöpfung darstelle.
In den Sätzen glühte das verheimlichte Feuer eines einsamen Grüblers. Die müde Gelassenheit, mit der er diese Rebellion aussprach, wirkte direkt tragisch. Mir schnürte es die Brust zusammen, und ich rief mitten in seine Worte ein lautes "Bravo", nur um mich innerlich zu entlasten. Denn das alles berührte mich weniger als Sache, sondern als das Bekenntnis eines Mannes, an dessen Ringen ich in so vielen Gesichtern der Nacht hatte Anteil nehmen dürfen. Ich sah kaum, wie Dr. Pfister seine Hand vom Gesicht nahm und mit mißbilligendem Erstaunen nach mir schaute, mir ging der folgende Hauptteil des Vortrages fast spurlos verloren, der von der Benutzung der Phrenologie, der Handkunde und noch anderen Hilfsmitteln für die Erkenntnis der Wesensart des Kindes handelte, ich saß da und starrte versunken in das Wesen dieses Mannes, das sich mir auftat wie ein geheimnisvoller, tiefer Gang. Plötzlich stockte der Redner. Ich schrak aus dem sinnenden Hinschwinden auf und bemerkte, wie Faber seine Blätter mit zitternder Hand senkte und mit einer tiefen Traurigkeit über uns hinsah. Doch nur einen Augenblick dauerte diese Unentschlossenheit. Eine trotzige Falte grub sich zwischen die Brauen, und mit erhobener Stimme las er die kurzen unvergeßlichen Schlußworte: "Die Freiheit der Menschheit gibt es nicht. Wir sollen die Kinder nicht von sich, sondern zu sich, – von uns erlösen. Seien wir demütige Diener, daß jeder Mensch zu seiner Freiheit gelange, die der unzerbrechliche Zwang und der Halt in aller Not ist. Vermögen wir uns zu der Ehrfurcht vor diesem ihrem Gott nicht hindurchzuringen, dann ist unsere Erziehung eine Gefahr, und wir sollten als Hinberufene von bannen gehen."
Er verbeugte sich. Keine Hand, sein Mund rührte sich zur Anerkennung. Voll Galle rief ich mein "Bravo!" Faber warf mir einen verweisenden Blick zu, und indem er die wenigen Schritte an seinen Platz tat, faltete er bedächtig die Blätter zusammen und ließ sie in seine Seitentasche gleiten. Die Erwartung eines Strafgerichtes erfüllte den Raum.
Dr. Pfister drehte lächelnd den Bleistift zwischen Daumen und Zeigefinger, genoß eine Weile den Schrecken kleiner Seelen, dankte dann mit seiner Wöchnerinnenstimme dem "jungen Herrn" für seine Mühe und stellte den Vortrag zur Diskussion.
Alles blieb still.
"Da sich niemand zum Wort meldet," fuhr er dann in weinerlicher Milde fort, "so möchte ich einiges erwähnen, was ich mir aufgeschrieben habe. Der Herr Vortragende hat mit viel Fleiß und Mühe vieles zusammengelesen und uns dargeboten, und wenn die Gesamtwirkung eine andere war, als er wohl erwartete, so habe ich nicht nötig, ihm daraus einen Vorwurf zu machen. Denn das hieße ihm das Vorrecht seiner Jugend verargen. Auch Ausdrücke wie "Tugendbold" und ähnliche sind wohl auf nichts als auf eine vorübergehende Vorliebe für Extravaganzen zurückzuführen. Nein, was mich schmerzlich berührt hat, das ist allein die Tatsache, daß in der Arbeit, die doch von der Erziehung der Kinderseele handelte, mit keinem Worte Jesu Christi, unseres einzigen Vorbildes gedacht worden ist." Und nun gab er die Gallerte gewohnter Phrasen von sich, um zu schließen: "Alles Menschenstreben hat in alle Ewigkeit die Erkenntnis zum Ausgang, daß wir zum Wissen kommen, nichts zu wissen. Wir christ-katholischen Lehrer haben diesen langen Irrweg nicht notwendig, wenn wir uns bei Anfechtungen der Eitelkeit mit den Worten zu Gott wenden: Führe uns nicht in Versuchung!"
Der spitzbübische Slave am Protokolltisch verzeichnete mit eifrigem Wohlgefallen die zerreibenden Sätze des guten Hirten.
Franz Faber erhob sich und erklärte mit unsicherer und gepreßter Stimme, daß sein Thema laute: "Hilfsmittel der Erziehung", daß aber Jesus Christus einem katholischen Lehrer doch mehr als ein Hilfsmittel sein müsse, und er habe es vermeiden wollen, die Anwesenden mit Beweisen eines Axioms zu langweilen.
Trotz des starken Hiebes gegen Dr. Pfister waren seine Worte nichts als eine vollkommene Unterwerfung.
In Scham starrte ich auf seinen Rücken, der sich ruhig gegen die niedrige Bank preßte.
Der Vorsitzende nahm keine Notiz von Fabers Entgegnung; eine böse Falte legte sich quer über seine gut gepolsterte Stirn, und mit unterdrücktem Widerwillen in seiner Kastratenstimme lud er die Anwesenden ein, Erfahrungen und Fragen aus dem Amtsleben zum Besten zu geben. Niemand fühlte den Mut, Erfahrungen gehabt zu haben, und so erhob sich nach einer gewaltigen Prise der Slave zur Verlesung des Protokolls.
Er hatte die Absicht des geistlichen Rates nur zu gut verstanden und dem Protokoll eine Fassung gegeben, die eine nur leicht verkappte Denunziation Fabers wegen unchristlicher Gesinnung enthielt, denn die Entgegnung des Vortragenden war unterschlagen worden.
"Ich denke, es ist gut so?" fragte der Slave nach Beendigung der Vorlesung zu Dr. Pfister hinauf, und dieser lächelte zurück.
"Hat jemand gegen die Fassung des Protokolls etwas einzuwenden?"
Bei dieser Aufforderung des Vorsitzenden hob Faber ein wenig das Haupt, ließ es aber sobald wieder gleichgültig sinken.
Er mußte einen bewußtlosen Tag haben, daß er sich ergeben den Strick um den Hals legen ließ. Die Empfindung haben, es geschehe eine Infamie und schon aufstehen und die Anfügung der Worte Fabers beantragen, war eines bei mir. Ich tat es mit vor Erregung bebender Stimme.
"Es ist sehr schätzenswert von Ihnen, diesen kleinen Irrtum bemerkt zu haben", redete Dr. Pfister mit seiner Wöchnerinnensüße und der bösen Falte im Fett seiner Stirn. "Ich möchte nur noch wissen, wie Herr Lehrer Faber sich zu dieser Frage verhält, die das Wesentlichste vom Gang der heutigen Konferenz nur ganz unerheblich berührt."
Zu meiner Überraschung schüttelte mich der Wecknitzer auch diesmal ab.
"Ich bin ganz der Meinung des Herrn Rates," sprach er, "daß es sich nur um eine Formalität handelt, habe aber nichts dagegen, wenn meiner bedeutungslosen Worte im Protokoll Erwähnung geschieht."
Ha, was soll denn das heißen? fragte ich mich, ganz aus den Fugen geraten über so viel Widersprechendes. Der Kaisertoast brauste an mir hin, die Unruhe der hinausströmenden Versammlung trug mich die Stiege hinab, schob mich in den Schulhof, verlief sich, und nach, ich weiß nicht welcher Zeit, grüßte mich ein Mann, der eine blaue Leinwandschürze vorgebunden hatte und sagte:
"Ach, Herr Lehrer, warten Sie etwa auf den Rektor Metzner? Der kommt heute nicht mehr her."
Ich fand mich unter der Tür nach dem Schulhof lehnen und erkundigte mich nun, ob der Frager der Schuldiener sei. Während er redselig begann, einen Abriß seiner Lebensschicksale zu geben, las ich zerstreut von meiner Uhr die Zeit ab und reichte dem Mann, der eben von seiner Verheiratung erzählte, ein Trinkgeld und ging davon, weil es schon einhalb ein Uhr Nachmittag war.
Ich lief in dem Städtchen umher, ging nach Hause, begann meine Schularbeiten, schlief, arbeitete, trödelte umher, und immer ward ich die quälende Vorstellung nicht los, daß ich Schiffbruch gelitten habe. Ich? Aber so ist es ja. Alles, was geschieht, geschieht an uns. Allein eben, weil ich nicht ergründen konnte, was eigentlich mit Faber vorgegangen war, kam ich in mir nicht zur Ruhe. Es half nichts, die Schnur meiner Vermutungen stets aufs neue abzugreifen, ich stand am Ende immer vor anderen, einander widersprechenden Ergebnissen. Er will sich ducken; er will es. Zu dieser Überzeugung kam ich am leichtesten. Aber, warum hatte Faber dann überhaupt diese rebellische Arbeit vorgelesen, gleichsam sein Haupt auf einer Schüssel seinen Gegnern ostentativ überreicht? Ostentativ. Ja, wenn es Bekehrung war, steckte in diesem aufgewandten dramatischen Apparat eine Menge Pose. Jedoch, warum hatte er den Schluß des Vortrages mit erhobener Stimme, wie eine unabwendbare Kriegserklärung gelesen? Und wenn er sich unterwerfen wollte, warum hatte er meine Hilfe, die ihn von den üblen Folgen disziplinarer Scherereien bewahren sollte, abgelehnt? Vielleicht, weil er jener seltenen Art starker Menschen angehörte, die die Buße von Übeln sich nicht schwer genug bereiten können. Warum? Warum? Ich spann immer neue Schleier von Vermutungen und litt zuletzt unter einer Abspannung, einem leisen Taumel, wie er uns erfaßt, wenn wir lange mit gleichen Schritten um einen kreisrunden Platz gegangen sind. Ich sah Fabers Bild nicht mehr in den Nächten. Aber die Stelle, von der es mir verschwunden war, lag jetzt in mir, und alle Stunden, auch die ruhigsten, erfüllte ein Vibrieren des Fernsten meiner Seele.
Bald aber trat jene Wandlung ein, die ich fast nicht zu hoffen wagte, und die mir für immer den unumstößlichen Beweis erbracht hat, daß ehrliche Sympathie auch die andere Seele, nach der es uns hindrängt, ebenso bindet wie uns. Denn etwa fünf Wochen nach der Konferenz erhielt ich einen Brief von Faber, in dem er mich um einen Besuch in seiner Wohnung bat. Es fiel mir nicht ein, diese Bitte als eine neue Bestätigung seiner Anmaßung zu deuten, sondern, indem ich die ganze Reihe innerer und äußerer Vorkommnisse, von der dieses Brieflein das letzte Glied darstellte, durchlief, wurden mir seine so schlichten Worte bedeutungsvoll, beluden sich mit den Gebilden meiner lebhaften Einbildungskraft und erfüllten mein Gemüt mit Beklemmung. Wir wissen mehr als uns bewußt wird. Nach Schluß des Nachmittagsunterrichts entwickelte ich bei den Vorbereitungen zum Besuch eine solche Eile, als gelte es mit einem Menschen schnell noch ein paar entscheidende Worte zu sprechen, der schon auf einem sich in Bewegung setzenden Bahnzug Platz genommen hat. In voller Aufregung sprang ich die Treppe des Schulhauses hinunter, an Christoph Dünnbier vorbei, der unter der Tür seiner Wohnung erschienen war, mich mit mißbilligenden Augen ansah und die Haare seines nackten Schädels beschützte. Als ich über die Schwelle der Haustür schritt, wagte er, mir ein sehr bedenkliches: Hm, Hm! nachzusenden.
Dann hatte ich das Dorf hinter mir, die sanfte Anhöhe hängte sich in die Knie, und ich mäßigte meine Schritte. Alles Feld lag so seltsam geduckt um mich, die Raine zwischen den Ackerbreiten dehnten sich in ungewohnten Linien in eine Luft hinaus, die mit dem Dunst der leidenschaftlichen Fruchtbarkeit des Mai erfüllt war, einer grauen, ruhelosen Schicht, in der die Laute der Vögel gedämpft erklangen und alle Dinge mit zweiten leuchtend-zerfließenden Umrissen umwittert waren, die den natürlichen Farben einen satteren Ton und eine größere Leuchtkraft gaben. Die Lerchenlieder verloren sich schmachtend in die blauende Höhe, die Birken trugen das verhuschende Grüngewölk der ersten Belaubung mit ihren schlanken Gliedern. Kurz, alles hatte einen so sonderbaren, niegesehenen Ausdruck, daß ich es plötzlich nicht begriff, wie ich auf den Weg nach Wecknitz komme. Solche Fremdheit und Unbegreiflichkeit des Handelns überfällt uns vor jeder wichtigen Tat, und weil ich damals noch nicht wußte, daß der Menschen Hand immer durch Schatten zugreifen muß, gab ich diesem Gefühl der Unsicherheit in mir nach, zog das Billett Fabers hervor und las es mehrere Male aufmerksam durch, so, als trügen diese so klaren Worte noch irgendeinen verborgenen Sinn, der mir nicht entgehen dürfe. Wirklich, ich kam zu der sonderbaren Überzeugung, Faber erwarte mich erst gegen Abend.
Es war in der Mitte der fünften Nachmittagsstunde. Ich setzte mich, auf der Anhöhe angelangt, abseits vom Wege, mitten im Birkenwäldchen auf einen Stein und sah nach Wecknitz hinunter. Das Licht der weißen Stämme war um mich und mir schien es, als sei ich von einem heiteren, lichten Schreine eingeschlossen.
In dem Weberdörflein drunten blühten alle Obstbäume, und Wecknitz sah nicht aus wie eine Menschensiedlung, sondern wie ein See aus weißen und rosa Wogen. Die grauen Hausdächer schwammen darin wie unbewegliche, halbversunkene Kähne, vermorscht und verlassen. Das Poltern der Webstühle schien von Wellen der Tiefe herzurühren, die gurgelnd und stoßend einem verborgenen Ausweg zuströmten. Mitten ragte die Schule, plump und trostlos wie das festsitzende Wrack eines größeren Fahrzeuges über die schimmernden Wogen des Blütensees. Ein leiser Wind war erwacht, und lautlos leckte der weiße Schaum an den alten Planken empor.
Meine junge Seele verfing sich in Träumen, aus denen mich die schnelle Kühle des Frühlingsabends aufriß. Es war dreiviertel sechs Uhr geworden und dunkelte schon ganz leicht. Der Dunst war von der Erde aufgestiegen und schwamm vor einem mäßigen Winde als Gewölk am Himmel hin. Die Sonne begann hinter die Waldmauer der Feistelberge hinunterzuglühen, während durch die Wolken im Osten die blassen Lichtschleier des aufgehenden Vollmondes wehten. In Sätzen sprang ich den Abhang hinunter und bog wahllos auf einem der vielen schmalen Hühnersteige in das Gewirr der Obstbäume ein. Nach einigem Hin und Her stand ich vor der Schule, das heißt, ich stutzte ein wenig an dem engen Zugange, der durch ein Vorgärtchen an die wenigen Stufen führte, die zu erschreiten waren, ehe man an die einfache Tür gelangte. Der lange Schrotbau lag mit den geschlossenen Fenstern seiner niedrigen Front in einer Art mürrischer Einsamkeit auf einem Hügelchen, auf den es hinaufgeklettert zu sein schien, um zu allen Tagesstunden den Kinderchen wie eine lebendige Mahnung vor Augen zu stehen.
Ich stand an dem Brunnen, dessen Wasser sich immer gurgelnd verfing, und stellte mit dem geheimen Wunsche Betrachtungen an, Faber möge mich bemerken und mir entgegengehen, um so unserer Annäherung den peinlichen Beigeschmack zu nehmen. Bald jedoch erkannte ich, daß er als Bittender von seinem Stolz nie die Erlaubnis zu dieser Demütigung erhalten würde. So trat ich in den Hausflur, der von jener maukigen Luft erfüllt war, die die offenen Lehrzimmer in alle Teile der Schule zu senden pflegen. Das Schulzimmer war ein getünchter, kahler Raum, groß und niedrig. Ihm gegenüber, ein wenig schief in der Bohlenwand sitzend, die Tür wohl zur Lehrerwohnung. Ich klopfte. An dem lauten Ton erkannte ich, daß das Zimmer leer sei. Ich schritt an einer engen Holztreppe vorüber, die jäh in das Dämmern des Bodenraumes aufstieß, und kam an die Tür nach dem Hofe. Hier hörte ich Menschenstimmen. Ich konnte nicht gleich entscheiden, ob sie aus dem Hofe drunten klangen, oder in irgendeinem Raume des Hauses eingeschlossen waren. Da fiel mein Blick auf eine vernutzte Tür, links neben dem hinteren Ausgang. Richtig, hier war es. Eine schmerzvolle Mädchenstimme redete bittend in langem Strome. Schonend und ruhig erklang die Stimme des Mannes. Das Gespräch kam gegen die abgenutzte Tür. Ich sprang auf den Zehen schnell in den Hausflur zurück, um hinter die Bodentreppe zu treten. Unterwegs fiel mir der Stock aus der Hand und polterte auf die Steinfliesen. Ehe ich ihn aufheben konnte, ging die Tür auf. Faber trat auf die Schwelle, erkannte mich sogleich und half mir über die Betretenheit, in die ich geriet, daß er mich herzlich begrüßte. Seine Lustigkeit war schlaff und gezwungen. Das Gesicht übernächtig und gealtert, und während er meinen Worten zu lauschen schien, schaute er, etwas anderem nachsinnend, zu Boden und begann, gedankenvoll seine ungewöhnlich langen Füße voreinander setzend, im Flur hinzuwandeln. Auf der Schwelle der Haustür hielt er an.
"Meine Karte ist eigentlich gegenstandslos geworden", sagte er und lächelte mich traurig an.
"Bin ich zu spät gekommen?"
"Ja – und nein."
Und als er sah, daß ich die Krücke meines Stockes fester umspannte, setzte er fort: "Aber, damit will ich Sie natürlich nicht verjagen. Wir wollen sehen."
Wiederum schaute er zu Boden, schob mit der Spitze seines rechten Fußes irgend etwas zur Seite, rückte sich dann herauf und sprach im Hausflur hin:
"Liese! Machen Sie das Abendbrot zurecht."
Ein gehorsames und ergebenes "Ja" antwortete, und ich sah, leise und eilig, ein Mädchen zur Hoftür hinaushuschen, das von einer seltenen Zierlichkeit war.
"Es ist die Tochter meines Nachbars, des alten Plaschkewebers. Sie besorgt die wenigen Aufwartedienste", erklärte mir Faber, und seine Stirn umwölkte sich.
"Sie haben Verdruß mit ihr gehabt?" fragte ich. –
"Mit ihr nicht, mit mir, und zwar habe ich ihn jetzt", antwortete er und sah gleich mir in das geöffnete Klassenzimmer, vor das wir getreten waren. "Haben Sie den Geruch überwunden?" fragte er nach einer Weile.
"Nun – freilich spür' ich ihn auch noch, aber was will man machen?"
"Eben, eben! Man will eben nichts machen. Durchaus will man nicht."
Er lachte bitter und kehrte sich um.
"Haben Sie Lust, noch mein anderes Leben zu sehen?"
"Wie meinen Sie das?"
"Na, das Schulhaus ist so ein Symbolum meines Lebens. Denn es ist morsch, unwohnlich und gewährt mir nur noch in einem Winkel Unterschlupf."
"So, sans phrase", entgegnete ich leicht.
"Natürlich, sans phrase! Bloß so." Er sprach eigentlich nicht mit mir, sondern redete nach Art der Einsamen mit sich, bitter und spöttisch, voll Hohn gegen sich.
Wir standen vor der Treppe zum Boden. "Da unten sind noch drei Zimmer und die Küche, aber..." Die Liese kam eben zur Hoftür herein. Faber unterbrach sich und sah nach dem Mädchen. Unter seinem Blick hielt es an.
"Wie Sie es gesagt haben, Herr Lehrer?" fragte sie mit glücklicher Unterwürfigkeit.
"Ja", erwiderte Faber merkwürdig rauh.
Mit einem Glanz im Gesicht verschwand sie hinter der vernutzten Tür.
"Sie meint meine Anweisungen zum Abendbrot", sagte Faber erklärend, und wiederum schlug sich die Falte tiefer über seiner Nasenwurzel nach der Stirn hin.
"Sie hat ganz sonderbar schöne, braune Haare", bemerkte ich.
"Außerdem kocht sie ganz gut", sprach er ironisch. "Ja, und dann dächt' ich, wir gingen nun in meine Bude. Bitte!"
Unter beißendem Lachen sprang er die Treppe hinauf. Er lief so schnell, daß ich ihm nicht folgen konnte. Noch ehe ich die steile Stiege emporgeklommen war, schloß er die Tür, und ich befand mich allein in einem schummrigen Dunkel. Halb von Grimm, halb von Scham erfüllt, kam ich im Aufstieg mit der Rechten an ein rauhes Gemäuer, das sich mir als der riesige Schornstein offenbarte, und stand gleich darauf an der niedrigen Tür. Eben kochte in mir der Zorn, und im Hineintreten fragte ich unvermittelt: "Ja, warum bin ich nun eigentlich zu spät gekommen?" stieß, während ich diese rauhen Worte sprach, schon nach dem dritten Schritt in die Stube an einen Stuhl und setzte mich, als sei ich von Faber dazu eingeladen worden. Der antwortete nichts, sondern kramte in einer geöffneten Kiste umher, aus der er bald dies, bald jenes Kleidungsstück herausnahm und in den rechts neben dem Eingang stehenden Schrank hängte. Nach einer Weile, als sei er eben jetzt von meinen Worten getroffen worden, hielt er inne, starrte einen Augenblick in den geöffneten Schrank, schloß mit sinnend zähen Bewegungen ihn und die Kiste, kehrte sich um, ließ seinen Blick über das Stübchen gleiten, sah mich dann tief an, nickte schmerzlich mit dem Kopfe und sagte: "Ja, Herr Kastner..." Seine Stimme klang trauervoll, und mit einer Armbewegung, als werfe er etwas von sich, setzte er sich auf einen Stuhl, stützte seine Arme auf die Knie und legte die Hände flach gegeneinander, indem er genau Finger auf Finger paßte. Als ich ihn so sitzen sah, dem schweren Klang seiner Stimme in mir nachlauschte und im Überschauen die Unordnung gewahrte, in der sich das Stübchen befand, erblickte ich in mir nicht nur das schmerzensblasse Gesicht Fabers, wie es aus meinen unruhigen Nächten mich angesehen hatte, sondern mußte auch daran denken, wie sicher mein Ahnen gewesen sei, das mir vor kurzen Stunden den vor mir Sitzenden als einen Menschen gezeigt hatte, der, vom Trittbrette eines abfahrenden Zuges herab, noch einige Worte zu mir reden wollte. Eben hatte ich mir vorgenommen, das peinliche Schweigen durch die Erzählung meiner nächtlichen Heimsuchungen zu brechen, als Faber den Kopf hob und bitter zu mir heraufsprach: "Warum sagen Sie denn nicht, was Sie von mir eben denken?"
"Da haben Sie recht," erwiderte ich betroffen, "eben habe ich über Sie nachgedacht..."
Allein, noch ehe ich vollenden konnte, stand er auf, rückte geräuschvoll den schief in die Stube stehenden Tisch vor das einfache Sofa und unterbrach mich mit sarkastischem Lachen: "Nun, mein lieber Herr Kastner, warum schießen Sie denn da nicht los? Sie wissen doch, daß wir uns vor dem anderen nicht verbergen können."
"Trotzdem Sie es wissen," antwortete ich mit herzlicher Schonung des Aufgelösten, "unternehmen Sie es selbst, nicht bloß jetzt, sondern seit langem, einen Menschen zu täuschen, der den innigsten Anteil an Ihnen nimmt."
Er blickte mich betroffen an und lud mich dann ein, am Tisch Platz zu nehmen. Als wir saßen, ich trotz aller Widerspenstigkeit auf dem arg mitgenommenen Sofa, er auf einem Stuhle mir gegenüber, sagte er mit unsicherem Lächeln: "Wie wäre es nun aber, wenn Sie sich täuschten in der Annahme, daß ich es auf die Täuschung des anderen abgesehen habe?"
"Dann bleibt zweierlei übrig: entweder der Zweifel an jeder Erkenntnis auf Grund von Tatsachen, oder die Überzeugung, der andere sei unsicher in sich."
Die Folge dieser scharf zupackenden Antwort war ein lautes Gelächter Fabers, das er ausstieß, aufsprang und mit großen Schritten auf- und niederging. Dann nahm er langsam wieder seinen früheren Platz ein und, als müsse er irgend etwas Störendes am Bein seines Stuhles untersuchen, beugte er sich nieder und fragte: "Nicht wahr, weil ich vor fünf Wochen mich so unbegreiflich auf der Konferenz benommen habe?" Und weil ich nicht den Mut hatte, es ihm schonungslos ins Gesicht zu sagen, richtete er sich auf und wiederholte dringend dieselbe Frage: "Wie? So sagen Sie es nur gerade heraus!"
"Allerdings habe ich mir zum großen Teil wegen dieser Ihrer seltsamen Haltung die Meinung gebildet, Sie seien Ihrer nicht sicher. Denn wozu in aller Welt warfen Sie der engen, geknebelten Menge den Fehdehandschuh hin? Entweder Sie mußten frisch-fröhlich den Haufen niederrennen wollen, was doch wohl unmöglich ist aus vielen Gründen, die uns die Scham aufs Gesicht treiben müßte, oder Sie hätten am Ende des Vortrages in aller Kühle die Erklärung abgeben müssen, daß Sie die Entlassung aus dem Schuldienst erwarten, wenn man mit solchen Gedanken gegen den Geist des Amtes sündigt oder – – – Mein Gott, ich kann Ihnen sagen, daß ich in den Zeiten, da ich leidenschaftlich über dieses Ereignis nachgesonnen habe, noch eine ganze Menge von Möglichkeiten fand, die Ihrer würdig waren. Doch die Rebellion mit nachfolgender glatter Unterwerfung habe ich nicht anders erklären können, als daß Ihnen die Hand zum Schlage gejuckt hat, daß Sie aber vor den Folgen Ihrer geistigen Aufsässigkeit zurückschreckten."
Während ich das sprach, hatte Faber das Gesicht von mir abgewandt und sah zum Fenster hinaus, wo die Sonne hinter den Bergen einen inbrünstig roten Strom ihres verscheidenden Lichtes heraufsandte, der durch blasse Schleier gemildert wurde, die der aufstrebende Mond hineinhauchte. Sein Gesicht, das im Profil zu mir stand, hatte leidend scharfe Linien bekommen, und seine beiden Hände auf dem Tisch waren wie zu verzweifeltem Gebete geschlossen. Am ihm die Überzeugung zu nehmen, ich habe mich durch Rücksichtslosigkeit für die von ihm erfahrenen Kränkungen rächen wollen, erzählte ich alles, was ich um ihn gelitten hatte. "Nach allem, was geheim zwischen uns hin- und hergegangen ist." damit vollendete ich meine Erzählung, "und was, wie ich immer deutlicher sehe, der Wahrheit unserer Gefühle entspricht, konnte ich nicht anders als ehrlich, ohne Rückhalt zu Ihnen sprechen, um Ihnen und mir zu dienen, und nun bitte ich, geben Sie die Verschlossenheit auf, die, wie ich ahne, zu lange gleich finsteren Wänden um Sie gestanden hat. Denn aus der Luft, die um Sie hängt und beklemmend Ihr ganzes Haus erfüllt, ersehe ich ..."
Faber ließ mich nicht ausreden, er kehrte mir sein erschüttertes Gesicht zu, erfaßte meine Hände und sagte mit leise vibrierender Stimme nichts als die beiden Worte: "Du! ... Bruder!"
Damit war auch äußerlich ein Band geschlossen, das lange unsere beiden Seelen auf geheimnisvolle Weise vereinigt hatte. Nachdem wir eine kurze Weile in dieser Stellung verharrt hatten, löste Faber nach einem vollen Druck seine Hände aus den meinigen und trat in einer Art ans Fenster, die mich aufforderte, ihm dahin zu folgen. Es war das linke der beiden Fenster, an das wir traten. Von dessen oberer Hälfte streckte ein Lärchenbaum, der die Ecke des Hauses schützte, seinen untersten Ast schräg vorüber. Ein Fink ging eben mit behutsamem Trippelschritt tiefer in das Geäst hinein. Wir beide sahen den zierlichen Bewegungen des Tierchens zu, das mit ängstlich starren Punktaugen nach uns blickte, und rührten uns nicht, um es nicht zu verjagen.
"Es sucht sein Nest auf", sagte Faber mit versonnentrauriger Stimme. "Es weiß, wo es ruhen soll, und wenn es dann am Morgen aufwacht, ist ihm sein Lied gewiß." Mit einem tiefen Atemzug schloß er die Betrachtung.
"Wenn er in der Nacht nicht einer Katze zum Opfer gefallen ist", setzte ich hinzu, um ihn aus seiner, wie ich glaubte, sentimentalen Anwandlung zu reißen.
"Wenn auch, so bleibt ihm doch die Qual erspart. Da es den Tod nicht kennt, leidet es nicht an seinem Leben", antwortete er.
"Oder umgekehrt", erwiderte ich.
"Mag sein. Trotzdem ist es seines Lebens sicher, solange es lebt", sagte er finster nach einigem Sinnen.
"Und warum sollten wir Menschen es nicht sein?"
"Weil wir unseres Wesens nicht sicher sind, unserer Notwendigkeit, unserer Absichten; weil unser Ich ein so vielfältig gesponnenes Seil ist, daß, wer es entwirren will, in seiner tiefsten Seele schwindelnd, davon ablassen muß, weil jeder neue Gedanke über die alten stolpert, sich in ihren Netzen verfängt und so im Kreise gewirbelt wird, dem er entrinnen wollte. – ›Ich‹, mein lieber Kastner, ›Ich!‹ Wenn die Rechte die Linke faßt, haben wir das ›Ich‹. So kommt man nicht von der Stelle und sieht doch in qualvoll klaren Augenblicken das Land, wohin man wandern soll."
Er schloß mit schwebender Stimme, nicht als ob er am Ende sei, sondern als ob er sich nur unterbreche, und tat einen unauffällig sichernden Seitenblick nach mir hin. Ich hütete mich wohl, ihn durch irgendeine Frage in seinem harten Stolz zurückzuschrecken, denn nach all dem, was ich aus seiner Umgebung und aus seinen vieldeutigen Äußerungen entnehmen mußte, handelte es sich nicht um die Folgen seines Konferenzvortrages, also um einen vorübergehenden Verdruß, sondern hier riß eine Seele an ihrem Grundreis. So harrte ich schonend. Aber ich harrte vergebens. Mein neuer Freund schwieg, und als ich nach ihm hinsah, bemerkte ich, daß er sein vergrämtes Gesicht gegen die Fensterscheiben gepreßt hielt und mit weiten, unbeweglichen Augen in den sinkenden Abend starrte. Als ich dieses Antlitz mit weichem Schmerz so den Schatten hingegeben sah, die unhörbar aus dem Himmel sanken, stieg plötzlich das Bild des keck-trotzigen Mannes vor mir auf, der mich einst am Bach in Wecknitz von sich getrieben hatte. Und ich weiß heute noch nicht, wo ich die Brutalität hernahm, ihn aus gnädigem Versinken zu reißen. Aus bloßen Vermutungen heraus, aber sicher, als wüßte ich alles, fragte ich: "So wollen Sie, willst du, in diesem Zweifel verwesen?" Er antwortete nicht. – Deswegen sprach ich weiter: "Dich auflösen, an deinem schwächlichen Erkennen verkommen – aber Faber, so rede doch! Nicht wahr, man hat dich aus dem Amte gejagt? Denn alles in deinem Hause sieht wie Flucht aus." Da reckte er sich endlich langsam auf, sah mich mit einem schwachen Lächeln an und sagte mit leiser, versagender Stimme: "Man hat mich nicht fortgejagt. Leider. Aber was du von der Flucht gemerkt hast, das ist wahr – und nicht wahr. Ja und nein. – Die Regierung hat mir eine Rüge zugeschickt, und ich habe sie unterschrieben. Ich habe mir den Strick um den Hals gelegt, und nun kann ich nicht erwürgen. Verstehst du, und diese Sünde gegen mich habe ich aus Tugend begangen. Alles in mir und um mich ist verwirrt: Haß und Liebe, Furcht und Sehnsucht ..."
Nachdem er den vorletzten Satz ins sinkende Grau der Luft gesandt hatte, wieder, als breche er ein monotones Lied ab, fügte er das andere murmelnd hinzu und sah mit auf die Brust geneigtem Haupte weiten Auges die Diele hin.