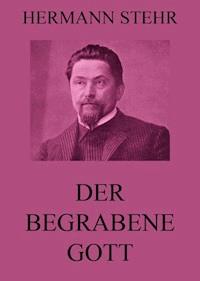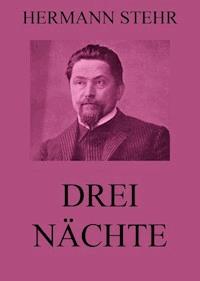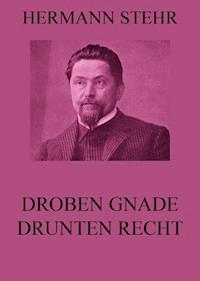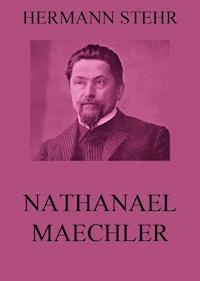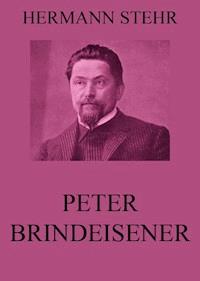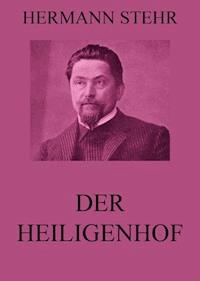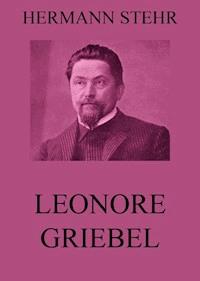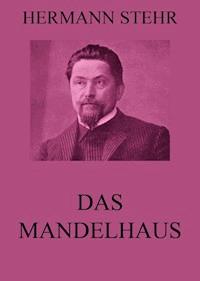
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Heimatroman über den schlesischen Schneider Eusebius Mandel.
Das E-Book Das Mandelhaus wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Mandelhaus
Hermann Stehr
Inhalt:
Hermann Stehr – Biografie und Bibliografie
Das Mandelhaus
Erster Teil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Zweiter Teil
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Das Mandelhaus, Hermann Stehr
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849636654
www.jazzybee-verlag.de
Hermann Stehr – Biografie und Bibliografie
Deutscher Schriftsteller, geboren am 16. Februar 1864 in Habelschwerdt, verstorben am 11. September 1940 in Oberschreiberhau im Riesengebirge. Sohn eines Sattlers. Arbeitete von 1887, nach Ablegen der zweiten Lehrerprüfung, bis 1911 als Volksschullehrer. Begann schon 1893 mit der Veröffentlichung erster Gedichte, fünf Jahre später folgte die erste Prosa. In der Frühzeit der Weimarer Republik unterstützt er Walter Rathenau als Redner. Ab 1911 arbeitete S. ausschließlich Schriftsteller, 1926 war er Gründungsmitglied der Preußischen Akademie der Künste.
Wichtige Werke:
Auf Leben und Tod. Zwei Erzählungen. Berlin, S. Fischer, 1898Der Schindelmacher. Novelle. Berlin, Fischer, 1899Leonore Griebel. Roman. Berlin, Fischer, 1900Das letzte Kind. Novelle. Berlin, Fischer 1903Meta Konegen. Drama in fünf Akten. Berlin, Fischer, 1904Der begrabene Gott. Roman. Berlin, Fischer, 1905Drei Nächte. Roman. Berlin, Fischer, 1909Geschichten aus dem Mandelhause. Berlin, Fischer, 1913Das Abendrot. Novellen. Berlin, Fischer, 1916Der Heiligenhof. 2 Bände. Berlin, Fischer, 1918Lebensbuch. Gedichte aus zwei Jahrzehnten. Berlin, Fischer, 1920Die Krähen. Novellen. Berlin, Fischer 1921Wendelin Heinelt. Ein Märchen. Trier, Friedrich Lintz Verlag 1923Der Schatten. Novelle. Chemnitz, Gesellschaft der Bücherfreunde 1924Peter Brindeisener. Roman. Trier, Friedr. Lintz Verlag, 1924Der Geigenmacher. Eine Geschichte. Berlin, Horen-Verlag 1926Nathanael Maechler. Roman. Berlin-Grunewald, Horen-Verlag 1929Das Haus zu den Wasserjungfern. Leipzig, Paul List Verlag 1929Das Märchen vom deutschen Herzen. Drei Geschichten. Leipzig, Paul List Verlag 1929Mythen und Mähren. Leipzig, Paul List Verlag 1929Meister Cajetan. Berlin, Horen-Verlag 1931Über äußeres und inneres Leben. Leipzig und Berlin, Horen-Verlag 1931An der Tür des Jenseits. Zwei Novellen. München, Albert Langen/Georg Müller 1932Die Nachkommen. Leipzig, Paul List Verlag, 1933Gudnatz. Leipzig, Insel-Bücherei, Insel-Verlag 1934Das Stundenglas. Reden/Schriften/Tagebücher. Leipzig, Paul List Verlag 1936Der Mittelgarten. Ausgewählte frühe und neue Gedichte. Leipzig, Paul List Verlag 1936Der Himmelsschlüssel. Eine Geschichte zwischen Himmel und Erde Lpz., Paul List 1939Von Mensch und Gott. Worte des Dichters. Ausgewählt von Emil Freitag, Paul List, Leipzig 1939Droben Gnade drunten Recht Das Geschlecht der Maechler. Roman einer Deutschen Familie. Leipzig, List 1944Das Mandelhaus
Erster Teil
1
Alle Frauen wachsen und vergehen an der Stelle, der sie entsprossen, gleich Blumen, und würden sie von ihrem Sterne auch durch die halbe Welt geführt.
Die Männer aber werden von der Unruhe immer über die ganze Erde gejagt und fänden ihre Füße auch wenig weiter, als der Schatten des Kirchturmes ins Feld reicht. Dieser Strom der Unrast gleicht einem Winde, der ihre Seele fortwährend in Atem hält. Bald ist er bunt, bald heiß, bald trocken, je nach dem Lebensalter.
Eusebius Mandel, der Schneider von Oberröhrsdorf, war schon in den rauhen, steifen Wind gekommen. Wenn der die Menschenmänner anweht, so stehen sie mit ihrem Leben schon hinter Mariä Geburt.
Die meisten Schwalben sind fort, hie und da auf den Stoppeln nesteln schon Spinnenfäden, und sie müssen einen krummen Rücken machen, um vorwärts zu kommen. So stand es um den Röhrsdorfer Schneider. Der Weg, den er ging, schwirrte schon manchmal vor seinen Blicken wie eine gespannte Schnur, die jemand anreißt, und er mußte seine Augen einkneifen, damit er nicht rechts oder links abkam, irgendwohin, wo er nichts zu suchen hatte. Dies genaue Hinlugen hatte schon allerhand Gekritzel auf seine Schläfe geschrieben, und über den Ohren bauschten sich seine Haare weiß.
Manchmal stand er auf der Lehne hinter seinem Hause und betrachtete die Welt: die Bauern, die über das Feld pflügten; die Holzfuhrleute neben ihren hohen Rädern oder den Bäcker, der in seinem Planwägelchen vorbeischnurrte. Und wenn er so eine Weile hinuntergesehen hatte, nahm er sein Taschentuch heraus, breitete es aus, als wolle er etwas hineinpacken, faltete es aber wieder zusammen und schob es in den Rock. Denn man mochte die Gedanken so oder so wenden, Eusebius Mandel konnte es nicht leugnen, die andern kamen leichter und fröhlicher vorwärts als er.
Und da er eine wieselflinke Seele besaß, blieb ihm auch nicht verborgen, warum das so war. Sie hatten Kinder. Das ist für Menschen aber nicht anders, als wüchsen zwischen den staubgrauen Steinen ihres Weges süße Schwingel des Grases, und als bräche aus schwerem Herbstgewölk unvermutet und unbegreiflich der Frühling herein, und der steife Wind des Alters hat keinen rechten Fug an solche Männer.
Und Eusebius Mandel blühte allemal in einer großen Sehnsucht auf, wenn er von der Lehne hinuntergesehen hatte über das Leben. Der ganze Schneider war dann wie ein straffgezogener Faden und auch wie eine Nadel, die zum Stich ausholt. Aber ehe er nach Hause kam, verlor sich immer die tüchtige Aufrichtung in ihm, und mit dem Kinde war es wieder nichts, nicht einmal mit einem Mädchen, die der Herrgott doch bloß so aus seinen Kleidern schüttelt.
Allein Eusebius hätte nicht Mandel heißen müssen, der mehr gesehen hatte, als hundert Augen aushalten und fünfzehn Hände zu greifen imstande sind, wenn er auf seiner Hoffnung eingeschlafen wäre. Einmal blieb er doch im richtigen Zuge, und drei Tage darauf sah sein Weib, die Agathe, ihn an, errötete und sagte: »Eusebius, ich dächte, dasmal hat's mit dem Windelband seine Richtigkeit.«
Dabei blieb's denn auch; und weil lange Erwartungen keinen anderen Sinn haben als den, die Erfüllung zu bereichern, wenn man's recht bedenkt, so lag es durchaus im Zuschnitt, wie der Eusebius sagte, daß das Kleine, das Agathe gebar, ein Knäblein war. Nicht nur das. Des kleinen Mandels Geburtstag fiel sogar auf einen Sonntag nahe dem Mittsommer. Das nahm sein Vater, der nebenbei sogar noch Christoph hieß, als ein gutes Zeichen, und weil die Hebamme im Kalender nachgesehen und gefunden hatte, daß die Stunde der Erscheinung des Jungen, es war die erste nach Mitternacht, schon in den gesegneten Einfluß der Zwillinge falle, war der Vater doppelt froh.
Kaum, daß der kleine Mandel im zittrigen Lichtkreis der Talgkerze betrachtet worden war, machte die kluge Frau zwei große Kreuze über seine Augen, seinen Kopf, seine Hände und seinen Schoß, damit er wahrhaftig alles Begehrenswerte doppelt haben sollte. Christoph nickte zu allem. Nur als die Hebamme das Kreuz über dem Schoß erklärte, hustete er in die Hand und ging aus der Stube.
Am Morgen, nach kurzem Schlaf, war er dieser Bedenken Herr geworden und schritt getrosten Mutes um sein Häuschen. Immer nach vier Schritten sagte er zu sich: »Doppelte Ehre«, oder »doppelt Geld«, oder »doppelt Klugheit«. Nur wenn er sagen sollte: »doppelt so viel Kinder«, stand er still und sah durch den großen Ahorn in den Himmel und dachte: der droben wird's schon wissen, was sich gehört. So baute Christoph Eusebius Mandel für seinen Sohn Luftschlösser bis in die Wolken.
Des Nachmittags ging die Haschmutter fort. Mandel setzte sich an das Bett seines Weibes und erzählte ihr von dem großen Glück, das ihrem Sohn beschieden sein werde, weil er in den Zwillingen zur Welt gekommen.
Allein seine Frau schüttelte nur schwach den Kopf, denn reden konnte sie noch nicht recht, und was sie zu sagen hatte, war zu viel. In desto größere Erregung geriet aber ihr Mann, weil er meinte, sie hätte lieber ein Mädchen gehabt und gönne ihm den Knaben nicht. Zum Schluß schwor er, ihn Amadeus zu heißen und nicht davon abzugehen, sollte der Pfarrer auch Himmel und Hölle dawider in Bewegung setzen.
Je tiefer aber Mandel in die Wolle geriet, desto blasser wurde seine Agathe. Deswegen biß er plötzlich den glühenden Faden mit den Zähnen durch und begnügte sich damit, in der Stube auf und ab zu gehen und immer beim vierten Schritte mit dem Absatz stärker aufzutreten, wobei er sich das Seinige dachte. So behielt er sein Recht, und Agathe bekam ihre Ruhe.
Sie wandte ihr blutleeres Gesicht gegen die Mauer und weinte still für sich hin, weil sie glaubte, was man vorher über alle Maßen beschreie, das könne nicht gedeihen. Dann tastete sie mit der Hand neben sich und rückte den Kleinen näher zu sich heran, um es ihm abzubitten, wenn ihn Gott doch zu etwas Großem bestimmt hätte.
Gegen Abend kam eine unbegreifliche Angst über sie. Aber sie schluckte den Kummer in sich hinein, bis es gegen Mitternacht nicht mehr auszuhalten war. Da rief sie schwach den Namen ihres Mannes. Der kletterte beim dritten Ruf aus dem Bett, zündete das Licht an und kam herzu.
»Christoph«, sagte sie, »bin ich nicht vierzig Jahre?«
»Ja.«
»Haben wir nicht lange auf ein Kind gewartet?«
»Und nun haben wir's.«
»Warum soll unsers Jungen Leben schon am ersten Tage verschlungen und verknüpft werden?«
Christoph war schon wieder seinen Freudenrausch los und gab seiner Frau in allem recht. Er bat sie, sich nicht aufzuregen, deckte sie sorgsam zu, löschte das Licht aus und tappte wieder auf sein Lager.
Die Wöchnerin war aber so schwach, daß sie von dem Gedanken nicht loskommen konnte, ihres Mannes Übermut habe Unglück über das Kind gebracht. Die Furcht überwältigte sie, bis der Angstschweiß aus den Poren ihres Leibes brach. Den Mund konnte sie nicht öffnen; denn es war, als habe jemand eine große Hand darauf gepreßt.
In der Morgendämmerung sah sie drei Frauen in grauen Gewändern. Die wurden vom Winde hin und her getrieben, so daß sie immer am Fenster vorbeiglitten. Der Spuk wollte nicht aufhören. Deswegen faßte sie all ihre Kraft zusammen und kehrte sich gegen die Wand, um die Unholden nicht mit ihrem Blick in die Stube zu saugen. Sie versuchte zu beten. Allein die Worte wurden wie ein Feuerwirbel, der vor ihren geschlossenen Augen kreiste. Nach vielem vergeblichen Bemühen wandte sie sich wieder der Stube zu, um sich zu vergewissern, ob die Grauen vertrieben wären. Aber eben sah sie die letzte in die Stube wehen und sich zu den beiden andern an ihr Bett stellen. Da lag die Wöchnerin still und fühlte heiße Luft über sich streichen. Die grub sich immer tiefer in sie hinein. Als sie bis an ihr Herz gekommen war, löste sich das Blut aus den Kammern und rann aus ihr heraus.
Nicht lange danach erwachte Christoph und trat an ihr Lager heran, um von den schönen Träumen zu sprechen, die gegen Morgen vor seinem Bette gespielt hatten. Sein Weib aber konnte keine Antwort geben, und der Blick ihrer großen, blauen Augen war starr dorthin gerichtet, von wo ihn keine Liebe und keines Menschen Gewalt mehr abwendet.
Er sah, daß sie gestorben sei. Allein so leicht vermag sich kein Mensch mit dem grausen Wunder, das der Tod ist, abzufinden, und indes dem armen Christoph Tränen aus den Augen und Gebetsworte von den Lippen flossen, griff er mit seiner Hand und suchte, ob nicht am Herzen, dieser tiefsten Feuergrube des Lebens, noch ein armes Fünklein brenne, das, mit Hingebung gepflegt, sich wiederaufrichten könne. Allein auch dort hatte sich der Tod eingenistet, und die gefüllte Brust lag wie ein harter, kalter Stein darauf. Da dachte Mandel mit Schrecken daran, was nun aus seinem kleinen Amadeus werden solle.
Er sprang auf und lief, wie er war, einen Hosenträger über die Achsel gelegt, den andern noch hinten herabhängend, die Straße hinunter, die Hebamme zu holen. Der Hosenträger, auf den sein Weib mit roter Wolle ein brennendes Herz gestickt hatte, schlug immer an die Beine, während er lief. Immer, wenn er so in Gefahr kam, zu fallen, sprang er, und jedesmal, wenn es ihn zu Boden rucken wollte, sagte er: »Fall zu, Schneider, und stirb!«
Aber jedesmal dachte er doch an seinen kleinen Amadeus und sein kaltes Weib, das vielleicht doch noch nicht tot sei, und nahm seine Verwünschung zurück. Auf diese Weise dauerte es nicht lange, da war er bei der Wehmutter. Die stand vor ihrer Tür im Grase und schlug mit einem Haselstecken den Staub aus ihrem Sonntagsrock, der am untersten Ast eines Pflaumenbaumes hing. Als sie von Christoph Eusebius gehört hatte, was auf dem Spiele stehe, legte sie den Haselstecken quer in den Baum, duckte sich, ließ den Rock von obenher über sich gleiten und band ihn auf dem Wege fest. Während sie eilig vorwärts kamen, fragte sie den Schneider dies und das, wie das Unglück so schnell gekommen sei und manches andere. Der aber stierte vor sich nieder und zählte vor Gram die Steine des Weges. Wenn sie ihn anstieß, wandte er ihr sein eingefallenes Gesicht zu und lächelte qualvoll. Da schwieg sie zuletzt, bis sie an das Schneiderhaus kamen, dessen Tür weit aufstand. Unter dem schmalen Bretterbänklein lagen ein Bündel und ein Stock. Die Wehmutter wollte wissen, wer denn Mandel das Haus gehütet hatte, indessen er fort war. Christoph antwortete aber nichts, denn er dachte, es sei die Bürde und der Stock des Todes, der rastlos über die Erde wandert, und wenn sie zu der Toten kämen, würden sie ihn schon neben dem Stuhl am Bett sehen, in der Haltung eines Menschen, der ein Werk beendet hat und zwischen Gehen und Stehen das Vollbrachte noch einmal mit ernüchtertem Auge überschaut.
Sie gelangten in die Stube, die still war vom stockenden Atem der Toten und doch auch friedvoll im Morgenlicht, das durch die Krone des Ahorns einen grünen Schimmer hereinwarf. Und wirklich, da Christoph, der hinter der Hebamme die Tür eingedrückt hatte, sich umwandte, sah er, wie eine dunkle Gestalt vom Bette der Toten sich lautlos in die Tiefe des Zimmers zurückzog und dort sich niederkauerte, indem sie ihr geneigtes Haupt noch mehr neigte. Christoph war in einer solch verzweifelten Stimmung, daß ihn auch diese schreckhafte Bestätigung seines Einfalles wenig berührte, und trat mit der Hebamme ans Bett der Entschlafenen. Da erkannte er nun freilich an ihren blauen Lippen, daß nichts mehr zu hoffen sei.
»Ist sie an ihrer Seele, das heißt aus dem Zentrum Punktum, gestorben oder an ihrem Leibe?« fragte er so leise, daß er kaum zu vernehmen war, denn er machte sich Vorwürfe, sein Weib durch seine hartnäckigen, lauten Hoffnungen in den Tod getrieben zu haben.
Die Wehmutter aber ergriff mit ihrer fetten, warmen Rechten seine magere, kühle Schneiderhand und antwortete: »Es Herzblut is fort. Wer doas wegstisst, doas weeß ich nich, doas weeß der Herrgott alleene.«
Damit griff sie hinüber, drückte der Toten die Augen zu und wünschte eine glückliche Reise in den Himmel und gute Aufnahme beim Vater.
Das alles ergriff den Schneider Mandel so sehr, daß er den Tod in der Stubenecke, seinen kleinen Amadeus und alles auf der Welt vergaß. Er sank am Bette nieder und weinte in die starre Hand seines Weibes hinein, die so viele Jahre alles Kummervolle und Liebe mit ihm getragen hatte. Das dauerte gar lange, denn je kleiner und ärmer ein Mensch ist, desto größer ist sein Schmerz. Der Druck einer Hand auf seiner Achsel riß ihn aus den Kreisen der Not. Er erschrak einen Augenblick bis in den Haarwirbel hinauf, denn er dachte, der Tod habe auch ihn berührt und wolle ihn mitnehmen. Als er wagte, sich umzudrehen, war die Gestalt, die er für den Tod gehalten hatte, aus der Ecke verschwunden, und ein volles, frisches Weib stand neben der Hebamme, machte ein schmerzlich-freundliches Gesicht und wiegte das kleine Bündel, seinen Amadeus, mütterlich auf den Armen. Da wickelte sich sein Blick vollends aus den Verschlingungen, und er erkannte in dem jugendlichen Weibe die taubstumme Maruschka aus Böhmen, die immer nach Wochen einen Streifzug ins Preußische unternahm, weil man drüben nicht so für die Armen sorgt. Jedesmal, wenn sie mit voller Bürde wieder der Heimat zuwanderte, war sie eine Nacht unter des Schneiders kleinem Dache geblieben. Nun fand sie ihre gute Gastgeberin bei den Toten. Die Seele der Menschen ist nicht preußisch und nicht böhmisch; in ihren besten Stunden redet sie göttlich, die Sprache aller Menschen.
Obwohl also in der armen Maruschka Ohr nichts hineinging und aus ihrem Munde nichts herauskam, verstand sie der Schneider doch gar leicht: wenn es der König von Preußen erlaube und der Schneider Mandel nichts dawider habe, wolle sie bei ihm bleiben, bis er eine bessere Pflegerin gefunden habe, sich des kleinen Kindes annehmen und seinem Hause vorstehen samt dem Garten und den zwei weißen Ziegen.
Am dritten Tage in der Frühe riefen die Glocken des Pfarrdorfes Neudeck über die Wipfelbreiten des Hainwaldes herüber ins Schneiderhaus, und der Gottesacker verlangte nach der Toten. Das Sterbelied der Kinder schwoll und versank in die blaue Luft hinauf. Der Bretterwagen mit dem schwarzen Sarge in grünen Tannenzweigen fuhr von dannen. Das einzige Mal reiste die Schneidersfrau zu Wagen in die Kirche, und diesmal kehrte sie nimmer wieder.
Der Ahornbaum bewegte die Äste, und ein Rieseln ging durch seine Krone.
Der kleine Amadeus lag wach in seinen Kissen, und es war, als lausche er dem Klang in den Lüften.
2
Als Christoph am siebenten Sonntage wieder verstohlen den Strauß frischer Blumen auf seines Weibes Grab gedrückt hatte, haderte er nicht mehr so bitter mit dem Geschick, das sie ihm entrückt hatte, und begann, sie demütig dem Herrn zu gönnen.
Bis jetzt hatte er den braun und schwarz gestreiften halbwollenen Rock und die blaugeblümte Jacke, die Agathe am letzten Sonntage ihres Lebens getragen, an dem Wandrechen neben ihrem Bette hängen lassen, um die tröstende Täuschung nicht zu entbehren, sein liebes Weib könne jeden Augenblick über die Schwelle treten und wirtschaftend durchs Haus gehen wie sonst, als sei der Tod nichts als ein langer Kirchgang gewesen. Nun legte er die Sachen in eine Kiste, deckte Zeitungspapier darauf wegen der Motten, nagelte den Deckel mit langen Schindnägeln fest und stellte die Kiste auf den Boden in einen Winkel.
Diese Aussöhnung mit dem Schmerze verwischte langsam das Totengesicht, mit dem ihn die Gestorbene aus seiner Seele herauf ansah, und mehr und mehr erblickte er sie in allem, worauf beider Augen im Leben geruht hatten. Sie schaute mit dem Licht, das hinter den Bergen hervorging, in seine Stube; das Wässerlein unter der Weide hatte ihre Stimme; die Blumen blickten ihn mit ihren Augen an. Sie summte im Rauschen des Ahornbaumes in seine Träume.
Sein Zwirn fand wie in den guten Tagen wieder von selbst das Öhr. Die Nadel hüpfte regsam auf und ab, und beschlich ihn ja einmal das Leid, so durchlöcherte er es kreuz und quer und schnürte ihm mit dem Faden den Dampf ab. War er solch schwerer Heimsuchungen ledig, dann spann er an den Hoffnungen weiter, die so jäh abgerissen worden. Denn der Pfarrer hatte seinem Knaben den schönen, reichen Namen Amadeus nicht abgestritten, sondern nur gütig dazu gelächelt. Das war doch so, als sei dem Kinde nun die Tür sperrangelweit aufgetan in die weite, reiche Welt, und wenn es groß geworden war, durfte es nur hingehen und mit seinen zwei gesunden Armen raffen nach Herzenslust. Manchmal ward er ganz verzückt über das Glück, das seinem Amadeus einmal beschieden sein könnte. Er warf die Arbeit in den Schneidertisch, nahm den Kleinen in die Arme, zeigte ihm die Sonne, die Blumen, den Himmel und sagte, dort oben sei seine Mutter.
So teilte sich Christoph Eusebius' Leben zwischen seiner Arbeit und seinem Kinde. Am liebsten aber war er bei ihm und vergaß, daß es ein Gasthaus gäbe, darin zu sitzen, und Männer, mit denen man plaudern könne zu seinem Vergnügen. Trug Maruschka den Knaben im Garten vor seinen Fenstern, so hatte er auch teil an ihrer Freude. Da der armen Ziehmutter Mund verschlossen war, wurde der kleine Amadeus nicht so zeitig eingefangen von dem Menschenworte und blühte und sog sich tief hinein in die tausend Lieder, die sich Gott selber vorspielt mit den Bäumen, den Vögeln, dem Wasser und dem Wind. Bald war es möglich, ihn auf den Ziegen reiten zu lassen, indem man seine Achseln unterstützte. Aus dem Kleidchen sprang er ins erste Höschen. Da war er ein richtiger Junge, trieb sich mit einem Stecken im Garten umher und blies auf den hohlen Stielen der Maiblume.
Viel Zeit, und das blieb die schönste seines Lebens, zum Glück und auch zum Kummer, saß der kleine Amadeus neben seinem Vater im Schneidertisch. Wenn ihn der hereinhob, drückte er allemal einen Kuß auf seinen blonden Scheitel, und seine Blicke lugten dann wohl eine Weile bewegt durch den Spalt des Jetzigen auf das, was gewesen war. Allein lange tauchte Eusebius nicht in die Schatten. Denn so ein Schneider bekommt überhaupt in seine Seele etwas von der Nadel, die er handhabt, so etwas scharf Entschlossenes, das wohl freilich bei manchen in komische Eitelkeit umschlägt. Und wie das spitze, glänzende Eisenlänzlein eilig und sicher aus wirren Haufen von Flecken ein gemessen ordentlich Kleid zusammenheftet, gelingt es vor allem dem Schneider, die bunten Zufälle seines Lebens zu einer wohlgeordneten Welt zu verwerten und um sich auszubreiten. Dem Christoph Eusebius glückte das noch besser, und das gerade darum, weil er eigentlich, mit Respekt zu sagen, nur Flickschneider war. Denn aus diesem Grunde brachte er sein Sinnen niemals ganz in seinem Werke unter. Mit dem Besten seiner Seele, während er mit überschlagenen Beinen bastelte, wandte und drehte er an seinem Leben herum, bis eine ganz außerordentliche Weltfahrt daraus geworden war, die ihm wohl gestattete, sich ihrer zu freuen.
Da erzählte er denn manchmal dem Amadeus davon. Am besten aufgelegt war er, wenn er auf seinen Hildesheimer Ritt zu sprechen kam. Dieser bildete überhaupt den Glanzpunkt seines Lebens.
Also sagte er:
In Berlin ist die Hauptstadt der Welt. Da gibt es so viele Menschen, daß sie auf der Gotteserde nicht Platz haben, und deswegen reisen wohl tausend fortwährend über die Dächer; andere fahren zum puren Vergnügen in tiefe Löcher hinein und kommen wohlbehalten auf der andern Seite wieder heraus. Dort wohnt auch der Kaiser, wenn er zu Hause bei seiner Kaiserin ist. Mehrenteils aber kutschiert er umher und hält die Welt imstande. Also sah ich ihn nicht, und weil sie damals die Hosen in Berlin gar so weit machten, gefiel mir's nicht lange, und ich schnürte meinen Ranzen, um mir Frankreich anzusehen. Ging und ging. Endlich steht wieder eine solche Stadt vor mir, und die Glocken läuten so laut von den Türmen, daß man meinen konnte, alle Leute hingen an den Stricken und zögen aus Leibeskräften. Wie ich ein Weib frage, das so eilig läuft, als mache sie sich vor dem Lärm aus dem Staube, wie die gute Stadt mit dem starken Geläut heiße, so sagt sie: Hildesheim und rennt weiter. Aha, denk' ich: Hildesheim, ein feiner Name! und gehe hinein und frage nach Arbeit. Bekam sie auch in einem schönen Hause bei einem Meister, der einen Bart wie Napoleon hatte. Das aber ging mir im ersten Augenblick wider den Strich; denn denen der Bart quer wie eine Säge und lang wie ein Stemmeisen steht, die sind allemal auf des Teufels Seite gewachsen. War auch so. Denn kaum hatte ich mich hingesetzt, so zerbrachen mir drei Nadeln. Auf diese Art bekam ich gleich wieder Feierabend, denn Napoleon meinte, zum Nadelzerbrechen brauche er keinen Gesellen, dazu seien die Lehrjungen da. Des war ich ganz zufrieden. Bei einem Schneider, der nicht genug Nadeln im Schube hat, steht der Gerichtsvollzieher schon hinter der Tür. Das halte aus, wer wolle, sagte ich und befand mich in einem Augenblicke auf der Straße. Da hatte ich, was ich haben wollte; auch fand ich nicht lange danach die Straße, die nach Paris führt. Wie ich so geh' und die Steine zähle, die am Graben hin stehen, und denke, wieviel tausend wohl an mir vorbeirennen müssen, ehe ich die ersten roten Hosen sehen werde, macht's hinter mir: Trapp, trapp und wieder trapp, trapp. Ich drehe mich um. Da kommt ein lediges Pferd daher. Kein Mensch weit und breit zu sehen, und die Zugblätter schleift es auf der Straße. Ich lasse es ein wenig an mir vorbei, laufe ihm dann nach und ergreife ein Zugblatt. Da meint das Pferd, der Wagen sei hinter ihm, und bleibt stehen. Es war ein Brauner und so gut gefüttert, daß ihm die Taler auf den Backen standen. Nun ich es klatschte, sieht es mich an und blinzt mit den Augen, als kenne es mich schon lange. Darum binde ich die Zugblätter herauf, führe es an einen Stein und schwinge mich auf den Rücken. Im nächsten Dorfe fragst du nach, wem es gehört, denke ich. Denn ich wußte wohl, daß der Herrgott keinem Handwerksburschen so mir nichts dir nichts einen spiegelblanken Braunen schenkt. Gehörte es niemandem, so wollte ich nach Frankreich reiten wie Blücher. Indessen lass' ich mein Roß den Stecken kosten. Da wirft es die Erde unter sich fort wie einen Pfefferkuchen, und die Bäume neben mir ducken sich förmlich, wenn ich vorbeisause. Das ging bis zum Abende, und ich fühlte weder Hunger noch Durst, denn wenn ich so rechts und links über das Feld sah, das sich langsam drehte wie ein bunter Mühlstein, war es mir nicht anders, als gehörte mir alles.
Endlich sah ich den ersten Stern über mein Mützenschild lugen. Häuser und Höfe hüpfen vor mir auf und nieder, und Leute stehen an den Türen und machen große Augen. Ich reiße mein Pferd an der Halfter, daß es Funken gibt, und ehe ich mich's versehe, komme ich herunter. Als alles wieder in Ordnung ist, frage ich christlich nach dem Eigentümer meines wackeren Reisegenossen. Nicht lange, so stand ein Mann vor mir wie aus Bohlen und Balken zusammengeschlagen und sah mir fest ins Gesicht. Als er bemerkte, ein wie guter, handfester Kerl ich sei, schmunzelte er und reichte mir unter vielem Dank seine fette, große Hand und sagte, das Bräunlein gehöre ihm. In meiner Hand aber ließ er einen harten, blanken Mansfeldischen Taler zurück. Ich war mit dem Handel zufrieden, denn ein ehrlicher Taler ist besser als ein gestohlenes Pferd.
»Bist du denn nach Frankreich gekommen?« fragte Amadeus, wenn Eusebius an dieser Stelle abbrach. Aber da sagte der Schneider weder ja noch nein, sondern fuhr fort: Das war ähnlich wie in Köln, oder das lief auf dasselbe hinaus, wie ich in eines Schlächters Hof gelaufen, der halbwegs gen Hamburg steht. So blieb es auch unentschieden, ob Christoph Eusebius je Hamburg gesehen hatte. Für den kleinen Amadeus aber wurde der Name gemach wie ein großes, leuchtendes Tor, hinter dem alle Wunder leben, und sein Vater, der bald dort gewesen wäre, erschien ihm merkwürdiger als alle Menschen. Der Schneider ging also über dies Faktum, das sein Söhnlein solchergestalt aufregte, in der strengen Sachlichkeit eines weitgereisten Mannes bald zu einem neuen Abenteuer über, und während dem Büblein die goldenen Berge Frankreichs noch vor den Augen lagen, merkte es wohl an seines Vaters Nadel, dieser sei in Gedanken schon wieder fortgereist. Denn je nachdem Christoph Eusebius von dem Dom zu Köln, von den Salzbergwerken zu Halle, dem weiten Meer oder einem Walde, der gar kein Ende nahm, erzählte, führte er seine Nadel so oder so. Alle seine Wanderschaften nähte er in die Kleider, die ihm die Leute brachten. Das schlug nun manchmal durchaus nicht zu seinem Vorteil aus. Denn wenn er einem Bauer hinten in die Hosen den großen, ebenen Platz vor dem Berliner Königlichen Schloß genäht hatte, so wollte der freilich die überstarke Rundung nicht zugeben, die einem rechten Bauern dort von selbst wächst. Und wenn der Landmann dennoch seinen Willen durchsetzte und, die Beine spreizend, in die Knie fiel, mußte der König von Preußen eben nachgeben und seinen schönen Platz in Fetzen gehen lassen. Nicht viel besser ging es mit andern Abenteuern aus, die der Mandel-Schneider in ander Leuts Sachen unterbrachte, und sein Ruf nahm eher ab als zu. Doch gab es immer noch genug Menschen, denen er zu Dank arbeitete. Seine Nadel spießte Pfennig auf Pfennig aus den Taschen der Kunden, erwarb Balken um Balken seines Hauses, brachte ihn recht und schlecht durchs Leben und gab ihm reichlich Gelegenheit, seines Söhnleins Seele mit bunten, seltsamen Geschichten und Träumen zu füllen.
3
Länger als andere Kinder lebte Amadeus in wunderbaren Gesichten. Aber auch bei ihm fügte sich aus Morgen und Abend der erste Tag, und er erwachte zum Leben der andern.
Wie immer saß er mit einem Töpfchen Milch und einer Schnitte Brot, seinem Frühstück, auf der Fußbank vor dem Stuhle und sah durchs Fenster. Alles bisher traumhaft Vertraute kam ihm rätselhaft vor.
Die Weide auf dem Wiesenplan, die er schon so oft gesehen hatte, stand krumm da, als blicke sie sich auf die Füße.
»Warum steht der Baum auf der Wiese?« fragte er seinen Vater.
»Weil sie ihn hingepflanzt haben.«
»Warum haben sie ihn hingepflanzt?«
»Wegen dem Schatten.«
»Was ist das: Schatten?«
»Das ist schwarz und kühl und liegt unter dem Baume.«
»Wem gehört der Schatten?«
»Dem Baum, Amadeus.«
Dann nahm der Kleine einen Bissen Brot und einen Schluck Milch. Er rückte herum und sah des Nachbars rotes Ziegeldach.
»Wem gehört das rote Dach?«
»Dem Bauer Schnallke.«
»Warum ist der kein Schneider?«
»Weil er Kühe und Pferde hat.«
»Warum wohnt er neben uns, und wir haben keine Kühe und Pferde?«
»Er gehört zum Dorfe, Junge.«
»Heißt das Dorf auch Schnallke?«
»Nein, es heißt Röhrsdorf, liegt im Kreise Mittelschwer und gehört zum Königreich Preußen.«
Nach einer Weile bückte sich Amadeus und schaute durch das kleine Fenster hinauf in den Himmel, um zu sehen, wie hoch das Königreich Preußen ginge.
»Wohnt dort der König von Preußen?«
Christoph Eusebius stieg aus dem Schneidertisch, bückte sich auch und blickte an dem Arm des Kleinen entlang.
»Nein, Amadeus, das ist kein Haus, das ist der Lange Busch.«
»Aber dahinter wohnt der König.«
»Nein, da wohnt deine Muhme, und wenn du groß bist und fleißig lernst, so gehen wir durch den Busch einmal zu ihr.«
Eusebius stieg wieder in den Schneidertisch und schmunzelte, daß Amadeus ein so geweckter Junge sei. Der Kleine vollendete gedankenvoll sein Frühstück. Dann sah er wieder aufmerksam und gründlich zu jedem Fenster hinaus. Zuletzt schüttelte er das Köpfchen und fragte beklommen:
»Gehört das Dorf Röhrsdorf uns?«
»Freilich, Amadeus«, antwortete der alte Mandel, »denn wir wohnen ja drin.«
Dieser Aufschluß vertrieb die Kümmernis von des Jungleins Gesicht, und aufgehellt verließ er die Stube.
Draußen stieg er, nicht allzu weit vom Hause, auf einen Haufen Lesesteine, um zu erforschen, wie groß seines Vaters Dorf sei. Jedesmal, wenn er ein Haus erblickte, sagte er: »Röhrsdorf«, und je mehr Dächer vor seinem erstaunten Auge auftauchten, desto froher wurde er, und zuletzt sang er den Namen seines Heimatortes, seines Vaters und flocht auch ein Lied vom Könige von Preußen ein. Das, was er sang, stürmte ganz unbändig, solange es in seiner Nähe war, sobald es aber immer tiefer in die helle Luft hineinflog, wurde es immer glänzender, ihm fremder. Und nichts war imstande, sein Lied zu hemmen. An den Grashalmen glitt es hin, daß sie zitterten, die Bäume berührte es, daß sie grüner wurden, und gar bis an die rote Sonne reichte es hinauf und schien dort oben aus dem Feuerrad an der blauen Decke tiefe, friedsame Laute loszulösen. Manchmal war es, als sänken diese Klänge gerade aus dem Himmel herab, dann wieder kam es ihm vor, als würden sie über den Hainwald hinübergetragen. Nun erkannte er deutlich, daß es die Glocken von Neudeck seien, und schwieg bestürzt, weil er meinte, seine Stimme habe sie ausgestoßen und sie müßten läuten, solange er singe. Wirklich verstummten sie nach einer Weile, und Amadeus dachte, wenn er der König von Preußen wäre, dann hätte sein Singen solche Gewalt, daß es die Kirchenglocken der ganzen Welt weckte. Auf der Straße drüben fuhr hin und wieder ein Wagen nach Berlin oder Hildesheim. Und Amadeus erkannte, wenn er ein König werden wolle, der die ganze Welt mit seiner Stimme beherrschte, müsse er erst eine Stadt haben. Darum stieg er von dem Steinhaufen herunter und errichtete aus großen Steinen einen Wall, hinter dem er Hildesheim erbaute. Hohe, schmale Steine waren die Türme; lange, plumpe Brocken bildeten die Häuser. Da waren auch kleine Häuschen, putzige Knötchen, daß Amadeus lachte, wie Leute so dumm sein könnten, darin zu wohnen. Als er auf dem Steige eine weggeworfene Streichholzschachtel fand, war ihm um Leute und Glocken nicht mehr bange. Er brach das Schüblein auseinander und hatte vier Leute: zwei große und zwei kleine. Der eine lange Span war die Frau, die aus der Stadt läuft, weil sie darin zu sehr mit den Glocken läuten.
Sie stand vornübergeneigt nahe beim Wall. Damit sie hinauskäme, nahm er einen Stein aus der Stadtmauer und hatte nun das schönste Tor. Die kleinen Spänchen, die Kinder des Weibes, die mit ihrer Mutter flüchten wollen, sind hingefallen und liegen jämmerlich vor der Stadt, auf deren längstem Turme die Glocke wackelt, die Hülse an dem queren Hölzchen. Amadeus gönnt ihr keine Ruhe. Immer stößt er sie mit dem Finger an und läutete mit seiner Stimme dazu, ob auch die Frau ganz verzweifelt ist und ihre armen Kinder auf der Nase liegen. Allein, nun soll doch sein Vater nach Hildesheim hereinkommen, und es ist noch keine Brücke über die alte Wasserfurche gebaut, damit er über den großen Fluß könne. Amadeus hält den reisigen Eusebius, den andern langen Span, in der Hand und weiß einen Augenblick nicht, wie da zu helfen sei. Wie er so über den Wiesenplan nach allen Seiten ausschaut und denkt: es muß doch wer aus Berlin oder Hamburg kommen, ruft es von des Schnallkebauers Schuppen her: »Schmiedla, hier!« und bald läuft hinter einem Spitzhündchen, das im Grase tanzt und komisch bald das eine, bald das andere lange Ohr umklappt, des Bauern kleiner Junge. Als der den Amadeus erblickt, schreit er noch viel lauter nach seinem Hunde. Der kleine Mandel, der neben Hildesheim steht und seinen Vater in die Steine gesteckt hat, wünscht sich, Schmiedla, der Spitz, möchte herkommen, damit er ihn streicheln könne. Aber er rührt sich nicht, und auch als der Hund bei ihm ist und an seinem Bein hinaufschnobert, greift er ihn aus einer unbehaglichen Empfindung nicht an, die ihm der Schnallkejunge einflößt. Das ist ein strunkiger, kleiner Mensch mit einer Knopfnase und einem verwegenen, gesunden Gesicht. Seine braunen Haare stehen durcheinander wie die Borsten eines zerstrichenen Butterpinsels, mit dem man die Kuchenbleche einfettet, und das eine Lederhöslein ist unten ohne Schnüre.
Als er herangekommen ist, ergreift er den Hund an den längeren Haaren des Halses und fragt:
»Bist du etwa der Schneiderjunge?«
Amadeus antwortet nicht, setzt sich neben die Stadtmauer und deckt seinen Vater zur Vorsicht mit der Hand zu. Diese Schweigsamkeit ärgert den kleinen Bauern offenbar, und um zu beweisen, was er für ein Mensch sei, sagte er:
»Die Wiese gehört uns. Dort ist unser Hof, und dort ist unser Korn.«
»Und die Weide?« fragt Amadeus.
»Die gehört auch uns.«
Der kleine Mandel lacht; denn er weiß es besser. Da ereifert sich der Schnallkejunge und ruft laut: »Der Baum und der und der dahinter und die andern und der ganze Busch, alles, alles gehört uns, und ich heiße Martin Schnallke.«
Er läuft um den Steinhaufen herum und zeigt auf die ganze Welt. Als er an Amadeus vorbei will, greift ihm dieser an die Hosen, um zu erkunden, aus was für Stoff sie seien.
Eigentlich wollte Martin nach Hause laufen, um seinem Vater zu klagen, es sitze draußen auf der Vorderwiese ein Junge, der nicht glaube, daß alles dem Schnallkebauer gehöre. Als er aber des kleinen Schneiders Hand an seinem Bein fühlt und ein Verwundern in dessen Gesicht gewahrt, beruhigt er sich und sagt gewichtig: »Ja, ja. Das sind Lederhosen. Glaubst du etwan, die sein nich meine?«
Amadeus deckt die Hand noch fester auf seinen Vater und fragt: »Wem gehört das Dorf?«
»Unser Dorf?«
»Nu ja, Röhrsdorf?«
»Doch nich etwan dir?«
Nun ist des kleinen Mandel großer Augenblick gekommen. Er erhebt sich und sagt mit tiefstem Ernst:
»Das gehört dem König von Preußen.«
Da erschrak der Schnallke-Martin doch sehr und setzte sich neben Amadeus, und der erzählte ihm vom Königreich Preußen. Das ginge bis an den Himmel und hinter dem Walde, noch viel weiter als seine Muhme wohne der König von Preußen, der Hosen habe, so weit wie Kornsäcke, gar nicht zu Hause zu sein brauche wie die andern Menschen, sondern immerfort mit allen Eisenbahnen fahre.
Dann spielten sie »Hildesheim«. Der Schnallke-Martin wurde der Glöckner von Hildesheim und freute sich, daß die Frau fortlief, und daß die Kinder da lagen und schrien. Er wackelte mit der Streichholzschachtel in einem fort und läutete mit seiner Stimme, so laut er konnte, um die armen Kinder recht bis in den Tod zu ängsten. Amadeus aber führte seinen Vater unter vielen Gefahren durch den unaufhörlichen Graswald gen Hildesheim und ließ ihn dort am Tor mit dem Weibe ein ganz artiges Gespräch führen.
Der Spitz »Schmiedla« aber lag in dem Graben ob der Stadt und schlief. Wenn die Glocke einmal gar zu stark läutete, richtete er sich ein wenig auf, hielt den Kopf halb schief und steifte das obere Ohr.
Das wäre mit dem Hildesheimspiel nun schön den ganzen Tag lang gegangen, wenn der Martin nicht auch hätte einmal den Handwerksburschen führen wollen. Amadeus konnte das aber nicht zugeben, weil es doch sein Vater war. Er sagte davon zwar nichts, sondern stellte sich nur vor die Wasserfurche und schützte den Eusebius, der auf seinem Marsche von Berlin her eben tief im Graswalde steckte.
Nach manchem Hin und Her verlor Martin endlich die Geduld, stieß ganz Hildesheim um, suchte den Handwerksburschen auf und stampfte ihn unter Schimpfreden in die Erde. Als Amadeus seinem Vater so übel mitspielen sah, stürzte er, um Hilfe schreiend, auf den Schnallkejungen. Der aber gab dem kleinen Mandel noch eins vor die Brust und begann dann über die Wiese zu traben, weil in des Schneiders Hause die Tür knackte.
Eben hatte er die Schuppenecke erreicht, als Eusebius auf dem Plan erschien. Er bemerkte wohl gleich, wer der Schuldige an dem Handel gewesen sei. Anstatt aber dem kleinen Unhold zu Leibe zu gehen, machte er sich über seinen Jungen her, der am Boden lag und unter Geschuchz ein zertretenes Spänchen aus der Erde grub. Auf alle Fragen, was der Martin mit ihm vorgehabt habe, rief er nur immer verzweifelt: »Er hat ihn zertreten.« Mehr war durchaus nicht aus ihm herauszubringen. Deshalb hob ihn Eusebius auf und gängelte ihn dem Hause zu. Ehe er aber unter der Tür verschwand, kam seine Ruhe doch zum Platzen, und er schoß gegen Martins Kopf, der von Zeit zu Zeit hinter der Schuppenecke hervorkam, einen heidenmäßigen Hagel von Verwünschungen und Drohungen ab. Als er aber einmal absetzte, um Atem zu holen, schrie der Schnallkejunge aus seinem Versteck: »Fabelaffe! Fünfzehnschneider!«
Da fand es Eusebius für geraten, das Feld zu räumen, damit sein Sohn von diesen respektwidrigen Worten nicht noch mehr zu hören bekomme; denn wer mit heißem Eisen zu lange an einer Stelle bügelt, verbrennt das beste Gewebe.
Drin empfing Maruschka den Geschlagenen, reinigte seine Höschen vom Staube und tröstete ihn mit herzlichen Gurgellauten. Den Eusebius stachelte sie durch Faustbewegungen zur Rache auf. Der sah eine Weile in ihr erregtes Gesicht, auf ihre fliegende Brust und zwinkerte mit den Augen, wie es seine Art war, wenn ihm etwas nicht geheuer vorkam. Dann trat er auf sie zu und drückte ihre Arme an dem Körper herunter. Das sollte heißen: Geh und mach deine Arbeit!
Und das tat der Schneider, obwohl es selbst noch in ihm rumorte. Aber es war ihm unmöglich, diese nackten, prallen Arme vor sich zu sehen, denn dann hätte er hinausstürzen und aufs neue laut schreien müssen, und doch wurde es nicht besser, als seine Hände des Weibes weiches, heißes Fleisch berührten. Nein, ihn packte einen Augenblick gar etwas wie die fliegende Sucht. Deswegen ließ er die Stumme los und stieg kopfschüttelnd in seinen Schneidertisch. Dort nähte er die ganze Geschichte in den Ärmel, den er eben vorhatte, seinen Zorn auf der Wiese und das Zittern in der Stube. Seine Nadel beschrieb lange, jähe Stöße, und sein Gesicht war gerötet wie damals, als er Napoleon die Arbeit aufgesagt hatte. Das Licht in der Stube schwankte wie trunken, und die Luft darin war dick, daß sie kaum durch Mandels Lunge ging. Als Maruschka die Stube verließ, um im Garten zu schaffen, hörten die Sonnenringel auf, über die Diele zu tanzen, und alles kriegte wieder sein gemessenes Aussehen. Der Schneider richtete sich von der Arbeit auf und suchte mit den Augen seinen Jungen. Der lehnte im Winkel neben dem Topfschrank. Sein Gesicht war blaß und erschreckt, und seine Blicke lagen schmerzvoll auf seinem Vater, als sei eben etwas Schlimmes passiert, was er nicht begreifen konnte. Mandel legte die Jacke hin und führte den Verschüchterten an den Stuhl. Währenddessen redete er gütig auf ihn ein. Er verbot ihm, je wieder mit dem Martin zu spielen, der den Teufel im Leibe habe und eines Vaters Sprosse sei, der sich zwei Weiber halte. Und wenn er ihm verspreche, nie wieder ohne Erlaubnis sich herumzutreiben, so kaufe er ihm eine Tafel und einen Stift, daß er schreiben und malen könne, was ihm einfalle.
Der kleine Amadeus saß neben dem Stuhl auf dem Fußbänklein und hörte auf alles, was sein Vater sagte. Als der aber wieder in seinem Schneidertisch saß und sänftlich mit der Nadel hantierte, begannen aus den Augen des Knaben die Tränen wieder ganz stille zu fließen. Denn er war traurig, daß der Schnallkejunge zwei Mütter habe und er bloß eine, die noch dazu weder sprechen noch singen konnte. Dabei war es doch ein ausgemachter Teufelsjunge, der ihm Hildesheim umgestoßen und seinen Vater zertreten hatte. Und als er bei diesem Punkt angekommen war und seinen Vater von der Seite unauffällig ansah, schien es dem Amadeus auch nicht mehr ganz gewiß, daß ihm Röhrsdorf gehöre.
Seine Welt hatte einen Stoß erhalten. Ein Gleiten und Anderssein kam über alles in seiner Seele. Das war manchmal so stark, daß er sich nicht getraute, aufzustehen, wenn er saß, und nicht den Mut hatte, stillezustehen, wenn er rannte. Nicht anders als in eine Fremde war er gekommen, und doch stand seines Vaters Stube um ihn wie immer.
Beim Abendbrot sah er plötzlich von seinem Teller auf und richtete seine blaßblauen ruhigen Augen lange auf die stumme Maruschka.
Dann fragte er seinen Vater:
»Warum kann die Maruschka-Mutter nicht reden und ich kann?«
»Deine Mutter ist im Himmel«, antwortete Eusebius und kehrte dabei sein Gesicht ab, damit seine Wirtschafterin ihm nicht die Worte vom Munde absehen könne.
»Ist die Maruschka-Mutter nicht meine Mutter?« fragte Amadeus weiter.
»O ja, sie ist auch dein.«
Darüber geriet der kleine Mandel in große Freude.
»Dann habe ich auch zwei Mütter wie Martin«, rief er, »und du hast auch zwei Weiber wie der Schnallkebauer.«
Eusebius antwortete darauf nichts, trat ans Fenster und fuhr sich mit dem Taschentuch übers Gesicht. Bei seiner Rückkehr zwinkerte er noch immer mit den Augen und sagte, es sei ihm eine Mücke hineingeflogen. Maruschka, die seine Worte auch verstanden hatte, wollte ihm das Tierchen herauswischen und streckte schon die Hand nach ihm aus. Aber um alles in der Welt hätte es der Schneider jetzt nicht ertragen können, daß sie ihn angriff. Er schüttelte den Kopf, ging hinaus und lehnte sich über den Zaun. Der Himmel war schon tiefer blau von der nahen Nacht, und hinter dem Wald des Langen Busches stieg ein weißes Glänzen herauf. Dorthinein verlor sich des Mandel-Schneiders Sinnen.