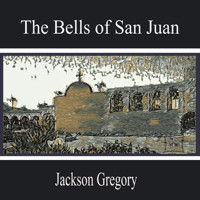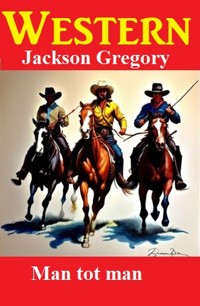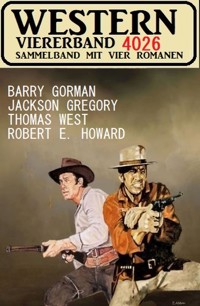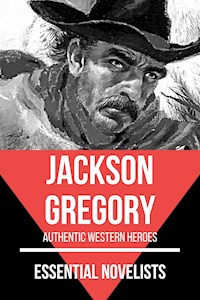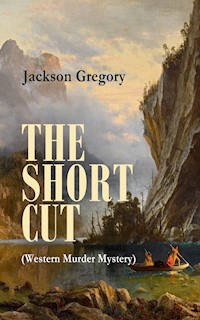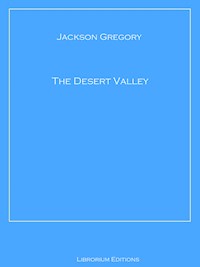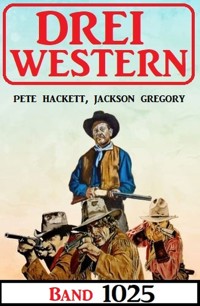
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Western: McQuade und die Schwester des Bravados (Pete Hackett) Marshal Logan folgte dem Tod (Pete Hackett) Der Mann aus Painted Rock (Jackson Gregory) Ned Colton parierte das Gespannpferd vor dem Store von Canyon, einer kleinen Ortschaft im Palo Duro Canyon zwanzig Meilen südlich von Amarillo. Das Mahlen der Räder im knöcheltiefen Staub der Main Street verstummte. Ein leises Klirren von der Gebisskette war zu vernehmen. Das Pferd peitschte mit dem Schweif und versuchte so die blutsaugenden Bremsen an seinen Flanken zu vertreiben. Die Straße war kaum belebt. Einige Passanten bewegten sich an den beiden Fahrbahnrändern. Die Gehsteige zu beiden Seiten waren oftmals unterbrochen. Canyon war ohne besondere bauliche Ordnung errichtet. Am Ortsrand gab es Pferche mit Schafen, Ziegen und Kühen. Uringeruch hing in der heißen Luft. Vor dem Saloon standen vier Pferde am Holm. Zwischen den Häusern der Stadt lastete die Hitze. Die Luft schien zu kochen. Niemand ahnte, dass sich in dieser Stunde eine Hölle für Ned Colton anbahnte … Ned Colton sprang vom Wagenbock und ging in den Store. Die Ladenglocke bimmelte. Hinter dem Verkaufstresen stand Liam Sanders und bediente eine Kundin. In dem Raum war es düster. Es roch nach Gewürzen. Der Farmer grüßte und Liam Sanders erwiderte seinen Gruß. Dann sagte Colton: »Ich habe alles aufgeschrieben, was ich brauche. Stelle es mir zusammen, Liam. Ich gehe auf ein Bier in den Saloon.« »Geh nur zu. Und lass dir Zeit.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jackson Gregory, Pete Hackett
Drei Western Band 1025
Inhaltsverzeichnis
Drei Western Band 1025
Copyright
McQuade und die Schwester des Bravados
Marshal Logan folgte dem Tod
Der Mann aus Painted Rock: Western
KAPITEL I.
KAPITEL II.
KAPITEL III.
KAPITEL IV.
KAPITEL V.
KAPITEL VI.
KAPITEL VII.
KAPITEL VIII.
KAPITEL IX.
KAPITEL X.
KAPITEL XI.
KAPITEL XII.
KAPITEL XIII.
KAPITEL XIV.
KAPITEL XV.
KAPITEL XVI.
KAPITEL XVII.
KAPITEL XVIII.
KAPITEL XIX.
Drei Western Band 1025
Pete Hackett, Jackson Gregory
Dieser Band enthält folgende Western:
McQuade und die Schwester des Bravados (Pete Hackett)
Marshal Logan folgte dem Tod (Pete Hackett)
Der Mann aus Painted Rock (Jackson Gregory)
Ned Colton parierte das Gespannpferd vor dem Store von Canyon, einer kleinen Ortschaft im Palo Duro Canyon zwanzig Meilen südlich von Amarillo. Das Mahlen der Räder im knöcheltiefen Staub der Main Street verstummte. Ein leises Klirren von der Gebisskette war zu vernehmen. Das Pferd peitschte mit dem Schweif und versuchte so die blutsaugenden Bremsen an seinen Flanken zu vertreiben.
Die Straße war kaum belebt. Einige Passanten bewegten sich an den beiden Fahrbahnrändern. Die Gehsteige zu beiden Seiten waren oftmals unterbrochen. Canyon war ohne besondere bauliche Ordnung errichtet. Am Ortsrand gab es Pferche mit Schafen, Ziegen und Kühen. Uringeruch hing in der heißen Luft.
Vor dem Saloon standen vier Pferde am Holm. Zwischen den Häusern der Stadt lastete die Hitze. Die Luft schien zu kochen. Niemand ahnte, dass sich in dieser Stunde eine Hölle für Ned Colton anbahnte …
Ned Colton sprang vom Wagenbock und ging in den Store. Die Ladenglocke bimmelte. Hinter dem Verkaufstresen stand Liam Sanders und bediente eine Kundin. In dem Raum war es düster. Es roch nach Gewürzen. Der Farmer grüßte und Liam Sanders erwiderte seinen Gruß. Dann sagte Colton: »Ich habe alles aufgeschrieben, was ich brauche. Stelle es mir zusammen, Liam. Ich gehe auf ein Bier in den Saloon.«
»Geh nur zu. Und lass dir Zeit.«
Copyright
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER EDWARD MARTIN
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
McQuade und die Schwester des Bravados
Der Kopfgeldjäger Band 85
Western von Pete Hackett
Der Umfang dieses Buchs entspricht 46 Taschenbuchseiten.
Pete Hackett Western - Deutschlands größte E-Book-Western-Reihe mit Pete Hackett's Stand-Alone-Western sowie den Pete Hackett Serien "Der Kopfgeldjäger", "Weg des Unheils", "Chiricahua" und "U.S. Marshal Bill Logan".
Über den Autor
Unter dem Pseudonym Pete Hackett verbirgt sich der Schriftsteller Peter Haberl. Er schreibt Romane über die Pionierzeit des amerikanischen Westens, denen eine archaische Kraft innewohnt - eisenhart und bleihaltig. Seit langem ist es nicht mehr gelungen, diese Epoche in ihrer epischen Breite so mitreißend und authentisch darzustellen.
Mit einer Gesamtauflage von über zwei Millionen Exemplaren ist Pete Hackett (alias Peter Haberl) einer der erfolgreichsten lebenden Western-Autoren. Für den Bastei-Verlag schrieb er unter dem Pseudonym William Scott die Serie "Texas-Marshal" und zahlreiche andere Romane.
Hackett ist auch Verfasser der neuen Serie "Der Kopfgeldjäger". Sie erscheint exklusiv als E-book bei CassiopeiaPress.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker.
© by Author
© dieser Ausgabe 2016 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
1
Es war gegen Mittag, als McQuade das Sheriff’s Office in Bisbee betrat. In dem Raum war es düster, es roch nach Bohnerwachs und Tabakrauch, an dem verstaubten Fenster tanzten Fliegen auf und ab, das monotone Ticken des Regulators an der Wand erreichte das Gehör des Kopfgeldjägers.
Die Lider des Mannes, der dösend hinter seinem Schreibtisch saß, die Füße auf dem Tisch liegen und die Hände über dem Bauch verschränkt hatte, zuckten in die Höhe, er schaute den Eintretenden etwas verständnislos an, doch dann erfasste sein Blick den grauen Wolfshund, der neben McQuade ins Office glitt, und der Schimmer des Begreifens blitzte in seinen Augen auf. Er schwang die Beine nach unten und setzte sich gerade, dann sagte er: „Ah, McQuade. Es ist schon eine ziemliche Zeit her …“
Der Kopfgeldjäger war verstaubt, tagealte Bartstoppeln wucherten auf seinem Kinn und seinen Wangen, die entzündeten Augen lagen in tiefen Höhlen und die Spuren in dem hohlwangigen Gesicht verrieten, dass hinter dem Texaner strapaziöse Tage lagen. „Ja, es ist schon einige Zeit her, dass wir miteinander das Vergnügen hatten, Sheriff“, antwortete er staubheiser. „Ich bin hinter einem Burschen namens Scott Biskup her. Er wird im Pima County wegen Mordes und einiger Raubüberfälle gesucht. Ich bin ihm in die Dragons gefolgt, dort hat er sich nach Süden gewandt und ich vermute, dass er Bisbee angeritten hat.“ McQuade holte ein zusammengelegtes Blatt Papier aus der Tasche des braunen, zerschlissenen Staubmantels, faltete es auseinander und hielt es dem Sheriff hin, der es nahm und längere Zeit darauf blickte. Dann murmelte er: „Der Steckbrief liegt in meiner Schublade, McQuade. Und er hängt auch draußen bei den anderen Anschlägen. Wenn Biskup in Bisbee gesehen worden wäre, hätte man mir das sicherlich zugetragen.“
McQuade nahm den Steckbrief wieder entgegen, faltete ihn zusammen und steckte ihn in die Manteltasche.
Der Sheriff ergriff noch einmal das Wort, indem er sagte: „Einer wie Biskup wird sich hüten, einen Ort wie Bisbee anzureiten. Schätzungsweise hat er sich nach Mexiko abgesetzt. Den können Sie wohl abschreiben, McQuade. In der Sierra Madre verliert sich so ziemlich jede Spur.“
„Ich werde noch ein Stück nach Süden reiten und es in Lowell und Warren versuchen. Vielleicht ist Biskup dort aufgetaucht. Vielen Dank, Sheriff.“ McQuade wollte sich mit dem letzten Wort abwenden, doch die Stimme des Sheriffs holte ihn ein und er hielt mitten in der Bewegung inne.
„Sie sehen ziemlich mitgenommen aus, McQuade. Wollen Sie nicht den Rest des Tages und die kommende Nacht eine Pause einlegen?“
„Machen Sie sich keine Sorgen, Sheriff. Ich bin weniger mitgenommen als heruntergekommen nach über einer Woche in der Wildnis. Aber wahrscheinlich haben Sie recht. Es dürfte keine große Rolle spielen, ob ich mich heute noch oder erst morgen auf den Weg nach Süden mache. Ja, ich glaube, ich miete mich im Hotel ein und setze mich beim Barbier in die Badewanne.“
„Das wäre ratsam“, versetzte der Ordnungshüter und zeigte ein schmales Grinsen. „Ich wünsche Ihnen ein paar schöne Stunden in Bisbee.“
McQuade verließ das Office. Draußen empfingen ihn gleißender Sonnenschein und brütende Hitze. Im Staub glitzerten winzige Kristalle. Die Schatten, die die Häuser warfen, waren kurz, denn die Sonne stand fast senkrecht über der Stadt.
Bisbee war eine wilde Grenzstadt in den Mule Mountains. Viele Häuser waren im typisch mexikanischen Stil erbaut, auch die Bevölkerung war überwiegend mexikanischer Abstammung. Es war noch nicht einmal fünfzehn Jahre her, da gehörte dieser Landstrich noch zu Mexiko. Im Jahre 1853 wurde das Gebiet südlich des Gila River durch den sogenannten Gadsden-Kauf den Mexikanern für 10 Mio. US-Dollar abgehandelt.
McQuade brachte sein Pferd in den Mietstall, dann ging er ins Hotel und bekam ein Zimmer. Dort deponierte er seine Satteltaschen und begab sich in den Barber Shop. Während ihn der Barbier rasierte, ihm die Haare schnitt und sich der Kopfgeldjäger anschließend in einem großen Holzzuber mit heißem Wasser aalte, lag Gray Wolf im Schatten unter dem Vorbau des Barber Shops und döste.
Als McQuade den Laden verließ, war er fast nicht wieder zu erkennen. Die Frau des Barbiers hatte für einen halben Dollar seine Kleidung ausgebürstet und nun sah der Texaner geradezu zivilisiert aus. Er ging in den Saloon und bestellte sich ein Essen, er bat den Keeper auch um ein großes Steak für Gray Wolf.
Der Kopfgeldjäger war beim Essen, als eine schwarzhaarige, rassige Frau Mitte zwanzig den Saloon betrat. Da außer McQuade um diese Tageszeit nur wenige Gäste anwesend waren, erspähte sie den Kopfgeldjäger mit dem zweiten Blick und steuerte zielstrebig seinen Tisch an. Als sie ihn erreicht hatte, sagte sie: „Mein Name ist Consuela Ramos. Darf ich mich setzen?“
McQuade schluckte den Bissen, an dem er eben gekaut hatte, hinunter und nickte, wies mit der Gabel in seiner Linken auf einen freien Stuhl und sagte: „Bitte.“
Sie ließ sich nieder. Ihre Bewegungen waren auf besondere Art grazil und geschmeidig. Consuela Ramos war eine bemerkenswerte Frau. Bekleidet war sie mit einem langen, schwarzen Rock und einer grünen Bluse. Die langen, schwarzen Haare hingen in leichten Wellen über ihre Schultern und auf ihren Rücken. Ihre Augen waren so dunkel wie Kohlestücke, in ihnen aber war ein Feuer, mit dem sie jeden Mann unweigerlich in ihren Bann zog.
„Ich weiß, wer Sie sind“, begann sie und ließ ihn nicht aus den Augen. „Und es hat sich herumgesprochen, dass Sie einen Banditen namens Biskup verfolgen, der sich wahrscheinlich nach Mexiko abgesetzt hat.“
„Sie sind gut unterrichtet, Ma’am“, antwortete McQuade. „Kennen Sie Biskup?“
Consuela schüttelte den Kopf. „Nein. Ich will von Ihnen wissen, ob Sie ihm nach Mexiko folgen.“
„Wieso interessiert Sie das?“
„Ich will zu meinem Bruder. Sein Name ist Arturo, und er lebt irgendwo in der Provinz Sonora, in der Gegend von Villa Verde, in den Bergen, wo genau weiß ich allerdings nicht. Alleine wage ich es nicht, in die Wildnis zu ziehen. Wenn Sie also über die Grenze gehen, um diesen Biskup zu suchen, würde ich mich Ihnen gerne anschließen.“
„Haben Sie eine Ahnung, was Sie in der Felswüste erwartet?“, fragte McQuade, als er ihre Worte verarbeitet hatte. „Die Sierra Madre sind die Hölle; nur Hitze, Staub, totes Gestein, Klapperschlangen und Skorpione und – Banditen, die von den Rurales und Regierungstruppen gejagt werden wie räudige Hunde.“
„Es sind keine Banditen, Gringo, es sind Revolutionäre“, sagte Consuela mit Schärfe im Tonfall.
Ein hartes Grinsen brach sich Bahn in McQuades Gesicht. „Aus Ihrer Reaktion schließe ich, dass Ihr Bruder auch einer dieser – hm, Revolutionäre ist.“
Ihre Miene hatte sich etwas verfinstert. „Werden Sie über die Grenze gehen, McQuade?“, fragte sie, ohne auf seine Worte einzugehen.
„Ich denke schon, denn ich bin viel zu viele Meilen schon auf der Fährte Biskups geritten, um jetzt unverrichteter Dinge umzukehren. Ja, ich werde wohl nach Mexiko ziehen und versuchen, den Banditen dort drüben aufzustöbern.“
„Nehmen Sie mich mit?“
„Ich werde keine Zeit haben, mit Ihnen nach Ihrem Bruder zu suchen, Ma’am.“
„Bringen Sie mich nach Villa Verde, McQuade“, versetzte die rassige Frau. „Das Dorf liegt etwa zwanzig Meilen hinter der Grenze. Irgendwo in den Bergen bei dem Dorf soll sich mein Bruder mit seinen Männern versteckt halten. Wenn ich erst einmal in Villa Verde bin, kann ich mir selbst weiterhelfen, denn dort gibt es sicherlich jemand, der mich zu Arturo führt.“
„Sagen Sie mir die Wahrheit, Consuela“, forderte der Kopfgeldjäger. „Ihr Bruder verkriecht sich doch nicht grundlos in der Wildnis. Ich denke, er wird vom Gesetz gejagt. Warum?“
„Er gehörte zu General Martinez, und Martinez kämpfte für Kaiser Maximilian. Juárez hat verfügt, dass jeder, der mit den Franzosen oder dem Habsburger sympathisierte, mit dem Tod zu bestrafen sei. Martinez und seine Leute gerieten in einen Hinterhalt der Regierungstruppen und die meisten von ihnen starben, auch Juan Martinez. Meinem Bruder und einigen Männern gelang die Flucht.“
„Ich werde darüber nachdenken, Consuela“, versprach McQuade.
„Ich könnte Sie für Ihre Dienste auch bezahlen, McQuade“, stieß sie hervor.
Der Kopfgeldjäger winkte ab.
2
McQuade lag auf dem Bett, hatte die Hände hinter dem Kopf verschränkt und starrte gedankenvoll zur Zimmerdecke hinauf. Die verworrenen Geräusche, die durch das Leben in der Stadt produziert wurden, drangen an sein Gehör, doch sie erreichten nur den Rand seines Bewusstseins.
Der Tag neigte sich seinem Ende zu und die Stadt lag im Abendsonnenschein. Die Schatten wuchsen schnell über die heiße Fahrbahn und in den Werkstätten legten die Handwerker ihre Werkzeuge aus der Hand, um den wohlverdienten Feierabend anzutreten.
Der Kopfgeldjäger war in der Tat ziemlich ausgelaugt und erschöpft. In den Dragon Mountains kreuzte sein Weg den einer Gruppe von Chiricahuas, die ihn jagten, denen er aber entkommen konnte, ohne dass er einen von ihnen töten musste. Er war schon oft in den Bergen, in denen Cochise mit seinen Guerilla-Apachen einen blutigen Krieg mit der Armee führte. Die Chiricahuas machten aber auch vor weißen Zivilisten nicht halt. Es war viel Blut geflossen, und es sollte noch viel Blut fließen. Ein hochrangiger Offizier kleidete es in Worte. „Wir haben einen Krieg gegen die Mexikaner geführt“, sagte er, „um dieses Land zu erobern. Jetzt sollten wir einen Krieg führen, um es wieder loszuwerden.“
McQuade kannte Cochise persönlich, und er hatte schon mit Geronimo zu tun gehabt. Sie waren ihm nicht feindlich gesinnt. Aber diese Einstellung zu ihm teilten nicht alle Krieger …
Der Texaner wurde aus seinen Gedanken gerissen, als jemand an die Tür klopfte; irgendwie ungeduldig und fordernd. Gray Wolf, der neben dem Bett am Boden lag, erhob sich mit einem Ruck, legte die Ohren an und knurrte leise.
„Ruhig, Partner“, stieß McQuade hervor, richtete den Oberkörper auf und schwang die Beine vom Bett. „Wer ist da?“
„Ich bin es – Consuela.“
McQuade kniff einen Moment lang die Lippen zusammen, dann drückte er sich hoch, ging zur Tür und schloss auf. Schön und rassig, die personifizierte Verführung, stand sie vor ihm. Sie war einen Kopf kleiner als der Kopfgeldjäger, und um in sein Gesicht blicken zu können musste sie den Kopf in den Nacken legen. „Darf ich eintreten?“
Er gab die Tür frei, sie schritt an ihm vorüber, ging bis zum Tisch und setzte sich auf einen der beiden Stühle. Indes drückte der Texaner die Tür wieder zu und fixierte die Frau fragend. „Eine Lady erwirbt sich sicher nicht den besten Ruf, wenn sich herumspricht, dass sie einen Mann in seinem Hotelzimmer besucht“, erklärte McQuade mit ironisch angehauchtem Tonfall.
„Ich bin keine Lady, McQuade. Es gibt in Bisbee einen Puff, und in dem arbeite ich.“
„Ah. Gefällt es Ihnen dort nicht mehr, weil Sie nach Mexiko möchten?“
„Wenn sie meinen Bruder schnappen, hängen sie ihn oder stellen ihn vor ein Erschießungskommando. Unsere Mutter ist vor drei Wochen gestorben. Ich musste ihr auf dem Sterbebett versprechen, alles zu tun, um zu verhindern, dass Arturo auf dem Altar irgendwelcher politischer Querelen geopfert wird. Sein einziges Vergehen besteht darin, dass er mit Benito Juárez’ Politik nicht einverstanden war und ist. Er kämpfte im Reformkrieg, der von Ende 1857 bis Anfang 1861 dauerte, auf der Seite der Konservativen; ein grausamer und blutiger Bürgerkrieg, der das gesamte Land spaltete. Der Krieg endete schließlich mit dem Sieg der Juaristas.“
„Das mag sein“, versetzte McQuade. „In Mexiko gilt er jedenfalls als Bravado, als Geächteter. Und wie Sie selbst eben sagten, muss er mit seiner Hinrichtung rechnen, wenn er erwischt wird. Wie wollen Sie es verhindern?“
„Ich werde ihn überreden, mit mir in die Staaten zu gehen. Da kann er ein normales Leben führen und muss keine Angst vor der Obrigkeit haben.“
McQuade schaute skeptisch drein. Dann schüttelte er den Kopf und sagte: „Tut mir leid, Consuela, aber ich werde Sie nicht nach Villa Verde bringen. Ich will nämlich nicht die Verantwortung für Sie übernehmen. Und das müsste ich, wenn ich mich bereit erklären würde.“
Einen Moment lang verkniff sich ihr ebenmäßiges Gesicht und es wirkte plötzlich gar nicht mehr so schön. Doch im nächsten Augenblick glättete es sich wieder und sie stieß hervor: „Ich kann Sie nicht zwingen, McQuade. Wenn Sie mir nicht helfen wollen, dann muss ich es eben alleine versuchen.“
„Das wäre selbstmörderisch“, warnte der Texaner. „In der Sierra Madre lauert der Tod hinter jedem Felsen, hinter jedem Strauch und in jeder Felsspalte. Ich an Ihrer Stelle würde das Wagnis nicht eingehen, Ma’am.“
„Ich muss meinen Bruder retten“, versetzte sie mit klirrender Stimme. „Por Dios, ich werde tun, was ich meiner Mutter auf dem Sterbebett geschworen habe, und wenn es mein Leben kostet.“
„Wenn Sie in der Felswüste vor die Hunde gehen wird das Ihren Bruder kaum retten, Ma’am“, platzte es etwas wütend aus dem Kopfgeldjäger heraus. Sie setzte ihm mit ihrer Sturheit gewissermaßen das Messer auf die Brust. Ihre Taktik war für ihn offensichtlich. Und das machte ihn zornig.
3
Als die Sonne aufging und der Morgendunst als Vorbote der kommenden Hitze die Stadt einhüllte, holte McQuade sein Pferd aus dem Mietstall. Er verließ in südliche Richtung den Ort. Hinter den Häusern waren Corrals, Koppel und Pferche errichtet, in denen die Nutztiere der Stadtbewohner weideten. Da standen auch einige Scheunen, in denen das Heu für die Winterfütterung gelagert wurde.
Hinter einer dieser Scheunen trieb Consuela Ramos ihr Pferd hervor. Abrupt fiel McQuade dem Falben in die Zügel. „Ich sehe wohl nicht richtig!“, entfuhr es ihm. Das Pferd unter ihm trat unruhig auf der Stelle. Gray Wolf hatte sich etwas geduckt und ließ die Reiterin nicht aus den Augen.
„Ich lasse mich nicht so einfach zurückweisen, McQuade!“, erklärte die schöne Frau. „Außerdem kenne ich deinen Ruf. Du würdest niemals einen hilflosen Menschen in der Ödnis sich selbst überlassen.“
Sie ließ jetzt jegliche Förmlichkeit außer Acht. Ihr unergründlicher Blick hatte sich an seinem Gesicht festgesaugt.
Der Texaner legte die Hände übereinander auf das Sattelhorn und seufzte: „Wenn du dir etwas in den Kopf gesetzt hast dann bist du wohl nicht mehr zu bremsen, wie?“
„Es ist für mich sehr wichtig, sabe Dios.“
„Was du vorhast ist Irrsinn“, knurrte er, und er schlug ebenfalls einen vertraulichen Ton an. „Die Wildnis macht keine Unterschiede – ob Mann oder Frau, ob stark oder schwach – sie fordert von jedem denselben Tribut. Du bist dort dem unerbittlichen Gesetz des Überlebens unterworfen, Lady. Du wirst nicht stark genug sein.“
„Täusche dich nicht in mir, Americano.“ Sie schlug mit der flachen Hand leicht an den polierten Kolben der Henry Rifle, der aus dem Scabbard an ihrem Sattel ragte. „Ich kann damit umgehen. Und wahrscheinlich bin ich zäher als die meisten der Kerle, mit denen ich in meinem bisherigen Leben zu tun hatte. Ich werde dir ganz sicher kein Klotz am Bein sein. Und du musst auch nicht die Verantwortung für mich übernehmen. Ich bin vierundzwanzig Jahre alt. Und du, Gringo, bist nur wenige Jahre älter als ich.“
Ein Zwiespalt brach in McQuade auf, Gefühl und Verstand fochten einen erbitterten Kampf in ihm aus. Der Verstand sagte ihm, dass er ablehnen sollte. Das Gefühl jedoch hämmerte ihm ein, dass er sie nicht alleine in die Sierra Madre reiten lassen durfte. Um überhaupt etwas zu sagen stieß er hervor: „Was meinst du, Partner? Nehmen wir sie mit?“ Er hatte den Kopf gedreht und schaute zu dem Wolfshund hinunter, der sich entspannt und auf die Hinterläufe niedergelassen hatte.
Das kluge Tier fiepte leise, dann bellte es einige Male.
„Na schön“, murmelte der Texaner ergeben. „Reiten wir gemeinsam.“
„Ich wusste es, McQuade, du würdest kein zweites Mal ablehnen. Bei der Heiligen Jungfrau – ich habe mich nicht in dir getäuscht.“
Der Kopfgeldjäger nahm die Hände vom Sattelhorn und trieb das Pferd mit einem Schenkeldruck an. Consuela zog ihren Vierbeiner halb um die rechte Hand, und als McQuade auf ihrer Höhe war, ritt auch sie an. Steigbügel an Steigbügel zogen sie aus der Stadt.
Vogelgezwitscher begleitete sie. Der Morgendunst löste sich auf und bald lag das Land wieder unter einem flirrenden Hitzeschleier.
Sie kamen eine Stunde später nach Lowell, einer kleinen Ortschaft, die vor nicht allzu langer Zeit gegründet worden war und nur aus wenigen Häusern bestand. Auch hier hatte sich Biskup nicht sehen lassen, und so ritten sie unverzüglich weiter. Auch in Warren – ebenfalls nur eine Ansammlung einiger Häuser und Hütten - war der Bandit nicht aufgetaucht.
McQuade aber war davon überzeugt, dass Scott Biskup die Südroute eingehalten hatte. Nach seinem jüngsten Verbrechen in Casa Adobes, einer kleinen Stadt in der Nähe von Tucson, waren sämtliche Gesetzeshüter im Süden des Territoriums und wahrscheinlich auch eine Reihe von Kopfgeldjägern hinter dem Outlaw her.
Dennoch begannen den Texaner Zweifel zu quälen. Wo sollte er in Mexiko mit seiner Suche beginnen? In der Sonora-Wüste konnte ein Mann verschwinden wie ein Regentropfen im Ozean. In der Sierra Madre trieben Bravados ihr Unwesen, da waren aber auch die Rurales, dieses berühmt-berüchtigten Grenzreiter, die nicht viel besser waren als die Renegaten, die sie jagten. Der eine oder andere Offizier arbeitete sogar mit den Banditen zusammen. Korruption war sozusagen an der Tagesordnung.
Trotz allem entschloss er sich, weiterzureiten. Dabei war die Hoffnung, Biskups Spur in Mexiko aufzunehmen, nur ausgesprochen gering. Er wollte Consuela gegenüber keinen Rückzieher machen, denn es war ganz und gar nicht seine Art, ein gegebenes Versprechen zurückzunehmen oder es einfach zu ignorieren. Außerdem würden sie, wenn sich ihnen nicht irgendein Hindernis in den Weg stellte, im Laufe des nächsten Tages Villa Verde erreichen, und damit würde seine Mission im Dienste Consuelas erledigt sein.
Eine gute Stunde, nachdem sie Warren hinter sich gelassen hatten, überschritten sie die Grenze. Von jetzt an war äußerste Vorsicht geboten, denn sie befanden sich illegal in Mexiko.
Vor ihnen lag ein Gebiet, das Gott in einem Anfall von Übellaunigkeit oder vielleicht sogar der Satan persönlich gestaltet hatte. Hier trieben nur giftige Reptilien ihr Unwesen. Manchmal kamen die Chiricahuas, von denen behauptet wurde, dass sie ihr Leben selbst dort noch fristeten, wo selbst Schlangen, Skorpione und Eidechsen keine Chance mehr hatten, auf der Flucht vor der U.S.-Armee in diesen Landstrich.
McQuade zügelte den Falben, und als auch die Frau anhielt, sagte er: „Du kannst es dir jetzt noch überlegen, Muchacha.“
„Es gibt nichts zu überlegen“, versetzte sie mit Entschiedenheit in der Stimme.
McQuade ruckte im Sattel und schnalzte mit der Zunge. Das brüchige Leder des alten Sattels knarrte, leises Klirren der Gebisskette kam hinzu. Um die Hufe des Falben wirbelte Staub. Consuela trieb die Stute an, die sie ritt. Das Tier prustete und warf den Kopf widerwillig in die Höhe, als spürte es, dass der Weg von hier aus geradewegs in die Hölle führte.
Um sie herum waren Hügel mit sandigen oder geröllübersäten Abhängen, nackter Fels, dorniges Strauchwerk und riesige Kakteen. Und über ihnen stand sengend die Sonne, grell und konturlos, wie eine zerfließende Scheibe aus Weißgold.
Gegen Abend lag ein Dorf vor ihnen; die Häuser waren um eine Plaza herum eng zusammengebaut, alles mutete verwinkelt und undurchdacht an, rund um das Dorf weideten Ziegen, Schafe, Milchkühe und einige schwere Kaltblüter, es gab sogar einen Koben mit Schweinen. Alles wirkte ärmlich, heruntergekommen und verwahrlost.
Von dem Ort aus führte ein schmaler Weg nach Süden, der sich schon noch hundertfünfzig Yard zwischen die Felsen bohrte. Es handelte sich lediglich um zwei Fahrspuren zwischen denen kniehohes Unkraut wuchs.
Sie ritten in das Dorf. Auch aus der Nähe wirkte es nicht weniger ärmlich und schmutzig. Daran konnten auch die roten, verstaubten Geranien auf der einen oder anderen Fensterbank nichts ändern. Die Häuser waren aus Adobeziegeln gebaut, aus den Frontseiten ragten die Dachsparren, die Fenster waren unverglast und konnten nur mit hölzernen Läden gesichert werden, die meistenteils verrottet und schief in den Angeln hingen.
Aber es gab eine Pulqueria. Ein verwittertes Holzschild über der niedrigen Eingangstür wies sie als solche aus. Rechts von der Tür befanden sich drei kleine Fenster, die sicherlich kaum Licht in den Schankraum ließen.
Vor dem schäbigen Gebäude saßen McQuade und Consuela ab. In die Hausmauer waren einige eiserne Ringe eingelassen, an die sie ihre Pferde leinten. McQuade zog die Henrygun aus dem Scabbard, schaute sich um und versuchte sich ein Bild von der Örtlichkeit zu machen. An einigen der Fenster sah er Gesichter vor dem düsteren Hintergrund in den Räumlichkeiten. Schnell traten die Menschen von den Fenstern weg, wenn sie das Gefühl hatten, dass sie der Blick des Amerikaners erfasste, als wären sie bei etwas Unerlaubtem ertappt worden.
„Dieser Ort gefällt mir nicht“, knurrte McQuade. „Gehen wir hinein. Es wird sich zeigen, ob wir die Nacht hier verbringen oder ob wir uns in der Wildnis einen Platz zum Schlafen suchen.“
Der Schankraum war niedrig, McQuade zählte fünf Tische mit jeweils vier Stühlen. Es war düster, fast schon dunkel. Die Theke war aus ungehobelten Balken und Brettern zusammengenagelt, ebenso das Regal dahinter, in dem Krüge, Gläser und Flaschen standen. Die Luft war abgestanden, fast stickig, es roch nach kaltem Tabakrauch und Schweiß.
Eine Tür hinter dem Tresen stand offen. Durch sie trat nun eine Frau mittleren Alters, deren lange, schwarze Haare sich schon grau zu färben begannen. „Buenos dias”, grüßte sie.
McQuade und Consuela erwiderten den Gruß, und der Kopfgeldjäger fügte hinzu: „Wir haben Hunger und Durst und suchen eine Übernachtungsmöglichkeit. Können wir bei Ihnen zwei Zimmer mieten, Señora?“
Die Wirtin streifte mit einem schnellen Blick den Wolfshund, der sich gegen McQuades rechtes Bein drängte. „Ist der gefährlich?“, fragte sie auf Spanisch.
„Nein“, antwortete Consuela ebenfalls in ihrer Muttersprache. Dann wiederholte sie McQuades Frage, die die Wirtin scheinbar nicht verstanden hatte. Die Mexikanerin antwortete etwas und Consuela wandte sich an McQuade. „Sie kann uns etwas zu essen machen, und Wasser oder Wein kann sie ebenfalls anbieten. Eine Übernachtungsmöglichkeit hat sie jedoch nicht. Sie meint, wir sollten in einer der Scheunen außerhalb der Ortschaft übernachten.“
„In Ordnung“, murmelte der Texaner. „Essen und trinken wir, und dann reiten wir weiter.“
4
McQuade war nicht dem Rat der Mexikanerin gefolgt und hatte sich nicht in einer Scheune einquartiert. Er und Consuela hatten ihr Nachtlager etwa eine Meile südlich des Dorfes in einer Gruppe von haushohen Felsen aufgeschlagen.
Über ihnen spannte sich ein klarer Sternenhimmel. Der Mond befand sich irgendwo im Südosten hinter den himmelstürmenden Felsmonumenten der Sierra de Madera. Die fernen Gestirne lichteten die Nacht und leises, monotones Säuseln erfüllte sie. Es war der Nachtwind, der von den Felsen gebrochen wurde.
McQuade spürte etwas Feuchtes an seiner linken Hand und wurde wach. Es war Gray Wolf, der ihn mit seiner Nase angetupft hatte. Nun fiepte das Tier, stupste noch einmal die Hand des Texaners an, dann warf es sich herum und lief in die Nacht hinein.
McQuade wusste dieses Verhalten des klugen Tieres zu deuten, seine Rechte tastete nach dem Gewehr, das neben ihm auf der Erde lag, er rollte unter seiner Decke hervor in den Schlagschatten eines Felsens und kam hoch. Schließlich stand er geduckt dicht beim Felsen, lauschte angespannt und verließ sich auf seinen in zig gefährlichen Situationen erprobten Instinkt, der ihm unmittelbare Gefahr signalisierte.
Die Hände des Kopfgeldjägers hatten sich regelrecht an Kolbenhals und Schaft der Henry Rifle festgesaugt. In der Kammer befand sich eine Patrone. McQuade sah die schlafende Mexikanerin, ein längliches, schwarzes Bündel, das sich im Sternenlicht deutlich vom helleren Boden abhob.
Nun vernahm McQuade ein Knirschen, das entsteht, wenn Steine aneinanderreiben. Jemand schlich ganz in der Nähe über Geröll. Das Geräusch versank im Säuseln des Nachtwindes, und plötzlich traten zwei – drei – vier Schemen zwischen den Felsen hervor, das Sternenlicht ließ die Läufe ihrer Gewehre matt schimmern und lag auf den bärtigen Gesichtern.
„Hoch mit euch!“, erklang es.
„Ich bin hier, Compañeros!“, stieß McQuade hervor und sah sie herumzucken. „Und ich ziele auch einen von euch – doch keiner von euch weiß, auf wen mein Gewehr gerichtet ist. Lasst eure Knarren fallen!“
Consuela war aufgewacht und stemmte nun ihren Oberkörper in die Höhe. „Was ist …“
„Unliebsamer Besuch hat sich eingestellt, Consuela. Wahrscheinlich hat jemand aus dem Dorf die Hombres auf uns aufmerksam gemacht. – Rührt euch nur nicht, Compañeros. Weg mit den Gewehren!“
Consuela saß da wie zu Stein erstarrt. Ihre Augen glitzerten im Licht der Nacht wie Glas.
„Halt deinen Finger am Abzug ruhig, Gringo“, sagte nun einer der ungebetenen Gäste. „Wir sind Rurales. Ja, man hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass ein Americano mit einem großen, grauen Hund, der von einer Mexikanerin begleitet wird, illegal in unserem Land unterwegs ist. Ich bin Teniente Jimenez. Nimm das Gewehr runter, Gringo.“
In McQuade läuteten die Alarmglocken Sturm.
Plötzlich brüllte in der Nähe ein Mann: „Caramba, ein Wolf! Por Dios …“
Ein peitschender Knall zerriss die nächtliche Ruhe, das Echo, grollte in den Canyons und Schluchten und verebbte schließlich.
McQuade warf sich zu Boden; es geschah mehr instinktiv als von einem bewussten Willen geleitet. Und sein sechster Sinn für die Gefahr hatte ihn wieder einmal nicht im Stich gelassen. Denn die vier Kerle, die er in Schach gehalten hatte, glaubten den Kopfgeldjäger abgelenkt und nahmen ihn aufs Korn. Ihre Gewehre brüllten auf, die Detonationen verschmolzen zu einem lauten, explosionsähnlichen Knall, aber die Geschosse pfiffen über den Kopfgeldjäger hinweg. Querschläger quarrten. In den verhallenden Donner hinein erklang das wütende Bellen Gray Wolfs.
Und nun begann die Henrygun des Texaners ihr tödliches Lied anzustimmen. McQuade feuerte in rasender Folge, so schnell, dass die vier Grenzreiter gar nicht mehr dazu kamen, durchzuladen. Die Kugeln fegten sie von den Beinen. In der Nähe erhob sich Geschrei, in das sich das aggressive Bellen Gray Wolfs mischte. Wieder dröhnten einige Schüsse, Schritte trampelten.
McQuade verlor keine Zeit; jede Sekunde konnte über Leben oder Tod entscheiden. Er kam mit einem Ruck auf die Beine, rannte zu Consuela hin, die nach wie vor wie versteinert dasaß, packte sie am Oberarm, riss sie hoch und zerrte sie hinter sich her in die Finsternis hinein.
Bei einem mannshohen Felsblock drückte er sie zu Boden und kniete neben ihr ab. Zwischen zwei Felsen hindurch konnte er ihren Lagerplatz einsehen. Eine schattenhafte, geduckte Gestalt tauchte dort auf und drehte sich auf der Stelle, das Gewehr an der Hüfte im Anschlag. McQuade hob die Henrygun an die Schulter, feuerte, repetierte und schoss sofort wieder. Der Bursche wurde regelrecht umgerissen.
Irgendwo in der Finsternis wurde ein Befehl geschrien. Ein grässlicher Aufschrei, der alle Not der Welt zu beinhalten schien, erklang, riss jäh ab und Gray Wolf bellte triumphierend.
„Rühr dich nicht vom Fleck!“, gebot der Kopfgeldjäger Consuela, drückte sich hoch und glitt davon. Die Nacht schien seine Gestalt zu schlucken. Der Texaner hatte keine Ahnung, mit wie vielen Gegnern er es zu tun hatte, doch ihm war klar, dass jeder von ihnen tödlicher war als die Cholera.
Und noch etwas war ihm klar: Wenn auch nur einer dieser Kerle entkam, würde er weitere Rurales in der nächsten Garnison mobilisieren und sie würden ein unerbittliches Kesseltreiben auf ihn und Consuela veranstalten.
Außerdem musste er verhindern, dass sie ihnen die Pferde wegnahmen. Ihre Chance, heil aus dieser Sache herauszukommen war gering – verdammt gering. Ohne Pferde aber war sie gleich Null.
Jemand rief etwas auf Spanisch. „No lo se – ich weiß nicht“, antwortete ein anderer. Der Rufer befand sich ganz in der Nähe McQuades, der lautlos einen Fuß vor den anderen setzte und wie eine große Raubkatze durch die Finsternis glitt. Und dann konnte er den Schemen ausmachen, er schob sich näher an ihn heran, die schemenhafte Gestalt nahm Kontur an und der Texaner schoss. Für den Bruchteil einer Sekunde erhellte der Mündungsblitz die Nacht um McQuade herum. Der Bursche brach zusammen, sein Aufprall am Boden war zu hören, ein Stöhnen – aus.
Und jetzt krachten ein ganzes Stück entfernt Schüsse. McQuade folgte dem Klang. Da vernahm er Wiehern, und es kam von dort, wo ihre Pferde standen. Sofort änderte er die Richtung, glitt zwischen die Felsen und sah einen Mann, der ihre Pferde wegführen wollte. Der Kopfgeldjäger fackelte nicht lange. Der Rurale brach zusammen. McQuade lief hin und schnappte sich die Zügel. Wohlweislich hatten sie die Pferde nicht abgesattelt und ihnen auch nicht das Zaumzeug abgenommen, sondern lediglich die Bauchgurte der Sättel etwas gelockert. Der Kopfgeldjäger brachte die Tiere zu Consuela. Die junge Mexikanerin hatte ihre Bestürzung überwunden und zog sofort ihr Gewehr aus dem Sattelschuh, indes McQuade die Pferde an einem Ast festband und die Bauchgurte fest anzog.
Da erklangen Hufschläge. Einen Augenblick lang schienen sie anzuschwellen, doch dann entfernten sie sich und wurden schnell leiser.
Plötzlich huschte auch Gray Wolf heran, rieb seinen Kopf am Bein McQuades und winselte leise. Der Kopfgeldjäger kraulte ihn zwischen den Ohren. „Dass auch nur einer von ihnen entkommt wollte ich verhindern“, stieß der Texaner hervor. „Verdammt! Ich weiß nicht, wo die nächste Garnison ist, in der Rurales stationiert sind. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich jeder verfügbare dieser Kerle auf seinen Gaul schwingt, um uns zu jagen.“
„Wie sollen Sie uns in dieser Wildnis finden?“, fragte Consuela.
„Sie haben uns auch in dieser Nacht gefunden. Diese elenden Halsabschneider kennen in diesem Landstrich wahrscheinlich jeden einzelnen Stein. Sie werden uns hetzen, bis uns die Zungen zu den Hälsen heraushängen.“
„Dann sollten wir zusehen, dass wir Land gewinnen“, stieß Consuela hervor.
„Ich hole unsere Decken“, erklärte McQuade und glitt davon. Er ließ die gebotene Vorsicht nicht außer Acht, als er zu ihrem Camp pirschte. Die Hufschläge waren in der Zwischenzeit verklungen und das einzige Geräusch war das gleichbleibende Säuseln des Windes. Aber von den Kerlen, die McQuades Blei aufgefangen hatten, ging keine Gefahr mehr aus, und die anderen waren fort. Der Kopfgeldjäger machte sich daran, die Decken zusammenzurollen …
5
Der Tag brach an. Die aufgehende Sonne färbte den Horizont über den bizarren Felsmonumenten im Osten schwefelgelb. Die Jäger der Nacht hatten sich zur Ruhe begeben und die Vögel verabschiedeten mit ihrem Gezwitscher die Nacht. Es war windig. Der heiße Südwind trieb Staubspiralen über die Ebenen und durch die Senken.
McQuade nahm die Wasserflasche vom Sattel und trank einen Schluck. Das Wasser schmeckte abgestanden. Der Texaner sagte: „Mein Wasser geht zur Neige. Bis Villa Verde sind es noch einige Meilen, und die Pferde werden ohne Wasser kaum durchhalten. Hast du eine Ahnung, wo es in der Nähe einen Fluss oder eine Tinaja gibt?“
Während er sprach hatte der Kopfgeldjäger angehalten. Nun stieg er ab, schüttete den Rest Wasser aus der Canteen in die Krone seines Stetsons und gab dem Falben zu trinken.
Auch Consuela saß ab und hakte die Wasserflasche vom Sattel, schüttelte sie und sagte: „Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke, dass wir den Weg bis Villa Verde auch ohne Wasser schaffen. Bis Mittag können wir dort sein.“
Die Frau, die nach einem Tag und einer Nacht im Sattel ziemlich mitgenommen aussah, trank einen Schluck und gab dann die Flasche dem Kopfgeldjäger, damit er auch ihr Pferd tränken konnte. Auch Gray Wolf bekam etwas von dem Wasser.
Sie stiegen wieder auf die Pferde und McQuade sagte: „Ja, bis Mittag können wir in Villa Verde sein – vorausgesetzt, die Rurales machen uns keinen Strich durch die Rechnung.“
Nach einer Stunde etwa – es war heller Tag und trotz der frühen Stunde schon sehr heiß -, stießen sie auf ein Wasserloch. McQuade saß ab, schöpfte mit der Hand etwas Wasser und probierte es, spuckte es aber sofort wieder aus und stieß hervor: „Alkalihaltig. Diese Brühe ist ungenießbar. Verdammt!“
Sie setzten ihren Weg fort. Immer wieder drehte sich McQuade um und schaute auf ihrer Fährte zurück.
„Wie sollen sie hier unsere Fährte finden?“, fragte Consuela, nachdem er wieder einmal nach hinten gesichert hatte. „Der Wind verweht jede Spur innerhalb kürzester Zeit.“
„Die dort oben können ihnen den Weg weisen“, versetzte McQuade und deutete mit der linken Hand hinauf zum Himmel.
Die Frau legte den Kopf in den Nacken, und nun sah sie hoch oben die schwarzen Punkte, die vor dem endlos anmutenden Blau des Firmaments lautlos ihre Kreise zogen; Aasgeier – Todesvögel.
„Sie begleiten uns schon eine ganze Weile“, sagte der Kopfgeldjäger. „Diese Biester sehen in uns eine potentielle Beute.
Die Hufe krachten und klirrten auf dem steinigen Boden. Stechmücken quälten Mensch und Tier. Sie befanden sich zwischen hohen Kakteen mitten in einer staubigen Senke. Nur ein paar Felsen gaben Deckung. Harte, dornige Comas hatten sich neben den Felsen eingenistet. Das Terrain stieg stetig an. Je höher sie kamen, umso heißer schien die Sonne herabzubrennen. Es war, als berührten Flammen ihre Gesichter.
Sie hielten auf eine Lücke zwischen den Felsen zu. Ehe sie hineinritten, drehte sich McQuade noch einmal um, um einen Blick hinter sich zu werfen. Und er sah ein Rudel Reiter aus einer Schlucht, die am nördlichen Ende der Senke eine Felskette spaltete, sprengen. Sie waren mit den schwarzen Anzügen der Rurales bekleidet, und sie vermittelten einen erschreckenden Eindruck von Wucht und Stärke. Der Hauch von grimmiger Entschlossenheit und der Strom des Vernichtungswillens, der von ihnen ausging, waren unverkennbar.
McQuade machte Consuela auf ihre Verfolger aufmerksam. Und wie es schien, hatten die Rurales die beiden Reiter ebenfalls entdeckt, denn sie spornten ihre Pferde noch mehr an und die Hufe der Tiere schienen kaum noch den Boden zu berühren. Der Pulk zog eine brodelnde Staubwolke hinter sich her und der Reitwind stellte die Krempen ihrer Sombreros vorne senkrecht.
„Lass uns verschwinden!“, drängte Consuela.
Sie trieben ihre Pferde in die Felslücke hinein. Nach einigen hundert Yard öffnete sich rechterhand eine Schlucht, die nach Osten führte. Sie war eng und kein Sonnenstrahl erreichte ihre Sohle. Kühle Luft strömte den Reitern entgegen. Sie konnten nur hoffen, dass die Schlucht nicht an irgendeiner Steilwand oder einem Abgrund endete und sie umkehren mussten. Dann würden sie den Rurales direkt in die Hände reiten.
Die krachenden Hufschläge fanden ein hartes Echo zwischen den Felsen. Hoch über ihnen war nur ein schmaler Streifen des blauen Himmels zu sehen. Feiner Sand, den der Wind über die Ränder der Schlucht trieb, wehte ihnen ins Gesicht.
Plötzlich ging es steil nach oben. Sie saßen ab und führten die Pferde. Wie Säulen stemmten die Tiere ihre Hinterbeine gegen das Zurückgleiten. Geröll, das sie lostraten, polterte den Steilhang hinunter. Die Anstrengung trieb ihnen den Schweiß aus sämtlichen Poren, sie keuchten, und selbst die Pferde begannen zu röcheln.
Sie erreichten ein Plateau. Jeder von ihnen – ob Mensch oder Tier – hätte jetzt etwas zum Trinken nötig gehabt. Von den Nüstern der Pferde tropfte zähflüssiger, weißer Schaum und ihre Flanken zitterten. Gray Wolfs Zunge hing seitlich aus dem Maul und ihr fehlte jeglicher feuchter Glanz. Mundhöhle und Kehle sowohl des Kopfgeldjägers als auch der Mexikanerin waren ausgetrocknet und das Schlucken fiel ihnen schwer.
McQuade schaute zum Himmel hinauf. Die Geier waren verschwunden. „Aufsitzen!“, kommandierte er und seine Stimme raschelte wie trockenes Laub im Herbstwind. „Sehen wir zu, dass wir zwischen die Felsen auf der anderen Seite der Ebene gelangen.“
Mühsam zog sich Consuela auf den Pferderücken. Nach vorne gekrümmt ritt sie. Ihre Augen brannten und Schwäche zog wie schleichendes Gift durch ihren ganzen Körper. Doch sie wollte nicht klagen, denn sie hatte auf dem Ritt nach Villa Verde bestanden.
Die Hufe trommelten auf dem felsigen Untergrund. Minutenlang stoben sie dahin und die Felsen im Westen rückten näher. Schließlich spengten sie in einen Einschnitt. McQuade nahm den Falben in die Kandare, zerrte ihn herum und spähte in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Von den Rurales war nichts zu sehen. Er folgte Consuela, die weitergeritten war. „Ich glaube, wir haben sie abgehängt“, stieß er heiser hervor. „Nun müssen wir wohl einige Umwege reiten, um nach Villa Verde zu gelangen. Das wird sicher nicht einfach ohne Wasser.“
„Es tut mir leid, McQuade“, murmelte Consuela. „Ich habe dich in diese missliche Lage gebracht.“
„Mach dir keine Gedanken“, versetzte der Kopfgeldjäger. „Ich hätte es ja ablehnen können, dich nach Villa Verde zu begleiten.“
6
Als die Sonne ihren höchsten Stand überschritten hatte, gelangten sie nach einem strapaziösen Ritt endlich nach Villa Verde. Das Dorf war in eine Senke eingebettet und vermittelte Ruhe sowie Frieden.
Irgendetwas warnte McQuade. Es war etwas Unbestimmtes, das sich im Hintergrund seines Bewusstseins eingenistet hatte und das ihm sagte, dass diese Beschaulichkeit trügerisch war.
Sie hatten die Pferde am Rand der Senke im Schutz hoher Ocotillos angehalten und nahmen die Eindrücke auf, die sich ihren Augen boten. Die Häuser waren aus Adobeziegeln und Bruchsteinen errichtet, besaßen flache Dächer und standen eng beieinander, die kleinen Grundstücke wurden von bis zu mannshohen Mauern begrenzt, in der Mitte der Plaza gab es einen Brunnen mit gemauertem Rand und einer Winde, der im Schatten zweier uralter, knorriger Steineichen lag.
Menschen waren keine zu sehen. Dies konnte darauf zurückzuführen sein, dass sie in der heißesten Zeit des Tages Siesta hielten – konnte aber auch andere Gründe haben.
„Du denkst, dass uns die Rurales erwarten, nicht wahr?“ Consuela fragte es und musterte das Gesicht des Texaners von der Seite.
„Irgendetwas stimmt nicht mit diesem Ort“, murmelte er. „Darum sollten wir ein wenig warten und das Dorf beobachten. Es ist nicht auszuschließen, dass die Polizeireiter den richtigen Schluss gezogen haben, dürfte es sich bei Villa Verde um die einzige Ortschaft weit und breit handeln, und dass sie in der Tat nur darauf lauern, dass wir vor die Mündungen ihrer Waffen reiten.“
McQuade saß ab und führte den Falben ein Stück zurück zwischen die Felsen, Consuela folgte seinem Beispiel. Staub rieselte von ihren Schultern, wenn sie sich bewegten. Sie banden die Pferde an und setzten sich so in den Schatten eines Felsens, dass sie Villa Verde sehen konnten. Die Luft schien vor Hitze zu zittern und die Konturen der Häuser und Hütten wurden verzerrt. Das ferne Krähen eines Hahnes erreicht ihr Gehör. Ansonsten schien eine unheilvolle Spannung die Stille zu erfüllen.
McQuade drehte sich eine Zigarette und rauchte. Jeder hing seinen eigenen Gedanken nach. Seit der vergangenen Nacht war er – McQuade -, in Mexiko ein Verfemter, ein Gesetzloser, dem der Tod drohte, wenn man seiner habhaft wurde. Er gab sich keinen Illusionen hin. Dass er die Rurales in Notwehr tötete würde niemanden interessieren. Wahrscheinlich käme es nicht einmal zu einem Prozess gegen ihn.
Die Zeit verrann träge. Die Sonne wanderte nach Westen, und Villa Verde erwachte zum Leben. Vereinzelte Menschen ließen sich auf der Plaza sehen, Frauen holten Wasser vom Brunnen, eine Caretta, die von einem Ochsen gezogen wurde, den ein Mann mit einem riesigen Sombrero führte, kam aus einer Einfahrt und fuhr in Richtung der Corrals und Koppeln auf der Südseite der Ortschaft.
„Sieht nicht so aus, als würde uns eine böse Überraschung erwarten“, bemerkte Consuela.
McQuade erhob sich und reckte die Schultern. „Reiten wir in das Dorf. Wenn wir hier sitzen bleiben bringt uns das auch nicht weiter. Außerdem habe ich langsam das Gefühl, innerlich zu vertrocknen.“
Sie banden die Pferde los und ritten in die Senke. Schließlich stiegen sie beim Brunnen auf der Plaza ab und McQuade ließ den Ledereimer in die Tiefe, hievte ihn wieder hoch und stellte ihn auf den Brunnenrand. Mit den hohlen Händen schöpften er und die Frau das Wasser, spülten sich den Mund aus, dann tranken sie und als sie ihren Durst gelöscht hatten wuschen sie sich Staub und Schweiß aus dem Gesicht.
Gray Wolf war zu einem Tränketrog vor einem der Häuser gelaufen, stand mit den Vorderpfoten auf dem Rand und trank gierig.
McQuade holte einen weiteren Eimer voll Wasser nach oben und tränkte die Pferde. Hier und dort stand ein Dorfbewohner am Rand der Plaza und beobachtete sie. Der Kopfgeldjäger warf einen umfassenden Blick in die Runde. Auch in Villa Verde gab es eine Pulqueria. Nachdem die Pferde versorgt waren, führten sie sie zu der Gastwirtschaft und banden sie davor an dem Holm fest. Sie nahmen ihre Gewehre, schnallten die Satteltaschen los und gingen hinein. Ein düsterer, menschenleerer Raum mit niedriger Decke nahm sie auf. Auf den runden Tischen standen Näpfe mit Talg, aus denen verbrannte Dochte ragten. Es roch säuerlich.
Hinter der primitiven Theke befand sich eine Tür, eine weitere führte auf der der Eingangstür gegenüberliegenden Seite in den Hof.
„Hola!“, rief Consuela. „Hört mich jemand?“
McQuade ging sporenklirrend zu einem der Tische, warf seine Satteltaschen auf einen Stuhl und setzte sich. Das Gewehr lehnte er gegen die Tischkante. Consuela setzte sich ihm gegenüber an den Tisch.
Nun trat ein Mann durch die Tür hinter dem Tresen. Ein zweiter folgte, und beiden hielten sie einen Revolver in der Hand. Der Hahn war jeweils gespannt, mattgrau schimmerten die Kugelköpfe in den Kammern der Sechsschüsser.
Und auch durch die Hintertür traten zwei Männer, und auch sie hatten jeder einen Colt in der Faust. Als die ersten beiden Kerle auftauchten, war McQuades Rechte zum Gewehr gezuckt, doch er konnte diesen Reflex noch rechtzeitig bremsen und seine Hand fiel auf seinen Oberschenkel.
Gray Wolf, der sich auf den Boden gelegt hatte, erhob sich, duckte sich ein wenig und ließ ein bedrohliches Knurren hören.
Consuelas unruhiger Blick sprang zwischen den Kerlen hin und her. Es waren bärtige, verwegen aussehende Gestalten, und sie trugen nicht die schwarzen Uniformen der Rurales. Doch von ihnen ging eine nicht zu übersehende Drohung aus, und McQuade sagte sich, dass das Quartett nicht nur einen ausgesprochen gefährlichen Eindruck vermittelte, sondern dass es sich um wirklich gefährliche Zeitgenossen handelte.
Einer sagte auf Englisch, aber mit hartem Akzent: „Wir haben dich und die Chica beobachtet, Gringo. Du hast unsere Geduld ganz gehörig strapaziert. Aber am Ende bist du doch noch in den Ort gekommen. Was treibt dich und die schöne Chica nach Villa Verde?“
Consuela enthob McQuade einer Antwort, indem sie fragte: „Sagt euch der Name Arturo Ramos etwas?“
In den dunklen Augen des Mannes, den Consuela während ihrer Frage anschaute, blitzte es auf. „Was hat es mit ihm auf sich?“
„Er soll hier in der Gegend leben. Ich suche ihn, denn ich muss mit ihm sprechen. Es ist sehr wichtig.“
„Und warum musst du ihn sprechen, Chica?“
„Ich bin seine Schwester. Ich soll ihm etwas von unserer Mutter bestellen. Sag mir, Hombre, kennst du Arturo?“
„Wer ist der Gringo, der dich begleitet?“
„Sein Name ist McQuade. Er ist ein guter Amigo. Wenn du Arturo kennst, dann kannst du mir sicher sagen, wo ich ihn finde.“
„Bist du wirklich seine Schwester?“
„Si, si. Mein Name ist Consuela Ramos. Ich habe in Bisbee gelebt.“
„Es ist richtig, Arturo hat eine Schwester“, sagte der andere der beiden Kerle bei der Theke. „Si, Chica, wir kennen Arturo. Natürlich bringen wir dich und den Gringo zu ihm.“
„McQuade sollte mich nur nach Villa Verde begleiten“, erklärte Consuela. „Ihn führt die Jagd auf einen Räuber und Mörder nach Mexiko. Er kann von hier aus seiner Wege reiten.“
„Reitest du für das Gesetz, McQuade?“, fragte der Mexikaner.
„Nein.“
„Wie heißt der Hombre, den du jagst?“
„Scott Biskup. In den Staaten zahlen sie eine hohe Prämie für seine Ergreifung.“
Der Mexikaner nickte. „Ich verstehe. Nun, ob wir dich ziehen lassen soll Arturo selbst entscheiden. Wir brechen morgen Früh auf. Versuch nicht, dich in der Nacht abzusetzen, Americano. Du würdest nicht weit kommen.“
„Bin ich euer Gefangener?“
„Wir müssen verdammt vorsichtig sein. In der Gegend treiben sich Rurales herum. Sie könnten von hier aus unsere Spur aufnehmen. Auch für die Ergreifung Arturos wird eine hohe Belohnung gezahlt. Wir gehen kein Risiko ein. Darum wirst du mit uns zu Arturo reiten, Americano. Ich rate dir, dich zu fügen.“
„Wir hatten in der vergangenen Nacht einen Zusammenstoß mit den Polizeireitern“, sagte Consuela. „Sie hätten uns getötet, doch McQuade war schneller.“
Die Brauen des Mexikaners schoben sich düster zusammen, über seiner Nasenwurzel standen zwei senkrechte Falten. „Sind bei dem Kampf Rurales gestorben?“
„Das ist anzunehmen“, versetzte McQuade. „Es war Notwehr.“
„Caramba!“, knirschte der Mexikaner. „Die Jagd auf dich wird jeden verfügbaren Rurales in dieses Gebiet verschlagen. Das wird Arturo nicht gefallen. Das wird ihm ganz und gar nicht gefallen.“
„Um darüber nachzudenken fehlte mir die Zeit“, knurrte der Kopfgeldjäger. „Töten oder getötet werden – das waren die beiden Alternativen. Die Rurales hatten nicht vor, Fragen zu stellen.“
„Es wird sich herausstellen, wie Arturo darüber denkt. Bei Tagesanbruch brechen wir auf. Und sei versichert, Gringo, dass wir ein Auge auf dich haben werden.“
7
In der Nacht wurde McQuade von Hufschlägen geweckt. Er schlief auf dem Heuboden des Stalles und ihn umgab eine mit den Augen nicht zu durchdringende Finsternis. Consuela hatte in der Pulqueria einen Schlafplatz erhalten. Die Männer, die sie am folgenden Tag zu Arturo Ramos bringen wollten, wohnten hier in Villa Verde.
McQuade hörte Stimmen, das Stampfen von Hufen, das Klirren der Gebissketten und das Knarren des Sattelleders und kroch zu der Luke in der Giebelseite des Stalles. Er öffnete sie vorsichtig und hatte schließlich den Blick auf die Plaza frei. Sie lag im Mond- und Sternenlicht und der Kopfgeldjäger sah beim Brunnen einen Pulk, der aus Pferden und Männern bestand. Er schätzte die Anzahl der Pferde auf etwa ein Dutzend, und trotz der Finsternis blieb ihm nicht verborgen, dass die Männer, die sich zwischen den Pferden bewegten, dunkel gekleidet waren. Die silbernen Knöpfe an ihren Jacken reflektierten das kalte Licht der Gestirne und des Mondes.
McQuade kniff die Lippen zusammen. Bei den Reitern handelte es sich um Rurales. Wie es schien, durchkämmten sie sogar nachts das Land auf der Suche nach ihm und Consuela.
Jetzt lösten sich drei Männer aus der Gruppe und kamen herüber zur Pulqueria. Sie gerieten in den toten Winkel zu McQuade und er konnte sie nicht mehr sehen, dafür aber hörte er, wie gegen die Haustür geschlagen wurde. Und schon gleich darauf erklang eine schlaftrunkene Stimme: „Was ist los? Por Dios! Wer begehrt zu dieser unchristlichen Zeit Einlass?“
„Ich bin Capitán Martinez von den Rurales. Wir suchen einen Americano, der von einer Mexikanerin begleitet wird.“
McQuade sprach zwar nicht fließend Spanisch, aber er konnte verstehen, was gesprochen wurde.
Der Capitán fuhr fort: „Der dreckige Gringo hat vier unserer Leute erschossen. Sicherlich befindet er sich illegal in unserem Land. Sag mir jetzt die Wahrheit, Hombre: Ist der Americano mit der Frau nach Villa Verde gekommen?“
„No, no. Ich habe hier seit vielen Wochen keinen Americano mehr gesehen, Capitán. Das ist die Wahrheit – bei der Heiligen Jungfrau von Guadalupe.“
„Sag mir die Wahrheit, Hombre. Sollte ich das Gefühl haben, dass du mich belügst, geht es dir schlecht. Also noch einmal: War der Americano mit der Chica in Villa Verde?“
„Nein, Capitán, ich schwöre es beim Leben meiner drei Enkel.“
„Wenn du lügst, komme ich früher oder später dahinter. Dann gnade dir Gott, Hombre.“
Die drei Männer tauchten kurze Zeit später wieder im Blickfeld des Kopfgeldjägers auf und marschierten zum Brunnen. „Aufsitzen!“, erklang es. „Wir schlagen außerhalb des Dorfes unser Camp auf. Und morgen, wenn es hell ist, suchen wir weiter. Der verdammte Gringo muss für die Morde an unseren Kameraden büßen.“
Sie schwangen sich in die Sättel und ritten im klirrenden Trab in die Dunkelheit hinein. Die Geräusche verloren an Intensität und versanken schließlich in der nächtlichen Atmosphäre.
McQuade legte sich wieder auf seine Decke, die er über einen Haufen Heu gebreitet hatte, und ließ seinen Gedanken freien Lauf. Dieses Dorf schien auf der Seite von Arturo Ramos zu stehen. Es war wohl in der Tat so, dass Benito Juárez überall in Mexiko Gegner hatte. Und solang das so war, würde das Land nicht zur Ruhe kommen.
Sorgen bereiteten dem Kopfgeldjäger die Rurales, die außerhalb des Dorfes campierten. Ihnen würde es nicht verborgen bleiben, wenn er und Consuela, begleitet von einigen Anhängern Arturo Ramos’, das Dorf verließen. Aber das musste auch den Männern klar sein, die ihn und die Frau in Ramos Schlupfwinkel bringen wollten.
Irgendwann schlief McQuade über diesen Gedanken ein.
Aber der Schlaf war nur von kurzer Dauer. Das ferne Dröhnen von Schüssen weckte ihn erneut. Es war ein rasendes Gewehrfeuer, das wohl eine halbe Minute lang anhielt und nach und nach verebbte. Schließlich war die letzte Detonation verklungen und lastende Stille schloss sich dem Schusslärm an. McQuade kroch noch einmal zur Luke und lauschte nach draußen.
Es blieb still – den Texaner mutete es an wie die Stille des Todes. Gedanken rasten durch sein Bewusstsein, und er stellte sich Fragen. Ein furchtbarer Verdacht stieg in McQuade auf, der ihn in seinem Innersten entsetzte. Der Verdacht wurde unvermittelt zur Gewissheit und die Erkenntnis fuhr ihm eiskalt in die Glieder.
Einige der Dorfbewohner waren den Rurales gefolgt, und als die ahnungslosen Grenzreiter schliefen, wurden sie gnadenlos zusammengeknallt.
Großer Gott! Sie kannten weder Gnade noch Erbarmen. Das war Krieg.
McQuade kroch zurück zu seiner Decke, nahm die Henrygun und tastete sich vor bis zu der Leiter, stieg sie im Finstern hinunter und stieß unten angekommen einen leisen Pfiff aus. Gleich darauf schmiegte sich Gray Wolf, der in einer leer stehenden Box geschlafen hatte, an sein Bein und ließ ein leises Fiepen hören. „Go on, Partner“, murmelte der Mann und ging zum Tor, durch dessen Ritzen etwas Helligkeit schimmerte.
Gleich darauf stand der Kopfgeldjäger im Freien; tief saugte er die frische Nachtluft in seine Lungen. In dem Moment, als er im Schutz des Schattens, den der Stall warf, nach rechts weggleiten wollte, erklang eine klirrende Stimme: „Wo willst du hin, Americano? Hat man dich nicht gewarnt? Willst du sterben?“
„Ich hörte Schüsse“, versetzte McQuade.
„Kümmere dich nicht darum. Und jetzt geh in den Stall zurück und bleib dort, bis wir morgen Früh aufbrechen.“
McQuade wusste, dass es sinnlos war, Fragen zu stellen. Darum schwieg er und kehrte in den Stall zurück, zog das Tor hinter sich zu und kletterte wieder auf den Heuboden. Er fand keinen Schlaf mehr. Einen Augenblick lang dachte er daran, sich den Weg aus Villa Verde freizukämpfen. Mit den Kerlen, die um die Pulqueria verteilt waren, um aufzupassen, konnte er fertig werden. Aber da war Consuela. Für sie fühlte er sich nach wie vor verantwortlich und er musste sie vor dem Schlimmsten bewahren, sollte sich bestätigen, was er insgeheim vermutete: Ihr Bruder war kein Revolutionär, den irgendeine patriotische Gesinnung zum erklärten Gegner der Regierung Juárez’ gemacht hatte, sondern ein skrupelloser und brutaler Bravado, der unter dem Deckmantel des Patriotismus raubte, mordete und brandschatzte. Möglicherweise streute er sogar den Männern, die ihm loyal zur Seite standen, Sand in die Augen.
McQuade wollte Arturo Ramos persönlich kennenlernen.
Dass er ein tödliches Risiko einging, wusste und akzeptierte er. Der Tod hatte für ihn längst seinen Schrecken verloren, zu oft war er mit ihm konfrontiert worden, zu oft hatte er ihm ins höhnisch grinsende Auge geschaut.
Durch die Ritzen zwischen den Brettern konnte er sehen, dass der Morgen graute. Eine Amsel begann zu pfeifen. Der Kopfgeldjäger rollte seine Decke zusammen, hängte sich seine Satteltaschen über die Schulter und kletterte, das Gewehr in der rechten Hand, die Leiter hinunter.
Im Stall war es immer noch finster wie im Vorhof der Hölle, doch als der Texaner das Stalltor aufzog, wich die Dunkelheit grauem Dämmerlicht. Gray Wolf strich heran und drängte sich gegen den Kopfgeldjäger. Er streichelte einige Male über den Kopf des treuen, klugen Tieres, dann machte er sich daran, sein Pferd zu satteln.
Er legte dem Falben gerade das Zaumzeug an, als Consuela und zwei Mexikaner erschienen. Es waren zwei von denen, die am Abend zuvor in die Pulqueria gekommen waren und von denen einer versichert hatte, dass sie ein Auge auf McQuade haben würden.
Niemand sprach ein Wort. McQuade wartete, bis Consuela und die beiden Mexikaner ihre Pferde gesattelt hatten, dann verließen sie nacheinander den Stall. Nach und nach ritten aus verschiedenen Richtungen Männer heran, und zuletzt bestand die Rotte, die Consuela und McQuade begleiten würden, aus sieben finsteren, bärtigen Kerlen, die mit Gewehren und Revolvern bewaffnet waren. Vier von ihnen trugen Patronengurte über Brust und Schulter. Sie vermittelten den hartgesottenen Eindruck von Männern, die notfalls in die Hölle reiten und dem Satan ins Maul spucken würden.