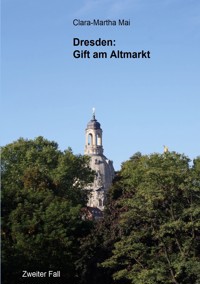Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Renate, 76, lebt seit ihrer Kindheit in einer Villa in bester Wohnlage. Sie hat sich immer erwartungsgemäß verhalten. Sie hat ein gutes Abitur nach Hause gebracht, sie hat den Kollegen ihres Vaters geheiratet, sie hat einen Sohn zur Welt gebracht. Nun ist sie die Erbin, die über allen Wohlstand verfügt. Ihr Glück ist unbeschreiblich, als sie auch noch ein Enkelkind bekommt. Dass dieses kleine Herzchen nicht von ihrer Schwiegertochter auf die Welt gebracht wurde, bleibt ein Geheimnis. Selbst Renate weiß nichts Genaues. Als die Kleine 12 ist, geht sie gemeinsam mit ihrer Oma auf Wahrheitsfindung und dann nimmt das Leben in der Villa kriminelle Wendungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Renate, 76, lebt seit ihrer Kindheit in einer Villa in bester Wohnlage. Sie hat sich immer erwartungsgemäß verhalten. Sie hat ein gutes Abitur nach Hause gebracht, sie hat den Kollegen ihres Vaters geheiratet, sie hat einen Sohn zur Welt gebracht. Nun ist sie die Erbin, die über allen Wohlstand verfügt. Ihr Glück ist unbeschreiblich, als sie auch noch ein Enkelkind bekommt. Dass dieses kleine Herzchen nicht von ihrer Schwiegertochter auf die Welt gebracht wurde, bleibt ein Geheimnis. Selbst Renate weiß nichts Genaues. Als die Kleine zwölf ist, geht sie gemeinsam mit ihrer Oma auf Wahrheitsfindung und dann nimmt das Leben in der Villa kriminelle Wendungen.
Clara-Martha Mai
Geboren bin ich in Leipzig und übersiedelte 1989 - vor dem Mauerfall - nach Dresden. Es war die Liebe, die Landschaft und die Elbe, der ich nahe sein wollte. Ich genieße es noch immer.
Beruflich liegt ein langes, spannendes Leben hinter mir. Viele Jahre war ich Dozentin an einer sächsischen Polizeifachschule.
Meine Geschichten handeln von Menschen, die ihrem Leben mehr Glück abringen, als das Schicksal ihnen zudachte; von Menschen, die sich aus misslichen Lagen befreien und vom Ungestüm der Jugend.
Mein Anliegen ist es, zu unterhalten, zu amüsieren und neugierig zu machen auf die Stadt, auf die Menschen und auf meine nächste Geschichte.
Welchen Sinn macht es, ein unglückliches Leben zu führen?
Mein Leben hat nach meinen Wünschen zu verlaufen. Das verlange ich einfach. Ich dulde es nicht, dass Unangenehmes die Sonne meiner Lebensfreude verdunkelt. Schließlich ist das Gefühl des Glückes eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. Ab und zu hat es Situationen gegeben, die mir zuwider waren. Doch ich habe das Blatt immer gewendet, zu meinen Gunsten. Sechsundsiebzig Jahre bin ich jetzt alt und wer weiß, wie lange mich der Herrgott noch hier wandeln lässt. Es ist keine Frage, ob ich sterben werde, die Frage ist, ob ich die Umstände dieses Ereignisses noch verbessern kann. Wie werde ich vor der langen Reihe meiner Ahninnen stehen, wenn ich das große Tor durchschritten habe? Die Männer meiner Vergangenheit fürchte ich nicht, sie sind mir egal. Was werden die Frauen mich fragen? Werden sie mich willkommen heißen? Werden sie sich von mir abwenden? Nein, das werden sie nicht tun! Ich habe meine Sache gut gemacht! Werden sie mich fragen, warum ich dieses oder jenes so entschieden und getan habe? Werden sie schon alles wissen? Jedenfalls ist die lange Kette des familiären Fortbestandes nicht in meiner Generation abgerissen. Ich habe einen Sohn zur Welt gebracht, die Tochter war mir nicht vergönnt. Das gibt mir die Hoffnung - fast schon die Gewissheit - im Jenseits eine von ihnen zu sein. Wie wird es sich anfühlen, wenn ich meine liebe Mutter endlich wieder an mein Herz drücken werde? Wir werden uns anschauen und uns kaum merklich zuzwinkern. Sie und ich wissen, dass alle Frauen dieser Blutlinie aus dem gleichen Holz geschnitzt waren und sind.
Ich bin wie meine Mutter. Sie hat alles für ihre Familie getan. Das war jedenfalls ihre Überzeugung. Doch in Wahrheit tat sie es weniger für ihre Angehörigen. Sie hatte ihr eigenes Wohl im Sinn. Sie hat mich diese Kunst gelehrt. Sie hat mir beigebracht, wie man es anstellt, dass das Haus voll ist, das selbst die erwachsenen Kinder lieber im Elternhaus bleiben, als eigenständig zu werden.
Ich selbst habe es erleben dürfen, als Erwachsene noch, unter Mutters Fürsorge zu stehen. Ich hätte nichts anderes gewollt. Sie hat mich auch gelehrt, wie man es anstellt als Seniorin von der Familie nicht abgeschafft zu werden. Sie war mir eine weise Lehrmeisterin.
Die erste Voraussetzung dazu ist ein Haus, in dem jeder ein bequemes und repräsentatives Auskommen hat. Außerdem muss dieses Haus Begehrlichkeit bei anderen wecken. Das Wichtigste ist aber, dass es einem uneingeschränkt gehört, unantastbar. So war es bei allen meinen Vorfahrinnen. Das Haus wurde traditionsgemäß immer von der Hausherrin an die Lieblingstochter vererbt. Alle anderen in der Erbfolge mussten sich abfinden lassen. Nun gehört die Villa mir.
Sie steht, nach Süden ausgerichtete, am oberen Elbhang im östlichen Dresden. Als einer meiner Vorfahren sie erbaute, gehörte der Ort – nein besser das Dorf - Loschwitz noch nicht zur Stadt Dresden. Am rechten Elbufer standen einige Fachwerkhäuser, in denen Fährleute, Waschfrauen, Fischhändler und Fuhrwerksbesitzer lebten. Barfüßige Kinder und räudige Katzen suchten nach interessanten Dingen, die das Rinnsal Trille in die Elbe spülte. Es roch nach Asche und Spülwasser und die Katzen hatten mehr Erfolg als die Kinder. Hinter dem schmalen Ufer der Elbe erhob sich das Plateau des Hochlandes. Steil und felsig, nicht zu gebrauchen für die Landwirtschaft. Wein baute man an. Das ging einigermaßen, doch es war zu wenig, um davon leben zu können. Mancher bot Fremdenzimmer an, denn es war ein hübscher Ort. Maler kamen und Wanderer. Sie priesen diese Gegend. So kaufte sich mancher ein Weinbergchen, obwohl er gar kein Winzer war. Loschwitz wurde modern! Es wurde der Ort, an dem die Höflinge des Dresdner Hofes, der Goldschmied des Königs, die Kammerherren seiner Majestät und die königliche Verwandtschaft ihre Sommersitze hatten. Einer aus des Königs Gefolge war mein Urahn.
In diesen Weinbergen standen erst kleine Hütten – die Unterstände für die Gerätschaften, die man für die Arbeit brauchte.
Die Winzer stiegen für die Pflege der Rebstöcke viele, viele Stufen den Hang hinauf. In schweren, vollen Körben wurden die geernteten Trauben diese Stufen wieder hinuntergetragen, zu den Pressen in den Weinkellern. Eine lange Tradition von Winzern hatte sich entwickelt - bis die Reblaus kam. Böse Zungen behaupteten, die Reblaus wäre in einer Kutsche, im Gepäck eines Spekulanten, angereist. Es sollen Weidenkörbe gewesen sein, in denen man die befallenen Weinstöcke transportiert hatte. Meine Mutter zwinkerte mir damals auf ihre unvergleichliche Art zu, als sie mir diese Geschichte erzählte. Dann flüsterte sie: »Diese Körbe haben lichterloh gebrannt, als man sie verschwinden ließ.« Außerdem wurde es zu jener Zeit schick, Bier zu trinken. Die Winzer haben sich leichten Herzens von den nutzlos gewordenen, steilen Hängen getrennt. So ein Glück für uns. Es dauerte wenige Jahrzehnte und aus der ländlichen Gegend wurde der nobelste Vorort der Residenzstadt Dresden. Die Pracht vergangenen Wohlstandes macht diese Gegend noch immer einzigartig.
Doch die Menschen haben sich verändert.
Als ich ein Kind war, gaben sich die Leute hier ganz anders. Ich bin aufgewachsen zwischen Männern, die die Hüte zogen, wenn sie einander begegneten. Frauen traten nur vor die Tür, wenn sie gut frisiert waren und auch sonst einen untadeligen Anblick boten. In allen Häusern arbeiteten Dienstboten, die mit gesenktem Blick die Anweisungen ihrer Lohngeber entgegennahmen und mit einem Knicks oder einem Diener die Aufträge bestätigten. So weit ging es mit der Ergebenheit in unserem Haus nicht, doch auch wir hatten Personal. Ich vermisse diese Lebensart und die galante Höflichkeit so sehr, die meine Mutter so wunderbar beherrschte. Ich vermisse die Distanz der Herrschaften zu den banalen Tagesangelegenheiten. Alles hatte seine Ordnung, seinen Rang und darauf konnte man sich verlassen. Als Kind hatte ich das Gefühl, als ob mit dem Erreichen des Seniorenalters die Krone der Würde auf den weißen Haaren wuchs. Niemand wagte an den Worten der Großeltern zu zweifeln. Was sie sagten, war immer wahr und richtig. Manchmal zweifle ich jetzt, ob das alles wirklich so gewesen ist. Vielleicht habe ich es nur geträumt.
Wie kann sich die Welt in so wenigen Jahrzehnten dermaßen verändern, ja geradewegs kopfstehen?
Wenn ich mich umschaue in meiner Nachbarschaft, werde ich traurig. Ich glaube, ich bin die letzte Greisin, die noch in Freiheit lebt. Wo sind sie alle hin, die würdevollen Alten, die mit silbernen Griffen an ihren Gehstöcken in den Kaffeehäusern der Stadt saßen und ihre Pensionen und Dividenden mit Sherry oder Torte verprassten? Wo sind die häkelnden und stickenden Großmütter, die ihren Enkeln Geschichten erzählten, während diese auf den gepolsterten Bänkchen zu ihren Füßen saßen? Wer lehrt die Kinder jetzt Manieren, Anstand, Herzensbildung? Ich bin wohl die Letzte dieser ausgestorbenen Gattung. Man hat sie abgeschafft.
Jetzt schieben die Alten einen Rollator vor sich her, um die letzten kleinen Notwendigkeiten, die ihre Existenzen noch bedingen, selbst zu erledigen. Sie schlucken Schmerztabletten und besorgen allein, was nötig ist. Nur niemandem zur Last fallen, oder auf der Tasche liegen, nichts brauchen, nichts wollen. Keiner soll ihnen verpflichtet sein, das ist ihr eigenes Bestreben. Die Kinder haben doch alle selbst mit sich zu tun. So schieben sie die luftbereifte Kapitulation ihrer finalen Lebenshoffnung vor sich her.
Natürlich ist damit die Zeit ihrer Mobilität ein wenig verlängert, doch wozu? Wo liegt die Freude dieses Lebens? Darin, das Enkelkind Ostern und Weihnachten mit einem Geldschein anzulocken? Zu sehen, wie es auf der Stuhlkante sitzt und auf den Augenblick wartet, dass es wieder gehen darf? Wo ist die Eintracht, die Loyalität in der Familie geblieben? Wie sehr hat es meine Mutter geliebt, wenn ich ihr die Haare kämmte. Als ich Kind war, fragte sie mich immer beim Kämmen: »Zöpfe oder Dutt, Haarkranz oder Ohrenschnecken?« Dann frisierte sie mit aller Mutterliebe und ich habe es genossen. An dieses Gefühl erinnerte ich mich jedes Mal wieder, wenn ich ihr die Bürste durch die dünnen Haare zog. Sie herzurichten war für mich keine Arbeit, es war ein Augenblick der Innigkeit. Mit welch verschwörerischer Heimlichkeit habe ich sie auf die Toilette begleitet. War sie sich doch einstmals nicht zu schade, mir die Benutzung der Toilette beizubringen.
Es ist kein Lebensabend, den man heutzutage den Senioren gönnt. Die Angehörigen haben sie vor der Zeit in den Wartesaal auf dem Bahnhof des letzten Zuges gesetzt. Sie verabschiedeten sich mit den Worten: »Ich gehe dann mal und lebe mein Leben.
Du bist ja hier gut versorgt, bis es für dich Zeit wird.« Niemand weiß, wann dieser Zug endlich kommt und die Erlösung bringt.
Es gibt nur einen Grund, ein solches Leben zu führen: Der Trotz, möglichst lange die Pensionsansprüche abzufordern. Bei mir ist das anders, dafür habe ich gesorgt.
Mein Leben war von Anfang an auf Rosen gebettet, doch es waren Rosen voller Domen. Es gab Licht und Schatten. Das Licht habe ich gelebt, in Schattenzeiten habe ich die Augen geschlossen und von den Zeiten des Lichtes gezehrt.
Als ich drei Jahre alt war, begann der Zweite Weltkrieg. Anfangs war für mich diese Tatsache so elementar wie das Wetter. Die Erwachsenen sprachen über den Krieg, wo immer sich Gelegenheit bot. Man berichtete von Leuten, die gefallen waren und von anderen, die nun ebenfalls eingezogen wurden. Ich hörte es und in meiner Vorstellung sah ich die gefallenen Leute auf dem Boden liegen, als ob sie über ein Hindernis gestolpert wären. Die Eingezogenen versuchten, mittels Muskelkraft die Bauchwölbung nach innen zu ziehen. Was diese Leute im Feld oder an der Front taten, ahnte ich nicht. Der Soldat hat ein Gewehr, weil das zu seiner Uniform gehört, dachte ich. Wenn die Sirenen heulten und wir alle uns beeilten, in den Keller eines Nachbarhauses zu laufen, hielt ich das für ein Spiel. Jeder wollte der Erste sein, doch es gab keinen Preis für den Sieg. Nur die Letzten wurden mit Bemerkungen wie, ,das wurde aber auch Zeit', gescholten.
Ich war schon immer ein schlechter Esser und so war es keine Entbehrung für mich, dass die Teller nur wenig gefüllt waren.
Schlimm waren für mich eher die Festtage, an denen reichlich gegessen wurde. Mein Magen meldete meistens schon beim Anblick des Essens, dass er satt sei. Den Hunger und die Lebensmittelknappheit habe ich nie gespürt. Krieg war etwas, dass ganz weit draußen in der Welt stattfand und eine große Faszination auf die Erwachsenen ausübte, denn wenn sich zwei trafen, gab es kein anderes Thema. Ganz zum Schluss kam der Krieg dann doch noch nach Dresden. Danach kam die Zeit, in der man sich schämte, wenn es einem ein wenig besser ging, als den verhungerten Flüchtlingen unten in der Stadt, die auch hier nicht wirklich willkommen waren. In meiner Erinnerung bestand die Stadt ausschließlich aus Trümmern und Schutthaufen. An den Zustand davor hatte ich keine Erinnerung. Als wir Kinder dann wieder Unterricht hatten, führte mein Schulweg hinunter in den Ortskern von Loschwitz. Auch dort war die Welt noch weitgehend in Ordnung. Doch wenn ich auf meinem Schulweg morgens, bei Dunkelheit, auf die Stadt jenseits der Elbe sah, ahnte ich das Grauen jener Februarnacht. Dunkelheit lag über den Trümmern. Leere Fensterhöhlen, hinter denen das Zimmer fehlte, gaben den Blick in den Himmel frei. Besonders schauderhaft war es, wenn der Mond hell schien. Wer weiß, wie viele Gebeine noch unter den Trümmern der zerbombten Häuser lagen und darauf warteten, bestattet zu werden. An manchen Stellen stieg Rauch auf. Ein Zeichen dafür, dass zwischen all dem Chaos Menschen einen Unterschlupf gefunden hatten. Unser Haus war unbeschadet geblieben und so empfand ich, was ich sah, als surreal, als unwirklich. Ich ließ das Leid der Menschen jenseits der Elbe nicht an mich heran. Erst viel später begriff ich das Ausmaß dieses Elends.
In dieser Zeit schlossen meine Mutter und ich ein stillschweigendes Bündnis für alle Zeiten. Wir erkannten unsere Seelenverwandtschaft. Wir musizierten oft miteinander und vermieden es, das Haus zu verlassen. Wenn wir dem Anblick des Elends nicht entfliehen konnte, sagte Mama: »Schau nicht hin, Kind. Das war Gottes Wille.«
Nach dem Krieg, ich war inzwischen neun, bedrohten die Russen unser Familienleben. Die Eltern bangten, das Haus zu verlieren. Im Nachbarhaus hatten sich diese groben Uniformträger bereits einquartiert und alles, was sie fanden, für ihre Zwecke verwendet. Sie verbrannten wertvolle Möbel, um auf diesem Feuer eine erbärmliche Mahlzeit zu bereiten. Sie soffen den Weinschatz der Nachbarn in einer Nacht aus, den man über ein Jahrhundert gesammelt hatte. Dann spien sie und urinierten im Garten. Sie machten sich einen Spaß daraus, in die Luft zu schießen, um mich zu erschrecken, wenn sie mich sahen. Ich rannte dann, so schnell ich konnte ins Haus. Von draußen hörte ich ihr grölendes Gelächter. Meine Eltern waren damals der Meinung, dass es nur eine Frage der Zeit sei, wann die Besatzung wieder abrückt und alles so wird, wie es einst war. Sie sollten Recht behalten, nur in den Zeiträumen täuschten sie sich. Die Russen blieben. Ich weiß nicht, wie mein Vater es anstellte, doch wir behielten das Haus. Alle Nachbarn mussten Flüchtlinge aufnehmen. Wir nicht. Sicher wären meine Eltern mit uns Kindern in den Westen gegangen, wenn wir die Villa verloren hätten. So blieben wir. Wir arrangierten uns mit den Roten und schlugen uns politisch durch. Weder ideologische Anpassung noch Gegenwehr waren je meine Sache. Ich hatte meinen Eigensinn und meine Erziehung, meine Mutter und das sorgenfreie Leben einer jungen Dame aus gutem Haus.
Streit gab es selten, weder in meiner Jugend, noch als Erwachsene. Ich hielt die Zügel des familiären Einflusses fest in meinen Händen. Wie man das anstellt, lernte ich von Mama und es war wohl die größte Gabe, die ich von ihr erhielt, neben dem Haus natürlich. Es obliegt den Frauen, Entscheidungen zu treffen.
Männer wollen kämpfen, sich messen, sich reiben. Wie untauglich für Familienangelegenheiten! Da sind andere Fähigkeiten gefragt.
Schaue ich jetzt beim Abendessen von meinem Teller auf, erfüllt mich Stolz. Wenn es nach meinem Sohn Reinhard gegangen wäre, würde ich schon seit Jahren in einer Seniorenresidenz verwaltet. Doch das konnte ich verhindern. Das Abendessen im Kreis meiner Familie ist der Höhepunkt meines Tages.
Jetzt, Anfang Juni, kommt die Dämmerung spät und zur Essensstunde scheint die Sonne direkt auf die halbrunde Terrasse hinter mir. Das Zimmer liegt im goldenen Glanz dieses Lichtes. Das Mahagoniholz der Möbel zaubert einen roten Schein auf die zartgelben und weißen Streifen der Stofftapete. Die geschliffenen Glasanhänger des Kronenleuchters, die Spiegel hinter den gläsernen Wandlampen und auch die Stuckrosette an der Decke, alles ist in rötliches Abendlicht getaucht. Selbst die weiße Tischdecke, das weiße Geschirr mit dem Goldrand und die geschliffenen Gläser sind davon verzaubert. Ich liebe dieses Spiel der Sonne. Meine Mutter schloss dann die Fensterläden, um zu verhindern, dass Möbel und Tapeten verbleichen. Ich tue das nicht. Die wenigen Jahre, die mir noch verbleiben, wird das Interieur dem Sonnenlicht trotzen. Was danach wird, ist mir egal.
In diesem zarten Abendschein sind die Gesichter meiner Angehörigen gut beleuchtet und ich sitze im Gegenlicht. In letzter Zeit passiert es schon mal, dass mir ein Tröpfchen Suppe vom Löffel schwappt. Bei dieser Beleuchtung fällt das gar nicht auf.
Die beiden Stühle an den Stirnseiten des Tisches haben Armlehnen. Als Kind dachte ich immer, dass es ein besonderes Zeichen von Würde und Machtstellung sei, auf einem solchen Stuhl sitzen zu dürfen, denn sie waren Mama und Papa vorbehalten.
Inzwischen habe ich den praktischen Nutzen der Einrichtung erkannt. Sich auf die Armlehnen zu stützen, erleichtert das Aufstehen. In meinem Alter ist man für Hilfe dankbar. Doch ich würde mir das niemals anmerken lassen.
Mein Sohn Reinhard sitzt auf dem anderen Armlehnstuhl mir gegenüber, doch weit entfernt. Dafür, dass er sich in seinem Leben nie angestrengt hat, sieht er ziemlich alt aus mit seinen siebenundvierzig Jahren. Das Blond ist großflächig dem Grau gewichen. Seine Augenbrauen und die Wimpern haben noch immer den ursprünglich blassblonden Farbton. Die grauen Augen und die weiße Haut lassen ihn beinahe kränklich erscheinen, doch das täuscht. Er strotzt vor Vitalität. Im Augenblick konzentriert er sich auf seinen Teller und ich weiß warum. Wie jeden Abend hat er auch heute noch Pläne, aushäusig versteht sich. Ich weiß nicht, in welchem Zustand er sein wird, wenn er nachts nach Hause kommt und wann das geschieht. Ich habe es mir abgewöhnt, auf ihn zu warten, als er sechzehn war. Vielleicht wartet Maria, seine Frau, auf ihn? Sie sitzt rechts von mir an der langen Seite des Tisches. Ein Schmunzeln zieht über mein Gesicht. Niemand beachtet mich. Sie braucht die größere Ellenbogenfreiheit, wenn sie Besteck in den Händen hält. Sie hat es nie gelernt, ordentlich zu essen. Außerdem ist sie in den fünfzehn Jahren, die sie hier lebt, jedes Jahr ein wenig breiter geworden. Wenn das so weiter geht, werden wir ihr bald die kleine Bank aus der Eingangshalle hinstellen müssen. Ihr gegenüber sitzt Katharina. Sie ist zwölf und die Freude meines Lebens.
Zwei Stühle sind leer. Mein sehnlichster Wunsch ist es, alle Plätze an diesem Tisch besetzt zu sehen, ja, vielleicht die Tischplatte zu verlängern, um alle um mich zu scharen, die dazu gehören. Früher war es normal, dass ein Mann mit fünfzig durchaus noch Vater wurde. In unseren Kreisen war es die Regel. Vielleicht überrascht mich Reinhard in dieser Hinsicht noch einmal. Zwillinge, bitte! Am liebsten Mädchen, das wäre so schön. Es ist der letzte Traum, den ich noch habe.
Jeden Abend sitzen wir in dieser Runde und essen, was ich mit Helgas Hilfe gekocht habe. Diese Mahlzeit pünktlich einzuhalten, ist die einzige Anforderung, die ich an meinen Sohn und seine Frau stelle. So weit sind meine Ansprüche gesunken. Auch die Tischsitten habe ich gelockert. Früher saß mein Vater auf meinem Stuhl und meine Mutter auf Reinhards, allerdings im Zimmer eine Etage höher. Ich hatte Katharinas Platz und meine ältere Schwester Ruth saß auf Marias Stuhl. Erst als wir Kinder tadellos mit Besteck umgehen konnten, durften wir an der Tafel der Erwachsenen sitzen. Vorher bekamen wir unser Essen in der Küche, gemeinsam mit dem Personal. Ruth war Vaters Liebling, ich Mutters und wir Mädchen hassten uns. So unterschiedlich unser Aussehen war, so unterschiedlich waren wir im Herzen.
Sie war für ihr Alter viel zu groß, ich zu klein. Sie ähnelte Vater, ich Mutter. Sie wollte die Welt erobern, ich liebte schon damals die Musik. Sie las nur wahre Geschichten und Expeditionsberich-te, ich schwärmte schon als Kind für Matthias Claudius.
Wir wohnten damals in den oberen Stockwerken der Villa. Im Erdgeschoss hatte Vater seine Arztpraxis.
Hals-Nasen-Ohren-Arzt Dr. Richard Buchhorn stand auf dem glänzenden Klingelschild am großen Gartentor. Drei Meter klafft die Lücke im Zaun, wenn es beidseits geöffnet ist, damals, wie heute. Auf den Gitterstäben des Tores und auf jeder eisernen Zaunsstange thront eine Pfeilspitze in Form einer Lilie. Vom Tor zum Haus führt ein kurzer, kunstvoll gepflasterter Weg. Die drei Stufen hinauf zur Haustür sind im Halbrund vorgelagert, beinahe spiegelgleich der Terrasse hinten. Vom, von der Straßenseite aus gesehen, könnte man sagen, die Fassade sei schlicht, wäre da nicht der kleine Balkon über der Haustür. Will man die ganze Pracht der Villa sehen, muss man es von der Rückseite aus betrachten.
Die Haustür ist ein Kunstwerk: Eichenholz, zweiflüglig, mit Schnitzerei verziert. Im oberen Drittel sind beidseits geschliffene Glasscheiben, von einem schmiedeeisernen Gitter geschützt.
Rechts und links neben der Haustür sind kleine, schmucklose Fenster. Rechts ist es die Küche, links ist es ein Wirtschaftsraum.
Tritt man durch die Haustür, steht man in der Eingangshalle. Sie hat die Größe eines Klassenzimmers und hätte ich sie nicht mit dicken Teppichen und Vorhängen aus Plüsch dekoriert, würde es genauso schallen wie in der Schule. Die Türen zu Esszimmer und Salon sind, ähnlich wie die Haustür, elegant und zweiflüglig. Das geschliffene Glas reicht beinahe über die gesamte Fläche der Türen. Zwischen Esszimmer und Salon ist noch einmal ein Durchlass. Es sind Schiebetüren, die nach beiden Seiten in der Wand verschwinden. Die beiden Räume sind gleich groß und beide haben an der hinteren Wand einen Ausgang zur Terrasse.
Von der Terrasse aus erstreckt sich das Grundstück abfallend nach Südwesten. Der Garten ist lange vor dem Haus entstanden und in den vielen Jahren zu einem Park aufgewachsen.
Das Parkett im Erdgeschoss ist uralt. Ich glaube, es stammt noch aus der Zeit der Erbauung des Hauses. In den Jahren, als alles knapp war, hatte mein Vater Linoleum besorgt und das edle Holz darunter verborgen. An vielen Tagen waren hundert Leute in seiner Praxis und manche hatten genagelte Ledersohlen unter den Schuhen. Das Holz trug Spuren davon und ich hoffte in meiner kindlichen Einfalt, dass diese Verletzungen im Boden schon wieder heilen würden. Schließlich wurden aufgeschlagene Knie auch wieder heil. Doch das hat wohl nicht funktioniert. Ich habe das edle Holz wieder freilegen und reparieren lassen. Linoleum!
Das gehört sich einfach nicht für dieses Haus.
Damals, in meiner Kindheit, saß eine Krankenschwester mit Häubchen, hellblauem Kittel und einer Schürze darüber, an einem kleinen Tisch in der Eingangshalle. Sie war groß und blass und sie benahm sich, wie man es von Personal erwartete. Immer, wenn jemand von den Buchhorns in der Halle erschien, erhob sie sich und grüßte. Beim ersten Mal des Tages mit vollem Namen, bei allen weitem Malen nur mit einem Nicken. Ruth machte sich oft einen Spaß daraus sie aufspringen zu lassen. Wenn Mutter kam, sagte die Angestellte: »Guten Morgen, Frau Dr. Buchhorn.« Mutter sagte jedes Mal: »Frau Buchhorn reicht, Fräulein Schuster. Der Doktor sitzt da drin.« Doch am nächsten Tag wiederholte sich das Spiel. Schon sehr früh wusste ich, dass ich niemals so leben wollte wie Fräulein Schuster. Ihr Anblick im Vergleich zu meiner Mama machte das schon deutlich. Wer will eine so unvorteilhafte Kopfbedeckung tragen und dann diese Schuhe: flach, braun und mit Schnürsenkeln zugebunden. Nein, ich wollte selbst Mama werden und immer gut angezogen sein.
Fräulein Schuster nahm die Papiere der Patienten entgegen, suchte aus einer Kommode die Unterlagen heraus und sorgte für die richtige Reihenfolge der Patienten. Wenn mein Vater sie rief, musste sie alles stehen und liegen lassen und ihm assistieren. Ihn umgab eine göttliche Aura. Niemand wagte, ihm zu widersprechen. Wenn er einen Raum betrat, erstarben alle Gespräche und die Aufmerksamkeit der Anwesenden richtete sich auf ihn. Manehe Patienten reisten von weit her an, um sich nur von ihm behandeln zu lassen. Wie schrecklich mussten dann erst die anderen Ärzte sein, wenn man als Patient die Wahl hat und sich für ihn entscheidet? Ruth bewunderte ihn dafür. Ich hasste gerade das, denn er ließ niemanden neben sich gelten. Mutter begegnete ihm mit kränkelnder Abweisung. Wann immer er etwas von ihr erwartete, rieb sie sich die Stirn und antwortete:
»Gleich, Richard, sobald es mir besser geht.« Dann schlich sie - sich an den Möbeln festhaltend - zum Sofa und legte sich hin.
Man brachte ihr die Kopfwehkompresse - ein feuchtes Tuch mit Minze parfümiert. Es wurde zur Gewohnheit, dass Vater bei kleinen Handreichungen jede andere Person im Haushalt bevorzugte, ehe er Mutter fragte. Mit kindlicher Intuition erfasste ich, dass es Mutter gut ging, wenn Vater nicht zugegen war. So war auch ich fröhlich und unbefangen, wenn Vater beschäftigt war. War er jedoch anwesend, so spürte ich Spannung, die mir jede Ausgelassenheit verdarb.
An den Seiten der Eingangshalle standen damals Stühle und Bänke. Es war sein Wartezimmer. Der einzige Schmuck in diesem Raum war ein überlebensgroßes Porträt meiner Ururgroßmutter Theresa, die ihre Enkelin Helene – meine Großmutter - auf dem Schoß hielt. Theresa war adligen Geblütes, jedoch bürgerlich verheiratet. Sie war schon siebenundzwanzig, als sie Ja zu dem Erben einer großen Brauerei sagte. Sie verlor ihren Titel und die Rechte ihrer edlen Herkunft, dafür gebar sie bereits im Äderten Monat ihrer Ehe eine gesunde Tochter. Das Mädchen wurde auf den Namen Konstanze getauft. Sie hatte das lebenslustige Naturell ihres Vaters und sie machte ihren Eltern Schande. Im Alter von fünfzehn Jahren verließ sie bei Nacht und Nebel ihr Elternhaus. Sie hatte den gesamten Bargeldvorrat mitgenommen und – wie sich später herausstellte – auch die kostbarsten Schmuckstücke ihrer Mutter. Damals, nach Konstanzes Geburt ergriff Theresa die Schwermut und ließ sie nicht mehr los. Man munkelt, dass wohl dieser Umstand hauptsächlich dazu beigetragen hätte, dass Konstanze auf und davon sei. Nach einigen Monaten kam ein Brief, in dem Konstanze um Hilfe bat. Sie hatte Zuflucht in einem Kloster gesucht und sie war schwanger.
Die Geschichte ist schon lange her und manches ist auch nicht genau überliefert, doch Tatsache war, dass der bierbrauende Großvater zu diesem Kloster reiste und eine Menge Geld im Gepäck hatte. Nachdem er zurückkam, begann Theresa sich mehr und mehr Kissen unter die Röcke zu schieben, bis schließlich eines Tages – wieder bei Nacht und Nebel – der Großvater ein kleines Mädchen aus dem Kloster abholte und ins Haus brachte. An diesem Tag war Theresas Schwermut geheilt. Das Kind wurde auf den Namen Helene getauft und wuchs als Theresas Nachzügler auf. Über Theresas Ehemann ist nicht viel überliefert. Er verdiente gutes Geld mit gutem Bier, hoffte vergebens auf einen männlichen Nachfolger in seinem Unternehmen und war auch später über seine Enkelin, die kleine Helene, nicht wirklich glücklich. Sie hatte nicht nur das falsche Geschlecht, er konnte sie nicht fürs Bierbrauen interessieren. Als Theresa fünfzig war, erkrankte sie. Sie muss gefühlt haben, dass sie nicht mehr genesen wird. Sie wünschte sich, dass man sie nicht vergisst, nicht ihre edle Herkunft und ihre große Liebe zu dem kleinen Mädchen. Also musste ihr Mann wieder tief in die Tasche greifen. Er ließ den besten Porträtmaler kommen, der zu finden war und dieses wunderbare Bild entstand. Wenige Wochen nach Fertigstellung des Gemäldes zog sich Theresa in ihr Zimmer zurück und ein halbes Jahr später trug man sie zu Grabe. Doch sie ist in meinem Haus noch immer so lebendig anwesend durch dieses Bild, als ob sie wirklich im Raum wäre. Man sieht sie kerzengerade auf dem Sofa sitzen. Sie trägt ein schwarzes Kleid und einen Hut. In ihrem Gesicht ist schon der Abschied zu erkennen, der bereits begonnen hat. Auf dem Schoß liegt Helene, ihr Liebling. Sie schaut den Betrachter mit offenem Blick aus wunderschönen blauen Augen direkt an. Helenes Kleid ist sommerlich leicht und hell. Theresas rechte Hand liegt schützend auf ihr. Die linke liegt auf ihrem Schoß und die blonden Locken des Kindes wallen weich über ihre Hand. Es ist ein Anblick der Eintracht, der Liebe und der Innigkeit. Ich weiß nicht, wie oft ich vor diesem Bild stand und mit den beiden gesprochen habe. Jede Sehnsucht und jeden Zweifel habe ich zuerst ihnen mitgeteilt, ehe ich meine Mutter oder einen anderen Menschen damit behelligt habe. Erst spät, aus den Briefen im Nachlass meiner Mutter erfuhr ich, dass der Bierbrauer ein Kindermädchen für Helene eingestellt hat. Das Kind gedieh prächtig und auch dem Großvater muss es in der Gesellschaft der Kinderfrau gut gegangen sein.
Mein Vater fand das Bild kitschig und unpassend und am liebsten hätte er es versilbert. Doch meine Mutter hielt daran fest. Es entstammte ihrer Erbschaft! Man hatte keinen anderen Platz für das Gemälde und eigentlich wollte Vater es auch nicht in der Eingangshalle haben. Es gefiel ihm nicht. Er musste sich abfinden. Doch ich habe es immer geliebt. Deshalb hängt es jetzt im Esszimmer und Theresa lächelt milde auf ihre Nachfahren herab, wenn wir bei Tisch sitzen.
Da, wo jetzt das Esszimmer ist, hatte mein Vater den Behandlungsraum. Behandlungsliegen und Gerätschaften standen für therapeutische Maßnahmen und kleinere Eingriffe bereit. An den Wänden hatte er Schränke aus weißem Metall mit Glasscheiben aufgestellt. Vater hielt sie immer geschlossen, doch wir Kinder konnten durch die Scheiben sehen, was darin lag.
Ich habe mich vor den Instrumenten in den Vitrinen gefürchtet.
Ruth kannte jedes dieser Werkzeuge beim Namen: Ohrtrichter, Otoskop, Vergrößerungsokular, Nasenspekulum, Kehlkopfspiegel, scharfer Löffel...
Manchmal, wenn er einem kranken Kind das Trommelfell durchstach und das arme Würmchen wie am Spieß schrie, habe ich mir die Ohren zugehalten und ihn zur Hölle gewünscht.
Meine Schwester sagte in solchen Momenten gönnerhaft: »Nun geht es dem Kind bald besser.«
Ich hätte sie dafür erwürgen können, doch sie war stärker als ich und größer. Vaters Sprechzimmer, neben dem Behandlungszimmer, war der schönste Raum im Haus. Später, als er nicht mehr hier praktizierte, richtete meine Mutter den Salon dort ein. Jetzt nennen wir diesen Raum nur Wohnzimmer. Doch das Wort wird ihm nicht gerecht. Auch von hier aus könnte man die Terrasse betreten. Ich mag es nicht, wenn diese Türen offen sind. Zugluft schadet meinem Konzertflügel. Deshalb habe ich einen kleinen Lesetisch und zwei Sessel vor die Türen gestellt, damit niemand auf die Idee kommt, die Tür zu öffnen. Meistens steht auf dem Lesetisch ein großer Blumenstrauß aus unserem Garten, von mir selbst gepflückt. Im Winter liefert ihn der Gärtner. An dieser Stelle hatte mein Vater seinen wuchtigen Schreibtisch. Er hatte zwei Schreibtischlampen auf diesem Tisch stehen. Sie waren eingeschaltet von morgens bis abends. Er brauchte das weiße Licht der Lampen, um die Hautfarbe seiner Patienten gut zu sehen, sagte er mir, als ich ihn fragte, ob es nicht Verschwendung sei, am Tage die Lampen einzuschalten? Wenn der große, hagere Mann über den Rand seiner Brille sah, fühlte man sich bedroht.
Ruth sagte als Erwachsene einmal, dass sie von ihm in dieser Pose gern ein Gemälde gehabt hätte. Wie furchtbar, wenn dieser Blick in einem Raum allgegenwärtig ist!
Die Küche der Familie war und ist noch immer im Erdgeschoss.
So konnte zur Mittagszeit damals jeder Patient riechen, was Buchhorns in den Töpfen hatten. Im letzten Kriegsjahr und in der Hungerzeit danach haben wir nur noch abends gekocht. Es wäre grausam gewesen, denen gegenüber, die mit leerem Magen im Wartezimmer saßen. Noch immer ist das Abendessen die Hauptmahlzeit und alle meine Familienmitglieder versammeln sich um mich alte Dame, um mir Gesellschaft zu leisten. Oh, wie ich das genieße!
Meine Mutter erzählte mir, als ich etwa in Katharinas Alter war, dass gemeinsamen Mahlzeiten früher zur Quälerei für die Kinder ausarteten. Es war bei Strafe verboten, zu sprechen. Weil es so mucksmäuschenstill war, gelangte jedes kleine Geräusch an alle Ohren. Kein Besteckklappern, kein Husten und kein Schmatzen wurden geduldet. Wenn das Familienoberhaupt das Besteck hinlegte, war das Essen beendet - für alle. Es gab eine weitere eiserne Regel für die Kinder: Sitzt still! Man fürchtete, dass die raue Kinderkleidung die Atlasseide der Polsterbezüge durchrieb. Meine Eltern waren nicht so streng und ich habe die Zügel in dieser Hinsicht noch lockerer gehalten. Wann, wenn nicht beim Essen, sollen wir miteinander reden? Auch wenn es meiner Schwiegertochter guttäte, muss niemand sein Essen beenden, wenn ich genug habe.
Dass Maria heute etwas auf dem Herzen hat, habe ich schon den ganzen Abend gespürt. Ich wundere mich, dass sie nicht schon während der Suppe damit herausgeplatzt ist. Sie passt so gar nicht zu uns und in dieses Haus. Sie ist so anders wie ich und die Reihe der würdigen weiblichen Ahnen. Sie ist so ungeschickt mit Worten, so direkt. Manchmal denke ich, dass genau das ein Auswahlkriterium für Reinhard war. Obwohl sie den Mund noch voll hat, die Serviette nicht benutzt, beginnt sie: »Renate, Katharina, wir müssen euch etwas mitteilen.«
Anfangs hatte sie den Drang, mich, Mutter' zu nennen. Wie furchtbar! Dann wäre der Eindruck entstanden, dass sich ein Geschwisterpaar vermählt hätte. Außerdem könnten Unwissende denken, ich hätte sie geboren und großgezogen. Das musste ich korrigieren. Ich bat sie, mich beim Vornamen zu nennen. Jetzt legt sie ihr Besteck ab und schaut Reinhard an. Sie wartet, dass er reagiert. Doch Reinhard nimmt sich lediglich ein weiteres Stück Fleisch von der Vorlegeplatte.
»Also... Reinhard und ich, also wir beide, wir werden ein Kind adoptieren.«
Ein paar Sekunden lang hüpft mein Herz. Familienzuwachs, wie schön. Maria stößt Reinhard an. Der nickt nur beiläufig, brummt:
»Hmm.«
Maria schwärmt: »Er ist ein so zauberhafter kleiner Bursche, zwei Jahre alt, Vollwaise und das schönste Kind der Welt, außer Katharina natürlich.«
»Bedeutet das, ich kann die Hoffnung auf ein blutsverwandtes Enkelkind aufgeben?«, frage ich. Ich weiß nicht, warum ich so spontan war? Doch gesagt ist gesagt. Katharinas Kopf schnellt herum. Was soll es? Ich kann es nicht mehr rückgängig machen.
Reinhard steht auf, wie immer, wenn das Dessert aufgetragen wird. Er bereitet mir meinen Verdauungsschnaps, denn ich vertrage keinen Nachtisch. Er gießt den Absinth ins Glas, taucht einen Würfelzucker ein, legt ihn auf den kleinen metallenen Löffel mit den Durchbrüchen, der über dem Glas liegt, zündet den Zucker an und stellt das Ganze vor mich hin, zusammen mit einer Karaffe Wasser. Wie jeden Abend nehme ich dieses Getränk. Am Tisch herrscht Schweigen. Als Katharina ihre Eiscreme aufgegessen hat, erheben wir uns. Bella, meine Mopshündin, wartet schon auf ihren Spaziergang. Eine Grundregel für ein langes Leben, so sagte meine Mutter, ist Regelmäßigkeit. Deshalb gehen Katharina und ich jeden Abend mit dem Hund zum Kleinen Belvedere, wie wir den Aussichtspunkt über der Stadt, ganz in der Nähe unseres Hauses nennen. Der Weg dorthin dauert zwanzig Minuten und geht bergab. Nach Hause brauchen wir doppelt so lange, denn Bella ist schon zwölf Jahre alt und der Weg bergauf macht ihr schwer zu schaffen. Als Katharina in der ersten Klasse war, habe ich einen Trick angewandt, damit sie mich begleitet. Ich habe sie vor die Wahl gestellt, ihrer Mutter beim Abräumen des Tisches zu helfen, um dann ins Bett geschickt zu werden, oder aber mit mir und dem Hund zu gehen. So schlägt sie jeden Abend, vor dem zu Bett gehen, Zeit heraus und ich habe eine Begleitung. Ich habe ihr bei diesen Spaziergängen schon viel beigebracht von den Fähigkeiten, die man in keinem Buch findet und die meine Mutter nur mir, nicht Ruth, weitergegeben hat. Katharina ist klug und allmählich wird sie eine raffinierte junge Dame. Ich liebe sie aus ganzem Herzen, auch wenn sie nicht mein leibliches Enkelkind ist.
Als wäre es gestern, steigt die Erinnerung in mir auf: Es war ein Wochentag. Reinhard und Maria saßen in der Küche und frühstückten, damals war meine Schwiegertochter noch schlanker von Schwangerschaft keine Spur. Beide verließen wie immer das Haus. Gegen Mittag fuhr Reinhard mit seinem Wagen vor. Er sprang heraus, öffnete den zweiten Flügel der Haustür und dann den Fond seines Wagens. Maria trug, in eine Babyschale gebettet, ein kleines Bündel Mensch ins Haus. Sie stellte es auf den Küchentisch, löste die Decke darum und ich sah Katharina zum ersten Mal. Es war, als ob mich in diesem Moment eine Fee mit dem Zauberstab berührte. Dieses wonnige, warmherzige Gefühl, das mich in jener Sekunde durchströmte, hat mich bis heute nicht verlassen, zumindest, wenn ich Katharina sehe. An jenem Abend klopfte Reinhard an meine Zimmertür. Aus dem Schlafzimmer der jungen Leute drang leises Babygeschrei. Maria eilte mit einer Babyflasche durchs Haus und kurz darauf war es wieder still. Gern wäre ich hinüber gegangen und hätte zugesehen, wie sich dieses Fläschchen leert, doch ich wollte mich nicht aufdrängen. Sicher wird sich bald Gelegenheit dafür ergeben, die Fütterung eines kleinen Engels zu beobachten. Ich saß in meinem Ohrensessel in meinem Zimmer und las, als mein Sohn zu mir kam. Er zog sich den Stuhl von meinem Schreibtisch heran und setzte sich.
»Mutter, du wirst dich schon gefragt haben, wie wir so schnell zu diesem Kind gekommen sind«, begann er.
Ich konnte nur nicken.
»Wir haben heute ganz überraschend die Nachricht bekommen, dass wir dieses kleine Mädchen adoptieren können.«
»Adoptieren? Das soll heutzutage sehr kompliziert sein.«
»Meistens, ja. Doch in unserem Fall ging es ganz schnell. Wir wussten heute Morgen selbst noch nichts von unserem Glück.«
»Wer sind die Eltern?«
Reinhard hob die Hand, als ob er einen Abstand zwischen uns herstellen wollte.
»Weißt du es nicht?«, hake ich nach.
»Mutter, genau deshalb komme ich zu dir. Ich möchte, dass du niemals über diese Adoption mit irgendjemanden sprichst. Nicht mit Helga, nicht mit den Nachbarn und auch nicht mit deiner Friseuse. Versprich mir das!«
»Was hältst du von mir? Bin ich eine Klatschbase?«
»Mit Helga werde ich selbst sprechen und alle anderen geht es nichts an.«
»Ja, natürlich. Aber sag mir wenigstens, ob das alles legal und gesetzlich gelaufen ist.«
»Selbstverständlich. In ein paar Tagen werden wir die Geburtsurkunde unserer Tochter Katharina zugeschickt bekommen. Ich werde sie dir zeigen, wenn sie da ist. Dann kannst du dich überzeugen, dass alles in amtlich bestätigter Ordnung ist.«
»Katharina«, wiederholte ich mit viel Gefühl und Betonung,
»Das ist ein wunderschöner Name!«
»Schön, dass er dir gefällt. Selbstverständlich möchten wir, dass du auch dem Kind gegenüber Stillschweigen wahrst, was diese Adoption betrifft. Maria und ich möchten es uns vorbehalten mit ihr zu sprechen, wenn die Zeit dafür reif ist. Es gibt da ein paar Dinge, ein paar Probleme, die verkraftet sie erst, wenn sie alt genug ist.«
»Was meinst du?«
»Je weniger man weiß, umso weniger kann man ausplaudern«, sagte er und ich war beleidigt, wegen dieser Antwort.
Ich musste ihm schwören, dass ich mich niemals in die Angelegenheit dieser Adoption einmische. In dem Augenblick der Ergriffenheit, der Gefühlsstürme, hob ich tatsächlich die Hand und nickte, als er es mir auftrug. Ein paar Tage nach diesem Gespräch kam ein Brief vom Jugendamt an Reinhard und Maria.
Beim Abendessen legte mir Reinhard die Geburtsurkunde des Babys vor. Ich konnte es selbst lesen: Reinhard und Maria waren die Eltern von Katharina Buchhorn. Das Standesamt hat den Stempel daruntergesetzt. Nun stand es fest: Ich war Großmutter geworden.
Als Katharina drei Jahre alt war, sah sie Großmutter Helene, dem Kind auf dem Gemälde, so ähnlich, als wäre sie es selbst. Ich redete mir ein, dass wohl alle dreijährigen Mädchen so aussähen.
Später, als ich die alten Fotos einmal ansah, bildete ich mir ein, dass Katharinas und mein Einschulungsfoto sehr viel Ähnlichkeit hatten. Mit den Jahren habe ich fast vergessen, dass sie nicht meiner Verwandtschaft entstammt, es wurde bedeutungslos.
Doch heute, als Maria von einem weiteren Enkelkind sprach, das adoptiert werden soll, wurde mir auch Katharinas Einzug in unser Haus wieder gegenwärtig.
Als sich Bella am Kleinen Belvedere unter die Bank legt und hörbar atmet, will Katharina schließlich wissen, wieso ich beim Essen gefragt habe, ob ich nun kein leibliches Enkelkind mehr bekäme.
»Was ist mit mir?«, fragt sie mit weit aufgerissenen Augen. »Bin ich nicht dein Enkelkind?« Wir sitzen nebeneinander und schauen auf die Stadt herab. Sie wartet auf meine Antwort.
Die Elbe führt Niedrigwasser. Es hat schon wochenlang nicht mehr geregnet. Ein Ausflugsdampfer kommt flussabwärts von der Tagestour aus der Sächsischen Schweiz zurück. Musikfetzen und das Geräusch des Schaufelrades weht der Wind herauf. Die Straßen und Häuser glänzen im roten Abendlicht der untergehenden Sonne. Eine Amsel sitzt auf einer Straßenlaterne und singt ein Abendlied für seine Liebste. Im Biergarten auf der Elbaue werden die langen Girlanden mit den bunten Glühlampen eingeschaltet und im Grundstück nebenan hört man den regelmäßigen dumpfen Aufschlag eines Federballs zwischen zwei Schlägern. Oh, hätte ich doch nur den Mund gehalten!
»Natürlich bist du mein Enkelkind«, sage ich so sachlich wie möglich. Ich fürchte, dass ich die Fassung verliere. »Alles andere musst du deine Eltern fragen. Ich musste damals schwören.«
Nun ist es heraus, nun wird sie ihre Schlussfolgerungen ziehen.
»Was schwören?« Ich lege meine Hand auf die ihre und sage: »Bitte, frage nicht weiter.«
Wieder zu Hause angekommen, ruft Katharina ihre Mutter: »Mama, wo bist du?«
Maria hat den Tisch abgeräumt und in der Küche rumort der Geschirrspüler. Reinhard ist nicht mehr zu Hause. Parteiarbeit ist die Ausrede seiner allabendlichen Ausflüge. Wir drei Frauen sind allein im Haus, wie jeden Abend. Der Hund säuft sabbernd Wasser aus seinem Napf. Dann kriecht er mit tropfnasser Schnauze und letzter Kraft in sein Körbchen.
»Hier bin ich!«, antwortet Maria aus dem Wohnzimmer. Ich sehe sie durch die offene Tür. Sie sitzt auf dem Sofa. Papiere und ein Fotoalbum liegen auf dem Tisch vor ihr.
Ich habe lange geübt, bis es mir gelang, aufbrausende Gefühle zu bändigen. Es gelingt mir nicht immer, besonders schwierig ist es bei Maria. Ich fühle, wie der Zorn mich packt. Allein ihr Anblick reicht, um meinen Blutdruck steigen zu lassen. So wie sie sollte sich eine verheiratete Frau nicht benehmen. Es gehört sich nicht, die jugendliche Haarpracht offen zur Schau zu stellen, zumal diese dünn und strähnig geworden ist. Was will sie damit erreichen? Männerblicke? Lächerlich, in ihrem Alter! Als sie jung war, fesselte sie die Blicke mit einer unglaublichen Oberweite. Sicher sind auch die Augen meines Sohnes dort hängengeblieben. Weiter ist er in seiner Wahrnehmung nicht gekommen. Doch nun ist die Pracht weit in Richtung Nabel gerutscht und sie trägt noch immer die billigen BHs. Wenn sie sich wenigstens gute, formgebende Mieder kaufen würde! Doch sie ignoriert die Tatsache und bei jedem ihrer Schritte bietet diese ungewünschte Dynamik einen abstoßenden Anblick. Wahrscheinlich hat die Natur ihr einen Ausgleich geben wollen zu der großen Brust. Auch ihr Hinterteil hat sich unglaublich entwickelt. Mit vorteilhafter Kleidung kann man manches verbessern, doch sie trägt enge Hosen.
Vor den Augen aller Nachbarn macht sie damit meine Ehrbarkeit als Schwiegermutter fraglich.
In meiner Zeit ging eine Frau vor der Hochzeit zum Friseur und ließ sich die Haare schneiden. Sie bedeckte ihre Reize und kaufte sich damenhafte Kleidung. Auch wenn der Ehemann vielleicht an der mädchenhaften Erscheinung seiner Frau festhalten wollte, so eine Entgleisung, wie Maria sie sehen lässt, kam nicht in Frage. Jeder Mensch ist für seinen eigenen Anblick verantwortlich.
Aber das ist im Moment die kleinste Sorge.
Wie lange will sie das Kind noch an der Nase herumführen?
Katharina hat ein Recht auf die Wahrheit. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jemals Zweifel an den Wurzeln meiner Existenz gehabt hätte, nicht auszudenken, wie mich das verunsichert hätte. Es ist bestimmt nicht leicht zu akzeptieren, dass der eigene Lebensweg gleich nach der Geburt eine Abzweigung genommen hat, doch wie herzzerreißend müssen in dieser Hinsicht Zweifel sein? Ich war das Kind von Mama und Papa, felsenfest! Nun weiß sie, dass es bei ihr nicht so ist, und ich kann fühlen, wie schrecklich es in ihrer Kinderseele jetzt aussieht. Oh, was habe ich getan!
Arme Katharina.
Andererseits: Es geschieht Maria ganz recht, dass sie endlich mit Katharina über diese Angelegenheit reden muss. Ich habe viel zu lange auf die Antwort auf diese Frage warten müssen. Lieber hätte ich sie von Reinhardt gehört, doch der hat sich aus dem Staub gemacht, wie immer. Also muss ich mit Marias hilflosen Ruderschlägen im Teich der Lügen vorliebnehmen. Vielleicht wird es interessant.
Ein Akt der Nächstenliebe wäre es, Maria sanft und liebevoll ihre Fehler und Schwächen selbst erkennen zu lassen; sie zu leiten, Defizite auszugleichen und Vollkommenheit zu erstreben.
Doch wenn ich sie sehe, muss ich mich zusammenreißen, um die Höflichkeit zu wahren. Dabei hätte sie mein Mitleid verdient, meine Fürsorge. Jedoch allein ihre Erscheinung macht mich wütend. Manchmal muss ich den Raum verlassen, um nicht die Fassung zu verlieren. Wenn sie mit dümmlichem Gesichtsausdruck, selbstvergessen, mit halb geöffnetem Mund über irgendetwas nachdenkt, kann ich ihren Anblick nicht ertragen. Es würde dann gut ins Bild passen, wenn ein dünner Speichelfaden auf ihren schwabbelnden Busen tropft. Nur zu gern würde ich sie provozieren und in die Falle ihrer fehlenden Bildung laufen lassen. Ich fürchte, sie würde es letztlich an Katharina abreagieren und deshalb halte ich mich zurück. Die Versuchung dazu ist allgegenwärtig.
Maria erzählte mir vor Jahren, als wir bei gemeinsamer Küchenarbeit saßen, dass sie vier Jahre alt war, als ihre Mutter bei einem Unfall ums Leben kam. Ihr Vater fand ihre Mutter im Schlafzimmer auf dem Fußboden mit gebrochenem Genick. Nach einem heftigen Streit soll sie, so sagte ihr Vater bei der Unfalluntersuchung aus, gestolpert und gestürzt sein. Zweifel blieben, ob sie nicht in Folge eines Handgemenges gestürzt sei. Es gab eine polizeiliche Ermittlung und für kurze Zeit war der Vater verdächtig.
Schließlich erklärte man die Angelegenheit zu einem tragischen Unglücksfall. Von ihrer zwölf Jahre älteren Schwester Anna erfuhr Maria, dass die Mutter eine sehr religiöse Frau war. Sie kam aus der Lausitz und dort sind die Menschen seit jeher stark dem katholischen Glauben verbunden. Marias Mutter hatte einen kleinen Hausaltar mit Marienbildern und Kerzen im Schlafzimmer aufgestellt. Der Vater tobte deshalb und warf alles weg, was der Mutter so wichtig war. Er meinte, dieser Hokuspokus sei eines modernen, aufgeklärten Menschen unwürdig. Sie solle nachlesen, dass schon bei Karl Marx stünde. Religion sei Opium für das Volk! Er fragte sie, ob sie wirklich so schwach und hilflos sei, dass sie auf solche Seelenkrücken angewiesen wäre? Er schäme sich für seine rückständige Frau. Er, als Offizier der Nationalen Volksarmee, sei mit seiner Stellung in der Gesellschaft ein Vorreiter auf dem Weg zum Sozialismus. Sie solle doch gefälligst bedenken, wie sehr sie seinem Ansehen schade, wenn jemand von ihrer Gesinnung Wind bekäme. Er könne sich dann unter seinen Genossen nicht mehr sehen lassen. Sie hörte auf, in die Kirche zu gehen, denn sie fürchtete, man könne sie dort sehen. Die Stasi lauerte überall und das war allgemein bekannt. Schließlich versteckte sie ihre Andachtsstätte in einem Fach ihres Kleiderschrankes und kniete jeden Abend, hinter abgeschlossener Schlafzimmertür, vor dem offenen Schrank, um zu beten. Einmal muss sie das Abschließen vergessen haben.
Maria deutet an, dass es wohl bei solch einem Gebet zu jenem Zornesausbruch des Vaters gekommen sein muss, den ihre Mutter nicht überlebte. Selbst nach dem Tod der Mutter konnte er keine Großzügigkeit zeigen. Die Eltern der Toten wollten sie gern auf dem Gottesacker ihrer Gemeinde bestatten, doch das lehnte er ab. Er begrub sie auf dem städtischen Heidefriedhof. Es gab keine Zeremonie und auch keine Grabrede. Er, Anna und die Eltern der Bedauernswerten standen am Grab, Maria hatte man in den Kindergarten gebracht. Anna berichtete, dass der Großvater aus der Lausitz seiner verstorbenen Tochter noch paar Worte mit auf den letzten Weg geben wollte. Ein paar Worte des Gedenkens. Doch der Ehemann der Verstorbenen wand sich ab und verließ das Begräbnis. So hörte nur Anna, dass ihr Großvater sagte: »Selbst Gott ist gegen verbohrten Fanatismus machtlos. Sei es uns ein Trost, dass er seine, unsere Tochter, zu sich genommen hat und ihr das Weiterleben in dieser Unterdrückung erspart geblieben ist.«
Dieser Sturkopf von einem Vater zog die kleine Maria gemeinsam mit seiner älteren Tochter Anna auf. Die Schwester begann nach dem Schulabschluss eine Ausbildung bei der Bahn. Weil sich niemand mehr um Maria kümmern konnte, suchte ihr Vater ein Internat für sie. Sie wurde in einer Sportschule aufgenommen. Damals muss sie klein und zappelig gewesen sein, schwer vorzustellen heute. Sie wurde Turnerin und eine politisch wichtige Bürgerin der Deutschen Demokratischen Republik. Die Schulbildung stand ein wenig zurück zu Gunsten des Turntrainings. Das habe ich sofort bemerkt, als Reinhard sie mir vorstellte. In ihrer aktiven Zeit hatte sie an den Wochenenden meistens Wettkämpfe. Es blieb ihr wenig Zeit zum Lesen und Lernen.
Nach Hause fuhr sie höchstens einmal im Monat. Entweder musste sie dem Sozialismus dienen, oder der Vater war eingeteilt zum Dienst am antifaschistischen Schutzwall. Gesund und förderlich für eine Kinderseele kann dieses Leben nicht gewesen sein. Außerdem, wer weiß, welches Zeug man sie hat schlucken lassen, um ihre körperlichen Leistungen zu verbessern. Als sie hier einzog, kurz nach der Hochzeit, musste sie große gesundheitliche Probleme gehabt haben. Zufällig lag einmal ihr Terminkalender offen herum und ich sah, dass sie mehrere Arzttermine pro Woche hatte über Monate hinweg. Sie begann mir damals zu berichten, was ihr Frauenarzt zu ihrer Kinderlosigkeit gesagt hätte. Das wollte ich mir nicht anhören. So weit kommt es noch, dass sie mich in ihr Intimleben einweiht. Es musste mit dem Sport zusammenhängen, so viel war sicher. Die Details will ich auch jetzt nicht wissen, das geht mich nichts an. Bei zwei deutschen Meisterschaften trat sie an. Doch Siege holte sie nicht. Sie ist noch heute stolz auf die Teilnahme.
»Dabeisein ist alles!«, trötete sie.
Dass ich nicht lache!
Reinhard hat sie kennengelernt, als sie siebzehn war. Ich erinnere mich, wie verliebt er in diese stillose kleine Pute war.