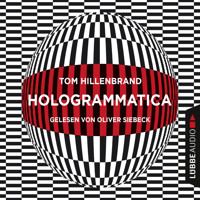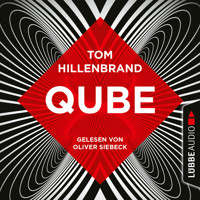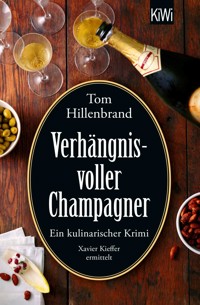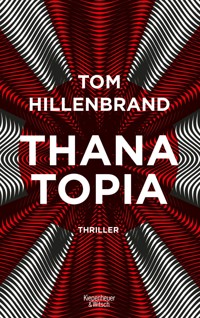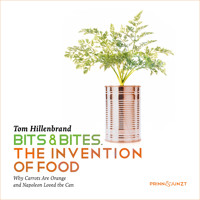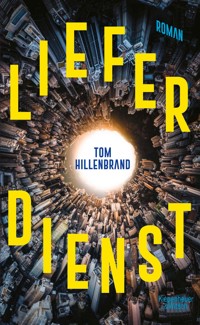Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Audio Media Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Mord in einer überwachten Welt. Eine Verschwörung, die ganz Europa erschüttert. In einer Zukunft, in der alles überwacht und sicher erscheint, geschieht ein Mord, der alles infrage stellt. Als ein Brüsseler Parlamentarier auf einem Feld nahe der Hauptstadt ermordet aufgefunden wird, glaubt Kommissar Aart van der Westerhuizen zunächst, den Fall mithilfe des beinahe allwissenden Europol-Fahndungscomputers und der brillanten Forensikerin Ava Bittmann rasch lösen zu können. Tatsächlich gibt es verblüffend schnell einen Verdächtigen. Doch dann entdeckt er immer mehr Hinweise darauf, dass die digitale Datenspur manipuliert wurde – und gerät in eine Verschwörung, die ganz Europa in seinen Grundfesten zu erschüttern droht. In »Drohnenland« entwirft Tom Hillenbrand eine faszinierende Vision einer nahen Zukunft, in der die Grenzen zwischen Überwachung und Sicherheit verschwimmen. Ein packender Politthriller, der die brisanten Fragen unserer Zeit auf die Spitze treibt.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tom Hillenbrand
Drohnenland
Kriminalroman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Tom Hillenbrand
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Tom Hillenbrand
Tom Hillenbrand, geb. 1972, studierte Europapolitik, volontierte an der Holtzbrinck-Journalistenschule und war Ressortleiter bei SPIEGEL ONLINE. Für seine Bücher wurde er vielfach ausgezeichnet (u. a. mit dem Glauser-Preis und dem Radio-Bremen-Krimipreis). Sie stehen regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste und sind in zahlreiche Sprachen übersetzt.
www.tomhillenbrand.de
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Wozu Zeugen vernehmen, wenn all ihre Bewegungen und Gespräche bereits auf einer Festplatte archiviert sind? Warum Tatorte begehen, wenn fliegende Polizeidrohnen schon alles abfotografiert haben? Als ein Brüsseler Parlamentarier auf einem Feld nahe der Hauptstadt ermordet aufgefunden wird, glaubt Kommissar Aart van der Westerhuizen zunächst, den Fall mittels des beinahe allwissenden Europol-Fahndungscomputers und der brillanten Forensikerin Ava Bittman rasch lösen zu können. Und tatsächlich gibt es verblüffend schnell einen Verdächtigen. Doch dann entdeckt er immer mehr Hinweise darauf, dass die digitale Datenspur manipuliert wurde – und gerät in eine Verschwörung, die Europa in seinen Grundfesten zu erschüttern droht.
»Da der gute Orwell auch schon in die Jahre gekommen ist, wurde es Zeit für diesen Roman.« FAZ
»Intelligent imaginierte Science Fiction aus der schönen neuen Überwachungswelt.« Die Zeit
»Ein großartig geschriebener Hochspannungsroman.« Die Welt
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2014, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Cobalt – Fotolia.com
ISBN978-3-462-30793-1
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
»Der Verstand ist oft die Quelle der Barbarei; ein Übermaß an Verstand ist es immer.«
Giacomo Leopardi
1
Er ist die mit Abstand bestangezogene Leiche, die mir je untergekommen ist: rahmengenähte Kalbslederschuhe, ein Mailänder Maßanzug, dessen Preis mein Monatsgehalt übersteigt, dazu ein bewusst nachlässig gebundener Steinkirk – nebst passendem Einstecktuch.
Alles an ihm sitzt tadellos, außer seinem Gesicht.
Dessen Überreste sind halbkreisförmig auf dem sandigen Boden verteilt. Der Regen hat sie bereits etwas ausgewaschen, wie ein rosafarbener Heiligenschein legt sich die Melange aus Blut, Gehirnpartikeln und Fleischfetzen um seine Schulterpartie.
»Was Großkalibriges«, sage ich zu Paul.
Der Forensiker schaut mich an und schüttelt den Kopf. Die Bewegung lässt seinen weißen Tyvek-Overall knistern. »Nee. Dafür ist noch zu viel vom Schädel übrig«, entgegnet er.
»Worauf tippst du denn?«, frage ich.
Paul verzieht sein unrasiertes Gesicht. Meine Frage kommt ihm zu früh. Wie die meisten Forensiker möchte er zunächst die Colibris und Mollys ihre Arbeit machen und den gesamten Tatort einspiegeln lassen. Danach würde er am liebsten eine Woche in den so extrahierten Daten herumstochern, bevor er sich auch nur auf das Geschlecht des Opfers festlegt.
Ich nehme eine Lakritzstange aus meiner Tasche und lasse sie langsam in meinem Mund verschwinden. Paul bleibt also reichlich Zeit, sich eine wohlinformierte Vermutung zurechtzulegen und sie hervorzuwürgen. Ich kaue und warte – vergebens.
»Ich werd dich schon später nicht drauf festnageln, Paul. Wie viele weggeschossene Visagen hast du in deinem Leben bereits gesehen?«
»Zu viele.«
»Ich wette, du könntest mit der Nummer im Netz auftreten«, fahre ich fort. »Paul Leclerq kann anhand von 360er-Aufnahmen zerschossener Gesichter binnen Sekunden Kaliber und Fabrikat …«
»Was habe ich dir eigentlich getan, Westerhuizen?«, knurrt er.
Ich stecke die Hände in die Taschen meines Mantels. »Du hast mich um vier Uhr morgens geweckt.«
Es war ein Prioritätsanruf über die Soundanlage meiner Wohnung, mit der Lautstärke einer Luftschutzsirene. Als ich wenige Minuten darauf in die Tiefgarage taumelte und mich in mein Auto setzte, hatte mir Terry bereits die ersten Infos überspielt: Leiche nahe der E40 bei Westrem. Den biometrischen Scans und der Signatur zufolge heißt der Tote Vittorio Pazzi, ist siebenundvierzig Jahre alt, Norditaliener, wohnhaft in Brüssel-Anderlecht.
Eine Leiche in der flandrischen Marsch ist eigentlich kein Grund, derart früh aufzustehen. Normalerweise hätte ich mich von zu Hause aus kurz an den Tatort spiegeln lassen, um den Datenschnüfflern ein paar Anweisungen zu geben, und wäre danach wieder zu Bett gegangen. Doch bei Signore Pazzi liegen die Dinge anders. Ihn kann ich leider nicht mutterseelenallein im Regen herumliegen lassen, denn er ist ein Abgeordneter des Europäischen Parlaments. Genauer gesagt war er es, bis ihm jemand seinen politischen Instinkt und sein Modelgesicht wegblies.
Mit einer Schusswaffe, deren Fabrikat mir immer noch unbekannt ist.
»Also?« Ich blicke Paul auffordernd an.
Er beschließt, zu parieren. »Ich würde auf ein hülsenloses Hochgeschwindigkeitsgeschoss tippen. Vermutlich 3,7 mm. Nicht aus nächster Nähe, wie gesagt, sonst wäre die Sauerei größer.«
»Wer verwendet so etwas?«
»Die Jungs von Taurus. Außerdem das Militär, Standardkaliber für Sturmgewehre. Sonst fast niemand, bekommt man nur mit Sondergenehmigung.«
Pauls Antwort wirft unerfreuliche Fragen auf. Aber fürs Erste reicht sie mir. Ich bedanke mich und gehe ein Stück in Richtung Straße. Von dort fällt das umliegende Gelände etwas ab, sodass ich einen guten Überblick über den Tatort habe. Früher muss das hier eine Acker- oder Weidefläche gewesen sein, darauf deuten die Knicke und Gräben hin, die das sandige Feld umgeben. Es ist kein schöner Ort zum Sterben, aber immerhin ein schön ruhiger. Hier gibt es rein gar nichts, vermutlich lässt sich tagelang keine Menschenseele in dieser Gegend blicken. Was allerdings die Frage aufwirft, warum man Pazzi so schnell gefunden hat.
»Einsatzprotokoll«, brumme ich.
Auf meinen von Regenspritzern bedeckten Specs erscheinen Informationen. Offenbar besaß Pazzi einen implantierten Vitalsender. Das ist ein teures Spielzeug, selbst für einen Abgeordneten. Sobald das linsengroße Plastikprojektil sich mit 1500 Metern pro Sekunde eine Schneise durch sein Gehirn zu bahnen begann, verständigte der Sender den ärztlichen Notdienst darüber, dass dieser Klient medizinische Betreuung gebrauchen könnte. Pazzi muss eine ziemlich gute Krankenversicherung gehabt haben, denn binnen zwanzig Minuten war eine Helijetdrohne vor Ort. Gegen 02.41 Uhr wurde die Polizei in Westrem verständigt. Als die Dorfsheriffs kapierten, dass es sich um einen MEP handelt, schissen sie sich in die Hosen und riefen uns an.
Von meinem Aussichtspunkt aus schaue ich dem geschäftigen Treiben auf dem Feld zu. Obwohl ich keine diesbezüglichen Anweisungen gegeben habe, hat offenbar jemand mitgedacht, auch wenn ich keine Ahnung habe, wer das sein könnte. Und so wimmelt es am Tatort bereits von Colibris, Flutlichtdrohnen und anderen Maschinen, die in konzentrischen Kreisen um den Toten herumschwirren und aus allen erdenklichen Winkeln hochauflösende Bilder knipsen.
»Nachricht an Paul Leclerq«, sage ich. »Text: Haben wir keine Mollys im Einsatz?«
Wenige Sekunden später erscheint die Antwort auf meinen Specs: »Molekularscanner taugen bei dem Scheißwetter nichts.«
Mir entfährt ein holländischer Fluch. Ich stelle eine Sprechverbindung her. »Paul, ich will die Mollys trotzdem. Sollen Terry und Ava später versuchen, aus den Daten schlau zu werden. Und ich will nicht nur den Tatort gespiegelt haben, sondern auch einen Umkreis von zwei Quadratkilometern, mindestens.«
»Das ist aber sehr aufwendig. Wir müssen fast alles neu erheben. Über dieses Kuhdorf fliegt nur jedes Schaltjahr eine Katasterdrohne.«
»Mir egal, Paul.« Ich mache eine Kunstpause. »Oder willst du Vogel erklären, warum wir bei einem toten MEP nicht alle Daten einspiegeln, die wir kriegen können?«
Der Chefforensiker gibt ein Grunzen von sich, das ich als Zustimmung interpretiere. Ich kappe die Verbindung und lasse meinen Blick nochmals über die Ebene schweifen. Diese Leere – was hatte Pazzi hier draußen verloren? Er muss von der Straße gekommen sein, falls er nicht eine längere Nachtwanderung hinter sich hatte. Ich spule die Videoaufzeichnung meiner Specs einige Minuten zurück, bis zu dem Punkt, wo ich direkt vor der Leiche stehe und deren Schuhe mustere. Das Standbild zeigt mir, dass Pazzis Sohlen und Leisten angeschmuddelt sind, aber nicht so angeschmuddelt, wie sie es sein müssten, wäre er in diesem Regen eine längere Strecke zu Fuß marschiert. Von der Straße bis zu der Leiche sind es laut den Specs 153,34 Meter, ein Teil davon Kiespfad. Weiter ist Pazzi vermutlich nicht gegangen. Das wiederum deutet darauf hin, dass er mit einem Auto gekommen ist, von dem jedoch jede Spur fehlt.
»Ist hier eigentlich irgendwas?«, frage ich die Specs.
»Sie befinden sich 31,37 Kilometer westlich von Brüssel, District Européen«, belehrt mich eine für diese Uhrzeit viel zu ausgeschlafene Frauenstimme. »Diese stillgelegte landwirtschaftliche Nutzfläche befindet sich im Besitz von …«
»Abbruch«, blaffe ich. Warum sind diese Dinger immer noch so dämlich? Ich wünschte, Ava wäre schon wach. Aber ich möchte sie nicht wecken, denn es ist erst fünf Uhr und ausgeschlafen wird mir meine Analystin später deutlich mehr nutzen. Außerdem dürfte es ohnehin noch etwas dauern, bis die Spurensicherung alles eingespiegelt hat.
Ich versuche es anders. »Auf dem Display die nächstgelegenen Häuser und Geschäfte anzeigen. Listenansicht.«
Vor meinem Auge laufen die Suchergebnisse vorbei. Viele sind es nicht. Es gibt eine Ladestelle an der Schnellstraße, in westlicher Richtung, ferner einen Bauernhof und eine Truckerpinte, alles jedoch mindestens zwei Kilometer vom Tatort entfernt. Anders gesagt, gab es kein sinnvolles Ziel, das Pazzi in der Nähe hätte ansteuern können. Ich sehe mir erneut den Tatort und die umliegende Gegend an. Zufällig anwesende Zeugen sind aufgrund von Tatzeit und Zivilisationsferne unwahrscheinlich. Außer den knorrigen Pappeln, die den Acker auf der Nord- und Westseite umfrieden, dürfte niemand etwas gesehen haben.
Der Regen wird stärker, es kommt Wind auf. Ich kann die nicht allzu ferne Nordsee riechen. Deshalb ziehe ich meinen breitkrempigen Regenhut noch tiefer ins Gesicht und beschließe, dass es hier nichts mehr für mich zu tun gibt. Dann gehe ich zurück zu meinem Mercedes, der in einer Nothaltebucht an der Autobahn parkt, und steige ein.
»Zum Galgenberg, Gottlieb«, sage ich. Der Wagen setzt sich in Bewegung. Ich nehme die Specs ab und lege sie zusammen mit dem Regenhut auf den Beifahrersitz. Der Himmel ist tiefgrau, und es sieht nicht so aus, als ob er sich demnächst aufhellen wird. Während das Auto mit einem Summen beschleunigt, zerplatzen fette Tropfen auf der Windschutzscheibe – Pruimenregen, wie die Flamen sagen, Pflaumenregen. Wie ich den Sommer hasse.
Ich schicke Ava eine Nachricht, sie möge so schnell wie möglich in mein Büro kommen. Laut ihrem Dienstkalender hat sie heute Morgen etwas anderes vor, aber das wird warten müssen. Wenn mein Vorgesetzter Jerôme Vogel von der Sache Wind bekommt, was etwa gegen halb acht der Fall sein wird, möchte ich gerne ein bisschen mehr wissen als den Namen und die Schuhgröße des Toten.
Ich weise den Mercedes an, die Frontscheibe auf undurchsichtig zu schalten und eine Verbindung zu Terry aufzubauen. Die in das Glas integrierte Medienfolie färbt sich dunkelblau, in ihrer Mitte erscheint das Logo von Europol. Mit dem Fahndungscomputer zu kommunizieren, ist eigentlich Analystensache, aber ich habe es eilig. Außerdem ist Terry nicht ganz so dämlich wie diese französische Datenbrillensoftware.
»Guten Morgen, Hauptkommissar Westerhuizen«, tönt es aus dem Lautsprechersystem des Wagens. »Wie kann ich Ihnen behilflich sein?«
»Précis zu Vittorio Pazzi.«
»Welchen Umfang wünschen Sie, Hauptkommissar?«
»Genug Stoff, dass ich bis zu unserer Ankunft beschäftigt bin und nicht einschlafe.«
»Einen Moment bitte. Ihr Précis wird erstellt.«
Auf dem Schirm erscheint ein offiziell aussehendes Foto von Pazzi. Er sitzt hinter einem wuchtigen Schreibtisch, eingerahmt von zwei Flaggen: links das dunkelblaue Unionsbanner, rechts die azurfarbene Fahne der norditalienschen Liga.
»Vittorio Pazzi, siebenundvierzig, geboren in Meran. Stammt aus einer wohlhabenden Unternehmerfamilie. Studium der Wirtschaftswissenschaften in Mailand und Uppsala. Unverheiratet, keine Kinder. Mitglied der Liberalen, sitzt seit vier Jahren für diese im Europäischen Parlament, stellvertretender Parteipräsident, Vorsitzender des Außenhandelsausschusses. Vergangenes Jahr von der Wirtschaftszeitung ›Il Sole 24 Ore‹ zum Mann des Jahres gewählt für seine Bemühungen zur Verbesserung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit.«
Während der Fahndungscomputer vorträgt, wechseln auf dem Screen die Bilder: Pazzi beim Skifahren in den Alpen, bei einer Preisverleihung in Berlin, auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt. Terry spielt ein Video ein, das den MEP auf irgendeinem Kongress während einer Rede zeigt: »… und nur durch eine konsequente Stärkung der Handelsbeziehungen zu unseren brasilianischen Freunden, bei gleichzeitiger Einhaltung bestehender Zollbestimmungen, können wir die Wirtschaftskraft der Union …«
Möglicherweise schlafe ich doch ein, bevor wir in Brüssel sind. Es ist das übliche Politikergewäsch, wie die meisten aus seiner Partei spricht Pazzi viel von Zusammenarbeit und Freihandel und versucht gleichzeitig, die Importe aus Südamerika zu begrenzen. Statt hinzuhören, betrachte ich ihn genau. Er verfügt über ein gewisses Charisma, sicher über mehr als der Durchschnittsabgeordnete. Und er ist stets gut gekleidet. Selbst sein Skianzug sieht maßgescannt aus.
Terry erzählt gerade etwas über Pazzis Verdienste um die Reform der Agrarpolitik. Ich unterbreche ihn. »Du sagtest, er habe keine Familie. War der Typ schwul?«
Der Fahndungscomputer hört auf zu reden, es entsteht eine kurze Pause. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glauben, dass er peinlich berührt ist.
»Es gibt diesbezüglich keine offiziellen Statements von Vittorio Pazzi, Hauptkommissar.«
»Mag sein. Aber du kannst doch bestimmt eine Kongruenzanalyse vornehmen.«
»Ich weise Sie darauf hin, dass derartige Daten im Falle von MEPs durch den Enhanced Privacy Act vor behördlichen Zugriffen geschützt sind.«
»Er ist tot, Terry. Und dies ist eine Mordermittlung.«
Wieder eine kurze Pause. »Der Zugriff auf derartige Daten wird protokolliert und in den Gerichtsakten vermerkt. Ferner muss ein unmittelbares Ermittlungsinteresse vorliegen. Ich bin verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass laut Artikel 23 der Strafprozessordnung …«
»Reg dich ab.«
»Bitte formulieren Sie die Frage neu.«
»Beantworte meine Frage nach Pazzis sexueller Präferenz und protokolliere, was du willst.«
Auf dem Bildschirm erscheint ein Foto, das Pazzi im Kreise anderer Menschen zeigt. Was man im Hintergrund vom Veranstaltungsort sehen kann, ist unfassbar hässlich. Das lässt mich vermuten, dass es sich um das EU-Parlamentsgebäude handelt. Ein Mann Ende dreißig, der ein Stück von dem Toten entfernt steht, wurde markiert. Er ist strohblond und etwas feist. Seine Wangen sind gerötet, vermutlich von dem Rotwein, den er in seiner Rechten hält.
»Es liegen keinerlei offizielle Informationen zu Vittorio Pazzis sexueller Orientierung vor. Eine Auswertung von Sprachduktus, Semantik, Musikgeschmack, frequentierten Orten und weiteren Datenquellen legt jedoch eine homosexuelle Neigung nahe.«
»Wie sicher ist das?«
»Die Wahrscheinlichkeit beträgt 95,1 Prozent. Die markierte Person auf dem Foto heißt Peter Heuberger, Parlamentsassistent bei der Konservativen Sammlung. Teile von Pazzis Mailverkehr sind aufgrund seines Abgeordnetenstatus derzeit versiegelt und müssen zunächst durch richterliche Anordnung für die digitale Forensik freigegeben werden. Verfügbare private Kommunikationsmuster sowie gemeinsame Airport-Check-ins in Brüssel, Berlin und Lissabon deuten jedoch auf eine partnerschaftliche Beziehung hin.«
Durch das Seitenfenster sehe ich, dass wir Saint-Gilles passieren. In wenigen Minuten werden wir da sein. Ich würde gerne noch etwas in Pazzis Bewegungsdaten der vergangenen vierundzwanzig Stunden herumstochern, aber anders als seine Leiche ist sein digitaler Kadaver weitgehend geschützt, zumindest bis der Untersuchungsrichter den Mist entsiegelt, was in etwa zwei Stunden passieren dürfte. Dann kommt der Frühdienst ins Büro. Ich weise Terry an, einen Eilantrag auf Entsiegelung aller Pazzi betreffenden Datenspuren zu stellen. Dann schalte ich das Display ab und blicke hinaus in den Brüsseler Morgenverkehr.
2
Am »Café Amsterdam« steige ich aus und sage dem Wagen, er möge in die Tiefgarage des Europol-Palais fahren. Ich betrete die Bar und bestelle Kaffee. An dem großen, mit Medienfolie überzogenen Tresen sitzen müde aussehende Männer und lesen die Nachrichten. Ich nehme an dem Ecktisch Platz, an dem ich immer sitze, ziehe mir ein Fenster auf und suche nach Meldungen zu Vittorio Pazzi. Es gibt ein paar aktuelle Erwähnungen, die Beiträge gehen erfreulicherweise jedoch alle davon aus, dass er noch am Leben ist. Das verschafft mir etwas Zeit. Sobald Pazzis Tod über die Feeds läuft, wird mir die Chefetage auf den Füßen stehen.
Ich bestelle einen zweiten Kaffee. In der Nachrichtenübersicht zeigen sie Bilder von ausgemergelten Persern oder Saudis in irgendeinem Auffanglager. Männer in ABC-Schutzanzügen überprüfen die Neuankömmlinge mit Geigerzählern. Andere Flüchtlinge stehen in Schlangen um Essen an, bewacht von Soldaten mit Sturmgewehren. Laut der Banderole spielt die Szene in Kalabrien.
Der Typ am Tisch neben mir beugt sich herüber und zeigt auf die Tischplatte. »Arme Schweine, was?«
Ich mustere ihn. Er ist die Art von Mann, bei dem sich die Wirkung einer doppelten Nassrasur bereits gegen Mittag verflüchtigt. Sein speckiges Jackett tut es ihm nach: Es geht allmählich auseinander. Er riecht nach Wallonien und Calvados.
»Ja«, antworte ich, »aber zumindest sind sie noch am Leben.«
»Aber ist das noch Leben«, entgegnet er, »so völlig ohne Heimat?«
Das Gespräch wird mir entschieden zu philosophisch, deswegen knurre ich: »Nicht unsere Grenze, nicht unser Problem.« Eine herzlose Bemerkung, aber sie zeigt die gewünschte Wirkung. Mein Tischnachbar wendet sich ohne ein weiteres Wort wieder seinem Getränk zu.
Auf meinen Specs erscheint eine Nachricht von Ava: »Bin in zehn Minuten da, Spiegelung steht.«
Ich stehe auf, lege einige Hunderteuromünzen auf den Tresen und nicke dem Wirt zu. Dann verlasse ich das Café und laufe in Richtung des Europol-Hauptquartiers. Auch nach derart vielen Jahren läuft es mir noch kalt den Rücken herunter, wenn ich mich dem immensen Justizpalast nähere. Das Palais ist der gescheiterte Versuch, zahllose klassizistische Stile miteinander zu verschmelzen. Das Resultat ist größer als der Petersdom und ungleich hässlicher.
Das Gebäude ist viel zu groß für unsere Zwecke. Früher residierte hier der gesamte belgische Justizapparat, nun beherbergt das Palais nur noch die Strafgerichtsbarkeit der Union und uns. Da wir nicht sehr viele sind, staubt das Gros der Räumlichkeiten allmählich ein. Pingelige Zeitgenossen kritisieren, Justiz und Strafverfolgung der Union im selben Gebäude unterzubringen, schicke sich nicht, wegen der Gewaltenteilung.
Als kleine Konzession an die Mahner hat man für Richter und Polizisten deshalb zwei verschiedene Eingänge ausgewiesen. Erstere verwenden das Hauptportal an der Poelaertplein, während wir auf der Hinterseite über die Jacobsplein in das Gebäude gelangen, womit der Gewaltenteilung aus meiner Sicht Genüge getan ist. Ein Resultat dieser Regelung ist der recht lange Fußweg zu meinem Büro, das sich im vorderen Teil des Gebäudes befindet. Ein anderes ist, dass der Zugang über den Jakobsplatz meiner Behörde ihren Spitznamen beschert hat: Der Volksmund nennt uns »Jakobiner«. Es ist als Kompliment gemeint.
Als ich das Sicherheitsperimeter passiere, heftet sich ein Colibri an meine Fersen. Er umschwirrt mich mehrmals, um meine Physiognomie und mein Laufmuster mit der Datenbank abzugleichen. Offenbar ist das Ergebnis zu seiner Zufriedenheit, denn die Sicherheitsschleuse gleitet lautlos auf. Ich grüße die beiden Gendarmen am Eingang und gehe hinein.
Das Innere des Palais wirkt noch gespenstischer als seine Fassade. Das Gebäude besteht aus Freitreppen, die nirgendwo hinführen, Hallen und Torbögen, deren Sinn der Architekt mit ins Grab genommen hat, und Säulen, immer wieder Säulen, oft mehr als zwanzig Meter hoch. Vermutlich gibt es im Justizpalast mehr Säulen als Beamte.
Ich gehe durch ein verwinkeltes Treppenhaus voller verstaubter Jugendstilleuchter bis zur Haupthalle. Sie hat die Größe eines Fußballfelds und ist mit derart vielen runden, eckigen, kannelierten und angedeuteten Säulen vollgestopft, dass selbst an einem gleißenden Frühlingstag nicht genügend Licht durch die viel zu kleinen Fenster dringt, um das ewige Zwielicht zu vertreiben. Dann nehme ich die Treppe in den ersten Stock. Als ich mein Büro erreiche, ist Ava bereits da. Sie steht über den Besprechungstisch gebeugt. Es ist ein Anblick, der mir keinerlei Unwohlsein bereitet.
Ich räuspere mich, woraufhin sie sich mir zuwendet. Sie trägt knallenge japanische Jeans, die in hohen schwarzen Schnürstiefeln stecken, dazu eine dieser neuartigen Trainingsjacken mit Regenneutralisatoren in den Schulterpads. Ava Bittman ist Anfang dreißig, hat den Körper einer altbabylonischen Tempeltänzerin und das Gehirn eines Atomphysikers. Sie ist die beste Analystin, mit der ich je zusammengearbeitet habe, außerdem die schönste. Die meisten Datenforensiker sind heutzutage Frauen. Angeblich hat es etwas mit weiblicher Intuition zu tun; das Klischee besagt, Frauen kämen besser mit Terry zurecht. Die Kommissare sind hingegen mehrheitlich Männer. Entgegen den Usancen des Hauses schlafe ich nicht mit meiner Analystin.
»Guten Morgen, Ava.«
»Hallo, Aart. Du siehst müde aus.«
»Ich werde noch viel müder aussehen, bevor das hier zu Ende ist. Selbstmord können wir wohl ausschließen, oder?«
Ava setzt sich auf die Kante meines Schreibtisches und mustert das gerahmte »Casablanca«-Poster, das an der Wand gegenüber hängt. Bogart schaut zurück. Er wirkt nicht uninteressiert.
»Wie du gleich sehen wirst, macht die Schussbahn einen Suizid unmöglich. Das Projektil wurde aus etwa hundert Metern Entfernung abgefeuert.«
»Paul sagt, Pazzi sei mit einer Hochgeschwindigkeitswaffe erschossen worden.«
Ava streicht sich eine ihrer kaffeebraunen Locken aus dem Gesicht und nickt. »Das stimmt. Es war dieses Modell.« Sie räuspert sich und sagt: »Terry, Mordwaffe Pazzi zeigen.«
Die Medienfolie des Besprechungstisches verfärbt sich und zeigt ein kurzläufiges Sturmgewehr aus schwarzem Plastik. Daneben schweben einige knallgelbe Streifen, die wie Päckchen eingeschweißter Kopfschmerztabletten aussehen.
»Eine Jericho 42C. Israelisches Fabrikat.«
Ich greife mit meiner rechten Hand nach dem Gewehr und ziehe es zu mir heran. Mit einer Geste meiner Linken lasse ich die Waffe um ihre Längsachse rotieren. Ich erinnere mich an dieses Modell.
»Damit habe ich sogar schon einmal geschossen«, sage ich.
»Wirklich? Wann denn das?«
»Du vergisst, wie alt ich bin, Ava. Während der ersten Marokkokrise war ich bei der Milpol.«
Sie schaut mich an, ihre großen kohlschwarzen Augen verraten Verwunderung, vielleicht auch ein bisschen Abscheu. »Ihr habt im Solarkrieg hülsenlose Hochgeschwindigkeitsmunition verwendet? Gegen Zivilisten?«
»Gegen Terroristen«, entgegne ich schwach. »Aber vergessen wir diese alten Geschichten. Wer benutzt die 42C denn heutzutage?«
»Nur Militär und Polizei dürfen diese Dinger verwenden, da aufgrund der Vibrationen und der enormen kinetischen Energie bereits ein Streifschuss das Nervensystem und die Blutgefäße des Opfers in Pflaumenmus verwandelt. Die Kohäsionskräfte im Süden sind damit ausgestattet, außerdem unsere Spezialeinheit.«
»Entwendete oder verschwundene Exemplare, von denen wir wissen?«
»Leider ziemlich viele. In Nordafrika geht bei all den Anschlägen zwangsläufig einiges an Ausrüstung flöten. Terry sagt, es seien um die zweihundert gestohlene Jerichos in der Datenbank. Allerdings keine mit einer Signatur, die zu dieser Waffe passt. Aber das heißt nichts, Ballistik ist bei diesen Dingern keine exakte Wissenschaft.«
Ich gehe um den Schreibtisch herum und lasse mich in meinen Sessel fallen. Nachdem ich eine Lakritzstange aus der Blechdose neben der Ablage gefischt habe, halte ich Ava die Büchse hin.
Sie schüttelt den Kopf. »Nein, danke. Dieser Lakritz ist irre salzig.«
»So muss er sein. Warum ist es schwierig, die Signatur der Waffe zu bestimmen? Wegen des Plastiks?«
»Genau. Der Lauf besteht aus einer reibungsfreien Keramikplastiklegierung. Die Munition ist hülsenlos und ebenfalls aus Plastik. Anders als bei Projektilen aus Metall ist es deshalb nicht ganz so einfach, Kugeln einem Lauf zuzuordnen. Weniger Abriebspuren. Wenn wir die Tatwaffe fänden, wäre es wohl möglich. Aber das ist unwahrscheinlich.«
»Sagt wer? Terry?«
»Sage ich, Aart. Das ist ein Scheißfall.«
Statt sofort zu antworten, kaue ich zunächst meine Lakritzstange fertig. Dann sage ich leise: »Das Gefühl habe ich leider auch.«
»Was machen wir zuerst?«, fragt Ava.
»Ich möchte zunächst mal reingehen und mir den Tatort angucken. Spiegelung steht, ja?«
Sie nickt, öffnet die Bürotür und läuft los. Ich folge ihr. Wir gehen in einen der Spiegelräume. Ava setzt sich auf einen rollbaren Hocker, aktiviert zwei Wandscreens und verriegelt die Schleuse. Dann schaut sie interessiert zu, wie ich meinen Steinkirk löse und zunächst das Jackett, dann das Oberhemd ausziehe. Sie reicht mir ein Escapepflaster, das ich auf meinen linken Brustmuskel klebe. Danach nehme ich in einem der gepolsterten Liegesessel Platz und ziehe meine Spiegelkappe über.
Aus dieser bequemen Position beobachte ich, wie Ava ihre Trainingsjacke öffnet. Darunter trägt sie nichts außer einem knappen Sport-BH. Diesen lupft sie nun an, um ihr Pflaster aufzukleben. Ich kann den dunklen Hof ihrer Brustwarze sehen und merke, wie mein Penis sich zu versteifen beginnt. Es ist wahrlich kein Wunder, dass so viele Kommissare und Analystinnen Pärchen sind.
Ava kommt auf mich zu und reicht mir einen Inhalator, dann legt sie sich auf die Liege neben mir. Ich drehe den Spender so, dass die gebogene Öffnung zu mir zeigt. Hypnoremerol, der beste Freund des Ermittlers. Theoretisch könnte man auch ohne dieses Zeug reingehen, aber es ist nicht empfehlenswert. Das menschliche Gehirn reagiert auf den Wechsel in immersive Computersimulationen nämlich ähnlich wie ein altes Auto auf Gangwechsel ohne vorheriges Betätigen der Kupplung – mit Ächzen und Knirschen. Macht man das zu oft, können disassoziative Fugen oder Amnesien die Folge sein, für einen Kommissar eher unvorteilhafte Gebrechen.
Das Hypnoremerol bringt einen sanft rüber. Sobald es die Synapsen flutet, findet bei aktivierter Spiegelkappe der Übergang statt. Ich überprüfe, ob die Spannung auf der Kappe anliegt. Erst dann umschließe ich den Inhalator mit den Lippen und drücke die Patrone herunter. Mit einem Zischen schießt das Aerosol in meinen Rachenraum. Wie jedes Mal überlege ich, was für ein Geruch da in meine Nase steigt. Ich bilde mir ein, dass er etwas von Himbeere hat, oder vielleicht auch Vanille gepaart mit …
Kurz bevor ich es habe, bin ich weg, wie immer.
Als ich wieder zu mir komme, höre ich als Erstes den Pflaumenregen. Er prasselt auf das Dach des Zelts, das Ava freundlicherweise am Rande der Schnellstraße aufgestellt hat. Ich erhebe mich aus dem Campingstuhl, in dem ich sitze, und trete durch die offene Plane hinaus ins Freie. Der Regen peitscht mir ins Gesicht, genau wie zur Tatzeit. Ava wartet bereits neben dem Zelt auf mich.
»Dein Realismus in Ehren«, brumme ich. »Aber kannst du jetzt bitte den Regen abstellen und es etwas heller werden lassen?«
Sie murmelt etwas Unverständliches. Die Sonne geht im Zeitraffer auf, der Regen stoppt abrupt. Kleine Schäfchenwolken ziehen über den flandrischen Himmel. Es ist das erste Mal seit drei Wochen, dass ich mich unter freiem Himmel aufhalte, ohne nass zu werden.
Ich gehe einige Schritte über das Feld und sehe mich um. Ein seltsames Gefühl beschleicht mich. Wie immer in Spiegelungen rebelliert irgendetwas in mir. Ich verspüre eine leichte Übelkeit und habe zunächst Schwierigkeiten, zu fokussieren. Es liegt nicht an der Simulation, die ist hervorragend. Ist wohl eine Kopfsache.
Ich atme tief ein. Die Luft hat jene Frische, die sie nur unmittelbar nach dem Ende eines Regengusses besitzt, es riecht nach Meersalz und Erde. Das Ganze ist verdammt gut gemacht. Terry wird von Jahr zu Jahr besser.
Der Tote liegt drüben auf dem Feld, einen Tick weniger nass und weniger bleich als noch vor einigen Stunden. Das liegt daran, dass dieser Pazzi und das dreidimensionale Orthomosaik der Umgebung aus jenen Hunderttausenden Einzelbildern errechnet worden sind, die man vor meiner Ankunft am Tatort aufgenommen hat. Auch die Fußabdrücke, die Paul und seine trampeligen Forensiker in der Marsch hinterlassen haben, sind verschwunden. Meine Specs sagen mir, dass die Spiegelung dem Tatort um 03.29 Uhr MEZ entspricht, also zweiundneunzig Minuten bevor ich dort heute Morgen ankam. In gewisser Weise unternehmen Ava und ich also eine Zeitreise. Man darf nicht allzu viel darüber nachdenken, sonst wird man ganz kirre.
Ich hätte gerne einen weiteren Lakritz, aber ich habe keinen dabei und müsste deshalb zunächst Ava fragen, ob sie mir welchen reinspiegeln kann. Stattdessen gehe ich zu Pazzi hinüber und betrachte nochmals seine Schussverletzung. »Beschriftung«, sage ich. Bläulich leuchtende Buchstaben und Zahlen erscheinen neben dem Leichnam, nebst Pfeilen, die auf verschiedene Körperteile deuten. Ich höre, wie sich Ava von hinten nähert.
Als sie neben mir steht, sagt sie: »Eintritt des Todes um 02.19 Uhr. Seiner Mediwatch zufolge war er sofort tot. Eine Kugel, in den Hinterkopf.«
»Wie unsportlich.«
»Vielleicht, aber handwerklich betrachtet ein hervorragender Schuss, bei der Entfernung und den Lichtverhältnissen. Das Hochgeschwindigkeitsgeschoss durchschlug sein Scheitelbein. Die enormen Vibrationen zerstörten augenblicklich sein Gehirn, ferner Schädigung des Rückenmarks, Ruptur der Halsschlagader, Platzen der Augäpfel.«
»Ich verstehe, was du mir sagen willst.«
Unbeirrt fährt sie fort. »Austritt etwas unterhalb der Augenpartie, mittig. Deshalb ist zwar noch was vom Schädel übrig, das Gesicht aber wegen des Austrittskanals weitestgehend futsch.«
»Zeig mir die Schussbahn.«
Ava macht eine Handbewegung. Eine rote Linie erscheint, die von unserem Standort zu einem aus acht Pappeln bestehen Knick an der Westseite des Feldes führt. Die Linie endet an dem dritten Baum, etwas oberhalb eines großen Seitenastes, der stabil genug aussieht, dass ein Schütze darauf hätte sitzen können.
»Originalwetter«, sage ich.
Ava schaltet den Regen ein und die Sonne aus. Ich sehe nun, was ich bereits erwartet hatte. Die Pappel ist 104,34 Meter entfernt, durch die Regenschlieren kann man in der Dunkelheit lediglich die Umrisse des Baumes erkennen. Wenn Pazzi seine Specs nicht gerade mit einer Scoutdrohne gekoppelt hatte, kann er den Schützen nicht gesehen haben.
»Drohnenbewegungen vor dem Mord, Ava?«
Sie scheint kurz in sich hineinzuhorchen. Dann sagt sie: »Rein gar nichts. Laut Terrys Datenbank hat die letzte registrierte Drohne vor zwei Tagen das Feld überflogen, ein kleiner Kurierheli von UDS.«
Ich bemerke, wie das an meinem Trenchcoat herablaufende Wasser kleine Pfützen auf dem Boden bildet. Mit einem Finger zeige ich auf die Wolken. »Das reicht, danke.«
Der Regen hört auf.
»Was haben wir noch, Ava? Kannst du ihn mal laufen lassen?«
Sie nickt, lässt den toten Parlamentarier verschwinden und zeigt zur Straße. »An der Stelle da hinten haben die Mollys etwas Abrieb von seinen Ledersohlen gefunden. Dort fängt die Spur an.«
»Also hat ihn ein Auto dort abgesetzt. Wissen wir, welches?«
»Terry sagt, es gebe kein Fahrzeug, das zum fraglichen Zeitpunkt hier gehalten hat.«
»Zumindest kein registriertes.«
»Richtig. Jedes Auto mit einem EU-Nummernschild und auch sämtliche Transit-Lkws besitzen eine Geosignatur, deren Verlauf laut Enhanced Privacy Act unbegrenzt gespeichert werden muss. Aber natürlich könnte ein versierter Krimineller das abklemmen. Dann würden ihm allerdings nach spätestens einer Stunde unsere Drohnen auf die Pelle rücken. Die mögen keine Autos, die die Identifikation verweigern. Vielleicht hat das Fahrzeug aber auch die gefälschte Signatur eines anderen registrierten Wagens ausgesendet. Dann bliebe es lange unbehelligt, zumindest bis das Original als gestohlen gemeldet wird.«
»Die gute alte Doublettenmethode. Wie diese Separatisten damals in München.«
»Genau. Sicher ist nur, dass er irgendwie hierhergekommen sein muss.« Sie malt eine Geste in die Luft, und Pazzi erscheint am Straßenrand. »Danach geht es so weiter.«
Der MEP läuft gemessenen Schrittes in unsere Richtung. Er bewegt sich sehr geschmeidig.
»Gut gemacht«, lobe ich meine Analystin.
Sie zuckt mit den Achseln. »Person des öffentlichen Lebens. Terry hat Tausende Stunden Videomaterial, ein Kinderspiel.«
Pazzi läuft den Abhang hinunter. Dann bleibt er stehen und zündet sich eine Zigarette an, was mich ein wenig neidisch macht. Nachdem er einmal abgeascht hat, läuft er weiter. Er ist jetzt 29,34 Meter von uns entfernt. Pazzi zieht noch einmal, dann wirft er die Kippe weg und bleibt stehen. Er legt den Kopf ganz leicht zurück, lässt die Arme hängen und murmelt vor sich hin. Das kann eigentlich nur eines bedeuten.
»Der schaut sich irgendwas auf seinen Specs an.«
Ava friert ihn ein und sagt: »Terry zufolge hat er eine Nachricht an Peter Heuberger versendet.«
»Um diese Zeit?«
»Verzögerte Nachricht. Sollte erst um 08.30 Uhr zugestellt werden.«
»Inhalt?«
»Sie lautete: ›Müssen reden. Dinner um 19.30 Uhr im Hotel Lotte?‹ Er scheint sich sicher gewesen zu sein, dass Heuberger zusagt, denn er hat auch gleich einen Tisch für drei geordert.«
»Wieso für drei? Wer war denn noch eingeladen?«
»Terry zufolge gibt es dazu keine Daten.«
»Prognose aufgrund früherer Treffen?«
»Auf Basis seiner Sozialkontakte und seiner Restauranthistorie sind das am ehesten Alan Thompson, britischer MEP, Heidi Garcia, Lobbyistin des Verbands für Solarenergie, oder Jong de Klerk, ein Jazzmusiker. Alles Freunde von Pazzi. Aber die Wahrscheinlichkeit liegt laut Terry bei allen unter 25 Prozent, denn in 91 Prozent aller verzeichneten Fälle waren Pazzi und Heuberger allein essen – und zwar, wenn ich das richtig sehe, stets in Restaurants außerhalb des Europaviertels.«
»Sehr diskret, die beiden Jungs.«
»Sieht so aus. Nach der Reservierung hat er seine Specs nicht mehr benutzt. Es gibt auch keine Point-of-View-Aufnahmen.« Ava murmelt etwas, und Pazzi setzt sich wieder in Bewegung. Er geht weiter auf uns zu, schaut durch uns hindurch in den Regen. Einen Meter links von Ava bleibt er stehen. Er wartet, geht einige Schritte hin und her, blickt in verschiedene Richtungen – zumindest interpretiert Terry seine Schrittfolge dementsprechend. Dann verwandelt sich Pazzis Gesicht in eine rosafarbene Wolke, und er fällt. Im Sturz dreht er sich, landet auf der rechten Schulter und rollt auf den Rücken. Kurz bevor er aufschlägt, höre ich den Überschallknall der Waffe.
Pazzi muss noch viele Male sterben, bevor ich zufrieden bin. Ava lässt ihn immer wieder über das Feld marschieren. Aus verschiedenen Blickwinkeln beobachte ich, wie er umfällt, in Echtzeit, in Zeitlupe, in Stop-Motion.
»Jetzt gehen wir zu der Pappel«, sage ich. Ava könnte uns auch dorthin zoomen, aber ich bin altmodisch. Diese Special Effects verursachen mir Kopfschmerzen. Also laufe ich. Als ich ankomme, steht Ava bereits auf dem fraglichen Ast, 5,21 Meter über mir. Sie schaut belustigt auf mich herab.
»Aber selbst hochklettern willst du da jetzt nicht, oder Aart?«
»Doch, genau das will ich.«
»Aber warum? Ich kann dich hochfliegen. Falls dir das zu surreal ist, kann ich auch eine Hebebühne erscheinen lassen, die dich …«
»Die Welt ist voller offensichtlicher Dinge, die niemandem je auffallen.«
»War das ein Zitat?«
Ich nicke. »Arthur Conan Doyle. Diese virtuelle Forensik hat den Nachteil, dass sie einen Offensichtliches vergessen lässt.«
Ava verdreht die Augen wie eine Teenagerin, der ein älterer Herr eine angestaubte Geschichte aus seiner Jugend erzählt. Ich ignoriere die Geste, ziehe meinen Trenchcoat aus und beginne, nach einem guten Halt zu suchen.
»Das Offensichtliche«, keuche ich, während ich mich auf einen der unteren Äste schwinge, »ist in diesem Fall, dass wir zwar fliegen können. Der Mörder dagegen musste auf die herkömmliche Art und Weise den Baum erklimmen.«
Es dauert etwa zwei Minuten, bis ich oben bin. Ich verzichte darauf, Ava um einen weiteren Regenguss zu bitten, der die Kletterpartie sicherlich realistischer gemacht hätte. Denn dann fiele ich vielleicht von der glitschigen Pixelpappel in den virtuellen Schlamm, und diese Genugtuung möchte ich meiner Analystin nicht gönnen. Aber auch so bin ich mir ziemlich sicher, dass jeder halbwegs trainierte Mann ohne Kletterwerkzeug auf den Ast käme. Als wir dort nebeneinandersitzen und zu Pazzi hinüberschauen, der bewegungslos mitten im Feld steht, wird mir klar, dass dies ein Wilhelm-Tell-Schuss gewesen sein muss. Da sind zunächst der Regen, die Dunkelheit und der etwas zu steile Winkel. Hinzu kommt, dass der Schütze die Waffe für solch einen Blattschuss sehr ruhig gehalten haben muss. Machbar, wenn man auf festem Boden steht. Schwierig, wenn man auf einem nassen Ast hockt.
»Spuren?«, frage ich.
»Die Mollydrohnen haben Abrieb seiner Kleidung und Ausrüstung gefunden, aber keine verwertbare DNA. Moment, ich habe eine Projektion.«
Neben uns auf dem Ast erscheint ein Mann ohne Gesicht, er sieht ein bisschen aus wie diese holografischen Schaufensterpuppen in den Galeries Lafayette. Er trägt schwarze Armeestiefel, schwarze Cargohosen und einen Chamäleonponcho, dessen Farbe sich der Rinde und dem Laubwerk angepasst hat. In den Händen hält er ein Jericho 42C, das auf den immer noch seines unvermeidlichen Schicksals harrenden Pazzi gerichtet ist.
Ava lässt den Killer abdrücken. »Das Plastik des Munitionsstreifens verdampft weitgehend rückstandslos, aber am Baumstamm klebten ein paar Moleküle. Er hat lediglich einen Schuss abgegeben.«
Ich schüttele den Kopf. »Das ergibt keinen Sinn. So macht man das nicht.«
»Jetzt kommt wieder irgendeine Soldatenweisheit aus dem Solarkrieg, stimmt’s?«
»Stimmt. Wenn ich jemanden mit einem praktisch rückstoßfreien Sturmgewehr von hinten erschießen will, dann stelle ich auf Automatik.«
Ava runzelt die Stirn. »Auf einem Baumstamm balancierend?«
»Okay, vielleicht doch Einzelschuss. Aber dann jagt man nach dem ersten Treffer noch ein paar Kugeln hinterher, um ganz sicherzugehen.«
»Aber er war doch nach dem ersten Treffer in den Kopf sofort tot. Insofern konnte sich der Schütze seine Munition sparen.«
»Und wie hätte er das wissen können? Pazzi ist von hier nur ein winziges Männchen. Profis sparen außerdem nie an Munition. Und sie zielen nie auf den Kopf.«
Sie murmelt etwas, dann nickt sie. »Terry ist deiner Meinung. Basierend auf den Fällen in seiner Datenbank.«
»Was ist da drin?«
»Europol-Forensik, Spiegelungen separatistischer Aktionen, Anschläge nordafrikanischer Terroristen, Auftragsmorde der Mafia, solches Zeug. Terry hat alle in einer Entfernung von fünfzig bis dreihundert Metern abgegebenen letalen Schüsse ausgewertet. Seine Prädiktion ist, dass ein professioneller Schütze im vorliegenden Szenario mit 93-prozentiger Wahrscheinlichkeit für einen Körpertreffer im oberen Teil des Rückens optieren würde.«
Es ist schön, das mit Zahlen unterfüttert zu bekommen, auch wenn ich es bereits wusste.
Ava sieht mich erwartungsvoll an. »Wo hättest du denn hingeschossen, Aart?«
»Ich war nie Scharfschütze. Aber der beste Punkt ist in der Tat der obere Rücken. Dann zerfetzt du Wirbelsäule, Lunge, Schlagader und eventuell noch das Herz. Toter geht es kaum.«
»Er hat aber auf den Kopf geschossen«, wendet sie ein. »Was sagt uns das über den Täter?«
»Vermutlich, dass er ziemlich arrogant ist. Überzeugt von seinen Fähigkeiten.«
»Offenbar nicht ganz zu Unrecht.«
Ich zeige auf die umliegende Gegend. »Wissen wir, woher er kam und wo er danach hin ist?«
»Laut den Spuren kam er wie Pazzi von der Straße, wie viel früher lässt sich nicht genau feststellen. Terry schätzt eine Stunde. Dorthin ging er auch wieder zurück. Auch hier gibt es keine Fahrzeugsignatur.«
Dies ist ein beschissener Fall, jedes weitere Detail, oder genauer gesagt, deren Fehlen, macht das deutlich. An mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit handelt es sich um ein politisch motiviertes Attentat. Die einzigen gewöhnlichen Kriminellen, die es hinbekämen, derart professionell ihre Spuren zu verwischen, sind die Britskis, aber daran will ich lieber gar nicht denken.
Und als ob all das nicht schon schlimm genug wäre, sagt Ava plötzlich: »Du hast einen Prioritätsanruf.«
Ich reibe mir die Augen. »Stell ihn durch.«
Höfliche Menschen kaschieren ihr unangekündigtes Eindringen in eine laufende Spiegelung, indem sie möglichst subtile Kommunikationsmittel wählen. Alte, von einem Pagen auf einem Tablett überbrachte Wählscheibentelefone sind beliebt, einmal ist sogar eine weiße Taube mit einem Brief im Schnabel auf meiner Hand gelandet.
Vogel sind derlei Feinheiten natürlich fremd. Er brüllt einfach in die Spiegelung hinein, seine donnernde Stimme scheint von irgendwo jenseits der weißen Schäfchenwolken zu kommen. So ähnlich muss sich Moses gefühlt haben, als ihn sein zorniger alttestamentarischer Gott wieder einmal herunterputzte. Ich frage mich, ob der Effekt beabsichtigt ist, oder ob Vogel es einfach nicht besser hinkriegt. Ich tippe auf Letzteres.
»Westerhuizen! Kommen Sie da raus, ich will Sie unverzüglich in meinem Büro sehen.«
»Gerne, Herr Präfekt.« Ich gebe Ava ein Zeichen, und um mich herum wird es dunkel.
Wie immer nach einer Spiegelung fühle ich mich, als ob ich am Vorabend eine Flasche Genever vernichtet hätte. Dabei waren es höchstens drei oder vier Gläschen. Offenbar sieht man mir meine Katerstimmung an, denn als ich vor dem Lift Marquez und Kaczynski treffe, verzichten die beiden auf die dummen Sprüche, die ich sonst stets zu hören bekomme. Stattdessen mustert mich Marquez fast mitfühlend durch seine bläulich getönten Specs.
»Die Pazzi-Sache, Westerhuizen?«
Ich nicke und krame in meiner Jacketttasche nach einem Lakritz. Marquez und Kaczynski sind seit Wochen dabei, sich an einen Schmugglerring heranzurobben, der Drogen und Waffen aus dem Ausland ins Unionsgebiet bringt, vermutlich über Sizilien. Die Sache scheint nicht recht voranzugehen.
»Immer noch die Schmuggler?«
Marquez grunzt. Er hat das Gesicht einer Bulldogge, die zu lange in der Sonne war. Da es in Brüssel seit mehr als drei Wochen ununterbrochen schüttet, tippe ich auf Bräunungspillen. Er wiegt seinen Quadratschädel hin und her, so als wolle er seine Nackenmuskeln lockern. »Ein Scheißfall. Aber nicht so beschissen wie deiner, was? Toter MEP, das sorgt für Wirbel.«
»Stimmt es, dass es kaum Spuren gibt?«, fragt Kaczynski. Während Marquez wie ein Kampfhund aussieht, erinnert der Pole eher an einen Geier: langer Hals, hektisch auf- und abhüpfender Adamsapfel, dazu strubbelige, semmelblonde Haare, die sich bereits seit einigen Jahren auf dem Rückzug befinden und fahle Kopfhaut durchschimmern lassen. Ein paar von Marquez’ Bräunungsdrops würden ihm guttun.
Sein scheinheiliges Gefrage macht mich wütend. Er könnte die Eckpunkte des Pazzi-Dossiers jederzeit von Terry bekommen. Vermutlich liest er den Mist gerade auf seinen Specs. Aber er fragt mich trotzdem, aus purer Bosheit.
»Wir wissen nicht, wie Pazzi und sein Mörder zum Tatort gekommen sind, und wir haben keine Signatur für die Waffe. Aber das wird schon.«
In diesem Moment kommt mir eine Idee. »Ihr Jungs seid doch Experten für Schmuggel. Wie bekommt man eigentlich ein Sturmgewehr aus dem Kriegsgebiet ungesehen in die Union?«
Kaczynski zuckt mit den Achseln. »Es gibt viele Wege.«
»Wie? Nachdem ihr bereits wochenlang an diesem Fall herumgepopelt habt, wisst ihr immer noch nicht, wie das läuft?«
Wie ich erwartet habe, schnappen Marquez’ Bulldoggenkiefer angesichts dieses Vorwurfs erregt auf und zu. Er versucht, böse zu gucken. »Wir wissen sehr genau, wie es läuft, Westerhuizen.«
»Und zwar?«
Marquez macht eine Kunstpause. Vermutlich glaubt er, dadurch Spannung aufzubauen. Aber das Einzige, was sich aufbaut, ist Langeweile. Nach einer Ewigkeit sagt er: »Menschliche Kuriere sind passé. Terrys prädiktive Software kann Schmuggler inzwischen identifizieren, bevor die sich die Ware auch nur halb in den Arsch geschoben haben. Das Neueste sind Hobodrohnen.«
»Was ist ein Hobo?«, frage ich.
»Das ist Englisch. So hat man in Amerika früher Landstreicher genannt, die als blinde Passagiere in Zügen durchs Land gereist sind.«
»Sie haben sich unter die Waggons gehängt«, sekundiert Kaczynski. »Damals fuhren die nicht schneller als vierzig Stundenkilometer.«
»Das muss aber vor sehr langer Zeit gewesen sein«, wende ich ein.
Marquez grunzt zustimmend. »1970 oder so. Diese Hobodrohnen machen dasselbe. Sie suchen sich einen Zug oder einen Megatruck und hängen sich drunter. Dann schalten sie alle Systeme ab, weswegen du sie mit Scannern nicht zu fassen bekommst. Am Zielort klinken sie sich dann aus. Viel Stauraum haben diese Dinger nicht, sie sind nur etwa so groß.« Er zeigt mit den Händen etwas, das die Abmessungen eines Putzeimers hat. »Aber das reicht dicke für zerlegte Waffen, Sprengstoff, Drogen, Organe, was auch immer.«
»Interessant«, erwidere ich tonlos. »Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss jetzt zu Vogel.«
Die beiden schauen sich an und grinsen. »Oh, Vogel? Mein Beileid«, sagt Kaczynski. »Aber besser du als ich.«
»Keine Sorge, Kollege. Wenn du noch ein paar Wochen erfolglos an diesem Schmugglerring herumermittelst, bekommst du sicher auch bald eine Audienz.«
Dann lasse ich die beiden ohne ein weiteres Wort stehen und steige in den Lift. Ich sage ihm, dass ich in die Präfektur möchte. Die befindet sich im obersten Stockwerk des Gebäudes. Bevor man das Büro von Jerôme Vogel betreten darf, muss man nicht weniger als drei Sicherheitsschleusen passieren. Ich gehe gemessenen Schrittes den langen Gang entlang, um den Colibris und Scannern ausreichend Gelegenheit zu geben, jede meiner Hautfalten zu inspizieren. Zu beiden Seiten des breiten Flurs stehen in regelmäßigen Abständen neoklassizistische Statuen, höchstwahrscheinlich handelt es sich um Reproduktionen, die man mit Sicherheits- und Abwehrtechnik vollgestopft hat. Dazwischen hängen mit Stuck verzierte, goldene Bilderrahmen, deren Medienfolien bedeutende Wahrzeichen der Union zeigen. Ich passiere das Neue Brandenburger Tor, den Eiffelturm, das Kolosseum und den Tempelberg. Direkt neben dem Eingang zu Vogels Büro hängen der Buckingham Palace und Stonehenge, was nicht einer gewissen Komik entbehrt.
Ich stehe vor dem Eingangsportal. Da die Systeme meine Ankunft ohnehin bereits angekündigt haben dürften, trete ich, ohne zu klopfen, ein. Vogel sitzt an seinem immensen Schreibtisch. Dahinter gibt es eine fast bis zum Boden reichende Panoramascheibe, durch die man die Regentschapsstraat hinaufschauen kann. Dort befindet sich das alte Palais Royal, nun Sitz der Europäischen Kommission. Sein Dienstherr sitzt Vogel also stets im Nacken, aber dieser Umstand scheint ihn nicht zu stören.
Es ist ohnehin kaum vorstellbar, dass es etwas gibt, das Jerôme Vogel stören könnte. Der Elsässer besitzt nicht nur den Feinsinn eines Nilpferds, sondern auch dessen dicke Haut. Er ist Ende sechzig und hat bereits ein halbes Dutzend Kommissionspräsidenten überlebt, Dutzende von Intrigen und mindestens vier Mordanschläge. Er wiegt hundertvierzig Kilo und verlässt seinen Bürosessel nur, wenn es absolut notwendig ist – aufgrund der immer besser werdenden Spiegeltechnologie also fast nie. Als er mich sieht, fährt er sich mit der Rechten über den ausrasierten Nacken und heftet seine durchdringenden, stahlblauen Augen auf mich.
»Guten Morgen, Westerhuizen.«
Es ist die freundlichste Begrüßung, die ich von Vogel seit mindestens zwei Jahren gehört habe. Das macht mich sofort misstrauisch.
»Guten Morgen, Herr Präfekt.«
Er deutet auf den Besucherstuhl. »Ich habe eben bereits Özal am Telefon gehabt. Die Kommissionspräsidentin ist äußerst besorgt wegen Pazzis Tod.«
»Sie ist wohl eher besorgt wegen der Verfassungsabstimmung.«
»Sechs Wochen vor der Abstimmung kommt ihr diese Sache in der Tat ungelegen, ja. Uns allen, wenn ich das sagen darf.«
»Sie verfolgen den politischen Zirkus genauer als ich, Präfekt. War Pazzi irgendwie an dieser Verfassungsgeschichte beteiligt?«
Vogel versucht, seinen Kopf zu schütteln. Nicht ganz einfach, wenn man keinen Hals hat. »Er war keiner der Strippenzieher, falls Sie das meinen. Aber er war immer gegen den Austritt der Briten und für die Einheit der Union.«
»Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, wenn ein Italiener so etwas sagt.«
Der Präfekt macht eine wegwerfende Handbewegung. »Anders als den Mezzogiorno hätten wir Großbritannien gerne behalten. Stammte Ihre Frau nicht aus England?«
Wieder beweist Vogel enormes Feingefühl, indem er meine tote Frau erwähnt. »Sie war aus Wales.«
»Verstehe. Wie auch immer, das Vereinigte Königreich ist raus, in sechs Wochen greift die Exitklausel. Pazzi war in der Sache neutral eingestellt.«
»Sagen politische Beobachter?«
»Sagt Terry. Nachdem all seine Datenstreams entsiegelt worden sind, habe ich mir ein politisches Kongruenzprofil erstellen lassen«, er wirft mir einen tadelnden Blick zu, »was Sie offensichtlich bisher versäumt haben.«
»Ich hielt es für wichtiger, zunächst den Tathergang zu rekonstruieren, Präfekt.«
»Dazu erwarte ich gleich Ihren Rapport. Terrys Kongruenzanalyse hat ergeben, dass sich Pazzis öffentliche und private Äußerungen zu 77 Prozent mit dem Parteiprogramm der Liberalen deckten.«
»Kein schlechter Wert. Beinahe ein ehrlicher Politiker.«
Vogel, der Mitglied der Konservativen Sammlung ist, ignoriert meine Bemerkung. »Was die Verfassungsreform angeht, ist die Sache hingegen etwas vager. Er hätte mit 57-prozentiger Wahrscheinlichkeit zugestimmt.«
»Das ist Terrys Art zu sagen, dass er nicht weiß, wie Pazzi abgestimmt hätte, oder? Vermuten Sie denn einen politischen Hintergrund?«
Vogel legt seine Kutscherpranken auf den Eichenschreibtisch. »Wir müssen das Schlimmste annehmen. Was glauben Sie, Westerhuizen? Separatisten? Mafiosi?«
Ich zucke mit den Achseln. »Nichts in seinem Précis deutet darauf hin, dass Pazzi Kontakte zu den Britskis oder der ’Ndrangheta hatte. Die gängigen Terrorgruppen kommen infrage, schlichtweg weil er ein MEP war. Sicher ist bisher nur, dass hier Profis am Werk waren. Es gibt kaum verwertbare Tatortspuren.«
»Was soll das heißen, zum Teufel?«
So viel zu der Freundlichkeit von vorhin.
»Ich habe alles doppelt und dreifach spiegeln lassen, Molekularscans, Colibris, das volle Programm. Aber bisher wissen wir nicht mal, wie Pazzi auf diesen Acker gekommen ist. Es deutet jedoch alles darauf hin, dass es eine geplante Exekution war. Bei Terroristen müssten wir allerdings bereits ein Bekennerschreiben haben – und das Web wäre vermutlich voll mit 360ern von Pazzis explodierendem Kopf. Sie wissen doch, wie diese Kerle auf Exekutionsvideos stehen.«
Ich erzähle Vogel, was bei der Spiegelung noch herausgekommen ist und dass Pazzi möglicherweise mit einer Waffe der Kohäsionskräfte abgeknallt wurde. Seine Miene wird, soweit das überhaupt möglich ist, noch finsterer.
»Sie machen ab sofort nichts anderes mehr, Westerhuizen!«
»Verstanden, Chef.«
»Ich will, dass die Sache binnen achtundvierzig Stunden geklärt ist.«
Ich merke, wie mein Hals trocken wird. »Ich kann Ihnen nicht versprechen …«
»Ich verlange nicht von Ihnen, dass Sie den Fall bis dahin vollständig gelöst haben. Ich verlange aber einen Ermittlungsstand, der es mir erlaubt, die Kerle da drüben«, er zeigt mit dem Daumen über seine rechte Schulter in Richtung des Kommissionspalais, »und die Leute von Parlament, Rat und natürlich die verdammte Öffentlichkeit mit einer Geschichte zu füttern, die den toten Pazzi möglichst langweilig erscheinen lässt. Zunächst werden die Medien durchdrehen, aber danach muss ich Ruhe reinbringen.«
»Ich tue mein Möglichstes.«
»Das will ich für Sie hoffen. Was brauchen Sie?«
»Avas gesamte Zeit. Vermutlich einen Haufen Spiegelungen. Außerdem muss ich einige Reisen unternehmen, zum Beispiel nach Norditalien, wo Pazzi herkommt.«
»Unsinn! Sie machen das per Spiegelung. Reisen kostet viel zu viel Zeit.«
»Man erfährt aber mitunter mehr als auf der Liege.«
Vogel entfährt ein Laut, den man mit viel Fantasie als Lachen deuten könnte. »Mein Bullenherz ist Ihrer Meinung, Westerhuizen. Sie sind vom alten Schlag, genau wie ich. Sie gehen raus, sprechen persönlich mit Zeugen, schnüffeln am Tatort herum. Aber mein Präfektenherz sagt mir, dass diese Zeiten vorbei sind. Das ist hier keiner Ihrer Harry-Bogart-Filme.«
»Humphrey Bogart.«
»Wie auch immer. Wir sollen Terrorismus, organisierte Kriminalität und andere schwere Vergehen in siebenunddreißig Mitgliedstaaten und acht assoziierten Territorien unterbinden. Dafür habe ich weniger Beamte als die Pariser Stadtverwaltung Müllmänner. Effizienz ist Trumpf, Westerhuizen. Sich die Schuhsohlen abzulaufen, ist nur noch eine romantische Fantasie aus 2-D-Filmen. Aber seien Sie unbesorgt. Ich werde Ihnen Werkzeuge an die Hand geben, die Ihre Ermittlungen erheblich beschleunigen.«
»Welche, Präfekt?«
»Sie können ab sofort als Ghost operieren.«
»Im Mirrorspace? Ich dachte, das darf nur der Geheimdienst.«
»Normalerweise ja, weil es teuer ist und Unmengen von Rechenleistung frisst. Aber ich brauche schnelle Ergebnisse. Und deshalb bekommen Sie einen Zugang.«
»Vielen Dank, Präfekt.«
Vogel winkt ab. »Und jetzt sehen Sie zu, dass Sie an die Arbeit gehen. Morgen um diese Zeit erwarte ich einen Zwischenbericht.«
Er legt die Hände in den Schoß und betrachtet konzentriert seinen Schreibtisch, was ich als Aufforderung interpretiere, mich zum Teufel zu scheren. Ich stehe auf und gehe zur Tür.
»Eins noch, Westerhuizen.«
»Ja, bitte?«
»Es gibt eine neue Iteration von TEREISIAS. Er ist jetzt viel … selbstständiger. Das ist noch geheim. Ich versuche, Ihnen auch da einen Zugang zu verschaffen. Vielleicht hilft das.«
»Vielen Dank. Ich werde meine Analystin darauf ansprechen.«
»Möglicherweise werden Sie die in Zukunft nicht mehr brauchen.«
»Wieso nicht?«
»Der nächste Terry soll direkt mit den Kommissaren zusammenarbeiten. Das zumindest ist die Idee. Anfangs wird noch wie bisher eine Analystin als Vermittlerin zwischengeschaltet sein, aber später vermutlich nicht mehr.«
»Ist er so schlau geworden?«
»Man wird sehen. Ich persönlich bin nach den ersten Tests äußerst beeindruckt. Und nun raus mit Ihnen.«
Ich verlasse das Büro und gehe in Richtung Aufzug. Digitale Forensik ohne Analystinnen – wie soll das funktionieren? Der Hormonhaushalt von Europol wird komplett aus dem Gleichgewicht geraten.
3
Auf dem Rückweg ins Büro rufe ich meine Analystin an.
»Hallo, Ava.«
»Hi, Aart. Wie war’s bei Vogel?«
»Er war freundlich, für seine Verhältnisse. Aber er wird es nicht lange bleiben, wenn wir seiner Ansicht nach zu langsam arbeiten. Wir machen ab jetzt nur noch Pazzi.«
»Und was ist mit der Creeperfeed-Geschichte?«, fragt sie. »Ich habe neue illegale Aufnahmen auf den Tisch bekommen. Irres Zeug.«
»Vogel sagt, wir sollen alles andere liegen lassen, also tun wir das auch. Die perversen Sexvideos werden warten müssen.«
»Mist.«
Ich bin unterdessen am Lift angekommen und fahre direkt in die Tiefgarage. »Ich werde mir jetzt Pazzis Wohnung ansehen.«
»Okay. Soll ich eine Spiegelung vorbereiten?«
»Ja, zur Sicherheit. Aber ich werde trotzdem zu seiner Wohnung fahren und sie mir in echt anschauen. Kannst du meinem Wagen Adresse und Zugangscodes übermitteln?«
»Mach ich.«
»Danke. Außerdem muss ich noch mit Pazzis Parteichef sprechen. Wer wäre das? Diese Dänin?«
»Genau, Jana Svensson, Fraktionsvorsitzende der Liberalen.«
»Gut. Aber noch wichtiger wäre Peter Heuberger, der Lover von Pazzi. Der ist in Brüssel, oder? Kannst du ihn für mich lokalisieren?«
»Easy. Er ist nur ein Parlamentsassi, hat also keine Immunität.« Einen Moment herrscht Stille. Als ich gerade die Tiefgarage betrete und meinen Wagen rufe, sagt Ava: »Peter Heuberger ist nicht im District Européen.«
»Wieso nicht? Ich denke, er war mit Pazzi zum Abendessen verabredet?«
»Ja. Aber er hat heute Morgen um 07.30 Uhr den Expresszug nach Berlin genommen. Dort kam er gegen zehn an.«
»Und was tut er da?«
»Zurzeit befindet er sich im Abgeordnetenhaus des Bundestags, zusammen mit seiner MEP, Tanja Boll. Willst du Terrys Prädiktion auf Basis der früheren Bewegungsmuster?«
»Bitte.«
»Die Stippvisite dauert fünfeinhalb Stunden. Heuberger fährt noch am gleichen Tag zurück. Wahrscheinlichkeit: 87 Prozent. Oder es dauert außerplanmäßig länger, dann Abendessen im ›Viaggio‹ am Gendarmenmarkt, Übernachtung im ›Lotte‹. Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent. Terry sagt, dass Heuberger im ersten Fall voraussichtlich um 18.33 Uhr mit dem Expresszug in Bruxelles-Midi eintreffen wird.«
»Okay. Eine halbe Stunde bevor er ankommt, soll Terry mich informieren. Wenn er in Berlin bleibt, will ich das ebenfalls sofort wissen. Setz Drohnen auf ihn an, falls notwendig.«
»Schicken wir Heuberger keine Vorladung?«
»Nein, ich passe ihn heute Abend am Bahnhof ab. Weiß er schon, dass Pazzi tot ist?«
»Moment. Seine Telefonate und Mails haben wir alle, da kann Terry nichts Derartiges finden.«
Noch hält Vogel es unter der Decke. Aber irgendwann am frühen Nachmittag werden es die Medien erfahren. Dann wird Heuberger es auch mitkriegen, vermutlich während der Rückfahrt. Nicht schön, so etwas in einem voll besetzten Zug zu erfahren. Wenn ich ihm gegenübertrete, wird er mit den Nerven folglich völlig am Ende sein. So mag ich meine Zeugen am liebsten.
Ich erwäge, Ava auf die neue Version von Terry anzusprechen, überlege es mir jedoch anders. »Bis später, Ava. Können wir heute Abend noch mal sortieren, was wir haben?«
»Klar. Aber wir müssten es bei mir machen, ist das okay?«
Ich war noch nie bei Ava. Unser Verhältnis ist, wie gesagt, rein professioneller Natur. Aber warum eigentlich nicht? »Alles klar. Ich komme vorbei, sobald ich Heuberger ausgequetscht habe.«
»Okay, das ist super, bis später, Aart.«
Ich steige in meinen Mercedes und weise ihn an, zu Pazzis Privatwohnung zu fahren. Als wir die Tiefgarage verlassen, ertönt ein vertrautes prasselndes Geräusch. Es schüttet immer noch, und es ist sogar schlimmer geworden. Man kann es an den Regensielen erkennen. Vor einigen Jahren hat die Stadtverwaltung in ganz Brüssel Kanalisationspumpen installieren lassen, weil sich die Boulevards und Avenuen immer wieder in Sturzbäche verwandelten. Normalerweise schaffen die Pumpen das Wasser problemlos weg, aber heute steht die Brühe knöchelhoch. Der Verkehr ist deshalb weitgehend zum Erliegen gekommen, obwohl die Rushhour noch gar nicht begonnen hat. »Prioritätsfahrt«, brumme ich. Sofort weist Gottlieb die anderen Autos an, Platz für einen dringenden Polizeieinsatz zu machen, und der Verkehr vor uns teilt sich.
Nach etwa zwanzig Minuten erreiche ich Pazzis Behausung. Es handelt sich um einen etwas in die Jahre gekommenen Kasten, den Neojugendstilelementen nach zu urteilen vermutlich aus den späten Zwanzigern. Der untere Teil, der die ersten fünf Stockwerke beherbergt, ist aus vormals weißem Sandstein, darüber hat man einen fast hundert Meter hohen Glasquader gestülpt. Trotz oder vielleicht gerade wegen all der floralen Motive und Märchengestalten sieht das Gebäude aus wie Schneewittchens Sarg. Das Auto darf dank meines Europol-Codes in die doppelt gesicherte Tiefgarage fahren. Vor dem Lift setzt es mich ab.
Pazzi wohnt, wie mir meine Specs mitteilen, im 57. Stock, Penthouse. Ich lege zunächst einen Zwischenstopp in der Lobby ein. Im Foyer erwarten mich noch mehr Jugendstiloptik, eine Sitzgruppe sowie ein Empfangstisch, hinter dem ein Concierge sitzt. Ich nicke ihm freundlich zu. Er lächelt mich an. Als ich ihm meinen Europol-Ausweis unter die Nase halte, hat das ein Ende.
»Guten Tag. Sie kommen sicher wegen Herrn Pazzi, Herr …«, er beäugt den Ausweis, »Inspektor Westerhuizen?«
Der Concierge ist ein kleiner, nervös dreinblickender Mann mit dünnem Oberlippenbart. Laut meinen Specs heißt er Reza Yekta, siebenundfünfzig Jahre, Perser, limitierte Aufenthaltsgenehmigung, wohnhaft in der Lombardstraat 15a, unverheiratet, keine Kinder, Probleme mit dem Entziffern von Polizeiausweisen.
»Hauptkommissar«, entgegne ich barsch.
Der Concierge wird blass.
»Wann haben Sie Vittorio Pazzi das letzte Mal gesehen?«
Er murmelt etwas, ruft auf seinen nordkoreanischen Billigspecs irgendwelche Daten ab. Das dauert. »Laut dem Überwachungssystem des Gebäudes …«
»… hat er seine Wohnung gestern kurz nach Mitternacht verlassen. Unsere Forensiker haben sich die Daten schon gezogen, Sie müssen sie mir nicht vorlesen.«
Ich aktiviere die schmale LED-Leiste der Specs, die anzeigt, dass ich aufnehme. In alten Filmen richten Polizisten bei Verhören immer grelle Lampen auf die Zeugen, heute kann man mit einer kleinen roten Leuchtdiode einen mindestens ebenso verheerenden psychologischen Effekt erzielen. In Wahrheit nehme ich schon seit Beginn des Gesprächs alles auf. Aber das muss der Concierge ja nicht wissen.
»Ich hätte stattdessen gerne gewusst, wann Sie ihn zum letzten Mal gesehen haben«, ich mache eine Kunstpause, »Herr Yekta? Aus der Lombardstraat 15a?«
Ich sehe Furcht in seinen Augen. »Als er gestern, gegen sieben Uhr, schätze ich, nach Hause kam, da habe ich ihn kurz gesehen«, stammelt er.
»Ist Ihnen etwas aufgefallen?«
»Er sah abgeschlagen aus. Und er hatte eine Packung Spielkarten in der Hand.«