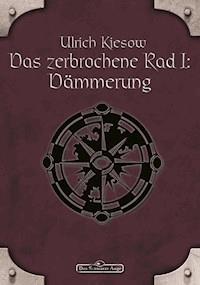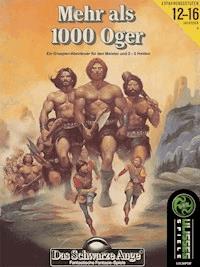Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
Der Tag der Entscheidung in der Schlacht an der Misa. Wenn es den vereinten Armeen aus Gareth und Festum hier nicht gelingt, den Heerzug der Mordbrenner, Beschwörer und Dämonen zum Stehen zu bringen, dann wird das Bornland untergehen, von der Blutgier Borbarads und seiner Schergen vernichtet... Nur die Barden werden dann noch vom prachtvollen Land am Born und seinen tapferen Bewohnern künden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 858
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Ulrich Kiesow
Das Zerbrochene Rad II: Nacht
Zweiter Teil
Siebenundfünfzigster Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©
Originalausgabe
Impressum
Ulisses SpieleBand 57
Kartenentwürfe: Ralf HlawatschE-Book-Gestaltung: Michael Mingers
Copyright ©2012 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN, DERE, MYRANOR, RIESLAND, THARUN und UTHURIA sind eingetragene Marken der Significant GbR.Alle Rechte von Ulisses Spiele GmbH vorbehalten.
Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.
Print-ISBN: 3-453-18810-1 (vergriffen)E-Book-ISBN: 978-3-86889-630-5
Kleine Rädchen Kreisten, kreisten – Großes Rad In Stücke brach.
Aus einem norbardischen Lied, meist am Spinnrad gesungen
17. Kapitel
Die Schwarze Sichel im Firun 1020 n. BF.
Der Troll auf dem Stieg
Die Kutsche ächzte laut auf und schwankte bedrohlich zur Seite. Für einen Moment schwebten die rechtsseitigen Räder in der Luft, dann fielen sie mit einem Ruck wieder auf den hartgefrorenen, beschneiten Weg zurück. Im Innern des schmalen Gefährts gab es einen Stoß, der die Passagiere fast vom Sitz geschleudert hätte. »Et wörd nix, et wörd nix – wej sterben und störzen uns dod!« rief draußen auf dem Bock der Kutscher laut genug, damit man ihn in der Kutsche hören konnte.
»Du hast unser Gold genommen und eingesackt, nun tu gefälligst deine Arbeit!« rief Gerion ebensolaut zurück. »Daß es nicht einfach wird, haben wir vorher gewußt – und du hast deswegen einen besonderen Zuschlag verlangt, Schlaumeier!«
»Aber et is‘n Wahnsinn!« schallte die Kutscherstimme. »Nimmed föhrt im Hesind über‘n Sichelstieg!« Auch der alte Gurvan war von dem Schlag geweckt worden. Er versuchte sich zu erheben, aber seine Pfoten scharrten vergeblich über den glatten Boden des Fahrzeugs. So stellte er seine Bemühungen bald wieder ein und begnügte sich damit, zornig zum Fenster hinaufzubellen – offenbar weil er dort den Rufer vermutete. »Du hältst das Maul, Stinker!« fuhr Selissa ihn an. »Nichts als Schwierigkeiten hat man mit dir, und wenn wir uns alle ›dodstörzen‹, bist du auch daran schuld, weil der bequeme Herr ja neuerdings nicht mehr zu Fuß gehen mag ...«
»Tatsächlich?« fragte Gilia, die ebenfalls gerade aufgewacht war und sich mit den Handknöcheln die Augen rieb. »Habt ihr deswegen die Kutsche gemietet, damit der alte Kerl nicht zu laufen braucht?«
»Natürlich«, antwortete Selissa grimmig. »Du kannst froh sein, daß wir überhaupt mit dem dicken Burschen ein Gefährt teilen dürfen und nicht hinterherlaufen müssen. Könnte ja sein, daß dem Alten der Platz nicht reicht ...«
Gerion beugte sich vor, um Gurvan hinter den Ohren zu kraulen. »Achte gar nicht darauf, was diese Orkinnen plappern«, murmelte er. »Halt dich an mich – ich lasse dich nicht verkommen. Das weißt du doch, alter Kampfgefährte, nicht wahr?«
Der alte Hund ließ einen knatternden Furz ertönen. Gerion hob verdutzt die Brauen, und Selissa bog sich vor Lachen – nur Gilia verzog keine Miene. »Wie viele Ausdrucksmöglichkeiten so ein Hund doch hat«, stellte Selissa prustend fest. »Der alte Kampfgefährte ... Schön hat er uns hineingeritten in dieser Orkenschänke.« Sie schaute auf den Hund hinab. »Wäre Gilia nicht gewesen, wir hätten alle dran glauben müssen – jawohl, auch du, Dicker! Mit einem Apfel in der Schnauze hätte dich der Wirt seinen orkischen Gästen auf einer silbernen Platte serviert!«
Auch Gilia beugte sich vor und strich dem Hund mit der Hand über den Kopf. Sie setzte zu sprechen an, sagte aber nichts, sondern wandte den Kopf zum Fenster. Wenig später zog sie mit energischem Griff einen kleinen Henkelkrug aus ihrem Reisesack, riß den Verschluß aus dem Hals, setzte das Gefäß an die Lippen und nahm einen tiefen Zug. Vernehmlich ausatmend lehnte sie sich auf der Bank zurück und schloß die Augen.
Die tiefstehende Wintersonne schien zum Kutschenfenster herein und übergoß die Züge der blonden Frau mit einem warmen goldgelben Licht. Welch ungewöhnliches Gesicht, dachte Gerion, der Gilia gegenübersaß und sie aufmerksam betrachtete. Die hohe, rechteckige Stirn, die ausgeprägten Wangenknochen und das feste Kinn verliehen dem Antlitz einen kämpferischen, verwegenen Zug, noch verstärkt von der über Stirn und Wange laufenden Narbe, während die Augen mit den langen schweren Wimpern und die vollen rosigen Lippen eher für eine gewisse Weichheit sprachen. Der Kontrast zwischen beiden Merkmalen war so ausgeprägt, entschied Gerion, daß man das Gesicht, folgte man allgemeinen Urteilen über die menschliche Anmut, nicht als schön bezeichnen konnte ... Aber edel, edel war es gewiß. Die Züge waren beherrscht von einer gelassenen Vornehmheit ... Eindrucksvoll ... Gerion fragte sich, ob ein solcher Vergleich statthaft sei, aber der zugleich wilde und sanfte Schnitt dieses Antlitzes erinnerte ihn an den Ausdruck jener selbstverständlichen, aber dennoch vollkommenen Eleganz, die man in manchen Tiergesichtern findet. Ja, eine heißblütige Shadifstute oder eine junge Löwin mochten eine solche Ausstrahlung haben – falls man, wie gesagt, in Fragen der Schönheit Menschen mit Tieren vergleichen durfte. Gilia hatte das Gesicht einer Königin, klug und herrisch, bezaubernd und abweisend zugleich ... Fraglich ist nur, dachte Gerion lächelnd, ob ich bei meiner Betrachtung zu den gleichen Ergebnissen gelangt wäre, wenn ich wüßte, daß Gilia eine Weidener Marktfrau wäre.
Sein Blick schweifte von der jungen Amazone, die weiterhin die Augen geschlossen hielt, aber offenbar nicht schlief, da ihr Körper lässig schaukelnd die harten Stöße der Kutsche abfing, zum Fenster hinaus, wo der weiter dem Horizont entgegengesunkene Praiosschild sein Licht auf die schneebedeckten Hügel am Westrand der schwarzen Sichel warf.
Auch Selissa schaute zum Fenster hinaus auf die sonnenbeschienenen rosigen Hänge und die teils sanften, teils recht schroffen Täler, in denen sich bereits die bläuliche Abenddämmerung sammelte. Es schien der Kriegerin, als könne sie erahnen, wie die Kälte, Firuns eisiger Hauch, in jenen Senken und Abgründen nistete, um mit Anbruch der Nacht hinauf auf die Hügel und den Sichelstieg zu wandern. Nirgends war eine Ansiedlung oder auch nur ein einzelnes Gehöft zu sehen. Das Sichelland, so hatte man in Darbwinkel erzählt, war ein rauhes Land, gerade recht, um es möglichst schnell zu durchqueren, aber gewiß keine Gegend, wo man sich niederlassen, roden und Ackerbau treiben mochte. Dennoch war das Wechselspiel von blauen und rosigen Flächen, unterbrochen von steilen Klippen und schwarzen kahlen Wäldern, von fast alveranischer Erhabenheit.
Wieder verloren ein oder zwei Kutschenräder den Kontakt zur Schneepiste und fielen mit hartem Schlag auf den Boden zurück. »Hooh!« hörte man den Kutscher rufen, Maultiere schnaubten unwillig, und das Gefährt kam zum Stehen. Kurz darauf tauchte das rotwangige Gesicht Lingmars, des Kutschers, am Fenster auf. »Nu iset jenuch!« verkündete er vorwurfsvoll. »Nu führ ich de Beistern am Strick!«
»Das scheint mir ein guter Einfall zu sein«, entgegnete Gerion. »Nun werden wir uns gewiß nicht so schnell zu Tode stürzen.« Er lächelte.
»Jau, spottet Ihr nur, hohe Herreschaften! Wenn die Kutsch in de Schlucht liecht, dann iset zu spat! Was for‘en verrückter Plan, mitte Kutsch obern Sichelstieg zu fahren! Wie kann man ...« Der Rest der kleinen Tirade war in der Kutsche nicht mehr zu verstehen, weil Lingmar sich zum vorderen der beiden Maultiere nach vorn begeben hatte. Die Kutsche, die nur vier Sitzplätze aufwies, war ein recht schmales Gefährt – darum hatte Gerion sie gemietet –, und die beiden Zugtiere hatte Lingmar, ein Veteran auf dem Sichelstieg, hintereinander angeschirrt. Diese Anordnung sah ein wenig merkwürdig aus, zumal das Fahrzeug nicht über eine Gabel, sondern über einen Deichselbaum verfügte. Darum ging ein Muli neben der Deichsel einher, und das vordere, das Führtier, war mit einer Zugkette an der Spitze der Deichsel befestigt. So war es in der Gegend Brauch, und so konnte man hoffen, Wagen und Tiere auf dem engen Pfad zu halten. Die schmale Bauweise der Kutsche hatte jedoch auch zur Folge, daß sie sich immer wieder bedenklich zur Seite neigte, so daß die Passagiere sich immer wieder einmal fragten, ob sie nun endgültig umstürzen würde.
Je höher der Sichelstieg in die Berge hinaufführte, desto schmaler und unsicherer wurde er. Außerdem war die Sonne inzwischen hinter der mächtigen Zackenreihe der schwarzen Sichel versunken, und die Dunkelheit stieg von Osten auf. Einige frühe Sterne glitzerten. Ein kalter Wind pfiff über das Land und in die Kutsche hinein und zwang die Reisenden, sich enger in ihre Decken zu wickeln. Vorn stapfte Lingmar, das Maultier am Kopfstück haltend, und fluchte auf die ausgefallenen Wünsche der hohen Herrschaften, die sich einen Deut darum scherten, ob sie einen armen Mann ins Unglück stürzten. »Met ihre blinkigen Münzen habet se mich verleit!« schimpfte der Kutscher. »Hätten sie mir nich ihre Taler unner die Nas gehalten, so säß ich jetzo te Hus bei meine Virna und atzte Hafergrütz met de Frau ...« Er schloß den obersten Knopf seiner derben Jacke und klappte den breiten Kragen hoch. »Un ihr, ärme Beister«, sagte er, zu den Maultieren gewandt, »speit Wrasen wie‘n oller Drach!« In der Tat schnaubten die Mulis bei jedem Schritt dicke weiße Dampfwolken aus den Nüstern. »Un glich iset schwatze Nach‘! Und wie sin‘ no nich bejet Ogerbau! Wat hav ick nu von meine vielen Taleren, wenn ich dod in dem Klamm zu liejen kömm?«
Etwa eine halbe Stunde später war es fast völlig dunkel geworden, aber ein paar hundert Schritt voraus kündeten einige schmale gelbleuchtende Rechtecke auf der Bergseite des Weges davon, daß die Herberge, in der man die Nacht zubringen wollte, fast erreicht war. Die Schänke trug den Namen Bärentatze, aber Kutscher Lingmar – und die meisten Leute, die schon mehrmals der Sichelstiege gefolgt waren – nannten sie Ogerbau, denn das Gasthaus war tatsächlich ein Ogerbau, wenn auch ein vor etlichen Jahren aufgegebener. Später, nachdem der unerträgliche Gestank abgezogen war, den die ursprünglichen Nutzer zurückgelassen hatten, wurden die Höhlen von einem findigen Angroschim für Zwerge (und Menschen) bewohnbar gemacht. Der erste Besitzer der Höhlenschenke nannte sie Ingerimms Kessel, ein Name, der sich ebensowenig durchsetzen konnte wie der jetzige, den der Wirt Buckram, Sohn des Huburg (und selbstverständlich ebenfalls ein Zwerg) der Herberge gegeben hatte.
Für den Reisenden bot sich der Ogerbau als eine mäßig zerklüftete, neben dem Stieg fast senkrecht aufsteigende Felswand dar, die nach Nordwesten, der Wetterseite, wies und darum mit allerlei Moosen und düster-grauen Flechten bewachsen war. Wenn man diese Felsenfront genau betrachtete, entdeckte man – als Spur der urtümlichen ogerischen Bautätigkeit – mehrere riesige halbrunde Tore, die einst als Zugänge gedient haben mochten. Diese mehr als drei Schritt hohen Öffnungen waren von zwergischen Steinhauern weitgehend zugemauert worden. Nur einige schmale Schießscharten waren geblieben, durch die ein Schütze den an der Felswand vorüberführenden Sichelstieg in beiden Richtungen auf etliche Schritt bestreichen konnte. Zur Zeit, da niemand mit einem Überfall rechnete, waren die schmalen Schlitze durch pergamentbespannte Holzrahmen verschlossen, durch die ein wenig gelber Kerzenschein nach draußen fiel und dem Reisenden vom Vorhandensein der Herberge kündete, an der er sonst womöglich achtlos vorübergestapft wäre. Weitere Aussparungen in den aus mächtigen Steinblöcken bestehenden Vermauerungen waren die (nur eineinhalb Schritt hohe) Eingangstür und (ein wenig abseits gelegen) ein etwa zwei Schritt hohes Tor, dessen Flügel aus schenkeldicken Eichenbohlen bestanden und hinter dem sich ein geräumiger Stall für Reitund Zugtiere befand.
In einer Felsnische neben dem Stall waren gewaltige Mengen grober Scheite als Brennholz gestapelt; hier fand sich auch ein kleiner Schuppen, der zum Aufbewahren der Holzkohlenvorräte diente. Etwa einen Schritt hoch in der Felswand befand sich eine kleine Öffnung, zu der ein mit Quersprossen benageltes und von graugrünem Kot verkrustetes Brett hinaufführte. Das Schlupfloch war jedoch – wie stets zur Winterzeit – von innen mit einer Klappe verschlossen. Diejenigen unter den Hennen, die den Winter überlebten, würden bis zum nächsten Phex warten müssen, bis ihnen wieder Auslauf gewährt würde.
Nachdem die Kutsche mit Selissa, Gerion und Gilia bei der Eingangstür angehalten hatte, schirrte Lingmar sofort die beiden Maultiere aus. Auch diese Tätigkeit war von halblautem vorwurfsvollen Gemurmel begleitet. »Arme Beistern, arme! Frostet euch noch zu Dode – un warum? Wejen Geld, wejen nüx as schnöde Talern!«
Derweil hatte Selissa erst mit der Faust und – als das erfolglos blieb – mit dem Säbelknauf gegen die niedrig Türe gepocht, die aus ähnlich dicken Eichenbohlen wie das Stalltor bestand. Nun wurde aufgetan, und im Rahmen erschien ein kräftiger Zwerg mit einem von grauem Bartgestrüpp zur Hälfte verdeckten roten Gesicht. Er hielt eine kurzstielige Doppelblattaxt in der Rechten. Hinter ihm stand, ebenfalls mit einer Axt bewaffnet, eine Frau, mehr als einen halben Schritt größer als der Angroschim, weizenblond, mit einem pausbäckigen Gesicht und kräftigen Oberarmen.
Der Wirt grüßte zuerst den Kutscher, den er kannte (»Heda, Lingmar, alte Unke! So gut gelaunt wie stets?«) und stellte sich dann den Gästen vor. »Buckram mein Name, Sohn des Huburg, und das ist meine Frau Feenholdchen ...« Die Axt hatte er gesenkt, seit sein Blick auf Lingmar gefallen war.
Während Feenholdchen, nachdem sie ihre Waffe hinter den Gürtel geschoben hatte, ins Freie trat, um dem Kutscher dabei zu helfen, die Zugtiere in den Stall zu führen, nannte Gerion seinen und die Namen seiner Begleiterinnen und fügte anschließend hinzu: »Ich habe schon viel von Euch gehört, werter Buckram, und nur Gutes.«
Der Wirt lächelte geschmeichelt; sein Mißtrauen gegen die Neuankömmlinge war offenbar verflogen. »Wo denn?« fragte er.
»Wie bitte?« fragte Gerion.
»Wo habt Ihr soviel Gutes über mich gehört, edler Herr?«
Gerion, der mit keiner Nachfrage gerechnet hatte, antwortete ins Blaue hinein: »In Salthel, mein Herr, an vielen Stellen ... Beim Krämer ...«
»Das kann ich mir vorstellen, daß der alte Borkfried gut von mir spricht«, warf Buckram ein. »Schließlich verdient er sich eine goldene Nase an mir ... Aber was tue ich hier? Lasse meine Gäste in der Kälte stehen!« Er trat zur Seite und wies mit der Axt in den Schankraum. »So tretet doch ein, edle Herrschaften. Setzt Euch ans Feuer und wärmt Euch die kalten Glieder!«
Das Innere der Schänke erwies sich als ein Höhlenraum von beeindruckender Größe und annähernd ovalem Grundriß, der an seiner breitesten Stelle etwa ein Dutzend Schritt maß. Die Wände aus gewachsenem Fels waren durch geschickte Meißelarbeit geglättet. Sie stiegen fast fünf Schritt in die Höhe, bevor sie sich oben zu einer Spitzkuppel trafen. In zwei Schritt Höhe lief eine breite hölzerne Galerie an den Wänden entlang. Eine steile Treppe führte zu der Plattform hinauf, die zum Schankraum hin durch ein schmuckloses Geländer gesichert war und die zu einem Teil als Schlafstätte für Gäste und zu einem anderen als Speicher für Getreide, Mehl, Räucherfleisch, Dörrwaren und ähnliche trocken aufzubewahrende Lebensmittel diente. Der Speicherteil und der Schlafteil waren durch eine bis zur Decke reichende hohe Holzwand voneinander getrennt. (Den einzigen Schlüssel zur eisenbeschlagenen Tür in dieser Wand trug die Wirtin Feenhold stets an einer Kette um den Hals.)
In der Mitte des Raumes erhob sich eine aus behauenen Felssteinen gemauerte mächtige Feuerstelle. Das einen Schritt mal einen Schritt messende Feuerbecken mit seinen schwarzeisernen Vorrichtungen wie Drehspieß und Schwenkhaken für die großen Henkeltöpfe erinnerte eher an eine Schmiedeesse als an eine Kochstelle.
Gefeuert wurde mit einer Mischung aus Holzkohle und Fichtenscheiten. Die hochauflodernden Flammen erfüllten den riesigen Schankraum mit wohliger Wärme, das Knacken und Zischen der brennenden Scheite waren zu hören, ein würziger Duft hing in der Luft, während der Rauch steil zu der zerklüfteten Kuppeldecke aufstieg, wo er in kaum sichtbaren kaminartigen Felsspalten verschwand.
»Tretet nur näher! Nur dichter heran!« Buckram deutete auf einen Tisch unmittelbar beim Feuer. Etwa zwanzig Gäste mochte der Schankraum um diese frühe Abendstunde beherbergen, die meisten von ihnen wandernde Händler. Aber auch ein Barde, drei Thorwaler Söldner, eine kleine Gruppe in teure Pelze gehüllter Elfen und ein nobler weißhaariger Greis sowie zwei elegant gekleidete alte Frauen mit einer Eskorte von vier Bewaffneten saßen an Tischen mit Platten aus weiß gescheuertem Buchenholz.
Gerion und seine Begleiterinnen ließen sich nieder. Wenig später erschien auch Kutscher Lingmar, setzte sich jedoch nicht an den Tisch, sondern gesellte sich zu einigen alten Freunden, die er unter den Händlern entdeckt hatte.
Während die Gefährten – etwa eine Stunde war seit ihrer Ankunft vergangen – beim Essen saßen und einen mit Wildschweinspeck angereicherten Bohnenund-Kraut-Eintopf verzehrten, wickelte der Barde eine Laute aus einer bunten Decke, stimmte die Saiten und zupfte eine Melodie, die, obschon getragen und zart, doch bis in die hintersten Winkel der Schankstube drang.
Gilia schob ihren Teller zurück und streckte unter dem Tisch die langen Beine aus. »Schön ist es hier«, sagte sie versonnen. »Zum Glück gibt es auch ein paar angenehme Plätze auf der Welt.«
»Da kann ich nur beipflichten«, erwiderte Gerion, »obwohl ich mich an Zeiten erinnere, da hätte ich keinem Fleck auf Deren irgendeine Schönheit zugestanden.« Er faßte Selissa in den Nacken, zog sie mit einem Ruck heran und drückte der Verdutzten einen geräuschvollen Kuß auf die Stirn. »Und daß dem so ist, habe ich dieser Frau zu danken, die mich alten Gelegenheitsmagus einem reichen bornischen Grafen von alveranischer Schönheit vorzog. Seitdem frage ich mich, ob Selissa tatsächlich ebenso klug wie hübsch ist. Daß sie eine Perle unter den Kriegerinnen ist, sieht ein jeder, aber ihre Entscheidung für mich dünkt mir kaum sinnvoll und läßt auf ein wenig entwickeltes Denkvermögen schließen. Dennoch soll die Wahl mir recht sein ...«
Selissa entwand sich lächelnd Gerions Griff. »Manchmal denke ich, der Herr Zauberer ist noch wirrköpfiger als sein Hund«, sagte sie zu der Amazone. »Wenn er einmal ins Faselieren gerät ...« Sie schüttelte den Kopf. »Übrigens, Gilia, wenn du Näheres über ›bornische Grafen von alveranischer Schönheit‹ erfahren willst – wir sind soeben auf dem Weg zum Gutshof dieses vielgepriesenen Herrn. Hast du nicht Lust, uns zu begleiten? Graf Arvid und seine Frau Algunde sind warmherzige, gastfreundliche Leute. Du wirst dem Grafen nicht weniger willkommen sein als Gerion und ich.«
»Was mich angeht«, warf Gerion ein, »vermutlich willkommener.«
»Ach, das darfst du nicht sagen!« ermahnte ihn Selissa mit plötzlichem Ernst. »Was soll Gilia von Arvid denken, wenn du gegen ihn stichelst? In Wahrheit hat Arvid damals meine Entscheidung hingenommen wie der Ehrenmann, der er nun einmal ist. Er hat mich nicht bedrängt und – wie du aus seinen Briefen weißt – auch seine Freundschaft zu dir bewahrt.«
»Ist ja schon gut«, wehrte Gerion ab. »Niemand wollte deinen Hünen schmähen. Ich gedachte zu scherzen – offenbar ist es mir mißlungen. Das ist aber, finde ich, kein Grund für die versammelten Damen, dermaßen finster zu blicken.«
Tatsächlich hielt nicht nur Selissa die Brauen immer noch streng gesenkt, auch Gilias Miene war sehr ernst geworden. Jetzt zwang sie sich zu einem Lächeln, das aber nur kurz anhielt.
»Unsere Amazone ist wieder weit fort von hier, hm?« fragte Selissa sanft.
Gilia wischte sich mit dem Handrücken über die feuchtglänzenden Augen und sah sie an. »Wenn ich euch nicht störe, will ich wohl mit euch kommen«, sagte sie in Antwort auf Selissas Einladung. Sie nahm einen langen Zug aus einem tönernen Schnapskrug und setzte ihn mit einem unterdrückten Keuchen wieder ab. »Scharfes Zeug, der Zwergenbrannt«, stellte sie fest. Nach einer Pause, während auch Gerion und Selissa geschwiegen hatten, fuhr sie fort: »Warum sollte ich wohl nicht mit euch ziehen? Die vier Tage, die ich mit euch verbringen durfte, waren die schönsten, die ich seit langem hatte ... Auch könnte ich von eures Freundes Gut nach Festum weiterreisen; das scheint mir kein schlechter Platz für jemanden zu sein, der seine Klinge vermieten will ...« Sie stockte. »... vermieten muß, weil er niemals einen anständigen Beruf erlernt hat.«
Von neuem legte sich Schweigen über die Runde.
Nach einer geraumen Weile war es wieder Gilia, die das Wort ergriff, nachdem sie noch einmal den Schnapskrug an die Lippen geführt hatte. »Seit vier Tagen sind wir jetzt zusammen, und mir scheint, es wird allmählich Zeit für einige klärende Worte ...« Ihre Stimme wurde leiser.
»Wenn du uns deine Geschichte erzählen willst«, erwiderte Gerion, »würden wir sie gewiß gern hören, aber denk nicht, daß du uns eine Erklärung schuldest. Du bist uns so oder so eine angenehme Weggefährtin.«
»Ob ich für irgend jemanden hier auf Dere noch eine angenehme Gefährtin sein kann darüber mögt ihr befinden, wenn ihr mich angehört habt.« Gilias Züge hatten sich verfinstert, ihre blauen Augen starrten ins Leere. »Als ich vor ein paar Tagen behauptete, ich sei die Königin der Amazonen, war ich zwar betrunken – ich bin gern betrunken –, aber ich habe dennoch die Wahrheit gesagt ... und habe wiederum nicht die Wahrheit gesagt, obwohl ich euch gewiß nicht belügen wollte. Das mag verwirrend klingen, aber ich habe benannt, was sein könnte. Kurzum, ich könnte die Königin der Kurkumer Amazonen sein, wenn ich der Burg nicht schnöde den Rücken gekehrt hätte und wenn« – Gilias Stimme wurde rauh – »es die Burg und die Kämpferinnen dort überhaupt noch gäbe. Unter diesen Umständen war es sehr anmaßend von mir mich vor euch prahlerisch eine Königin zu heißen.« Mit einem leisen Knacken brach der Henkel, den sie mit der Linken umklammert hielt, von ihrem Schnapskrug. Sie starrte auf das Bruchstück in ihrer Hand, hielt es an den Krug, als hoffe sie, daß es sich wieder anhefte, ließ es schließlich zu Boden fallen und umfaßte den Hals des Gefäßes, um es an den Mund zu heben.
»Wir haben dir geglaubt, daß du bist, wer du zu sein vorgibst«, versicherte Selissa. »Und wir haben während unseres Aufenthalts in Trallop vom Untergang der Kurkumer Burg gehört. Welchen Grund hätten wir gehabt, an deinen Worten zu zweifeln? Den noch wollten wir dich, wie Gerion schon sagte, auf keinen Fall bedrängen. Warum läßt du die Vergangenheit nicht ruhen, wenn sie dich gar zu sehr bedrückt?«
Gilia leerte den Krug, kippte ihn um, so daß der Hals nach unten wies, und beobachtete, wie die letzten Tropfen auf die Tischplatte fielen. »Heda«, rief sie laut durch die Schankstube, »Meister Buckram, Sohn des Wie-auch-immer! Eure Schnapskrüglein sind sehr klein und allzu zerbrechlich. Bringt mir rasch einen neuen, bitte schön!« Sie wandte sich wieder an Gerion und Selissa. »Ich fühle mich nicht bedrängt, und ich will endlich reden. Also laßt uns den Abend nutzen und bereitet euch auf eine lange traurige Geschichte vor, in der eine gewisse Thesia Gilia eine erbärmliche Rolle spielt. Thesia Gilia, Prinzessin von Kurkum – so lautet mein vollständiger Name: Gilia nach meiner Großmutter, die lange vor meiner Zeit gestorben ist und eine sehr gestrenge Königin gewesen sein soll, und Thesia nach einer Freundin meiner Mutter, einer Gräfin aus dem Bornland, für die ich als junges Mädchen sehr geschwärmt habe.«
Der Wirt brachte den Schnaps, aber Gilia trank nicht. Sie erzählte ihre Geschichte. Von ihrer Kindheit und Jugend sprach sie, von der strengen, aber liebevollen Erziehung, die ihr ihre Mutter und die Schwertmeisterin angedeihen ließen. Das Leben der kleinen Amazonenprinzessin war von Anfang an in festen Bahnen verlaufen. Die Körperertüchtigung und das Erlernen der Staatsund der Waffenkunst hatten einen breiten Raum in der Einteilung eines jeden Tages eingenommen. Für den Umgang mit der Mutter, den anderen Kriegerinnen, ja selbst mit den anderen jungen Mädchen auf der Burg waren gewisse Überlieferungen zu beachten. Aber trotz dieser strengen Ordnung, sagte Gilia, oder vielleicht gerade wegen dieser strengen Ordnung bezeichne sie ihre Kindheit, wenn sie heute auf jene fernen Tage zurückschaue, als sorglos und glücklich.
»Jene fernen Tage«, warf Gerion freundlich spöttelnd ein. »Wenn ich dich so ansehe, können diese Tage kaum in weiter Ferne ...« Ein Blick Gilias traf ihn, so ernst und gramerfüllt, daß er mitten im Satze abbrach und sich vornahm, die Geschichte der Amazone nicht noch einmal durch einen Scherz zu unterbrechen.
Gilia fuhr fort. Diese Lebensleichtigkeit der Kindheit aber, so berichtete sie, verging fast über Nacht, als die Tage der jugendlichen Reife begannen. Die festen Erwartungen, die ihre Kinderzeit so angenehm sicher gestaltet hatten, empfand Gilia nun als kaum zu ertragende Zwänge. Ihre Zukunft erschien ihr – und zwar Tag für Tag, wie sie voller Schrecken feststellte – vorherbestimmt, von der feierlichen Thronbesteigung bis zum letzten Gang an Rondras Tafel.
Die junge Amazonenprinzessin führte lange Gespräche mit ihrer Mutter Yppolita, die eine verständnisvolle Zuhörerin und eine Ratgeberin voll großer Lebensklugheit war und dennoch der Tochter nicht helfen und die Bürde nicht von ihr nehmen konnte. Wann immer Gilia sich ihre künftige Zeit auf Deren vorzustellen versuchte, sah sie sie als ›lebenslange Haft in einem Verlies, in dem ein Thron steht‹. Vorwurfsvoll beschrieb sie die Enge, von der sie ihr Leben bedroht sah.
»Du wirst eines Tages Königin von Kurkum sein«, pflegte Yppolita zu sagen. »Deine Wünsche spielen in dieser Sache keine Rolle, denn dein persönliches Glück muß vor dem Wohl unserer Schar zurückstehen. Und es ist für die Amazonen von großer Bedeutung, daß du eines Tages ihre Königin bist, denn du wirst ihnen eine gute, eine fähige, kluge und verantwortungsvolle Herrscherin sein. Wäre dies nicht meine feste Überzeugung, ich hätte dich längst aus deiner Pflicht entlassen, denn ich sehe sehr wohl, daß diese Last meine Tochter unglücklich macht. Und wenn du unglücklich bist, kleine Löwin, dann will mir schier das Herz zerspringen, denn du bist mir das Wichtigste auf der Welt. Ja, mein Herz, wichtiger als unser Volk ... Siehst du, das dürfte ich nicht aussprechen, ich dürfte es nicht einmal denken, aber ich bin eben keine gute Königin für die Amazonen. Du aber wirst diese Herrscherin sein – das lese ich in deinen Zügen.
Finstere Zeiten werden über Aventurien kommen, ja, auch über Kurkum, aber du wirst zu jenen wenigen gehören, denen es gegeben ist, dem Bösen zu wehren und die schrecklichen Geschicke zu wenden. Du wirst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. ›Deiner Tochter ist es aufgetragen, ein grausiges Schicksal abzuwehren, weil sie zur rechten Zeit am rechten Fleck sein wird.‹ Diesen Satz hörte ich sprechen, als ich neulich allein und um Mitternacht den Tempel der Leuin aufsuchte. Und seitdem bin ich erfüllt mit Zuversicht, aber eben auch mit dem festen Willen, dich auf den Kurkumer Thron vorzubereiten, denn der rechte Ort für dich ist Kurkum. Du wirst es erretten aus finsterer Not.«
So hatte die Königin gesprochen, und so hatte Gilia die Rede ihren Gefährten Wort für Wort wiedergegeben, bis ihr plötzlich die Stimme brach. Sie ergriff den Schnapskrug und schleuderte ihn voll jäher Wucht in die Feuerstelle. Das Gefäß zerschellte an einem über dem Feuer hängenden Eisentopf, der Schnaps ergoß sich in die Flammen, und eine gewaltige blaurote Waberlohe flog wie ein Feuerdämon zur Höhlendecke hinauf.
Während spitze Schreckensschreie erklangen und schwere Stühle, von eilig rückwärts flüchtenden Gästen umgestoßen, über den Boden polterten, fuhr Gilia fort, als wäre nichts geschehen. »Zur richtigen Zeit am richtigen Ort ...!« wiederholte sie mit bitterem Lächeln. »Da kann man sehen, daß auch eine Königin wie Yppolita ihren Träumen nicht trauen sollte. Jetzt liegt Kurkum in Trümmern, die edelsten und zugleich die meisten der Kriegerinnen sind tot, und ich war nicht zur Stelle, wie es ihr der Traum versprochen hatte. Aber vielleicht« – sie stieß heftig die Luft aus – »war ich doch am richtigen Platz, denn während Kurkum unterging, habe ich überlebt. Ich hatte den rechten Ort für Feiglinge gefunden ...«
Gilia verstummte und starrte in die Flammen, die längst wieder auf ihr übliches Maß geschrumpft waren, aber immer noch gelegentlich zischend bläulich und purpurrot aufflackernde Verfärbungen aufwiesen. Auch in der Schänke war wieder Ruhe eingekehrt. Einige Gäste hatten zwar Anstalten getroffen, die blonde Frau, die – anscheinend aus reinem Übermut – den Krug ins Feuer geworfen hatte, zur Rede zu stellen, doch als sie Gilias finstere Miene und die vermeintliche Gelassenheit wahrnahmen, mit der sie das Auffahren der Feuerwolke verfolgt hatte, da wandten sie sich wieder um und kehrten zu ihren Plätzen zurück. Die Lohe war ebensoschnell verpufft, wie sie entstanden war, und es schien ratsam, vor der grimmigen Kriegerin nicht weiter auf diesen Vorfall einzugehen. Auch Wirt Buckram eilte zwar erschrocken herbei, beschloß dann aber, nur in knappen Worten zu fragen, ob er ein neues Krüglein bringen solle. Gilia antwortete mit einem stummen Kopfnicken. Erst nach einer langen Weile des Schweigens und nachdem der Wirt den Schnaps auf den Tisch gestellt hatte, ergriff sie wieder das Wort. »Was mir zu nahe kommt, zerstöre ich: Schnapskrüge, wehrlose kleine Hunde – nichts überlebt eine solche Begegnung. Also hütet euch vor mir ... Wo war ich stehengeblieben? Ach ja, ich wollte euch berichten, warum ich nicht auf Kurkum war, als ich dort gebraucht wurde: Die Prinzessin von Kurkum hatte sich davongestohlen! Da meine Mutter wohl gar zu sehr unter der Elendsmiene litt, die ich als Backfisch täglich zur Schau trug, schlug sie mir eines Tages vor, ein wenig die Welt zu bereisen. Fremde Länder und Menschen sollte ich mir ansehen und meine Tage genießen, solange sie noch mir gehörten.
Das tat ich nur allzugern, und ich wandte mich nach Norden, weil ich gehört hatte, daß es dort niemals schmelzendes Eis und schneeweiße Winterelfen geben solle. Weit kam ich nicht in Richtung auf Firuns Land. Auf meinem Ritt durch die hohen Salamandersteine begegnete ich Lindion, einem Elfen, keinem schneeweißen, sondern einem Elfen der Wälder, der sich nach einem Besuch in seinem Heimatdorf auf dem Rückweg in die Menschenwelt befand. Ich hatte bis dahin Elfen nur in einem Buch in der Kurkumer Bibliothek erblickt. Ich wußte nicht, wie schön diese Wesen sind. Zwar zeigten die Abbildungen durchaus wohlgefällige Gestalten, aber ich weiß heute, daß die Schönheit Lindions dadurch so überwältigend auf mich wirkte, daß er lebte und sich bewegte. Seine besondere Anmut lag in seiner Lebendigkeit, die ihn wie ein Sommerwind umwehte. Ich weiß noch recht gut, was ich damals empfand, während ich ihn beobachtete ... Es wurde alles eins: der Frühlingswald mit seinem sonnendurchfluteten zarten Grün und mein schöner Elf« – sie lächelte bitter –, »der durch das Unterholz glitt, als wären die wildverflochtenen Ranken und Sträucher ein Gewässer, das sich bereitwillig vor jedem seiner Schritte teile. Vielleicht träfe diese Beobachtung auf alle Elfen zu. Ich weiß es nicht, aber ich denke noch heute, daß diese atemberaubende Fähigkeit, in die Lebendigkeit seiner Umgebung einzutauchen, nur Lindion zu eigen war ...
Auch hatte ich noch nie mit einem Wesen wie Lindion ein Wort gewechselt, und es schmeichelte mir, daß er nicht nur mit mir sprach, sondern mir auch anbot, mich ein Stück auf meinem Weg zu begleiten, um mich ›seine Sicht der Dinge zu lehren‹, wie er sagte. Auch sprach er mir davon, wie sehr ich ihm gefalle, und bat mich, einen Bund mit ihm einzugehen. Ich willigte ein, und wir reisten fortan gemeinsam durch das Land. Lindion war zwar ein Geschöpf der Wälder, aber er hatte auch eine Zeitlang in Beilunk und anderen Städten gelebt. Mir schien es, daß er die Menschen besser kannte, als sie sich selbst einzuschätzen vermochten. Jedes seiner Worte nahm ich auf und machte es mir zu eigen. Es gefiel mir sehr, mich an Lindions Seite über die anderen Menschen zu erheben, weil er mir zeigte, wie jene sich umsonst abmühten, um irgendwelchen wohlfeilen Zielen nachzuhecheln, und doch niemals zum inneren Mark der Dinge vordringen. Ja, wer seinerzeit mit mir gesprochen hat, wird mich als unerträglich herablassend empfunden haben. Dabei hatte mich Lindion auf einen schrecklichen Irrweg geführt. Für ihn mochte es angemessen und richtig sein, die Menschen mit der gleichen Teilnahmslosigkeit zu betrachten, mit der auch der Wald auf einen jeden Eindringling blickt. Wer sich im Tannicht verirrt, dem wird der Wald den Weg ins Licht nicht weisen; wer von Wölfen gehetzt wird, dem wird der Wald keinen Schutz bieten. Er wird stumm betrachten, wie der eine oder der andere zum Sterben kommt, es wird ihn so wenig bekümmern, wie wenn einer seiner zahllosen Bäume vom Sturm geknickt zu Boden stürzt.
So mag der Wald und der Elf auf den Menschen blicken, nicht aber der Mensch selbst auf seine Mitmenschen, denn dann wandelt sich teilnahmslose Nüchternheit in Grausamkeit. Wir können dem Elend und dem Sterben nicht zusehen, ohne daß unser Gemüt bewegt wird. Wir können, wenn wir nicht helfen wollen, uns wohl einreden, daß uns etwas nicht berührt, in Wahrheit aber entscheiden wir uns – jedesmal, wenn wir helfen könnten, es aber nicht tun – für die Grausamkeit ... Auf der Grausamkeit aber kann kein Mensch, kein Mensch jedenfalls, der sich vor den Zwölfen Mensch nennen mag, sein Leben gründen. Mein Elf hat, das weiß ich heute, mir schlechten Rat gegeben!«
»Du hast sehr viel über alle diese Dinge nachgedacht?« fragte Selissa.
Gilia nickte knapp. »Ja, ich hatte genügend Zeit, zur Besinnung zu kommen. In den Tagen aber, von denen ich reden will, hatte ich solche Erkenntnisse noch nicht gewonnen. Ich hatte mich in Lindion verliebt. Unrettbar war ich ihm verfallen, so glaubte ich jedenfalls. Vielleicht weil ich es glauben wollte, weil es mir gefiel, nach den Jahren der Nüchternheit in mädchenhafter Schwärmerei zu versinken.
Ich reiste gemeinsam mit Lindion nach Kurkum, um ihn meiner Mutter vorzustellen und ihr zu verkünden, daß ich den Thron nicht übernehmen würde. ›Was dir die Freiheit geben kann‹, hatte der Elf mich gelehrt, ›das findest du auf keinem Thron der Welt!‹ Mutter vernahm meine Mitteilung, ohne die von mir gefürchteten Einwände zu erheben. ›Wenn dies dein fester, freier Wille ist, meine Tochter‹, so sprach sie zu mir, ›dann mußt du ihm folgen. Du gehst in die Irre, des bin ich mir gewiß, aber mir scheint, hier auf Kurkum könnte dich nichts halten. Also geh! Ich werde dich nicht verstoßen, so wie ich es tun sollte, denn es erscheint mir unbedingt nötig, dir ein Tor offenzulassen. Du wirst deinen Platz und deine Aufgabe noch finden. Und nun verlasse mich! Ich habe wichtige, unaufschiebbare Dinge zu tun. Wir werden uns nicht wiedersehen. Rondra sei bei dir auf allen Pfaden!‹ Ich habe Yppolita nie wiedergesehen. Die Vorstellung, in Kurkum stehe ein Tor für mich offen – inmitten eingestürzter Mauern –, ist so absurd, daß ich darüber weder lachen noch weinen kann.« Sie hob den Krug zum Mund, trank aber nicht, sondern stellte ihn behutsam auf den Tisch zurück.
»Mein Elf ist nicht bei mir geblieben«, fuhr Gilia fort. »An dem Tag, an dem er mich verließ, setzte er nur das in eine sichtbare Tat um, was schon vorher still geschehen war: Wir hatten uns voneinander getrennt. Ich könnte auch sagen, Lindion hat mich abgestreift ...« Sie lachte leise. »Hinterher habe ich mich natürlich oft nach dem Warum gefragt, und es sind mir zwei Antworten in den Sinn gekommen: Vielleicht erging es mir wie der halbtoten Maus, mit der zu spielen die Katze nach einer Weile die Lust verliert. Vielleicht befand Lindion aber auch, daß ich, die ich mich in allem, was ich tat und sagte, nach ihm ausrichtete, ihm inzwischen zu ähnlich geworden sei und daß es sich nun nicht mehr lohne, seine Zeit und seine Klugheit mit mir zu teilen ... Der Elf ging fort, und ich folgte ihm nicht. So geriet ich in die Krallen einer Orkmeute, vor der mich Lindion zuvor noch vorausschauend gewarnt hatte. Die Schwarzpelze töteten mich nicht, nachdem sie mich überwältigt hatten, sondern schleppten mich mit sich. Ich war zur Sklavin ihres Anführers geworden. Ich muß sagen, anfangs hatte ich keine große Mühe, mich in meine neue Rolle einzufinden. Mein Leben war ohnehin zerstört, nun schien es eine angemessene Form gefunden zu haben. In einem rahjagefälligen Buch habe ich einmal den Satz gelesen: ›Freiheit ist ein anderes Wort für Nichts-mehr-zuverlieren‹, und erst bei den Orks habe ich den Sinn dieses Satzes verstanden. Vollendete Freiheit findet nur, wer an nichts mehr hängt, nicht an den Göttern, nicht an der Würde, nicht am Leben ... Mutter hat mir von einer Gefährtin namens Junivera erzählt, einer Geweihten der Rondra, die sich einmal von ihrer Angst überwältigen ließ und von da an mit sich haderte. Als selbstauferlegte Buße, so meine Mutter, habe sich Junivera freiwillig in alanfanische Sklaverei begeben. Doch vermutlich, so sehe ich das heute, hatte die Tat der Geweihten mit Bußfertigkeit gar nichts zu tun: Das Leben hatte für sie alle Werte und alle Bedeutung verloren. Da ist es dann gleich, ob man als Gaukler durch die Lande schweift oder die Fußkette eines Erntesklaven trägt.«
»Welche Bitterkeit des Denkens«, stellte Gerion mit nüchterner Stimme fest. Gilia sah ihn abwartend an, da sie erwartete, daß er mit seiner Bemerkung fortfahren wolle, aber der Magier schwieg. Selissa hingegen bat nach einer Weile: »Erzähl doch weiter! Wie konntest du den Orks entkommen?«
Die Amazone schüttelte den Kopf. »Ich bin ihnen nicht entkommen. Jedenfalls hatte ich keine Anstalten getroffen, meinem stinkenden Meister davonzulaufen. Nein, meine Orks übernahmen sich ein wenig, als sie einen Wagenzug überfielen, der von mehr als einem Dutzend schwerbewaffneter Söldner gesichert wurde. Die wenigen Schwarzpelze, die den Kampf überlebten, flüchteten, so schnell sie ihre Beine trugen, und vergaßen mich mitzunehmen. So kam ich zu der netten Schar, die ihr in der Schenke in Darbwinkel kennengelernt habt. Nachdem sie mich aufgenommen hatten, bin ich mit ihnen durch die Lande gezogen. In der Hardorper Gegend halfen wir, einen Familienstreit zu beenden. Ich denke, meine neuen Freunde haben an der Sache recht gut verdient, aber sie erwiesen sich als gehörig habgierig. Mir gaben sie vom Sold gerade soviel, daß es immer für ein Krüglein Schnaps reichte; dabei hatte ich recht ordentlich gekämpft, falls man das Erschlagen von einem halben Dutzend Bauernlümmeln und schlecht gekleideten Waffenmägden als ordentlichen Kampf bezeichnen kann. Mir war es gleich. Auch ließ es mich kalt, ob ich um meine Dukaten betrogen wurde. Vieles im Leben ist beliebig, wenn man die vollkommene Freiheit errungen hat. Also will ich fürderhin darauf achten, daß stets ein wohlgefüllter Krug bereitsteht; alles andere soll mir bis ans Ende meiner Tage beliebig bleiben, und irgendwann werde ich mich auch damit abgefunden haben, daß ich meine Mutter und die Kriegerinnen nie wiedersehen und daß ich niemals wieder die Gnade der Göttin erlangen werde.« Als sie diesmal den Krug an den Mund führte, nahm sie einen langen Zug und wischte sich mit dem Handrücken über die Lippen, bevor sie weitersprach. »So, nun habt ihr gehört, was es von meinem Leben zu berichten gab, und könnt entscheiden, ob ihr eine solche ›angenehme Weggefährtin‹ weiter in eurer Nähe dulden wollt.«
»Welch traurige Geschichte«, murmelte Selissa.
Schweigen senkte sich über den Tisch; nur das Prasseln und Knacken der brennenden Scheite und die Gesprächsfetzen der wenigen verbliebenen Gäste wehten heran.
Gerion starrte in seinen Bierkrug, den er in den Händen drehte, und lächelte grimmig. »Das war eine traurige Geschichte, und doch sagt sie nicht soviel über dein Leben aus, wie du denken magst. Mich hat das Leben vor allem eines gelernt: daß alles erst dann entschieden ist, wenn du Golgaris Schwingen rauschen hörst. Was du dann nicht gerichtet hast, wirst du wohl ungeordnet und ungelöst zurücklassen – bis dahin kann alles geschehen.« Er warf Selissa einen langen, ernsten Blick zu. »Ich weiß, du glaubst mir jetzt nicht. Durch Geschwätz können wir Menschen niemandem helfen, dessen Seele unglücklich und krank ist. So habe ich, was ich eben sagte, auch nur aus Wichtigtuerei ausgesprochen: Es ist so schön, recht zu behalten, und irgendwann wirst du an mich denken und erkennen, daß ich recht hatte, und wirst drei Wimpernschläge lang leise und anerkennend lachen, und ich werde es spüren, wo immer ich gerade sein mag, und in dein Lachen einstimmen.«
Ein verstohlenes Lächeln huschte über Gilias Züge, und erstmals seit Selissa und Gerion ihr begegnet waren, lag keine Bitternis darin. Gerion leerte seinen Krug und winkte Wirt Buckram heran, auf daß er den dreien ihre Schlafplätze auf der Empore unter der Höhlendecke zuwies.
Zum Frühstück versammelte sich die Schar der Gäste an einer großen Tafel, die der Wirt dicht am Feuer aufgebaut hatte, denn die Wärme der frisch angefachten Flammen reichte noch nicht in die ferneren Winkel der ausgedehnten Gaststube. Der unwiderstehliche Hefeduft von ofenwarmem frischen Brot – Feenholdchen hatte in aller Frühe gebacken – war schon vor einiger Zeit hinauf zu der hölzernen Galerie gestiegen, hatte den dort ruhenden Gästen höchst angenehme Träume von gutem Essen geschickt und sie so auf die denkbar angenehmste Weise aus dem Schlummer geweckt. In dem Maße, wie sich die Tafel füllte, wurden das Schwatzen und Lachen, das Klimpern, Klappern und Glucksen der Essenden immer lauter, so daß schließlich auch hartnäckige Schläfer die Augen öffnen und das mollige Strohlager verlassen mußten.
Gerion, Selissa und Gilia gehörten zu jenen Gästen, die eher schwerfällig aus den Betten kamen. Als sie bei der Tafel eintrafen, war das Morgenmahl schon im vollen Gange. Buckram ging fröhlich grinsend von Platz zu Platz, brach das Brot, verteilte dicke Käsescheiben und schenkte dampfendheißen Tee in kleine Henkelkrüge. Mit großem Hallo wurden zwei Pfannen mit Rührei und Speck begrüßt, die Feenholdchen in der Tischmitte abstellte.
Die drei Gefährten ließen sich nieder, tranken und aßen und ließen – gemeinsam mit anderen Gästen – die Wirtsleute hochleben, die es verstanden, mitten in der kalten steinernen Wildnis ein so behagliches und gastfreies Haus zu unterhalten.
»So gut wie hier und jetzt hat es mir schon lange nicht mehr geschmeckt«, beteuerte Selissa, während sie sich mit einem hölzernen Löffel goldgelben Honig auf einen großen Brotbrocken träufelte. Gerion wandte sich derweil an eine reisende Händlerin, die zu seiner Rechten saß und auf dem Weg von Tobrien nach Weiden war. »Ich hoffe, Ihr hattet eine gute Reise ... Sagt an, was geschieht in Gareths gebeutelter Ostprovinz? Man hört, es hat im letzten Sommer eine Schlacht gegeben, die nicht eben gut für Euch ausging ...«
Die Frau, eine hagere schwarzhaarige Mittdreißigerin, die eben noch – wohl eingedenk des guten Morgenmahls – zufrieden gelächelt hatte, blickte plötzlich sehr ernst. Langsam drehte sie den Kopf, um Gerion ausgiebig zu mustern. Dann nickte sie befriedigt. »Ich dachte schon, werter Herr, Ihr wolltet scherzen, wo es nichts zu scherzen gibt, aber mir scheint, Ihr befleißigt Euch nur einer recht lockeren Ausdrucksweise ... Nein, aus Tobrien gibt es wahrhaftig nichts Gutes zu berichten. Es scheint, daß die Zwölfe allen Schutz von uns genommen haben!« Sie stieß grimmig ihren Teekrug zurück. »Wir haben die Schlacht an der Tobimora nicht nur verloren, werter Herr, nur jeder zehnte, der dort für Tobrien angetreten war, hat die Kämpfe überlebt. Das mögt Ihr, wenn Ihr die Ausdrucksweise angemessen findet, als ›nicht eben gut ausgehen‹ bezeichnen! Mir bricht es das Herz, wenn ich daran denke.«
Gerion neigte den Kopf. »Ich bitte Euch um Vergebung, Ehrenwerte. Ich hatte meine Worte in der Tat falsch gewählt, aber ich wußte auch nicht, daß die Sache so schlimm ausgegangen ist.«
»Ach, es ist schon gut, mein Herr. Wer nicht dort war ... Aber ich bin aus Eslamsbrück und habe – aus der Ferne, wie ich bekennen muß – viele schreckliche Dinge gesehen. Und viel Schrecklicheres noch soll geschehen sein, als Warunk fiel. Ich weiß nicht, ob es stimmt, was die Leute erzählen, daß nämlich der Anführer der Feinde jener Borbarad sei, der Dämonenmeister, der nicht in seinem Grabe geblieben ist. Aber ich weiß wohl, daß Kreaturen durch mein Tobrien streifen, die nicht von Deren sind! Und nun entschuldigt mich, ich will abreisen, solange der Weg noch passierbar ist.« Heftig stieß die Händlerin ihren Stuhl nach hinten, sprang auf und eilte die Treppe hinauf.
»Was ist denn in diese Frauensperson gefahren?« fragte Selissa, ihr Honigbrot schwenkend. »Hast du etwas Unanständiges zu ihr gesagt? Hast du sie beleidigt ...?«
»Ja«, antwortete der Magier nachdenklich, »ich glaube, ich habe sie beleidigt ... Bisweilen vergesse ich, in welch finsteren Zeiten wir leben. Besonders an einem Ort wie diesem kann einem das leicht geschehen. Dennoch, es sollte mehr Herbergen wie Bärentatze geben und mehr Wirtsleute wie Buckram und Feenholdchen.«
Als Lingmar etwa eine halbe Stunde später – seinen Unmut durch ein dumpfes Gebrummel kundtuend – die Kutsche auf den Sichelstieg hinauslenkte, trieben feine Schneeflocken in dichten Schleiern durch die Luft. Am Himmel, der gestern noch so klar und blau das Hügelland und das Gebirge überspannt hatte, waren über Nacht gelbgraue Wolken aufgezogen. Beunruhigend tief hingen sie, so daß die Gipfel der Sichelberge in ihnen verschwanden, und eine gewaltige Schneefracht auf das Land abzuladen drohten.
In der Nacht hatte scharfer Frost geherrscht, mit dem Aufzug der grauen Morgendämmerung war es kaum wärmer geworden, und der frischgefallene Schnee war so kalt und trocken, daß er unter den Kutschenrädern knarrte. Jenseits der Höhlenschenke war der Sichelstieg merklich breiter als zuvor, und Lingmar mußte die Maultiere nicht mehr am Strick führen, sondern konnte wieder auf dem Bock Platz nehmen. Auch wenn ihn die neue Entwicklung nicht frohgemuter stimmte. Von seiner hohen Bank aus rief er allerlei Verwünschungen in den Wind und machte dem Gott des Winters bittere Vorhaltungen, weil Er mit Seinen Gaben nicht hatte warten können, bis Lingmar und sein Gefährt die Schwarze Sichel passiert hatten. In der Kutsche herrschte Schweigen. Die Fahrgäste blickten zum Fenster hinaus, obwohl der Schneefall bald so heftig geworden war, daß die Täler und Gipfel ringsumher größtenteils hinter dem grauweißen Flockengestöber verschwunden waren. Nach einer Weile der Stille, während nur das Ächzen der hölzernen Kutschfedern und das unwillige Schnaufen der Zugtiere zu hören gewesen waren, zog Gerion die Hände aus den weiten Jackenärmeln hervor, blies sich in die Handflächen und rieb sie aneinander. »Heute friert es wahrhaftig Stein und Bein«, stellte er fest. Selissa und Gilia spähten weiter schweigend aus dem Fenster, hinüber zu einem schneeumwehten Rand eines düsteren Tannenwaldes, der auf der Talseite des Weges wuchs. »Im Bornland soll es Kutschschlitten mit eingebauten kleinen Feuerbecken aus Eisen geben ...«, setzte Gerion von neuem an, wartete kurz ab und fuhr dann fort: »Selbst die alten Echsenherrscher sollen Ofen besessen haben. Ein guter warmer Ofen in einer Gegend, wo einem das ganze Jahr hindurch der Schweiß von der Nase tropft, ist natürlich hervorragend geeignet, die Wohlhabenheit seines Besitzers darzustellen ...« Wiederum antwortete ihm nur Schweigen, aber er mochte noch nicht aufgeben. »Es ist ein alter Brauch bei den Firnelfen«, verkündete er, »in unregelmäßigen, aber nicht zu langen Abständen immer wieder einmal die Lippen zu bewegen, damit sie dem Elfen nicht zusammenfrieren und er schnöde verhungern muß ...«
Selissa lachte, und Gerion nickte beifällig. »Ei nun, es ist also doch möglich – die ärgste Gefahr ist überwunden. Jetzt du, Gilia, laß uns einen Laut hören!«
Die Amazone schien aus schwermütigen Gedanken zu erwachen. Offenbar hatte sie keinen der Scherze des Magiers wahrgenommen. »Was soll ich tun?« fragte sie verwirrt.
»Es ist schon gut«, erwiderte Gerion. »Ich wollte dich nicht stören, nur einmal deine Stimme hören ...«
»Ich kann euch ein Lied singen«, entgegnete Gilia nach einer Weile mit ernsthaftem Kopfnicken. »Die Söldner haben es mich gelehrt, es war das Lieblingslied dieser Lysmene, die gestorben ist ...«
»Gern würde ich ein Lied hören«, versicherte Selissa. »Vielleicht hilft es, die Kälte aus diesem rollenden Kasten zu vertreiben ...«
»Nun denn ...« Gilia räusperte sich. »Ihr habt es so gewollt.« Das Lied hatte eine einfache, schlichte Melodie. Die Amazone sang es mit ruhiger, klarer Stimme, die kraftvoll hinaus in das Schneetreiben schallte. Gerion, der die Verse schon einmal gehört hatte, stimmte beim zweiten Refrain mit ein, mit sanftem, heiserem Ton, der die Wehmut des Liedes noch eindringlicher machte. Sie sangen das Lied von der alten Söldnerin. Der geneigte Leser mag es kennen – falls nicht, so sei es hier wiedergegeben.
Die alte Söldnerin
Stolzes Wams hängt längst in Fetzen,
Und dein Haar weht dünn und grau,
Doch das Haupt wirst du nicht beugen,
Stolze, harte Söldnersfrau.
Refrain:
Schlafe gut hier in den Schatten,
Wo der Büttel dich nicht sieht.
Unterm Banner, schwarz und silbern,
singt der Wind dein Schlummerlied
Denke gar nicht erst an morgen,
Tage kommen, Tage geh‘n.
Heute unterm Schild der Sterne
wird dir schon kein Leids geschehen.
Refrain
Ja, die Büttel machen Ärger,
Immerzu, an jedem Ort.
Ziehst du einst in Rondras Hallen – siehst du keinen Büttel dort.
Schlafe gut hier in den Schatten,
Wo der Büttel dich nicht sieht.
Unter‘m Banner, schwarz und silbern,
singt der Wind dein Schlummerlied.
Selissa, die erst beim letzten Refrain eingestimmt war klatschte beifällig in die Hände und rief jenes »Noch einmal, noch einmal!«, mit dem die Thorwaler eine gelungene Darbietung zu belohnen pflegen. Gilia dankte ihr mit einem Kopfnicken und einem Lächeln. Selbst Kutscher Lingmar schien für einen Augenblick seinen ganzen Verdruß vergessen zu haben, und seine rauhe Stimme tönte durch das Schneegestöber: »Ein schöns Lied, die hohen Herreschaften! Allet, wat recht is! Unnerm Banner, schwarz un silbern – hab ich no nimmes gesehn, so‘n Fahn.«
Selissa lachte. »Das ist keine Fahne, guter Lingmar!« rief sie zurück. »Das ist der Nachthimmel, der gestirnte Himmel.«
Während die wackeren Mulis die Kutsche aus dem Vorgebirge in die machtvolle Bergkette der Schwarzen Sichel schleppten, nahm der Schneefall noch an Stärke zu. Jeder Blick aus dem Fenster zeigte nichts als treibende Flocken. Der Stieg war bald unter mehr als schritthohen Verwehungen kaum mehr auszumachen. Lingmar, der längst wieder vor der Kutsche herschritt, hielt die Mulis an. Als sein mit einem Wollschal umwickeltes schneeverklebtes Gesicht im Kutschfenster erschien, zeigte es nicht die aufgesetzte Verdrossenheit, die der Kutscher für einen Teil seiner Aufgabe zu halten schien, sondern echte Besorgnis. »Um Vergebung, die hohen Herreschaften«, sagte er verlegen. »Ich bräuchet eine Hülf!«
Es stellte sich heraus, daß fortan einer der Fahrgäste vor den Maultieren einhergehen und mit einer langen Stange den Weg ertasten mußte. Oftmals war der Stieg – von dicken schrägen Schneeflächen bedeckt – so sehr mit dem Hang verschmolzen, an dem er entlangführte, daß sein Verlauf mit dem Auge nicht mehr zu erkennen war. Gilia übernahm als erste die Rolle der Pfadfinderin. Sie ließ sich von Lingmar den Stecken reichen und arbeitete sich, ständig das Holz durch die weiße Decke stoßend, in dem teils knie-, teils hüfthohen Schnee voran. Auch Gerion und Selissa waren ausgestiegen und gingen hinter der Kutsche her, um den Maultieren ihre mühselige Arbeit ein wenig zu erleichtern. Einzig Gurvan war in dem Gefährt zurückgeblieben und winselte höchst jämmerlich, weil er die menschliche Gesellschaft vermißte.
Das besorgte Schweigen des Kutschers und sein stets zur Seite und hangaufwärts gerichteter Blick gaben dem Magus zu denken, und zum ersten Mal seit ihrem Aufbruch in Darbwinkel fragte er sich, ob es nicht tatsächlich besser gewesen wäre, für die Reise über die Sichel das nächste Frühjahr abzuwarten. Wenn nur der Schneefall ein wenig nachließe, dachte Gerion und sandte ein Stoßgebet zu Firun, dem Herrn über diese weißen Massen. Da er aber noch nie in seinem Leben zu dem Wintergott gebetet hatte, verspürte er wenig Hoffnung, daß Dieser ihn erhören werde. Tatsächlich fiel der Schnee weiter, rauschend und knisternd, ohne Unterlaß. Der Magus versuchte es nun, weiterhin ohne viel Zuversicht, mit Ifirn, des Wintergottes sanfter Tochter, aber auch Sie war nicht bereit, Gerion anzuhören. Nach einer weiteren Stunde mühseligen Voranstapfens und als die Kutsche sich kaum noch von der Stelle zu bewegen schien, ging er nach vorn zu Lingmar und schlug ihm vor, zu der Höhlenschenke zurückzukehren.
Der Kutscher nahm den Vorschlag recht ungnädig auf. »Et is so, hoher Herr«, erwiderte er, »dat wej nun ungefährens in der Mitten sind, zwischen de Bärentatz und de Sichel – so heeßt eine Kneip auf de annere Seit von et hohe Paß. Nu mach et sein, datet hinner de Bergen nich schneit, dann ginget uns beder. Et mach natürlick auch sein, datet Wetter hinner de Bergkett noch übler is. Dann habet wej Pech gehabt. Aber, so oder so, umkehren können wej jetz nich – sunst rutsch us die Kutsch vonet Steg!«
»Aber mir scheint, der Weg wird immer steiler und schlechter«, wandte Gerion ein.
Lingmar blieb stehen und drehte den treibenden Flocken den Rücken zu. »Jau, dat wird er wohl, aber umwenden können wej hier trotzdem nich – und stehenbleiben hat ers recht kein Sinn.«
Eine halbe Stunde später lichtete sich plötzlich der Himmel. Der Schneefall wurde spärlicher und setzte bald völlig aus. Die Sonne brach durch die letzten dünnen Wolkenschleier, und die Landschaft ringsumher erstrahlte in blendendgrellem Weiß. Die Kutsche war stehengeblieben. Lingmar und die drei Reisenden hatten sich beim vorderen Muli versammelt und spähten mit zu schmalen Schlitzen zusammengekniffenen Lidern über die weißen Täler und Hänge. Selbst die Bäume in den Tälern waren von einer so hohen Schneeschicht bedeckt, daß man die sonst so dunklen Wälder kaum noch ausmachen konnte. Vernehmlich plumpsend sprang der alte Gurvan aus der Kutsche und schloß sich den Menschen an, um gleichfalls Ausschau zu halten.
Er stieß ein jammervolles Winseln aus – aus welchem Grund, kann wohl nur ein Hund erahnen. Die Menschen jedenfalls hatten keine Muße, nach der Ursache für Gurvans Unglück zu forschen; dennoch war ihnen ähnlich unfroh zumute: Der Sichelstieg war verschwunden!
Vor den Reisenden erstreckte sich nur ein schier endloser, steil geneigter Hang. Rechter Hand erhob sich der Kamm etwa einhundertfünfzig Schritt über die Kutsche, und linker Hand fiel die schräge Fläche etwa zweihundert Schritt ab bis hin zu einem von Felstrümmern übersäten schmalen Tal. Von dem Sichelstieg, der etwa auf halber Höhe an diesem Hang entlanglaufen sollte, war nichts mehr zu sehen. Die Hangschräge verlief glatt und gleichmäßig, nirgendwo deutete eine Kante darauf hin, daß dort irgendwo der Weg entlangführen könnte.
Der Kutscher nahm Gilia den Stecken aus der Hand und wühlte sich vorwärts durch den tiefen Schnee. Er stocherte hier und prüfte dort und hatte am Ende den Weg ein paar Schritt weit erkundet. Die Kutsche konnte ein kleines Stück vorrücken, aber die rechtsseitigen Räder rumpelten über eine unter dem Schnee verborgene Unebenheit, vermutlich ein paar Felsbrocken, und das Gefährt neigte sich bedenklich der Talseite zu. Es ruckte noch einen Schritt vor und kippte weiter ... Lingmar packte das Maultier am Halfter, brüllte ihm in die Ohren und schob es rückwärts. Die Kutsche richtete sich knarrend wieder auf. Gerion und die beiden Frauen räumten mit den Händen den Schnee beiseite, um das Hindernis freizulegen. Es erwies sich als ein kleiner Geröllhaufen, Reste eines Steinschlags, der irgendwann den Stieg heimgesucht hatte. Der Weg selbst verlief an dieser Stelle einen halben Schritt weiter talwärts, als Lingmar vermutet hatte. Als die Kutsche wiederum vorrückte, hatte sie innerhalb einer halben Stunde knapp zehn Schritt Boden gewonnen.
»Wir sin zu langsam, die hohen Herreschaften«, stellte Lingmar schnaufend fest. »So hanget wej in de Nacht noch hier am Hang! Wat tun wej nu?« Er hatte sich an Gilia gewandt, die er offenbar seit einiger Zeit als Anführerin der Reisegesellschaft betrachtete, obwohl er doch von Gerion seinen Lohn erhalten hatte.
»Wir werden weniger Zeit mit unnützem Geschwätz verbringen«, entschied die Amazone, »und statt dessen zusehen, daß wir eine bessere Geschwindigkeit vorlegen. Was sollten wir wohl sonst tun?«
Fortan wurde weniger geredet. Gerion wickelte den Zauberstab aus seinem Packen, um sich an der Wegsuche beteiligen zu können. Fortan ging er an der Bergseite, während Lingmar an der Hangseite seinen Stecken in den Schnee stieß. Gilia führte die Maultiere, und Selissa, die Gurvan zurück in die Kutsche bugsiert hatte, schritt neben der offenen Tür einher und streichelte dem fortwährend winselnden und jaulenden Hund über den Kopf. »Was mag er nur haben?« rief sie nach vorn zu Gerion, aber der Magus zuckte nur die Schultern. Er war vollauf mit dem Erkunden des Weges beschäftigt. In der nächsten Stunde legte die Gruppe auf mühselige Weise etwa eine knappe Meile zurück, eine kümmerliche Strecke auf der gewiß neun bis zehn Meilen messenden Bergflanke.
Die Sonne hatte schon fast den höchsten Stand erreicht, und Gerion schlug eine Rast vor, doch Lingmar schüttelte nur stumm den Kopf und wies nach Nordwesten, wo ein dunkelgrauer Saum am blauen Himmel heraufstieg.
»Nun, es wird wohl bald wieder schneien«, brummte Gerion, »aber ob wir bis dahin noch eine götterverdammte Meile zurückgelegt haben, kann uns doch gleichgültig sein, oder?« Da ihm niemand zustimmte, machte er sich wieder auf den Weg und stieß den Stab zornig in den Schnee.
Die Wolken zogen erschreckend schnell auf, und bald war klar zu erkennen, daß das Unwetter die Kutsche innerhalb der nächsten Stunde erreichen würde – mitten auf dem mit lockerem Schnee überladenen ungeschützten Hang. Lingmar spähte immer wieder zu der Wetterwand hinüber. Zur Eile trieb er nicht, es hätte ohnehin keinen Sinn gehabt.
Als die ersten Flocken fielen, entdeckte Selissa auf der waldigen Talsohle, von den Kronen der verschneiten Bäume größtenteils verdeckt, eine Bewegung. »Da unten regt sich etwas!« rief sie ihren Gefährten zu. »Ein Tier, glaube ich, ein großes Tier, vielleicht ein riesiger Bär.«
Auch die anderen spähten ins Tal hinab, aber dort tauchte nur hin und wieder in einer Baumlücke für einen winzigen Moment eine pelzbehangene Form auf. Das Wesen im Tal bewegte sich in die gleiche Richtung wie die Kutsche, kam aber viel schneller voran. Gurvan, der sich mühevoll hochgestemmt hatte, hob die Nase in den Wind und winselte lauter denn je.
»Das ist kein Bär«, stellte Gerion fest. »Wann immer wir je in die Nähe eines Bären kamen oder auf seine Spuren stießen – stets verhielt sich Gurvan – wenig mutig – mucksmäuschenstill. Laute wie diese habe ich noch nie von ihm gehört. Mir scheint, ehrlich gesagt, er hat soviel Angst, daß er gar nicht mehr weiß, was er tut. Was immer sich da unten verbergen mag – ich hoffe inständig, es bleibt, wo es ist!«
Derweil war der Schneefall schon wieder so heftig geworden, daß die hohen Sichelberge nicht mehr zu sehen waren, auch der Blick ins Tal hinab wurde zunehmend schlechter.
Von der Bergseite, hoch über dem Stieg, war ein Rauschen zu hören: Ein Schneebrett hatte sich gelöst, sauste hangabwärts und riß weitere Schneemassen mit sich. Etwa fünfzig Schritt entfernt rutschte die kleine Lawine herab, in sicherem Abstand also; doch das dumpfe Brausen, das plötzlich die Luft erfüllte, erschreckte das vordere Maultier so heftig, daß es blindlings vorwärtsstürmte und das zweite Muli und die Kutsche mit sich zog. Lingmar und Gilia stapften hinter den durchgehenden Tieren her, konnten aber nicht an der sparrigen Kutsche vorbei nach vorn zu den Zugtieren gelangen. Zum Glück hatte der Marsch durch den fast brusthohen Schnee die Mulis bald so erschöpft, daß sie nach etwa dreißig Schritt zum Stehen kamen. Nur durch ein Wunder waren sie auf dem Weg geblieben, und Lingmar ließ sich mit einem Stoßseufzer auf die Knie sinken, um den Zwölfen zu danken. Im selben Augenblick rutschte der hintere Teil der Kutsche zur Seite. Ein Hinterrad schwebte plötzlich über dem Hang, das Heck des Fahrzeuges senkte sich bedrohlich ... Gurvan erschien in der offenstehenden Kutschentür und machte Anstalten, herauszuspringen.
»Setz dich! Sitz!« brüllte Gerion ihn aus vollem Halse an. Der Hund zuckte erschreckt zusammen und fügte sich dem Befehl. Die Kutsche richtete sich wieder auf, nur um sich, da die Mulis einen halben Schritt rückwärts strebten, noch bedenklicher über den Hang zu neigen. Lingmar brachte die Tiere durch ein Rucken am Halfter zum Stehen, aber die Lage war bedrohlicher denn je: jede weitere Erschütterung des Gefährts konnte den Sturz in die Schlucht zur Folge haben. Gurvan schien die Gefahr erkannt zu haben. Winselnd spähte er ins Tal hinab und wagte sich nicht zu rühren. Nur seine Nase zuckte, während er sich verzweifelt bemühte, die Witterung jenes Wesens aufzunehmen, das dort soeben aus dem Wald getreten war.
Auch die Menschen sahen nach unten – und hielten den Atem an. Ihre Sicht war vom Schneetreiben so getrübt, daß sich die Kreatur nur als graubrauner Schemen vor dem Weiß des Talbodens abzeichnete, aber es war doch klar zu erkennen, daß das Wesen aufrecht ging, zottelige Felle, zotteliges Kopfhaar und einen ebenso zotteligen, fast knielangen Bart trug – und daß es mit mehr als vier Schritt Höhe höher hinaufreichte als zwei Thorwaler, die man aufeinanderstellte.
»Ich kenne es nur von Bildern«, flüsterte Selissa, »aber das muß ein Troll sein ...«
»Ich fürchte, du hast recht.« Auch Gerion hatte die Stimme gesenkt, obwohl die Entfernung bis ins Tal weit über hundert Schritt maß.
»Er kommt«, stellte Gilia fest.
Tatsächlich hatte der Troll mehrfach nach oben zur Kutsche heraufgeblickt, so daß die Reisenden voller Beklommenheit in das von Haargebüschen überwucherte riesige Gesicht sehen konnten. Nun ging ein Ruck durch den mächtigen Leib, er trat vor und machte sich daran, den Hang heraufzuklettern. An dieser Stelle fiel der Boden sehr steil – an manchen Stellen fast senkrecht – zum Tal hin ab, aber der Troll schien den Aufstieg nicht als schwierig zu empfinden. Seine riesigen Füße stemmten sich in den Schnee und ließen Abdrücke, groß wie Waschkörbe, zurück. Seine gewaltigen Fäuste umklammerten Klippensteine und Felsnadeln, die an vielen Stellen aus der Schneedecke ragten. Erschreckend schnell schob sich die Gestalt hangaufwärts auf die Kutsche zu, kleine Schneerutsche lösten sich unter den Tritten der Füße.
Die Lage auf dem Weg war verzweifelt: Die Kutsche war nicht mehr rechtzeitig freizubekommen, die Zeit würde nicht einmal mehr reichen, um Gurvan durch die zweite Tür aus dem absturzbedrohten Gefährt zu befreien. Gilia, Selissa und die beiden Männer tauschten ratlose Blicke.
»Wat maak wej nau?« fragte Lingmar. Er hatte sich an Gilia gewandt, und seine Stimme hatte recht vertrauensvoll geklungen. Um so enttäuschter blickte er drein, als die blonde Kriegerin zu erkennen gab, daß sie auch keinen Ausweg wußte.