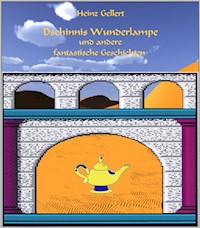
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichtensammlung beinhaltet märchenhaft abenteuerliche Kindergeschichten, die als Ebook oder Taschenbuch veröffentlicht wurden. In "Dschinnis Wunderlampe" befreien die Freunde Ben und Fabian einen Dschinnjungen aus seiner tausendjährigen Gefangenschaft in einer orientalischen Öllampe und schaffen sich damit Probleme. In "Die Erdmännlein" erlebt Tim ein Sommerferienabenteuer im Dorf seiner Großeltern. Von der Kuhweide seines Onkels wird Tims Lieblingskuh "Elsa" von kleinen Zwergen, den "Erdmännlein" geraubt. Obwohl ihm keiner glaubt, versucht Tim den Kuhdieben auf die Spur zu kommen und erfährt ihr Geheimnis. In "Der kleine Wassermann" hilf Niklas bei einem Besuch der Großeltern auf dem Lande dem Wassermannjungen Wirl im Kampf gegen einen bösen Wassermann, der ihm den Wohnteich geraubt hat. In "Das nächtliche Abenteuer" erlebt Mark, weil er seine Arbeit nicht erledigt hat, eine abenteuerliche Nacht mit Wichteln auf dem Gartengrundstück seiner Eltern. In "Hilfe für Rotkäppchen" hat ein böser Zauberer das Rotkäppchen mit dem Wolf aus dem Märchenland verbannt. Darum kennt kein Mensch mehr das Märchen. Die beiden Schulfreunde Jens und Anne bekommen die Aufgabe, das Märchen in die Welt der Menschern zurückzubringen. Auf dem Weg durchs Märchenland begegnen die Kinder den bekanntesten Grimmschen Märchenfiguren, werden in abenteuerliche und gefährliche Situationen verwickelt, bis sie ihre Aufgabe erfüllt haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Heinz Gellert
Dschinnis Wunderlampe und andere fantastische Geschichten
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Dschinnis Wunderlampe
Die Erdmännlein
Der kleine Wassermann
Das nächtliche Abenteuer
Hilfe für Rotkäppchen
Anmerkungen
Impressum neobooks
Vorwort
Die Geschichtensammlung beinhaltet märchenhaft abenteuerliche Kindergeschichten, die bereits als EBook und Taschenbuch veröffentlicht wurden:
- Dschinnis Wunderlampe
- Die Erdmännlein
- Der kleine Wassermann
- Das nächtliche Abenteuer
- Hilfe für Rotkäppchen – Abenteuer im Märchenland
Dschinnis Wunderlampe
1. Die Villa Sonnenschein
Es ratterte und polterte. Die ganze Straße war erfüllt vom Lärm, den der Handwagen auf dem holprigen Kopfsteinpflaster verursachte.
Ben zog ganz vorsichtig an der Wagendeichsel - beängstigend klirrte Glas hinter ihm. So ein Quatsch, dachte er, dieser kleine Kastenwagen ist doch kein Fahrzeug. Was die Frau eben für dummes Zeug geredet hat: ‚Ein Fahrzeug gehört auf die Straße, mein Junge. Der Gehweg ist für die Passanten da. Einen Handwagen zieht man nichtden Bürgersteig entlang, dass die Leute keinen Platz mehr zum Gehen haben.’ Wenn nur Fabian bald aus dem Haus seiner Tante herauskommt!
Ben stoppte und blickte sich um. Der Freund kam noch nicht. Doch zum Glück war die Frau nicht mehr zu sehen. Da überlegte er nicht lange. Er bog die Deichsel nach rechts, um den Wagen wieder auf den Gehweg zu ziehen. Aber die Bordsteinkante war für die Wagenräder zu hoch. Er musste darum die vorderen Räder hochheben; anders war ein Hinaufkommen auf den Gehweg nicht möglich. Zwei alte Vasen gerieten ins Rollen und schlugen aneinander. Ben erschrak und hielt an. Für einen Moment stand daher der Kastenwagen schräg. Damit die Vasen nicht noch kaputt gingen, legte er zwei Bücher dazwischen. So schien ihm die Sache sicherer. Daraufhin zog er von Neuem am Handwagen. Ein letzter Ruck, dann waren auch die beiden hinteren Räder über den Bordstein hinweg. Der Wagen rollte wieder. Der feine Sand unter den Eisenbeschlägen der Holzräder knirschte auf den Gehwegplatten.
„Sieh nur, Ben“, hörte er den Freund rufen, „der Beutel ist voll!“
Ben drehte sich um. Sein Klassenkamerad Fabian kam freudig angerannt.
„Es sind zwar nur Bücher“, sagte er, als er am Handwagen ankam und begann, die Bücher hineinzulegen. „Wir können aber morgen Nachmittag noch altes Geschirr von meiner Tante bekommen. Herr Kunze, ihr Nachbar, will auch seinen Keller aufräumen. Sie glaubt, dass wir auch bei ihm etwas für den Tödelstand deines Onkels finden werden. Ist das nicht toll? Dann brauchen wir heute auch nicht mehr in die Parkallee gehen, sondern können gleich zu dir nach Hause und die Trödelsachen in euren Keller bringen. Ich hoffe nur, dass dein Onkel alles los wird, was wir auf den Handwagen haben und ´ne schöne Summe Geld für uns zusammenkommt, um uns die Mountainbikes kaufen zu können.“
Ben wusste nichts zu erwidern. Er hatte es jedes Mal schwer, gegen die Überzeugungskraft des Freundes anzukommen. Außerdem war ihm die Lust am Sammeln für heute vergangen, weil er sich noch immer über die unangenehme Begegnung mit der Frau ärgerte. So zogen die beiden mit dem Wagen in Richtung Sonnenburger Straße.
„Was meinst du, Ben, wann wird dein Onkel den Trödel bei euch abholen?“
„Du willst wohl das Geld dafür haben? Du weißt, wir haben uns vorgenommen zu sparen!“
„Ach, darum geht´s nicht. Ich befürchte nur, wenn wir morgen noch die Fuhre von Herrn Kunze abholen, dass der Platz in eurem Keller nicht mehr ausreicht.“
„Nächste Woche. Mein Onkel war am Sonntag bei uns zu Besuch, da hat er es gesagt. Entweder nächsten Mittwoch oder Freitag kommt er mit dem Auto und Anhänger.“
„Na ja, bisher haben wir noch nicht viel Geld zusammen“, meinte Fabian. „Soviel bringt das Trödelsammeln auch nicht ein.“
Bevor Ben und Fabian in die Sonnenburger Straße gelangten, mussten sie zuerst den Weidendamm entlang - einem kleinen Park, durch den sich ein schmaler Bach schlängelte. An seinen Ufern standen beiderseits große knorrige Trauerweiden, deren untere Äste bis ins Wasser hingen. Danach bogen sie in die Weinbergstraße ein. Sie gingen die Straße bergan. Ob die sanfte Steigung der Straße ehemals Grund für die Namensgebung war? Wovon der Name tatsächlich abstammte, das wussten die beiden nicht. Weinstöcke jedenfalls waren an den Hängen der angrenzenden Hügelkette, die die Stadt südwestlich umgab, nicht zu finden. Vielleicht gab es sie aber früher einmal. Doch etwas Besonderes war trotzdem an dieser Straße. Hohe alte Buchen säumten sie. Diese standen so dicht, kaum ließen sie im Sommer das Sonnenlicht durchscheinen. Es war deshalb immer schattig und dunkel. Und noch etwas unterschied diese Straße von vielen anderen der Stadt. Hier standen ausschließlich Villen - zumeist ältere Bauten, jedoch immer von einem kleinen Park oder zumindest von einem Garten umgeben.
Für Ben und Fabian - ein alltäglicher Anblick, die zum Teil sehr schön gestalteten Häuser und Anlagen. Aber an diesem Tag erschien alles irgendwie herrlicher als sonst. Es lag wohl an der milden Mailuft. Kann sein, dass auch die über den bewaldeten Hügeln stehende rot glühende Sonne alles in einem anderen Licht erscheinen ließ. Vielleicht war es auch nur die Freude über den Tag und ihren Sammelerfolg, die den beiden alles rosiger erscheinen ließ. Das traf sogar für den Schandfleck der Straße zu - eine verfallene Villa und den sie umgebenden verwilderten Park.
„Früher muss die Villa Sonnenschein mal gut ausgesehen haben. Was meinst du, Fabian?“
Der Freund war durch das offene Gittertor in den Park hineingegangen. Er interessierte sich für einen Haufen Ziegelsteine, der am Eingang abgeladen worden war.
„Warst du schon mal drinnen, Ben?“, fragte Fabian. „Schließlich kommst du doch jeden Tag hier vorbei. Es sieht ja so aus, als wär´ das Haus seit Jahren nicht mehr bewohnt.“
„Ja, früher! Warum fragst du? Bisher war das Tor aber verschlossen.“
„Ich meine ja nur!“, erwiderte Fabian und kramte zwischen den Steinen herum.
Ben schaute ihm unverständlich zu und fragte nach einer Weile: „Was suchst du überhaupt? Es sind doch nur ganz gewöhnliche Mauersteine.“
Fabian kam nachdenklich zum Tor zurück. „Die Villa hat bestimmt einen großen Keller“, meinte er. „Da könnte man vielleicht interessante Sachen finden. Wir sollten uns mal umsehen. Jetzt! Wenn wir schon hier sind.“
„Aber Fabian, hier wird gebaut! Wir können doch nicht einfach raufgehen.“
„Es ist ja keiner mehr da. Die Bauarbeiter sind längst nach Hause. Und ... steht hier irgendwo ein Schild?“ Er blickte sich um. „Außerdem tun wir ja nichts. Wir lassen alles so, wie es ist. Wir wollen nur mal sehen. Es wär´ doch schade, wenn da was liegen würde, was man noch gebrauchen könnte. Denk nur an deinen Onkel, wie der sich freuen würde. Ich glaub´ nicht, dass sich die Arbeiter die Mühe machen. Die bringen alles nur auf die Müllhalde.“
„Na, wenn du meinst, Fabian. Aber was machen wir mit unsrem Wagen?“
„Den nehmen wir mit, stellen ihn dort hinter die Hecke!“ Fabian wies mit der rechten Hand auf eine Gruppe Sträucher. „Da kann ihn keiner von der Straße aus sehen.“
Als sie den Handwagen abgestellt hatten, ging Fabian sofort auf einen Schutthaufen zu, der seitlich der steinernen Treppe zum Hauptportal angehäuft war. Während der Freund mit Eifer den Bauschutt untersuchte, betrachtete Ben die Vorderfront des Hauses. Die rechte Seite der Villa war bereits bis zum Dachrand eingerüstet. Die oberen Fenster standen offen, einige der Glasscheiben waren zerbrochen. Am Balkon, im zweiten Stockwerk über dem Portal, fehlte der Putz. Ben konnte die rostigen Eisenträger sehen. Anscheinend war der Balkon aber noch betretbar, da ein Flaschenzug angebracht war. Sämtliche Fenster im Erdgeschoss hatte man mit Brettern zugenagelt.
Ben bemerkte, dass Fabian zwei alte Messingwasserhähne aus dem Haufen beiseitegelegt hatte. „Die sind doch Müll!“, rief er ihm zu. Da der Freund keine Reaktion zeigte, ging er zu ihm, zog ihn am Arm und sagte: „Lass uns gehn! Ich habe keine Lust im Dreck zu wühlen.“
„Vielleicht hast du ja recht“, meinte Fabian und warf die Wasserhähne zurück auf den Haufen. „Dann lass uns rein gehen!“
Sie stiegen die Stufen zum zweitürigen Hauseingang hinauf und mussten unverrichteter Dinge kehrtmachen, weil er verschlossen war.
„Das ist doch logisch, dass die Bauarbeiter abgeschlossen haben“, stellte Ben fest, „sonst hätten sie ja die Fenster nicht vernagelt.“ Er rannte die Treppe hinunter und wollte zum Handwagen gehen. Fabian hielt ihn zurück.
„Wir können ja das Gerüst hochklettern.“
Ben blickte ihn entsetzt an.
„Na, dann versuchen wir´s eben hinterm Haus.“ Fabian wollte die Suche nicht so schnell aufgeben wie sein Freund Ben. In ihm war die Abenteuerlust geweckt. Um jeden Preis wollte er wissen, wie es im Hausinnern aussah.
Den Jungen fiel sofort die Ruine des Seitenanbaus auf, der schon vor langer Zeit durch einen Brand zerstört worden war. Es stand nur noch die Fassade, das Dach fehlte völlig. Die Fenster im hinteren Teil des Anbaus waren zugemauert. Dem Anschein nach wurde dieser Teil der Ruine als Abstellmöglichkeit genutzt. Aber die betreffende Tür war ebenfalls verschlossen. Man schien an alles gedacht zu haben, um Unbefugten den Zutritt zu verwehren. Eine kleine, seitlich am Giebel des Haupthauses angebaute Treppe führte leider auch nicht weiter. Gleichfalls waren alle unteren Fenster wie an der Vorderfront der Villa mit Brettern geschlossen. Wie Fabian nach einer gründlichen Betrachtung der Hinterfront feststellte, gab es nur die Möglichkeit, über einen der unteren Äste eines nahestehenden Walnussbaumes ein offenes Fenster im ersten Stockwerk zu erreichen.
„Dann bleibt uns doch nur das Gerüst vorne, um ins Haus zu kommen“, meinte Fabian.
„Ich klettere jedenfalls nicht“, sagte Ben mürrisch. „Du kannst ja machen, was du willst.“
Fabian sah Ben verärgert an. „Was ist denn schon dabei“, maulte er. „Die Bauarbeiter steigen auch rauf.“
Ben wollte ihm darauf nicht antworten. Er hatte die Idee von Anfang an für blöd gehalten und wollte jetzt nur noch nach Hause.
Dann entdeckte Fabian noch eine Tür. Sie war verdeckt durch einen Fliederbusch und ihm darum nicht gleich aufgefallen. Fast ohne Hoffnung griff er nach der Klinke. Doch diese Tür war unverschlossen, sie öffnete sich und gab den Blick in die ehemalige Hauswartwohnung frei.
Obwohl Ben keine Lust mehr hatte, folgte er Fabian. Sie gingen hinein.
Die Wohnung an sich bestand nur aus einer großen Küche und einer Kammer. In der Kammer fanden sie die Fußbodendielen an zwei Stellen morsch und eingebrochen vor. Die Wände waren schmutzig, die Fensterscheiben gesprungen und blind. Die Jungen hatten den Eindruck, als hätten die letzten Bewohner hier all ihren überflüssigen kaputten Hausrat vor dem Umzug zurückgelassen.
Da die Tür von der Küche ins Hausinnere nicht verschlossen war, setzten die Jungen ihre Erkundung fort. Durch einen kleinen Flur gelangten sie in einen breiten Gang. Drei Türen gingen davon ab - die mittlere war mit schweren Eisenbeschlägen versehen. Fabian vermutete dort den Kellereingang. Aber die Jungs lenkten ihre Schritte vorerst zu einer grauen, abgetretenen Treppe und kamen ins Foyer, dessen Mittelpunkt eine Marmortreppe bildete, die ins Obergeschoss des Hauses führte. Zu beiden Seiten im Foyer waren zwei bis fast zur Decke reichende Doppeltüren angeordnet. Sie standen offen.
Ben und Fabian besichtigten nacheinander die Zimmer im Erdgeschoss und auch die Räume im oberen Stockwerk. Überall das gleiche Bild: Bauschutt, leere und halb gefüllte Bottiche und Holztröge mit Mörtel, Leitern, Arbeitstische, Werkzeug, Rohre. In einem Raum hatten die Handwerker Umkleideschränke aufgestellt. Hier fanden die Jungen einige Pfandflaschen.
Die Freunde kehrten zurück ins Erdgeschoss. Die Tür zum Keller ließ sich schwer öffnen. Es war stockdunkel. Kühle, feuchte Luft schlug ihnen entgegen. Fabian tastete an der Wand entlang, um einen Lichtschalter zu suchen. Das Licht funktionierte, wenn auch nicht alle Lampen brannten.
Sie stiegen langsam, Stufe für Stufe, die Steintreppe im Halbdunkel hinab. Die Schritte hallten. Es roch muffig. Gewiss war lange Zeit niemand mehr hier unten gewesen. Die Bauleute würden bestimmt auch im Keller eine Instandhaltung durchführen. Doch momentan herrschte noch Unordnung. Ein großer Teil des Kellergewölbes war durch Holzlattenverschläge abgeteilt. Der hintere Teil schien vormals der Weinkeller der Villa gewesen zu sein; ein altes, geborstenes Fass und Regale mit verstaubten Weinflaschen zeugten davon.
„Glaubst du etwa, hier noch volle Flaschen zu finden?“, fragte Ben und sah Fabian zu, wie der in gebückter Haltung eine Reihe Regale abschritt, hier und da eine Flasche in die Hand nahm und das Etikett vom Staub befreite.
„Quatsch! Ich sehe auch, dass sie leer sind. Mich interessiert nur, aus welcher Zeit sie stammen.“
„Du bist wohl Weinkenner!“, spottete Ben.
Fabian drehte sich um, gab aber keine Antwort. Er wusste selbst, wie dumm es war, nach vollen Weinflaschen zu suchen. Wenn wirklich einmal welche vorhanden waren, dann waren sie längst von denen gefunden, die hier im Keller ihren Unrat hinterlassen hatten. Die Regale quollen über mit Kartons, Lumpen, Weckgläsern, verrosteten Fahrradteilen und anderem Zeug. Viel Brauchbares war nicht darunter. Wenn sie sich vielleicht am nächsten Tag genauer umsehen würden, vielleicht würden sie noch ein paar gute Stücke für den Trödelmarkt finden.
Dann, Fabian wollte Ben schon auffordern, mit ihm den Keller zu verlassen, entdeckte er eine andere Kellertür. Sie ähnelte der, durch die sie gekommen waren. Zur Hälfte von einem Regal verstellt, und weil die in der Nähe hängende Kellerleuchte entzwei war, war sie auf den ersten Blick nicht auszumachen.
„Ben, komm her! Hier ist noch eine Tür. Vielleicht ein zweiter Keller.“
Ben kam herbei. Er packte auch sofort mit an, um das Regal von der Tür abzurücken. Aber es war zu schwer. Deshalb mussten sie erst die darin befindlichen Gegenstände in das nebenstehende Regal umlagern. Mit großer Anstrengung versuchten sie dann, durch Ziehen und Schieben das Hindernis aus dem Weg zu räumen. Es schwankte bedrohlich und stürzte um. Noch rechtzeitig konnten sie beiseite springen. Das umgestürzte Regal behinderte trotzdem das Öffnen der Tür. Nur einen Spalt weit ließ sie sich aufmachen. Vereint zerrten beide am Regal, und es gelang ihnen, wenigstens soviel freien Platz zu schaffen, um sich durch die Tür zu drängen.
Stockfinster war es hinter der Tür.
„Sollen wir hineingehen?“ Ben sah Fabian unentschlossen an.
„Ohne Licht natürlich nicht“, antwortete er. „Zu gefährlich! Der Keller gehört bestimmt zur Ruine. Aber mit einer Taschenlampe können wir ja mal hineinleuchten. Oben, in der Waschküche habe ich eine liegen gesehen. Warte! Ich hole sie.“ Er kletterte über das Regal und stieg die Kellertreppe hinauf.
Nur wenig Zeit verging, da kam er tatsächlich mit einer Taschenlampe zurück, und sie funktionierte sogar. „Ich lege sie nachher wieder zurück“, sagte er beiläufig, weil er das Gefühl hatte, etwas sagen zu müssen. Dann drängte er Ben beiseite, um von der Tür aus in den Raum zu leuchten.
Im Schein der Lampe suchte Fabian den dunklen Raum ab. Dabei streifte er für Augenblicke einzelne Gegenstände. Aber vorerst interessierte ihn einzig und allein der Zustand der Kellerdecke. Er konnte nichts Verdächtiges feststellen. Einen Moment lang zögerte er noch, dann wagte er das Betreten des Kellers.
Ben wollte den Freund erst zurückhalten, bedachte dann aber, dass er ihm gegenüber zu offensichtlich als Angsthase dastehen würde. So folgte er Fabian mit bangem Herzen.
2. Auf Trödelsuche
Dumpf hallten die Schritte wider. Obwohl der Raum kleiner war als der vorgelagerte Kellerraum, schien es den Jungen lauter. Sie gingen, nachdem sie einen Schalter für das elektrische Licht vergeblich gesucht hatten, immer vom Lichtstrahl der Taschenlampe geführt, auf eine Gruppe von Stühlen zu. Sie zählten fünf. Bei näherer Beleuchtung erkannten sie, dass die Stühle schon alt waren. Fabian meinte, sie würden aus dem 19. Jahrhundert stammen. Das Holz war dunkel, Lehne und Füße geschwungen, der Polsterbezug auf Rückenlehne und Sitz sehr verschmutzt und stellenweise eingerissen. Die Feuchtigkeit im Keller hatte den Stühlen schwer zugesetzt. Ein Stück weiter davon entfernt stand ein großer, eingerahmter, ovaler Spiegel. Er war in der gleichen Form gearbeitet wie die Stühle, allerdings von Staub und Feuchtigkeit blind. Nur schwach war darum der Widerschein des Lichts der Taschenlampe. Näher zur linken Wand hin und darum den Freunden nicht gleich aufgefallen, stand noch eine wuchtige, mit Messingbeschlägen verzierte Holztruhe.
„Die würde ich gern mitnehmen!“, rief Ben und konnte seine Bewunderung für die Truhe nicht verbergen.
Fabian stürmte gleich darauf zu und meinte: „Was denkst du, was mein Vater sagen würde, wenn der das Ding sähe! Der steht auf solch altes Zeug.“
Ben war betrübt. Damit hatte er nicht gerechnet, dass Fabian auch Besitzansprüche stellen würde. Er hingegen schenkte dem schlagartigen Stimmungswechsel des Freundes keine Beachtung; viel zu sehr war er mit dem Öffnen der Truhe beschäftigt. Zum Glück hingen keine Schlösser davor. Nach mehrmaligem Rütteln bekam er die beiden Verschlüsse auf. Langsam hob er den Deckel und ließ ihn vorsichtig nach hinten gleiten, die alten Scharniere sollten nicht überbeansprucht werden. Er wollte später keine Vorwürfe von seinem Vater zu hören bekommen, dass er nicht sorgsam mit der Truhe umgegangen sei, wenn der sie sehen und bestimmt abholen würde.
Fabian leuchtete mit der Taschenlampe hinein. Zuoberst lag eine verblichene, in den Farben grau und rot karierte Reisedecke. Ben, der hinzugetreten war, nahm sie heraus, um zu sehen, was durch sie verdeckt wurde.
Auch Fabian griff zu und entnahm der Truhe eine helle Hose, ein Hemd und einen runden Tropenhelm - Safarikleidung für einen ziemlich dicken Mann. Dabei fielen Fotos zu Boden. Er gab Ben die Sachen und bückte sich, um die Fotos aufzuheben. Wie es aussah, waren die Schwarz-Weiß-Fotos in Afrika aufgenommen worden. Sie zeigten wilde Tiere in freier Wildbahn und schwarze und weiße Jäger, die Tiere gefangen oder erlegt hatten. Die auf den vergilbten Fotos abgebildeten weißen Männer trugen alle die gleiche helle Kleidung und Tropenhelme, die dem aus der Truhe ähnelten.
„Das muss schon einige Jahre her sein“, meinte Ben.
„Bestimmt Jahrzehnte!“, stellte Fabian fest. „Das sieht man doch an der altmodischen Kleidung und den Gewehren.“ Darauf forderte er den Freund auf, ihm zu leuchten, beugte sich über den Rand der Truhe und wühlte wichtigtuerisch darin herum.
„Hier sind Bücher!“ Fabian hielt ein dickes Buch in der Hand und blätterte. „Fotos und Zeichnungen“, sagte er vor sich hin. „Auch aus Afrika. Sieh selbst! Die Schrift kann man aber nicht lesen, sieht seltsam aus.“
Ben nahm das Buch. Er betrachtete es gründlich. Dann gab er es Fabian zurück und beugte sich in die Truhe. Er suchte eine Weile. Als Ergebnis brachte er weitere Bücher zum Vorschein, blätterte kurz in ihnen, stapelte sie neben sich auf den Boden, bis er ein in schwarzes Leder gebundenes Tagebuch gefunden hatte. Nun musste Fabian ihm mit der Taschenlampe leuchten, während er sich einige Seiten des Buches ansah.
„Das ist die alte deutsche Schrift“, stellte Ben fest. „Meine Uroma kann heute noch so schreiben. Ein bisschen kann ich auch lesen. Hier wird über eine Reise durch Ostafrika im Sommer 1910 geschrieben. Das war mal eine deutsche Kolonie.“
„Woher weißt du das?“, fragte Fabian verblüfft.
„Mein Opa hat auch solche Bücher. Die sind noch von seinem Vater. Wir haben sie uns oft gemeinsam angesehen und darüber gesprochen.“ Ben war stolz, einmal etwas gewusst zu haben, was Fabian nicht wusste.
„Du wirst schon recht haben“, sagte Fabian brummig. Er hatte sich wieder der Truhe zugewandt und kramte schlecht gelaunt weiter.
Ein leises Knacken war zu hören - nur kurz. Ben und Fabian nahmen keine Notiz davon. Dann rieselte Sand an irgendeiner Stelle im Keller.
„Findest du nichts mehr, Fabian?“ Ben wunderte sich und trat hinter ihn. „Da ist bestimmt noch ´was. Ich hab´s doch gesehn.“
„Ja, ja! Hier ist was von den Arabern.“ Er warf einen zerfetzten Turban und einen knittrigen Kaftan hinter sich.
„Pass doch auf!“, sagte Ben ärgerlich, weil er die Sachen über den Kopf bekam. „Und jetzt lass mich mal!“ Er nahm Fabian die Taschenlampe aus der Hand und richtete den Lichtstrahl auf den Boden der Truhe. Ein Rest Bücher, zusammengerollte und zu einem Bündel verschnürte Landkarten, ein Zinnteller und ein unansehnliches, verbeultes Ding - eine orientalische Öllampe. Das war alles.
Die Lampe hatte es Ben gleich angetan. „Die ist bestimmt aus Kupfer!“, schwärmte er und hielt sie Fabian unter die Nase.
„Und wenn schon“, sagte der verächtlich und schob sie von sich. „Dafür bekommst du nicht mal ´nen Euro von deinem Onkel.“
„Das ist doch kein Trödel!“, entrüstete sich Ben. „Die ist bestimmt antik.“
„Antik? Du spinnst! So viele Beulen, wie die hat.“ Fabian lachte.
„Lach nur!“ Ben machte sich nichts daraus. „Ich sage dir, sie sieht genauso aus wie die in meinem Märchenbuch. Nur ein bisschen schmutzig.“
„Ein bisschen!“, brüllte Fabian und bekam fast einen Lachanfall. Gleich darauf fiel Putz von der Kellerdecke und klatschte auf den Steinboden. Die Jungen starrten erschrocken ins Dunkel. Aber da nichts nachfolgte, nahmen sie es nicht für wichtig.
Ben kam sofort wieder, auf seine Kupferlampe zu sprechen. „Du sollst die Lampe auch gar nicht nehmen. Du kannst meinetwegen den Zinnteller haben.“
Doch Fabian wollte ihn nicht. Er nahm dafür das große Buch mit den Bildern aus Afrika und drängte zum Aufbruch. „Komm, Ben! Wir räumen die Sachen wieder ein und gehen dann. Das andere können wir morgen mitnehmen ...“ Er konnte nicht zu Ende sprechen; ein Krachen und Poltern setzte unerwartet ein, ließ ihn vor Schreck verstummen.
Staub wirbelte auf, kam in Mund und Nase. Ben musste husten und wollte schon Reißaus nehmen, doch Fabian hielt ihn zurück. Mit der Taschenlampe versuchte er, die Ursache des Lärms zu ergründen. Aber der Lichtstrahl drang nur schwach durch den aufgewirbelten Staub. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als weiter in den Raum hineinzugehen, wenn er feststellen wollte, was geschehen war.
Nochmals ein dumpfes Krachen. Etwas fiel auf den steinernen Boden, dass es laut widerhallte.
„Komm zurück!“ Ben ließ erschrocken die Bücher, die er gerade in der Truhe verstauen wollte, aus den Händen fallen, griff schnell nach Teller und Lampe und rannte zur Tür.
Fabian entdeckte im Lichtkegel der Taschenlampe ein großes Loch in der hinteren Wand. Steine lagen am Boden. Ein beachtlicher Teil der Decke hatte sich gesenkt, einzelne Stücke waren herausgebrochen.
Wieder polterte es. Steine fielen. Fabian hörte Ben warnend rufe: „Komm da weg!“ Der aufgewirbelte Staub war bereits so dicht, dass er den Freunden die Luft zum Atmen nahm. Fabian schleppte sich hustend zum Ausgang. Schnell schlossen beide die Tür, damit der Staub sich nicht weiter ausbreitete, und verließen den Keller.
Fabian wollte Ben nicht zeigen, dass auch er einen gewaltigen Schreck bekommen hatte. Darum sagte er: „Ich bringe nur noch die Taschenlampe weg. Geh du schon zum Handwagen! Ich komme gleich nach.“ Er steckte ihm im Gang noch schnell sein Buch unter den Arm.
Im Freien atmete Ben mehrmals tief durch. An das Geschehen im Keller wagte er nicht zu denken. Ein Blick zu seiner Armbanduhr sagte ihm, dass nicht mehr viel Zeit war, um noch pünktlich zu Hause zum Abendessen zu erscheinen. Der Zinnteller, die Kupferlampe und Fabians Buch waren sicher im Wagen verstaut. Nun fehlte nur noch der Freund selbst, dann konnte es losgehen.
Und wie aufs Stichwort kam er, ergriff schweigend die Wagendeichsel. Ben musste hinten am Wagen schieben. Als sie fast das Gittertor zur Straße erreicht hatten, blieben die vorderen Wagenräder an etwas hängen. Als Fabian nachsah, machte er das Baustellenschild ausfindig. Irgendwer hatte es umgestoßen. Er lehnte es an den Torpfosten.
„Nun hat alles wieder seine Ordnung“, bemerkte er ironisch.
„Ich hätte mich auch gewundert, wenn hier keines gewesen wäre“, meinte Ben, lief dann nach vorn und nahm Fabian die Deichsel aus der Hand. „Ich ziehe den Wagen heute allein nach Hause. Es ist ja nicht mehr weit. Außerdem … deine Mutter wird bestimmt schon auf dich warten.“
Die Freunde verabschiedeten sich und gingen in entgegengesetzter Richtung davon.
3. Dschinni aus der Wunderlampe
Ben wohnte am Anfang der Sonnenburger Straße in einem Reihenhaus. Er zog seinen Handwagen durchs Hoftor auf den Hof. Die Mutter goss im Garten die Beete. Als sie ihn kommen sah, rief sie ihn zu sich.
„Du kommst ziemlich spät, Ben“, sagte sie. „Wir haben extra mit dem Abendbrot gewartet. Dein Vater ist nicht sehr erfreut darüber. Er muss heute Abend noch weg.“
„Entschuldige, Mutti, aber ...“
„Na, schon gut! Du bist ja sonst immer pünktlich. Lass den Wagen hier erst mal steh´n! Du kannst die Sachen nachher in den Keller tragen. Geh dir jetzt die Hände waschen! Ich bin dann auch soweit.“
Ben war froh, dass die Mutter nicht böse war. Darum holte er die Kupferlampe aus dem Wagen und zeigte sie ihr. Er nahm an, sie würde sich genau wie er über den Fund freuen. Aber weit gefehlt! Als die Mutter die Lampe in seiner Hand erblickte, schimpfte sie: „Das scheußliche Ding trägst du mir nicht in die Wohnung! Wirf es weg! Musst du auch immer jeden Unrat mitbringen! Woher hast du´s überhaupt?“
„Gefunden“, antwortete er geknickt. „Die Lampe ist bestimmt sehr alt und wertvoll.“ Selten hatte Ben seine Mutter so aufgebracht erlebt. „Und wenn ich sie putze, Mutti?“, bettelte er. „Wenn ich sie mit Silberglanz putze, wie du´s immer mit deinem Besteck machst, kann ich sie dann in mein Zimmer stellen?“
„Meinetwegen, dann ja!“, war ihre Antwort. Sie schien jetzt mehr darüber verärgert zu sein, wieder nachgegeben zu haben. Darum sagte sie schroff: „Leg sie jetzt aber weg! Und vergiss nicht, die Hände zu waschen!“ Sie wandte sich wieder ihren Beeten zu.
Ben betrachtete die Lampe in seiner Hand. „Ist sie wirklich so hässlich?“, dachte er.
Nach dem Abendessen trug Ben die gesammelten Trödelsachen mit einem Einkaufsbeutel in den Keller. Dort stand schon eine Menge davon. Würden sie morgen noch die Sachen von Herrn Kunze abholen, überlegte er, wird der Platz knapp. Für eine weitere Ladung aus der Villa wäre er garantiert nicht mehr ausreichend.
Zuletzt trug er seine Lampe und den Zinnteller in den Keller. Er legte beides auf einem alten Küchenschrank ab, worin die Mutter ihr Eingemachtes aufbewahrte. Wieder betrachtete er die Lampe und grübelte, wie er wohl die Beulen herausbekäme. Um den Schmutz machte er sich keine Sorgen. Es erforderte eben etwas mehr Geduld und Ausdauer beim Putzen. Da er keinen Putzlappen herumliegen sah, entschloss er sich, mit der Lampe in den Hobbyraum des Vaters zu gehen. Dort würde er sicherlich einen finden. Außerdem lag der Raum gleich gegenüber, und gemütlicher war es auch.
Er schloss die Tür zum Hobbyraum auf, schaltete die Neonleuchte ein. Der Vater hatte aufgeräumt. Die vorbildliche Ordnung stach sofort ins Auge. Auf den ersten Blick fand er keinen Lappen. Darum sah er im altmodischen Wäscheschrank nach, der einmal seiner Urgroßmutter gehörte. Der Schrank war mit Wurmlöchern übersät; Generationen von Holzwürmern hatten an ihm mit dem Zahn der Zeit um die Wette genagt. Verhielt man sich still und lauschte, konnte man sogar einen Vertreter der jüngsten Generation in Aktion erleben. Ben interessierte es schon, ob die kleinen Würmer einen Schrank soweit zerstören konnten, dass er zusammenbrach. Aber so fest, wie der da stand, würde es wohl sobald nicht passieren.
Ben fand einen Lappen und auch feines Sandpapier. Vorerst jedoch wollte er nur den Lappen verwenden. Wenn möglich, sollten keine Kratzer entstehen. Würde er die Lampe doch ausbeulen können - er hoffte, dass ihm der Vater dabei half - wäre es schade, wenn statt der Beulen dann Kratzer sie verunzierten. Er setzte sich in den alten Schalensessel, der neben einem ausrangierten, runden Klubtisch in der Ecke stand, schaltete das darauf befindliche Radio ein und begann, mit dem Lappen an der Lampe zu reiben. Ganz unerwartet drang Rauch vorn aus der Öffnung. Ben wunderte sich. Normalerweise brannte dort eine kleine Flamme, wenn die Lampe mit Öl gefüllt und angezündet war. Er hatte sie aber nicht angezündet. Wozu auch? Es war ja kein Öl darin. Wie konnte also ein schwacher, bläulicher Rauchfaden kerzengerade nach oben steigen?
Er schaute sich die Sache genauer an. Er drehte die Lampe in seiner Hand und versuchte, in die Öffnung hinein zu sehen. Außer dem Rauch konnte er aber nichts Auffälliges entdecken. Er versuchte ein Weiteres, deckte mit der Handfläche die Öffnung zu. Vielleicht würde dadurch der Rauch ersticken; stattdessen verstärkte er sich.
Ben versuchte mit stärkerem Druck, die Öffnung verschlossen zu halten. Es gelang ihm nicht, so sehr er auch seine Hand darauf presste. Auf einmal strömte es so gewaltig aus der Öffnung, dass er erschrocken die Lampe auf den Boden warf und in panischer Angst zur Tür rannte. Immer mehr quoll der Rauch aus der Lampe. Er füllte den ganzen Kellerraum. Ben griff daher hastig nach der Türklinke, weil er fürchtete zu ersticken.
Da hörte er jemanden hinter sich rufen: „Höre, Erhabener Jüngling! Ich bin dein Diener. Was ist dein Begehr?“
Ben drehte sich um. Eine Jungengestalt, fremdartig gekleidet, formte sich im blauen Dunst über der Lampenöffnung, löste sich dann und schwebte geradewegs auf ihn zu.
Ben stand wie angewurzelt. Er hielt noch immer mit der rechten Hand die Türklinke fest. Er wollte sprechen, doch die Stimme versagte ihm. So starrte er regungslos den fremden Jungen an, der nur einen Schritt weit entfernt, die Arme vor der Brust gekreuzt, in gebeugter Haltung vor ihm stand. In seinem golddurchwirkten Gewand sah der Junge wie ein Märchenprinz aus dem Orient aus. Er trug dunkelgrüne, seidenglänzende Pumphosen und ein orangefarbenes, ärmelloses Hemd, das gut zu seiner braunen Hautfarbe passte, an den Füßen goldbestickte Pantoffel und auf dem schwarzen, krausen Haar einen Turban aus Goldbrokat.
„Wer bist du?“ Ben hatte seine Stimme wiedergefunden.
„Dein Dschinni!“, erwiderte der andere - noch immer in demütiger Haltung.
Ben wusste, was ein Dschinn war; schließlich war er belesen. Wenn auch nicht tausend, so hatte er doch eine große Anzahl der Märchen aus Tausendundeine Nacht gelesen. Aber er war sich nicht sicher, ob er nicht träumte. Jedes Kind weiß doch, dass Märchen nicht wahr sind. Darum konnte erst recht kein Märchenwesen leibhaftig vor ihm stehen.
Wie war das nur möglich?, überlegte Ben. Der Keller war verschlossen. Er hatte die Tür doch erst aufgeschlossen. Auch das Fenster stand nicht offen, und er hielt ja immer noch die Türklinke fest. Also konnte auch keiner von draußen hereingekommen sein. Der hätte ja an ihm vorbeigehen müssen. Er konnte also nur träumen. Der blaue Nebel, der damit verbundene süße, betäubende Duft - ein schöner Traum. Oder eine Halluzination?
„So was Verrücktes!“, sagte er zu sich selbst und lachte. „Ich träume schon mit offenen Augen. Es fehlt nur noch, dass ich nachher im Sessel aufwache.“ Er beruhigte sich und kam zu dem Schluss, dass es wirklich nur ein Traum sein konnte. Zwar in wenig schöner Umgebung, jedoch hatte er schon schlechter geträumt.
Ben war neugierig, wie die Sache weiter verlaufen würde. So entschloss er sich, dem Traumjungen zu antworten - natürlich in der Weise, wie es sich als Gebieter eines Dschinns geziemte, wie er es gelesen hatte: „Erhebe dich, Junge! Ich bin dir geneigt. Lass mich dein Gesicht sehen!“ Er postierte sich gebieterisch.
Da nahm er eine andere Stimme wahr. Er brauchte eine Weile, bis ihm klar wurde, woher sie kam - vom Radio. Die Sieben-Uhr-Nachrichten. Unweigerlich schmunzelte er. So einen in allen Einzelheiten exakten Traum hatte er noch nie. Er empfand jedoch das Geplärr des defekten Gerätes als störend. Vielleicht könnte der Traum dadurch schwinden? Er ging am Jungen vorbei auf den Apparat zu, um ihn auszuschalten. Dabei stieß er mit dem Knie an die Werkbank seines Vaters. Der Schmerz raubte ihm jeden weiteren Gedanken. Einen Augenblick lang war er wie gelähmt. Dann kam Wut in ihm auf und mit der Wut die Besinnung. Nachdem er mit der Hand sein Knie gerieben hatte, sah er ein, dass es kein Traum sein konnte. Er war in seinen Träumen schon von hohen Häusern gestürzt, hatte aber niemals etwas verspürt.
„O Schei ...!“, rief er - es war ein Lieblingsspruch seines Vaters, den er auch gern benutzte. „Menschenskind! Wie kommst du denn hierher?“ Er humpelte zum Jungen hin, der immer noch ergeben tat, und schubste ihn kumpelhaft.
„Erhabener Jüngling!“, sprach der ihn an. „Wisse, ich bin der Dschinni aus der Wunderlampe! Du hast mich gerufen. Ich stehe zu Diensten. Was ist dein Begehr, Meister?“
„Lass das erhabene Getue und diese blöde Verbeugung!“ Ben fasste ihn bei der Hand und zog ihn zum Sessel hin. Er wischte mit dem Ärmel seines Pullovers über den Sitz und sagte: „Damit du dich nicht dreckig machst. Setz dich und erzähle! Bist du wirklich ein Dschinn?“ Ben hob die Kupferlampe vom Boden auf, stellte sie auf dem Klubtisch ab und ließ sich voller Erwartung neben ihr auf dem Klubtisch nieder.
4. Dschinnis Geschichte
„Auf Weisung des Königs aller Dschinn“, begann der Dschinnjunge, „wurde ich in diese Kupferlampe gebannt. Damals sah sie besser aus. Sie glänzte fast so schön wie eine goldene Lampe. Es gibt größere, schönere unter Allahs Sonne … nicht nur aus Kupfer, sondern aus Silber und sogar aus Gold. Doch jeder junge Dschinn fängt klein an und muss sich bescheiden. Ich bekam die hier … sozusagen auf Probe. Muss mir erst eine bessere verdienen. Ich habe den Auftrag, demjenigen als Dschinni zu dienen, der an der Lampe reibt. Ich kann aber nur einen Wunsch erfüllen. Und ich muss einen kleinen Schatz hüten. Wenn möglich, soll ich ihn vergrößern; denn je größer der Schatz, je mächtiger der Dschinn …“
„Seit wann bist du denn der Geist der Lampe?“, unterbrach ihn Ben, der solange aufmerksam zugehört hatte.
„Bei Allah! Es werden wohl an die tausend Jahre und mehr sein.“
Ben blickte verwundert, denn sein Gegenüber sah nicht älter als er selbst aus.
„Wisse, o Erhabener! Wachstum und Alter des Dschinns hängen von seinen Taten und der erlangten Weisheit ab. Darum kann ich nur größer werden, wenn ich meine erste Tat vollbringe, wenn ich den einen Wunsch erfülle. Dann bin ich frei. Dann kann ich die Lampe für immer verlassen. Und ich kann endlich wie die anderen Dschinn hinaus in die weite Welt ziehen, lernen und gute Taten vollbringen, meinen Schatz vermehren und mit Allahs Hilfe groß und mächtig werden. Vielleicht bekomme ich auch eine neue Wunderlampe. Dann bestimmt eine größere … schönere. Dazu natürlich einen größeren Schatz. Um Gutes zu tun in Allahs Reich. Aber ich will nicht verschweigen, dass es auch andere Dschinn gibt. Solche, die sich ihren Schatz zusammenrauben, die den Menschen Unglück bringen. Das sind böse Geister wie die Marid, die fürchterlichsten unter ihnen. Sie sind von uns guten Dschinn verstoßen. Doch es ist leider so: Je mehr sie rauben, desto mächtiger werden sie.“ Er schien sich für diese Dschinn zu schämen, denn er hatte für einen Moment den Blick nach unten gesenkt. Dann fasste er sich wieder, um seine Erzählung fortzusetzen.
„Höre, o Erhabener, von Allah begnadeter Jüngling, da du mich aus meiner misslichen Lage befreitest ...“
„Lass das!“, unterbrach Ben ihn erneut. Er mochte solch Gerede nicht. Es war ihm peinlich, so angesprochen zu werden. „Sag einfach: Ben!“
„Verzeih mir, o Jüngling, Ben! Es ist die Freude, die ich über meine Errettung empfinde und die mich so reden lässt. Ich werde mich von nun an bemühen, mich zu mäßigen, weil du es willst, du mein ...“
„Hör´ auf!“, rief Ben gereizt. „Erzähle lieber weiter!“
„Allah ist mein Zeuge!“, setzte der Dschinni, etwas eingeschüchtert, seine Lebensgeschichte fort. „Mein Unglück war, dass über die lange Zeit, in der ich in der Lampe gebannt war, niemand an ihr gerieben hatte. Immer wurde nur Öl hinein gegossen. Sie wurde immer nur angezündet, damit sie brannte. Keiner kam jemals auf den Gedanken, sie zu putzen.“ Er griff nach der Kupferlampe und betrachtete sie traurig. „Sieh nur! Über und über ist sie mit Schmutz bedeckt. Und die vielen Beulen …“
„Mein Vater und ich, wir werden sie schon wieder zum Glänzen bringen.“ Ben nahm ihm die Lampe aus der Hand und stellte sie neben sich auf den Tisch zurück. „Erzähl doch weiter!“
Der Dschinni warf noch einen Blick auf die Lampe, blickte dann Ben in die Augen und begann weiterzuerzählen: „Auf einem Basar in Basra wurde damals die Wunderlampe zusammen mit anderem Hausrat angeboten. Hast du schon von dieser Stadt im Orient gehört? Sindbad, der Seefahrer, hatte zu dieser Zeit gerade sein Segelschiff im Hafen liegen. Von dort war er zu seinen berühmten Reisen übers Meer in aller Herren Länder aufgebrochen. Immer dann, wenn er das müßige, nur in Lustbarkeit schwelgende Leben in Bagdad, der Stadt des Kalifen Harun Al Raschid überhatte.
Wie gern wäre ich mit ihm in die weite Welt gesegelt“, seufzte der Dschinni. „Aber weder er noch einer von seiner Mannschaft, niemand wollte die Lampe kaufen. Es gab eben schönere. So wurde sie zuletzt einem alten Töpfer als Kaufgeschenk mitgegeben. Dem erhellte sie ab und zu sein ärmliches Haus, wenn er Öl zum Brennen hatte. Oh bei Allah, dem Erhabenen! Mit Freude hätte ich dem guten Mann geholfen. Ich versuchte auch ein paarmal, mich durch Klopfen bemerkbar zu machen, doch er vernahm es nicht. Letzten Endes, als der Alte starb, fielen die Gläubiger über seine wenige Habe her. So gelangte die Lampe an einen geizigen, reichen Kaufmann. Der konnte sie gar nicht gebrauchen; denn er besaß sogar welche aus Gold. Und er hatte andere, mit schönen Ornamenten verzierte, die für ihn brannten. Aber seine Habgier trieb ihn dazu, alles an sich zu reißen, was er bekommen konnte. Er war als Blutsauger der Armen in Basra verschrien. Ihm wollte ich um keinen Preis einen Wunsch erfüllen. Ich bat Allah, er möge mich davor bewahren. Und ich war völlig zufrieden, als man meine Kupferlampe eines Tages ins Warenlager trug und dort vergaß.“
Der Dschinni blickte Ben in die Augen, als erwartete er Zustimmung von ihm, doch der fragte nur: „Und … was geschah dann?“
„Tagein, tagaus stand die Wunderlampe nun im Lager neben der Tür und verstaubte immer mehr“, setzte der Dschinni seine Erzählung fort. „Ich weiß nicht mal mehr, wie viele Jahre vergingen. Schon bereute ich, dass ich es mir gewünscht hatte. War es nicht dumm von mir, zu wünschen, vergessen zu werden? Ich musste doch nur einen Wunsch erfüllen. Was konnte schon Großartiges dadurch geschehen? Der habgierige Kaufmann würde nur mehr Hab und Gut besitzen wollen. Und es wäre doch alles für ihn verloren, wenn auch ihn der Tod zu sich holte. Er würde vergehen wie sein Hab und Gut. Doch ich wäre frei … unendlich frei!“
Der Dschinnjunge sah den Menschenjungen an und überlegte: Würde er es verstehen? Ben hingegen war sichtlich verlegen, schlug die Augen nieder und war einen Moment lang in sich versunken. Dann stellte er fest, nachdem er seinen Blick wieder auf den Dschinni gerichtet hatte: „Du hast dich nicht verraten!“
Die Blicke beider trafen sich, ihre Augen begannen zu leuchten. Dann fügte Ben noch scherzhaft hinzu: „Sonst wärst du ja jetzt auch gar nicht hier, nicht wahr?“
Der Dschinni, sichtlich erleichtert, erzählte weiter: „Eines Nachts kamen zwei Räuber ins Warenlager. Sie zündeten meine Lampe an. Es war noch ein Rest Öl übrig geblieben. Ich machte, dass sie besonders hell brannte, damit die beiden alles Wertvolle finden und rauben konnten. Nur die Wunderlampe ließen sie zurück. Vor Wut warf der Kaufmann sie daraufhin auf die Straße. Davon ist die erste Beule zurückgeblieben. Eine Karawane, die durch die Stadt zog, fand sie am selben Tag noch und nahm sie mit. In einer Karawanserei vor der großen Wüste wurde sie mit Öl aufgefüllt und leuchtete dem neuen Besitzer und seinen Freunden, während sie speisten und Geschichten erzählten. Als sie aber eines Morgens alle aufbrachen, vergaßen sie sie. Der Wirt, ein ehrlicher Mensch, trug mich in seine Vorratskammer. Er wollte mich meinem letzten Besitzer zurückgeben, wenn die Karawane auf ihrem Rückweg wieder haltmachte. Aber diese kam nie mehr. Nach vielen Jahren zog ein neuer Wirt ein und stellte meine Lampe, inzwischen unansehnlich, in eine dunkle Ecke. Er besaß eine bessere, doch wegwerfen wollte er meine noch nicht.
Oh Allah, keinen Widerspruch gibt´s gegen deinen Spruch und deine Allmacht, denn nicht hast du Rede und Antwort zu stehen für dein Tun, und du hast Macht über alle Dinge!“ Der Dschinni machte eine tiefe Verbeugung bei diesen Worten und sah darauf demütig zur Kellerdecke empor.
„Mich hatte das Schicksal hart getroffen“, sagte der Dschinnjunge betrübt, als er sich wieder Ben zuwandte. „Es war wohl bestimmt, dass mich niemand aus meinem Gefängnis befreien sollte. Und es wurde in der Folgezeit weit schlimmer, als ich es damals ahnen konnte. Irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, wurde die Karawanserei von plündernden Arabern überfallen, ausgeraubt und niedergebrannt. Meine Wunderlampe entdeckten sie nicht. Sie lag am Boden, völlig verstaubt in einer Ecke. Es war keine glänzende Stelle mehr an ihr.“
„Ist dir nichts passiert, als das Haus brannte?“ Ben war vom Leid des Dschinnjungen gerührt und bedauerte ihn.
„Nein“, antwortete der Dschinni, „Allah hielt seine schützende Hand über mich.“ Er rutschte darauf vom Sessel auf den Boden, kniete sich hin, und während er seine Arme zur Decke streckte und den Blick hob, rief er: „Es gibt keine Macht und keine Kraft außer bei Allah, dem Hohen und Erhabenen!“ Worauf er sich mehrmals verbeugte.
Diese Verbeugungen verwunderten Ben immer wieder. Welcher Sinn darin lag, war ihm ein Rätsel. Er traute sich aber nicht, den Dschinni danach zu fragen.
Nachdem der Dschinni einen Moment lang noch still verharrte, sah er Ben wieder in die Augen, setzte sich in den Sessel und erzählte von Neuem: „Es begann für mich eine unglückliche Zeit. Eine endlose Zeit. Die Mauern der Karawanserei stürzten ein, die Steine verwitterten. Der Wind wehte den heißen Wüstensand in die Ruine und deckte alles zu. Traurig war ich darüber, dass ich das Los so vieler Dschinn teilen müsste: Für ewig in der Wunderlampe gefangen. Verschollen, vergessen in der Unendlichkeit der Zeit. Dann, ich hatte alles Maß der Zeit verloren, wurde mir durch einen … ihr sagt wohl, Archäologen, mein Schatz geraubt. Ich habe dir doch zu Beginn davon erzählt. Er war in einer Ruine auf einer Oase, weit von mir in der Wüste, vergraben. Ich konnte nichts dagegen tun, weil ich unter Trümmern und Wüstensand in der Lampe gefangen saß.
Wieder vergingen unzählige Jahre, in denen ich betrübt war wegen meines gestohlenen Schatzes. Da schwor ich bei Allah, demjenigen die Hälfte davon abzugeben, der mich aus der Lampe befreite. Denn wenn ich frei wäre, würde ich mir schon mein Eigentum zurückholen, ganz gleich, an welchem Platz der Welt es sich auch befinden würde. Dann kam der Tag, an dem ich auf Befreiung hoffen konnte: Ein weißer Europäer war mit einer Handvoll Araber angereist, um den Wüstensand nach Schätzen aufzuwühlen.“
„Ein Deutscher in Safarikleidung und Tropenhelm?“, fragte Ben.
„Ja … jedenfalls ein verrückter Mann, denn er hoffte, in der Ruine der Karawanserei wertvolle Krüge, Vasen und andere Dinge auszugraben. Neben einer Menge Scherben fand er die Wunderlampe. So gelangte ich in das Haus, wo du mich gefunden hast. Bei Allah! Der einfältige Mann, er war seinem Schatz zum Greifen nahe und spürte es nicht. Mühsam setzte er die gefundenen Scherben zusammen, säuberte und putzte den so wiederhergestellten Hausrat. Er glaubte, Wertvolles in den Händen zu haben. Aber dem wahrhaft Wertvollen, der kupfernen Lampe, schenkte er keine Beachtung. Das verbeulte Ding missfiel ihm. Darum schob er es von einer Ecke in die andere ...“
„Und zum Schluss bist du in der Truhe im Keller gelandet“, ergänzte Ben.
„Wo du mich gefunden und errettet hast. Dafür sei dir, du mein Erhab ... Ben, Dank auf Ewigkeit! Doch nun ist es an der Zeit, mir die Freiheit zu geben. Sage mir deinen Wunsch!“ Der Dschinni nahm wieder die ergebene Haltung vor Ben ein.
„Du sollst dich nicht vor mir verbeugen“, sagte Ben. „Ich will das nicht! Ich bin dein Freund. Ich werde dir auch ohne deine ständigen Verbeugungen helfen. Zuerst muss ich natürlich mit meinem Freund Fabian darüber sprechen. Schließlich haben wir beide dich gefunden. Ich sehe ihn aber erst morgen wieder. Bis dahin musst du dich gedulden.“
Ohne noch ein weiteres Wort abzuwarten, löste sich der Dschinni in blauen Dunst auf.
Ben war es recht so. Er nahm den Lappen, mit dem er begonnen hatte, seine Lampe zu reinigen, und wickelte sie darin ein. So wollte er sie in der Schultasche am nächsten Tag mit in die Schule nehmen.
5. Am nächsten Morgen
Am nächsten Morgen wartete Fabian vor der Schule. Ben sah ihn schon von Weitem ungeduldig hin und her laufen. Etwas Besonderes musste vorgefallen sein, denn immer dann war der Freund völlig aufgelöst.
Sie hatten sich nicht mal richtig die Hand gegeben, da platzte es aus Fabian heraus: „Stell dir vor, Ben, die Decke ist total eingefallen!“
„Was für ´ne Decke?“
„Na, die Decke im Keller ...“, stotterte er. „Du weißt schon! Wo wir gestern waren ... In der Villa. Dort, wo die Truhe steht. Mein Vater war gestern Abend noch mit mir mit dem Auto hingefahren …“
„Ich hab´ mir schon so ´was gedacht“, unterbrach ihn Ben. „Und?“
„Nichts und!“ Fabian spürte den Vorwurf. „Wir sind nicht mehr ´reingekommen. Der Schutt hat sogar die Tür aufgedrückt. Wahrscheinlich haben wir sie gestern nicht eingeklinkt. Bestimmt ist alles futsch!“
„Na, dann brauchen wir uns wenigstens nicht mehr drum streiten“, erwiderte Ben schadenfroh.
„Wieso?“ Fabian sah ihn überrascht an.
„Ach, nur so!“, meinte Ben.
„Aber nach Trödelsachen suchen wir doch heute noch in der Villa, oder?“
„Ja, natürlich.“ Ben sagte es nur so hin. Im Moment war ihm anderes wichtiger - sein Erlebnis vom Vorabend. „Du, Fabian, ich muss dir was sagen. Die Kupferlampe …“
„Ach, das beulige Ding aus der Truhe. Das kannst du wegschmeißen. Dafür kriegen wir sowieso nichts von deinem Onkel. Was soll der damit anfangen?“
„Das kommt überhaupt nicht infrage!“ Ben hätte noch mehr gesagt, aber es klingelte zum Unterrichtsbeginn. Beide hatten Mühe, noch vor dem Erscheinen des Lehrers ihre Plätze in der Klasse einzunehmen.
Während der Unterrichtsstunde startete Ben einen zweiten Versuch, Fabian von der Wunderlampe zu erzählen. Aber der winkte nur ab. Auch in den kleinen Pausen bot sich keine Gelegenheit, ihn allein zu sprechen. Als Hans-Dampf-in-allen-Gassen, der er nun mal war, musste Fabian überall dabei sein, überall mitreden. So blieb Ben nur die große Pause.
Auf dem Schulhof führte Ben den Freund etwas abseits von den anderen Mitschülern. Fabian wunderte sich, weil Ben seine Schultasche mitgenommen hatte und fragte ihn, was er damit wolle; bekam aber statt einer Antwort die mit dem Lappen umwickelte Kupferlampe vor die Nase gehalten.
„Was soll das?“, fragte Fabian brummig. „Warum hast du das Ding mitgeschleppt? Ich habe dir doch gesagt, was wir damit machen.“
Ben ärgerte sich, dass Fabian so selbstverständlich voraussetzte, alles würde so getan, wie er es für richtig hielt. „Ich habe gar nicht die Absicht, die Lampe meinem Onkel zu geben“, sagte er verärgert. „Ich habe dir schon gestern gesagt, dass sie antik ist.“
Fabian lachte.
„Ja!“, sagte Ben heftig. „Sie ist schon über tausend Jahre alt.“
„Du spinnst!“ Fabian lachte wieder.
Verärgert packte Ben ihn am Arm, rüttelte ihn und sagte bissig: „Mensch! Fabian! Kannst du denn nicht mal einen Moment lang zuhören? Ich wollte es dir schon heute Morgen sagen. Unsre Kupferlampe ist eine echte Wunderlampe … mit einem echten Dschinn drin. Wie Aladins Wunderlampe …“
„Du hast wohl ´nen Vogel! Willst mich verkohlen, was?“ Fabian riss ihm die Lampe aus der Hand und warf sie zu Boden.
Während Ben sie aufhob, überlegte er, was er falsch gemacht hatte. Eigentlich hatte er erwartet, Fabian würde sich darüber freuen. „Denkst du wirklich“, sagte er enttäuscht, „dass ich dich, als meinen besten Freund, verkohlen würde? Mensch, Fabian! Ich hab´s erst auch nicht geglaubt, als er vor mir stand. Gestern Abend. Im Keller. Ich dachte, ich träume. Aber er ist tatsächlich da. Ein Dschinnjunge! Leibhaftig stand er vor mir, wie du jetzt. Und er hat mir seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Wie er der Geist der Lampe geworden ist. Dass er uns einen Wunsch erfüllen will. Wir sollen sogar die Hälfte seines Schatzes bekommen ...“





























