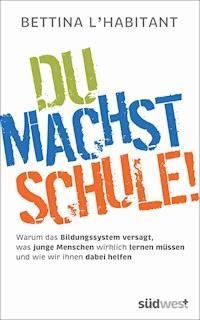
14,99 €
Mehr erfahren.
Die längst fällige Wertediskussion in der Bildungsdebatte
Das staatliche Bildungssystem ist am Ende: Allerorten liest man, die Elternhäuser seien überfordert, die Schulen nicht mehr zeitgemäß und die Schüler schlecht ausgebildet – und wenn es darum geht, welche Werte und Inhalte junge Menschen auf die Welt von morgen vorbereiten, ist die Gesellschaft in tiefe Resignation verfallen. Das hat fatale Folgen für die Heranwachsenden: Mit unbrauchbaren Konzepten im Kopf verlassen sie die Schulen, leiden unter ihrer Orientierungslosigkeit. Weder Schulzeit noch weiteren Lebensweg bringen sie mit ihrem eigenen aktiven Handeln in Verbindung.
In ihrem Buch zeigt die Lehrerin und Persönlichkeitstrainerin Bettina L’habitant Wege aus der Bildungskrise. Im Mittelpunkt steht dabei die Hilfe zur Selbsthilfe: Denn nur mutige Schüler haben Freude am Leben, kennen ihre Ressourcen und Stärken, versöhnen sich mit ihren vermeintlichen Schwächen, sehen optimistisch in die Zukunft und wissen: Ich kann es schaffen. Und genau das brauchen unser Schulsystem und unsere Gesellschaft: Heranwachsende, die an sich glauben, ihre Persönlichkeit akzeptieren und ihr Leben selbst in die Hand nehmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
FÜR NORBERT
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Schule ist ein Thema, das mir am Herzen liegt. Ich selbst habe diese Institution zuerst als Schülerin, später als Lehrerin und auch als Mutter dreier Kinder aus verschiedenen Blickwinkeln erlebt. Und ich muss sagen: Unsere Schule ist lebensfremd und nutzlos. Früher wie heute lassen sich die Lehrer, die begeistert ihre Berufung leben, an einer Hand abzählen. Schulen, in denen die Lehrer mit ihren Schülern auf Augenhöhe kommunizieren, Schüler grandioses Sozialverhalten entwickeln, Wertschätzung und Achtsamkeit im menschlichen Miteinander geübt werden, sind winzige Lernoasen in einer Wüste.
Nach wie vor bestimmen an den allermeisten Schulen Langeweile und Bevormundung den Alltag. Eigenständiges Denken wird allen Beteiligten ausgetrieben. Schüler verschlafen kostbare Lebens- und Lernzeit. Wenn sie schließlich mit einem Abschlusszeugnis die Schule verlassen und vor dem Abenteuer Leben stehen, dann wissen sie vor allem eines nicht: Wer bin ich, was kann ich, was will ich.
Aber wieso tragen wir ein Schulsystem mit, das dem von Natur aus neugierigen und lernwilligen Menschen das Lernen abgewöhnt? Ein System, das Individualität und Selbstbestimmung unterdrückt? Wir können uns doch wahrlich nicht darüber beklagen, dass das Thema Bildung zu wenig beachtet wird: Eine Reform jagt die andere, Schule steht ständig im Mittelpunkt von Diskussionen – doch es verbessert sich rein gar nichts. Wäre nicht allmählich die Frage angebracht, ob das Umgestalten unseres Schulsystems endlich im Leben stattfinden muss anstatt an den Schreibtischen bürokratischer Entscheider?
Ich denke, genau das ist der Punkt: Wir selbst sind gefragt! Eltern, Lehrer und Schüler. Wir selbst müssen Schule machen.
Wir brauchen ein Schulsystem, in dem wir junge Menschen dazu befähigen, sich ihre Lebensziele selbst zu stecken und zu erreichen. Bildung ist erst dann wertvoll, wenn der Mensch etwas damit anfangen kann. Und genau das muss Schule leisten: die Lust am Lernen aufrechterhalten und vorantreiben, denn jeder lernt gern! Ich sehe es als meine Berufung als Lehrerin, junge Menschen dabei zu begleiten, wie sie über sich selbst hinauswachsen und sich mutig auf ihren Lebensweg machen.
Damit uns das gelingt, müssen wir alle etwas beitragen. Ich hoffe, dieses Buch ist ein Teil davon.
Ihre Bettina L’habitant
Was Schule heute bedeutet
Kaum etwas regt Eltern, Lehrer, Schüler und viele andere Menschen hier und heute so auf und wird derart kontrovers und zuweilen auch hilflos diskutiert wie das Thema Schule. Um die Schule zu begreifen, die wir hier und heute kennen, werfen wir auch einen kurzen Blick zurück: Welche Aufgabe hatte Schule früher – und welche hat sie heute?
Ein erster Blick in unsere Schulen
Wie erleben Schüler die Schule? Eine Neuntklässlerin beschreibt ihren Start in eine beliebige Schulwoche so:
PRAXISBEISPIEL ______________________________________
Montagmorgen, 8 Uhr. Der Tag beginnt mit zwei Stunden Religion. Die Lehrerin ist noch nicht da, die Schüler lärmen durch den Schulflur. Endlich hastet sie herbei. Während sie die Tür aufschließt, nuschelt sie eine Entschuldigung, dass ihr Auto nicht angesprungen sei. Man begrüßt sich, die Lehrerin geht die Anwesenheitsliste durch. Schon sind etwa zehn Minuten vergangen.
Der Unterricht könnte nun endlich beginnen. Aber die Lehrerin redet aus einem Zufallsgespräch heraus erst einmal 15 Minuten lang über Käpt’n Blaubär. Anschließend redet sie weitere 20 Minuten über das »Nichts«, das die Schüler immer unter dem Tisch haben und tun (»Was machst du da unter dem Tisch?« – »Nichts.«).
Mehr als eine halbe Stunde der Unterrichtszeit ist inzwischen vorbei – und schon geht’s tatsächlich los! Die Lehrerin erklärt weitere 20 Minuten die Aufgabe des heutigen Unterrichts: Die Schüler sollen in Gruppen über ein bestimmtes Thema diskutieren.
Und die Schüler diskutieren. Über das vergangene Wochenende, über die Planung des Nachmittags oder des kommenden Wochenendes ...
Nach zehn Minuten wird die Aufgabe in der Klasse besprochen. Die Schüler denken sich rasch Antworten dazu aus, da sie ja gar nicht über das Thema diskutiert haben. Die Lehrerin beantwortet die gestellte Aufgabe schließlich selbst in einem 15-minütigen Vortrag.
Es ist geschafft: Die erste Doppelstunde ist beendet.
Ergebnis der Stunde: Die Schüler sind jetzt schon ermüdet, diese 90 Minuten haben niemandem etwas gebracht.
Weiter geht’s mit 90 Minuten Mathematik. Als der Lehrer nach der Pause ins Klassenzimmer kommt, schreien, diskutieren und blödeln die Schüler herum. Der Lehrer stellt seine Sachen ab und wartet, bis die Klasse irgendwann von selbst leise wird. Gemeinsam mit den Schülern kontrolliert er nun die Hausaufgaben (zwei Mathematikaufgaben). Nach 35 Minuten und mehreren Unterbrechungen ist das endlich vollbracht.
Ein Schüler hat eine Frage zu einer anderen Aufgabe, der Lehrer erklärt auf unverständliche Art, wie man beim Lösen dieser Aufgabe vorgehen muss. Danach sind die Schüler noch verwirrter als vorher. Der Lehrer ist genervt, bricht das Thema und die Erklärung ab. Die Schüler sind darüber frustriert. Aber egal: Der Lehrer beginnt jetzt mit einem neuen Thema, obwohl das alte noch nicht verstanden wurde. Die Schüler schalten resigniert ab und unterhalten sich miteinander, statt zuzuhören. Der Lehrer ahndet das mit Strafen, er schreibt Schülernamen ins Klassenbuch und verteilt Extraaufgaben.
Ergebnis der Stunde: Der Lehrer ist sauer, die Schüler sind frustriert und gelangweilt, ein im Unterricht »behandeltes« Thema bleibt unverstanden, ein neues Thema fängt schon mit Unlust der Schüler an – auch dieses wird kaum einer der Schüler am Ende der Unterrichtseinheit wirklich verstanden haben.
Wie haben Sie sich beim Lesen dieser Beschreibung gefühlt? Spüren Sie auch die Sinn- und Hoffnungslosigkeit darin? Vier Unterrichtsstunden sind vorbei. Nichts ist gewonnen, eine Menge verloren – Lebenszeit, Begeisterung, Motivation ...
Aber warum nur funktioniert der Unterricht an unseren Schulen so und nicht anders? Warum sind Schüler und Lehrer nicht von der Freude am Lehren und Lernen und von Begeisterung getragen?
Mögliches Ideal versus klägliche Realität
Im Internet las ich vor einiger Zeit einen Kommentar zur Fußballmannschaft Borussia Dortmund. In dem Beitrag wird beschrieben, dass der Trainer Jürgen Klopp ein einzigartiges Team geschaffen habe, das für Teams aller Art, ob im Berufs-oder Freizeitleben, Vorbildfunktion hat. Die Basis: grandiose Leistung gepaart mit großem Teamgeist sowie Arbeitsbedingungen, die mittlerweile im Leben eines jeden Bürgers rar geworden sind.
Ähnlich funktionierende Gemeinschaften kenne ich als Geigerin aus der Musikwelt. Schauen wir uns einmal an, unter welchen Voraussetzungen der Arbeit in einem Swing-Orchester nachgegangen wird, und übertragen dann diese Erkenntnisse auf gängiges Berufs- und Schulleben. Ref 1
EXTRA ______________________________________
Produktives Ideal: So funktioniert einSwing-Orchester
Die Mitglieder sind Vollprofis auf ihrem Instrument. Jeder Einzelne lebt seine Talente und trainiert mit hoher Leistungsbereitschaft, Geduld und Fleiß seine Fähigkeiten. Für den Job muss sich jeder Musiker einem strengen Bewerbungsverfahren unterziehen. Bei der Auswahl sind alle Orchestermitglieder stimmberechtigt. Sie ermitteln ihren neuen Band-Kollegen aufgrund seiner musikalischen Qualitäten, seines Charismas und nicht zuletzt auch aus Gründen der Sympathie. Denn entscheidend für den Erfolg eines Ensembles ist, dass sich der Bewerber in die Gruppe integriert und gleichzeitig durch sein individuelles Spiel dem musikalischen Gruppenerlebnis die kleinen »Sahnehäubchen« aufzusetzen vermag. Je besser ein Ensemble aufeinander eingespielt ist und für das gewisse Etwas im Klang sorgen kann, umso größer wird sein Erfolg sein. Also ist sich jeder Musiker seiner enormen Verantwortung als Teamplayer und gleichzeitig als Solist bewusst.
Eine Top-Leistung kann nur erbracht werden, wenn die Menschen einander respektieren und sich als gleichwertig betrachten. Wir haben es bei dieser Gruppierung mit einem auf Einfühlungsvermögen und non-verbaler Kommunikation basierenden, perfekt eingespielten Team zu tun, welches auf die individuelle Bestleistung jedes Einzelnen angewiesen ist. Jede Art von Konkurrenzkampf und das Ausleben egozentrischer Befindlichkeiten würden unmittelbar den hohen Verdienst des Orchesters schmälern. Das Wesen des Erfolgs liegt darin begründet, alles zu geben, ohne dem anderen auf die Füße zu treten. Je besser das gelingt, desto erfolgreicher ist das Team.
Versetzen wir uns jetzt einmal gedanklich an den Arbeitsplatz in einem größeren Unternehmen. Welche Arbeitsbedingungen finden wir dort vor? Viele schimpfen auf den nächsthöheren Chef und schleppen sich morgens mies gelaunt an den Arbeitsplatz. Grabenkämpfe unter den Kollegen sind keine Seltenheit. Die Arbeit wird häufig ohne Freude erledigt. Der Verdienst ist knapp, die gegenseitige Wertschätzung gering, Anerkennung für erbrachte Leistung gibt es selten. Ein Lob wird meist nur zum Manipulieren genutzt: »So toll, wie Sie das machen, Frau Meier, kann das hier keiner. Können Sie das hier nicht auch noch bis morgen erledigen?«
Ob einer viel oder wenig Eigenleistung erbringt, ist eher nebensächlich, der eine mag sich nicht für »die da oben« kaputt schuften, der andere lässt sich die Arbeit aufs Auge drücken und rackert sich für drei ab, ohne dass es sich auf seinem Gehaltskonto auswirken würde. Mit zunehmendem Aufstieg auf der Karriereleiter kann hier und da einer dem ganzen Hickhack entfliehen und sich eitel darin sonnen, doch etwas Besseres zu sein. Dafür muss er heutzutage nicht zwingend etwas können, er muss in erster Linie gut wirken und sich zu verkaufen wissen. Er muss die Karriereleiter lediglich so erklimmen, dass er Konkurrenten »wegbeißen« kann, ohne an öffentlicher Reputation einzubüßen. Dabei hilft ihm ein cooles, lockeres Auftreten. Konflikte werden über andere ausgetragen, um nicht das eigene Image zu gefährden. Der erfolgreiche Karrierist wird in erster Linie seine Fähigkeiten als guter »Schachspieler« unter Beweis stellen: Indem er seine Mitmenschen als Schachfiguren benutzt und gegeneinander antreten lässt, sichert er sich seine Pfründe als glorreicher Dritter, wir kennen doch alle das Sprichwort »Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte«.
Was an menschlichen Werten dabei zwangsläufig auf der Strecke bleiben muss, sind der Respekt, die Achtung und die Wertschätzung für den anderen. Jegliche Art menschlicher Beziehung am Arbeitsplatz muss auf Beziehungslosigkeit ausgerichtet werden, denn Beziehung verpflichtet: Wer könnte sonst morgens noch unbeschwert in den Spiegel schauen, wenn sein Gewissen ihn daran erinnern würde, mit welch unlauteren Methoden er menschliche Würde verletzt hat, nur um selbst weiterzukommen! Auch muss der Aufstrebende für die notwendige Distanz sorgen, damit er sich die Mitarbeiter besser vom Hals halten und ihm niemand am Stuhlbein sägen kann, denn die Nachrücker lauern an allen Ecken und warten nur auf ihren Moment.
Dass dieses emotional kalte Verhalten mit ins Privatleben getragen wird, verwundert nicht. Wer unter Karriere versteht, andere aus dem Weg zu räumen, verliert die Würde, begräbt sein Gewissen und stumpft gegenüber seinen Mitmenschen ab. Dummerweise scheint dieses Menschenbild zum nachahmenswerten Vorbild geworden zu sein: Je aalglatter die Fassade, je empfindungsloser der Mensch und je nichtssagender seine Sprüche sind, desto wichtiger wird man wohl.
Bringen wir gedanklich nun dieses ungünstige Arbeitsumfeld mit der soeben dargestellten positiven Orchesteratmosphäre in Zusammenhang: Was glauben Sie, zu welchen Ergebnissen das Ensemble unter den geschilderten Arbeitsalltagsbedingungen überhaupt noch käme? Und welchen Erfolg könnte dagegen ein Unternehmen für sich verbuchen, wenn die Arbeitnehmer ein Berufsleben unter den beschriebenen »Orchesterbedingungen« vorfänden?
Soziales Miteinander in der Schule
Last but not least beenden wir unsere Gedankenreise, indem wir uns wieder in eine Alltagssituation im Klassenzimmer begeben – als ein Schüler unter vielen: Abhängig von den verschiedenen Chefs, genannt »Lehrer«, sitzen wir mehr oder weniger unsere kostbare Lebenszeit ab. Schule bedeutet für Kinder und Jugendliche heute vor allem Langeweile, Sinnlosigkeit, vergeudete Lebenszeit.
Im schlimmsten Fall auch Angst, Demütigung und
Entwürdigung.
Selbstredend finden wir dort wenig von den im Swing-orchester gelebten Werten wie Begeisterung, Talentförderung, persönliches Wachstum, gegenseitige Wertschätzung, Ideenreichtum, Kreativität, Spaß und Lachen. Sondern stattdessen lähmende Angst und Frustration.
Die Schule ist ein Abziehbild unserer Gesellschaft. Sie gaukelt uns vor: Je passgenauer sich der Einzelne in die Gemeinschaft integriert, umso besser. Konkurrenz läuft in unseren Schulen zwar schon genauso ungesund ab wie in der späteren Arbeitswelt – jedoch noch viel verdeckter. Schule gaukelt das Traumbild einer harmonischen Schafherde vor, in der Angepasstheit, Einmütigkeit und Gleichheit wertbestimmend sind. Außenseiter werden durch Manipulation und Anpassungsdruck auf die richtige Spur gebracht. An allen Ecken und Enden wird subtiler Druck ausgeübt, um jedes individuelle Aufmucken zu unterdrücken.
Damit begeht Schule ein Verbrechen! Denn je mehr sie den Heranwachsenden vermittelt, dass nur derjenige weiterkommt, der brav mitmacht, umso mehr Unmündige zieht sie heran, die später im Berufsleben für die geschickten Karrieristen ein gefundenes Fressen sind.
Ist dies vielleicht gar das Ziel unserer heutigen Schule? Betrachten wir das Ganze am besten einmal aus verschiedenen Blickwinkeln. Denn so lässt sich vielleicht eine Antwort darauf finden, warum in unserem Bildungssystem immer nur Löcher gestopft werden, anstatt es von Grund auf zu sanieren. Ein sehr interessanter Gesichtspunkt dabei ist die Frage nach der Geschichte unserer heutigen Schule.
Ein kurzer Exkurs in die Geschichte der Schule
Schon etwa 35000 Jahre vor Christus finden sich erste Strukturen, die auf die spätere Schule hindeuten. Eine tatsächliche Schule wurde zum ersten Mal etwa 2000 bis 1500 vor Christus erwähnt. Der Unterricht in diesen frühesten Schulen bezog sich zunächst auf das Lesen und Schreiben, später kamen dann noch das Studium der Mathematik, Literatur, Ästhetik, Ethik und Logik hinzu. Schulbildung blieb sehr lange einer elitären Schicht vorbehalten.
Mit dem Sieg des Christentums wurde die Kirche zum entscheidenden Träger des Bildungswesens. Sie bewahrte das Wissen der Antike und vermittelte das christliche Gedankengut in ganz Europa. Da die Bildung vor allem durch die Beschäftigung mit den Weisheitsbüchern der Bibel erfolgte, sollten die Schüler in erster Linie dazu erzogen werden, von Geboten und Verhaltensregeln geprägt in göttlichem Einklang zu leben. In den Dom-, Kloster-, Pfarr- und Küsterschulen wurde ausschließlich der Klerikernachwuchs ausgebildet. Lediglich die Küsterschulen durften auch Kinder aus ärmeren Bevölkerungsschichten besuchen – zwar ein früher Beleg dafür, dass Schule zumindest ein Stück weit den sozialen Aufstieg ermöglichte, aber auch ein deutlicher Hinweis darauf, dass sie sich religiösen und weltanschaulichen Richtungen unterwarf.
Im 13. Jahrhundert entstanden mit zunehmender Entwicklung der Städte auch die ersten städtischen Schulen in Europa. Der städtische Rat nahm starken Einfluss auf diese Schulen, indem er die Schulmeister einstellte und besoldete. Immer mehr verdrängten so die weltlichen Lehrer die geistlichen Bildungsträger, und damit entstand die Grundlage der späteren deutschen Volksschule. Die Erziehung an den städtischen Schulen war streng. Gehorsam, Fleiß, Ordnung und Sauberkeit waren die Werte, die hier vermittelt werden sollten. Mit Strafen wie Ruten- und Stockschlägen, Handtatzen oder dem langen Knien auf einem Holzscheit versuchten die Lehrer, ihre Vorstellungen von Disziplin durchzusetzen – es ging also auch bei der frühen staatlichen Pädagogik um die Vermittlung weltanschaulicher Denkweisen. Neben der Erziehung zum gläubigen Christen und gehorsamen Untertanen sollten die Kinder außerdem die nötigsten Grundkenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen erhalten.
Von der klerikalen Elite zur staatlichen Pflichtveranstaltung Im Mittelalter verbreiteten sich Ideen und Nachrichten zunächst noch vor allem durch das gesprochene Wort, die Predigt, durch handgeschriebene Texte und gemalte Bilder. Mit der Gutenbergschen Erfindung des Buchdrucks wurde das gedruckte Wort und Bild zu einem Massenmedium – und so auch im Unterricht genutzt. Auf diese Weise konnten immer mehr Menschen schreiben und lesen lernen. Theologische Inhalte rückten zugunsten zeitgenössischer Themen in den Hintergrund. Unter dem Einfluss der Renaissance, des Humanismus und der Reformation erfuhr Schule in dieser Zeit eine stürmische Entfaltung.
Neue Ideen entstanden: Nun sollte Schule für alle da sein. Der Reformator Martin Luther ermahnte die Eltern eindringlich, sowohl Jungen als auch Mädchen zum Schulbesuch anzuhalten. Das Bewusstsein für die Individualität des Menschen rückte in den Blickpunkt des Schulalltags. Auch die neuen Werte der Aufklärung hinterließen ihre Spuren, und so wurde die Schule im Sinne von Kant und Descartes aufgeklärter und humaner. Auch in Deutschland gab es Bildungsreformen. In immer mehr Ländern wurde die Schulpflicht erklärt. Sie konnte sich unterschiedlich gut durchsetzen, da vor allem Kleinbauern die Kinder in den Familienbetrieben als Arbeitskräfte benötigten und nicht davon zu überzeugen waren, dass der Schulbesuch höhere Priorität haben könnte.
Mit der Einführung der Schultypen »Landschule«, »Bürgerschule« und »Gelehrtenschule« im 18. Jahrhundert war ein Schulsystem erfunden, das bis heute in unserem Bildungssystem nachwirkt.
Ziel und Zweck der Schulbildung hingen in diesen strukturierten Anfängen eng mit der Industrialisierung zusammen. Sowohl der moderne Staat als auch die Wirtschaft entwickelten einen immer größeren Bedarf an gut ausgebildeten Menschen – und genau diesen Bedarf sollte die staatliche Schule decken. Damit diente das staatliche Schulsystem von Anfang an den Interessen der Volkswirtschaft und nicht den Interessen des Individuums. Zugleich erließ der preußische Staat strenge Kriterien für die Anerkennung von Schulen und die Ausbildung der Lehrer. Immer stärker übernahm die Institution Schule Erziehungs- und Lenkungsfunktionen, um die Kinder im Sinne des Staates zu guten Untertanen zu erziehen. Somit war Schule zwar immer ein Spiegel der Gesellschaft, aber eben zugleich auch nie ein Ort der individuellen Selbstverwirklichung. Der Anspruch der Schule war nie, dem Individuum zu seiner persönlichen Entfaltung zu verhelfen, sondern es ging stets um die Ansprüche der Gesellschaft und den Bedarf der Industrie.
Aus dieser Tradition heraus spiegelt auch unser heutiges Bildungswesen einen bestimmten Stand der gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen wider, ebenfalls ausgerichtet an den Bedürfnissen der Wirtschaft. Und es ist im Grunde nichts Schlechtes, wenn die Schule junge Menschen auf die Belange der Wirtschaft vorbereitet. Aber tut Schule heute das überhaupt noch?
Wie Schule funktioniert
Kaum jemand ist zufrieden mit unserer Schule, so wie sie ist. Aber was genau läuft da falsch? Und wie könnte es verändert werden? Schauen wir genauer hin: Was vermittelt Schule heute den Kindern – vor allem aber: Wollen wir das genau so?
Wie unterschiedlich die Forderungen an die Schule auch immer sind: Einig sind sich alle bestimmt darin, dass Schule vorrangig die Aufgabe hat, junge Menschen für das spätere Leben vorzubereiten. Angesichts der überwältigenden Zahl von Schulabgängern, die offensichtlich nicht für ihr weiteres Leben vorbereitet sind, stellt sich die Frage nach den Gründen.
Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit
Deutlich mehr als früher muss heute jeder Einzelne schnell und flexibel auf politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen reagieren können. Damit liegt die erforderliche Kernqualifikation eines Menschen vor allem in seiner Fähigkeit und der Bereitschaft, sich ein Leben lang neuen Lernsituationen zu stellen. Und es stellt sich die Frage, ob die heutigen Bildungsideale und Inhalte schulischer Bildung diesem Anspruch einer veränderten Welt gerecht werden. Denn es geht nicht nur um bloße Arbeitsplätze – es geht heute darum, dass jeder einzelne Schulabgänger sich mit seinen Fähigkeiten weiterentwickelt, in einer Welt, die sich rasant verändert. Dass er sich eigenverantwortlich bewegt, ein selbstständiges Einkommen erzielt – und die Menschheit insgesamt ein Stück weiterbringt.
Schule bereitet nicht auf die Welt von morgen vor
Wenn heutige Schulabgänger in die freie Wirtschaft kommen, dann fragt man sich in so manchem Unternehmen, was die jungen Leute eigentlich all die Jahre in der Schule getan haben. Dies ist nachvollziehbar, angesichts von Berufsanfängern, die nicht wissen, wie die Mehrwertsteuer funktioniert oder wie man eine Wiedervorlage organisiert. Die Schule präsentiert sich gern als ein Ort des Lernens und der Erziehung, an dem junge Menschen auf ein zukünftiges Leben vorbereitet werden. Doch das ist nicht der Fall.
Die meisten Abiturienten haben keine Ahnung, wo ihre berufliche Zukunft nach der Reifeprüfung liegen könnte. Genauso wenig sind sie sich ihrer eigenen Stärken und Interessen bewusst. Der Schüler hat bis zu 13 Jahre auf Anweisung funktioniert, Klausurvorbereitungen wechselten sich mit wochenlangem Nichtstun ab. Denn sobald eine Arbeit geschrieben ist, pflegt sich in der Schule eine Riesenflaute breit zu machen. Ferien werden immer wieder mit wochenlangem Rumsitzen eingeläutet. Doch wer sich nur berieseln lässt, der lernt nichts. Und wenn er dann die Schule verlässt, hat er keinerlei Ahnung vom Berufsleben. Dann stolpert er in eine x-beliebige Ausbildung, ohne zu wissen, was er besonders gut kann. Oder unter allen Studienmöglichkeiten erscheint ihm ein BWL- oder ein Lehramtsstudium als das kleinste Übel. Und man kann sich gut vorstellen, welch motivierte Menschen wir anschließend im Berufsleben antreffen werden. Schlimmstenfalls sind das dann auch noch die zukünftigen Lehrer.
Es gäbe tausend Möglichkeiten, Schülern gleichbleibend attraktive Lernangebote zu unterbreiten. Sie könnten Präsentationen über ihre besonderen Leistungen erstellen, ihre Neigungen herausfiltern und in Form von Projektarbeiten aus diesen Interessen konkrete Job-Ideen kreieren, sich in Rhetorik schulen. Kurz gesagt: an sich arbeiten und sich entwickeln. Denn genau das zählt heute.
Die Gesellschaft hat sich gewandelt. Hohe formale Abschlüsse werden zwar oft als selbstverständlich erwartet – ohne Realschulabschluss ist kaum noch ein Ausbildungsvertrag zu bekommen, oft wird sogar Abitur verlangt. Schulabschlüsse sind aber lange nicht mehr ausreichend, um einen begehrten Ausbildungs-, Studien- oder Arbeitsplatz zu bekommen. Zunehmend erfahren das die Absolventen des Bildungssystems am eigenen Leib: Schulabschlüsse, ja sogar akademische Grade an sich genügen nicht mehr. Welchen Sinn also hat ein Bildungssystem, das sich beharrlich auf die Vorstellung versteift, lediglich eine akademische Ausbildung sei das erstrebenswerte Ideal? Wer die Welt außerhalb der Institutionen kennt, weiß genau: Beim Lernen geht es immer um den Nutzen. Lernen heißt, Fähigkeiten zu erwerben, aus denen sich auch in unserer komplexen Gegenwart konkret etwas machen lässt. Die Welt verändert sich, und zum Lernen gehört es, sich auf diese Veränderungen einzustellen und trotz des hohen Tempos unserer Zeit immer wieder Möglichkeiten zu finden, erfolgreich durchs Leben zu navigieren.
Aber was bringt Schule Schülern denn bei?
Wenn ein Schüler einen Schulabschluss wie die mittlere Reife oder das Abitur erreicht hat – wozu befähigt ihn das dann konkret? Was kann er nach der Schule wirklich? Was kann er anwenden von dem, was er gelernt hat?
Erfolg im Leben ist das, was folgt, wenn ich mir selbst folge. Dafür muss ich mich selbst kennen. Was habe ich denn im Laufe der Schulzeit über mich herausgefunden? Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich tun? Das sind die Fragen, die sich jeder Schulabgänger nicht erst mit dem Erhalt des Abschlusszeugnisses stellt und auf die er häufig keine Antwort weiß. Er hat wenig über sich erfahren. Ein Schulabgänger hat dann seine gesamten Schuljahre abgesessen und ist sich selbst fremd geblieben.
Was tun? Gut, dass es ein soziales Jahr gibt! Vielleicht bringt auch eine Auszeit in fremden Ländern die gesuchten Erkenntnisse. Und zur Not kann man vielleicht noch in einer kaufmännischen Ausbildung oder einem BWL-Studium unterkommen. Wenn alle Stricke reißen, kann man auch Lehrer werden, die werden immer gesucht und gut bezahlt.
Betrachten wir Schule noch einmal etwas genauer bezüglich der Zielsetzung, Heranwachsende auf das spätere Leben in der Gesellschaft allgemein und im Beruf im Besonderen vorzubereiten, dann drängen sich mir besorgniserregende Fragen auf. Ref 2
Ist Wissensvermittlung wichtiger als Persönlichkeitsentfaltung?
Vor einiger Zeit las ich einen Zeitungsartikel, in dem beschrieben wurde, wie auf einer Bildungskonferenz im Emirat Quatar Experten im Dezember 2010 über die Vermittlung von »Soft Skills« im Rahmen eines regelrechten Schulfachs diskutierten. Konkret ging es dabei um die Option, nach dem Vorbild von Australien und Singapur Schüler bereits in der Schule besser in den Schlüsselqualifikationen des 21. Jahrhunderts auszubilden. Weiter las ich, dass sich die nächste PISA-Studie 2012 mit dem Bereich »Problemlösungskompetenz« beschäftigen wird. Endlich tut sich etwas, dachte ich mir und wandte mich in der Bürgersprechstunde meiner Stadt umgehend an den Bundestagsabgeordneten meines Wahlkreises. Ich erzählte ihm von dem Zeitungsartikel und wie wichtig ich solch eine Entwicklung finde. Doch auf meine Frage an den Politiker, wie er sich vorstellen könne, dass persönlichkeitsbildende Angebote verstärkt in den Schulalltag mit einfließen, erntete ich von ihm verständnislose Blicke. Er erklärte mir, dass Schule in erster Linie ein Ort der Wissensvermittlung und nicht der Persönlichkeitsbildung sei.
Solche Aussagen machen mich ratlos – und auch wütend. Denn jeden Tag erlebe ich, dass sogar Schüler eines Gymnasiums Schwierigkeiten damit haben, sich verständlich auszudrücken, logisch zu denken, sich erreichbare Ziele zu setzen, Eigenverantwortung zu übernehmen, Lösungsstrategien zu entwerfen, mutig ein Referat zu halten, ein Selbstbild zu kommunizieren, mit Neugier eigene Grenzen auszutesten, eine eigene Meinung zu vertreten, konstruktive Kritik zu üben, einem Menschen gedanklich zu folgen. Schüler wissen keine Antwort auf die Fragen: Wer bin ich, was kann ich, was will ich? Wie erreiche ich das, was muss ich dafür tun? Nicht etwa, weil sie zu dumm dafür wären, sondern weil es schlicht und ergreifend nicht mit ihnen trainiert wird.
Sich zu entdecken braucht Zeit, Geduld, Übung und einen wertschätzenden Rahmen. Dafür scheint mir Schule ein geradezu idealer Ort zu sein! Hier könnten junge Menschen beim Lernen etwas über sich herausfinden und entdecken, denn jeder Schüler ist wissbegierig, lernwillig und neugierig. Doch das reale Bild ist ein trostloses. Wir sehen, wie unzureichend Schüler an sich glauben. Wir erleben, dass sie Angst vor Fehlern und keine Lust zum Lernen haben. Sie haben Angst, dass man sich über sie lustig macht, sie für doof hält, Angst davor, nicht dazuzugehören. Wie soll denn in solch einer Atmosphäre der Mensch wachsen können?
Aber mit Persönlichkeitsbildung kann gar nicht früh genug begonnen werden. Eine Persönlichkeit formt sich ganz automatisch, und sie wird in ihrer Gesamtheit immer dann gestärkt, wenn sie eigenständige und wertfreie Lernerfahrungen machen und sich ausprobieren kann. Es ist wie mit dem Laufenlernen: Man läuft, fällt hin, steht auf, läuft weiter, fällt hin, steht wieder auf ... und eines Tages klappt es. Immer, wenn ein Mensch sich etwas selbst erarbeiten darf, kann er voller Stolz auf seine Errungenschaften blicken.
Alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen.
(Aristoteles)
Und was tut Schule? Sie dirigiert den Lernprozess. Einem Heranwachsenden, dem man keine Eigenständigkeit zumutet, dem wird die Hilflosigkeit in die Wiege gelegt. Kein Mensch muss zum Lernen animiert werden. Lernen vollzieht sich automatisch, wird nur durch Reglementierung und Lobhudelei behindert. Deshalb muss Schule ein Ort werden, an dem der Schüler ermutigt wird: Er muss erfahren, dass er an den Herausforderungen wächst und dass es sich folglich lohnt, Frustrationen auszuhalten. Erst dann kann er sich zu einer starken Persönlichkeit entwickeln. Mehr denn je brauchen junge Menschen wieder den Mut, sich etwas zuzutrauen und eigene Lebensziele zu entwerfen. Und dafür wäre Schule doch tatsächlich eine ideale Plattform. Ref 3
Wie Wissen vermittelt wird
In der Schule wird Wissen vor allem abstrakt über die Sprache vermittelt. Gelernt wird durch mühseliges Abspeichern dieses Wissens im Gedächtnis. Das ist so fern jeder emotionalen Eigenbeteiligung, wie es monoton und öde ist. Zudem glaubt der Lehrende zu wissen, was Schüler wissen müssen, der Lehrplan gibt die Ziele vor. Doch wer nach Plan unterrichtet, verliert den Menschen aus dem Auge. Und im Schulalltag sieht das dann so aus: In Mathe wird jeder Satz so oft wiederholt, bis auch der Letzte ihn nachplappern kann. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich diejenigen im Tiefschlaf, die ihn schon beim ersten oder zweiten Mal begriffen haben.
In Erdkunde oder Physik wird der Stoff häufig durch Vorlesen aus dem Buch und Nachbeten der Texte vermittelt. Eine weitere beliebte Methode der Wissenspräsentation sind Referate. An sich ja sinnvoll – aber in der Realität druckt sich der Referierende alles aus dem Internet aus, und spätestens wenn der Text von der dritten Powerpoint-Folie abgelesen wird, passt ohnehin keiner mehr auf.
In Deutsch schlagen sich die Schüler mit mittelhochdeutschen Gedichten herum, die sie nicht verstehen und die nichts, rein gar nichts mit ihrer Lebenssituation zu tun haben und somit jegliche Identifizierung ausschließen. Wie will jemand lernen und verstehen, wenn er sich überhaupt nicht mit den abstrakt vermittelten, lebensfernen Inhalten identifizieren kann? Und wozu sollte er auch? Um echtes Lernen in Gang zu setzen, bedarf es alltags- und berufsbezogener Themen.
Diese Art der Wissensvermittlung bringt Schulabgänger hervor, die keinen Schimmer von Allgemeinbildung haben, weil sie kaum ein positives Erlebnis mit dem Lernen verknüpfen können und nie wirklich begreifen gelernt haben. Und das hat enorme Nachteile für die Persönlichkeit jedes Einzelnen, denn der Mensch kann so keinen Selbstwert schaffen, weil ihm dafür die befriedigenden Lernerlebnisse vorenthalten bleiben. Wie will Schule denn berufsvorbereitend sein und einen guten Start ermöglichen, wenn sie in erster Linie »Fachidioten« mit großen Defiziten in den Schlüsselqualifikationen des 21. Jahrhunderts produziert?
Betrachten wir nun die Aussage, dass Schule aufs Leben vorbereiten soll, einmal aus dem Blickwinkel des gesellschaftlichen Eingliederungsprozesses. Dann drängt sich die Frage auf, ob wir tatsächlich eine Gesellschaft voller Duckmäuser auf der einen und gewissenloser Ellbogenkämpfer auf der anderen Seite anstreben? Denn in dieser Hinsicht leistet Schule leider hervorragende Arbeit.
Welche Werte Schule heute vermittelt
In regelmäßigen Abständen wird in den Medien ein Bild der Jugend gezeichnet, das an Trostlosigkeit kaum noch zu überbieten ist. Es wird beklagt, dass sich junge Menschen heute kaum noch politisch engagierten, sich erst gar nicht für Ideale einsetzten und nicht dafür kämpfen würden und sich je nach Bedürfnislage ihren individuellen Wertecocktail mixten. Auch die Vorbilder fehlen, woraus eine Wertebeliebigkeit resultiert. Traditionelle Grundwerte wie Glaubwürdigkeit und Verantwortung scheinen wegzubrechen.
Nicht zuletzt zeigte das rigorose Managergebaren in der jüngsten Wirtschafts- und Finanzkrise den Heranwachsenden, dass es im Leben weniger auf Ehrlichkeit und Ethik denn auf rücksichtslose Selbstbedienung und mangelnde Integrität ankommt. Nicht die ehrbare Leistung siegt, sondern Skrupellosigkeit. Nicht Bildung und Fleiß werden belohnt, sondern Mittelmaß und quotenträchtige PR.
Was sind also die neuen Werte, mit denen sich die Jugend identifiziert? In erster Linie sind es Geldwert und Erfolg. Natürlich will auch jeder nett behandelt werden, woraus jetzt allerdings bitteschön keine gegenseitige Verpflichtung abgeleitet werden möge. Aber dürfen wir uns darüber wundern? Ich denke nicht! Schließlich wird in Deutschland seit vielen Jahren unter hohen Einschaltquoten der Supertrottel gesucht und ausgezeichnet. Leistung wird nur bewundert, wenn jemand eine Billardkugel schlucken und auswürgen kann. Stars und Sternchen müssen nicht mehr aufweisen als getunte Lippen, volle Kleiderschränke und perfekt gemeißelte Körper. Mode, Lifestyle und Sixpack sind zum Inbegriff des Lebenssinns geworden. Mehr denn je brauchen wir verbindliche Werte und Tugenden, um die Gesellschaft zusammenzuhalten. Sie können nicht verordnet, sie müssen gelebt werden. Heranwachsende beziehen in hohem Maße ihre Werte und Normen aus dem TV-Grauen, genannt Privatfernsehen. Doch sie brauchen reale Vorbilder, Eltern, die sich ihrer Erziehungsaufgabe stellen, und eine Schule, die ihren Bildungsauftrag nicht auf bloße abstrakte Wissensvermittlung beschränkt, sondern auch Selbstreflexion schult und Werte vermittelt.
Damit der gesellschaftliche Eingliederungsprozess gelingen kann, brauchen junge Menschen ein stimmiges Weltbild, welches ihnen die Erwachsenen vorleben müssen. Doch genau das geschieht unzureichend, denn das macht Arbeit, schafft Konflikte, ist unbequem. Dass ein junger Mensch heute nicht einmal mehr »danke« sagen mag, ist meiner Ansicht nach das Ergebnis des antiautoritären und egoistischen Erziehungsverhaltens einer 68er-Generation, die den Nachwuchs in Watte hüllte, weil sie nicht nur das Beste fürs Kind wollte, sondern in erster Linie auch für sich selbst. Mit dem Resultat müssen wir uns heute alle auseinandersetzen, Tyrannen, die nun ihrerseits die Erwachsenen herumkommandieren und nicht erfahren haben, dass die persönliche Freiheit des Einzelnen da endet, wo die des Nächsten beginnt. Und weil viele Eltern, mittlerweile selbst schon Nachwuchs der 68er-Generation, ihrer Erziehungsverpflichtung nicht ausreichend nachkommen, weil sie es schlicht nie anders kennengelernt haben, schiebt man den Schwarzen Peter der Schule zu. Die Lehrer machen es halt nicht richtig! Aber ein Lehrer kann diese Arbeit niemals allein leisten. Denn wenn er seine Ideale von Demokratieverständnis, gegenseitiger Akzeptanz, respektvollem Miteinander, Achtung vor der Würde des anderen, Fürsorglichkeit, Hilfsbereitschaft, Verlass auf Gerechtigkeit im Unterricht zur Anwendung bringen möchte, dann wird er auch immer Führung übernehmen und sich durchsetzen müssen. Er muss wissen und zeigen, wo es lang geht. Das ist der Moment, in dem er dann sofort gekränkte Eltern auf der Matte stehen hat, die ihm vorwerfen, er würde die Individualität des Nachwuchses zu wenig berücksichtigen. Da reichen zwei Mütter pro Klasse, um einen gestandenen Pädagogen dermaßen zu mobben, dass er die Schulaufsicht an den Hals bekommt, nur weil er darauf achtet, dass sich alle Kinder an gemeinschaftliche Regeln halten. Und niemand wird ihm hilfreich zur Seite springen. Er wird die Misere allein ausbaden müssen, weil alle Angst haben, sie könnten das nächste Opfer sein.
Berücksichtigt man diese schwierigen Begebenheiten, dass den Lehrern in der Ausübung ihrer Aufgabe ständig Steine in den Weg gelegt werden, braucht man sich nicht zu wundern, dass alle lieber über Werte reden als sie leben.
Was Schüler heute aus der Schule für ihr Leben mitnehmen, lautet: Aufmerksamkeit bekommt der, der sich schlecht benimmt. Schlechte Manieren und Ellbogeneinsatz sind cool. Es hilft mir sowieso keiner, also halte ich besser den Mund, als dass ich mir Ärger einfange. Der andere ist mir egal, mir steht auch niemand bei. Ich bin nicht verantwortlich, es sind immer die Umstände. Anstrengung lohnt sich nicht, es interessiert ohnehin keinen. Höflichkeit? Schüler begrüßen sich gegenseitig als Schlampe, fallen einander ins Wort, hören nicht zu, unterhalten sich, während einer etwas vorträgt, ignorieren jede Art einer Gesprächskultur. Zivilcourage? Schüler schauen und hören weg. Sie haben oft genug erlebt: Wer eine eigene Meinung vertritt, wird angegriffen. Es gibt kaum eine Klasse, in der Schülermobbing nicht an der Tagesordnung wäre. Gegenseitige Wertschätzung und Achtsamkeit? Schüler erfahren bereits in der Schule, dass unsoziales Verhalten wie Gewalt (gegen Personen oder Dinge), Störung des Unterrichtablaufes und der Mitschüler, Nichtbefolgung von Anweisungen, Diebstahl, Verschmutzung der Schule, rücksichtsloses Verhalten (im Unterricht und in der Pause), Intoleranz, fehlende Konfliktfähigkeit und Arbeitsverweigerung mehr Aufmerksamkeit sichern, als sich ins Klassengefüge einzuordnen. Vor allem, es passiert nichts, Disziplinarmaßnahmen werden angedroht, aber nicht erfolgreich umgesetzt. Schule kapituliert vor Verhaltensauffälligkeiten. Somit werden auffällige Typen einerseits abgelehnt, andererseits bewundert und gefürchtet. Sehr schnell ist klar, wer das Sagen hat und wer nicht. Ehe man sich versieht, flüchten 80 Pozent der Schüler in Gleichgültigkeit, Teilnahmslosigkeit gegenüber Unterrichtsangeboten, Schüchternheit, soziale Ängste oder eine Außenseiterrolle. Mit gravierenden Folgen wie Prüfungsangst, geringes Selbstvertrauen oder psycho-emotionale Störungen. Ist das wirklich die Welt, in der wir leben wollen? Auf diesem Nährboden können Schüler kein kreatives Lernpotenzial entfalten. Talente verkümmern und der einzigartige Mensch endet als ein angepasstes Schaf unter vielen in einer gleichförmigen Herde.
Anpassung um jeden Preis
Schule erzieht auch heute noch zum Untertanentum und bereitet damit den idealen Nährboden dafür, ausgenutzt zu werden. Werfen wir einen Blick darauf: Was macht einen Untertan aus? Es ist ein Mensch, der Hilflosigkeit und Unmündigkeit erlernt hat, weil irgendwelche schlauen Leute ihm ständig sagen, wie das Leben läuft. Also funktioniert er auf Anweisung, er überlässt das Denken anderen, er gibt zunehmend die Eigenverantwortung ab, er verliert an Selbstwertfefühl, er misstraut seinen Fähigkeiten, er passt sich an, was ihn aber in einen Konflikt mit seinem Selbst bringt. Das Selbst weiß nämlich, was in ihm steckt, und es reagiert mit unguten Gefühlen wie Unzufriedenheit, Ärger, Aggression, Langeweile, Resignation. Genau an diesem Punkt wird diese fatale Haltung erlernt, die viele später als Berufstätige in die innere Kündigung gehen lässt.
Damit drängt sich der Gedanke auf, dass mit dem System Schule möglicherweise vor allem ein Status quo erhalten werden soll, der einer herrschenden Gesellschaftsschicht die Pfründe sichert und ihnen gehorsame, zuarbeitende, funktionierende Untertanen beschert.
Der Unternehmenscoach Stefan Merath spricht von etwa 15 Prozent Adlern, die die Verantwortung tragen, und der großen Masse Enten, die vor allem eines gut können: schnattern, sich gegenseitig beißen und einander am Fortkommen aus dem Ententeich behindern. Den wenigen Enten, die es dann vielleicht doch aufs grüne Gras schaffen, wird nicht mehr Qualifikation zugesprochen als lediglich die: eine motivierte Ente zu sein.
Das will ich nicht hinnehmen! Das kann sich doch nun wirklich keine Gesellschaft leisten, auf ein Heer unmündiger Bürger zu setzen. Gerade in Zeiten, in denen die Sozialsysteme nicht mehr greifen, sich niemand mehr auf seinen Arbeitsplatz verlassen kann, die Globalisierung den Wettkampf auf dem Weltmarkt immer weiter verstärkt, Akademiker zu Dumpingpreisen gehandelt werden, Facharbeiter aus dem Ausland angeheuert werden, muss endlich Schluss sein damit, dass Schule immer noch vor allem anderen die Anpassung in eine von anderen hergestellte Ordnung verlangt. Es muss aufhören, dass Wissen, das von irgendwelchen Bildungspolitikern als wichtig und des Lernens würdig empfunden wird, durch einen funktionierenden Lehrapparat in Schülerköpfe hineingepresst wird, wo es eine Haltbarkeit von vier Wochen hat, nämlich exakt bis zur nächsten Klassenarbeit. Ref 4
Wie bitter jungen Menschen die Fremdbestimmung aufstößt, zeigt folgende Schüleraussage aus einer 12. Jahrgangsstufe: »Also ich muss sagen, dass ich in der Schule meistens meine Meinung für mich behalte. Denn wenn ich mich erklären will, kommt es oft zu Unverständnis bei Lehrern und Mitschülern. Ich brauche immer eine Ewigkeit, um ihnen meine Sichtweisen begreiflich zu machen, und sie davon zu überzeugen, dass auch meine Meinung aus dem und dem Grund vertretbar ist. Aber meistens nimmt sich keiner die Zeit, mir zuzuhören, und ich werde irgendwann vom Lehrer abgewürgt. Wenn ich die Notwendigkeit von Dingen anzweifle, von denen andere überzeugt sind, dann ist ja klar, dass ich bestraft werde. Ich werde beispielsweise ausgelacht, und vor allem wirkt es sich meistens auf die Note aus. Die Schule ist auf jeden Fall dazu da, um den Leuten beizubringen, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen. Du musst etwas lernen, das du nicht willst, du musst aufstehen, wenn dein Körper noch gar nicht dazu in der Lage ist, musst denken, wenn du geistig noch gar nicht da bist ... und das alles nur für eine Note. Wenn die Leute das nicht lernen würden, würde dieses ganze System hier zusammenbrechen. Denn bei der Arbeit ist es doch auch meistens so, dass du viel zu früh aufstehen musst, Aufgaben bekommst, die du nur wegen des Geldes erledigst, und immer schön funktionieren musst. Die Schule ist deswegen meiner Meinung nach ein Unterdrückungsapparat, der die Leute auf die Unterdrückung durch den Arbeitgeber vorbereitet.«





























