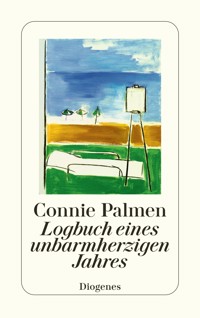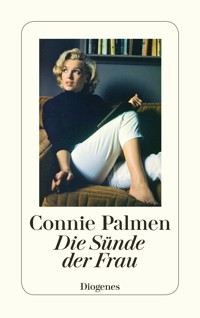9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sylvia Plath und Ted Hughes sind das berühmteste Liebespaar der modernen Literatur – und das tragischste: Denn nach Sylvias Suizid im Jahr 1963 galt sie als Märtyrerin, hingegen ihr Mann als Verräter – eine Schuldzuweisung, zu der er sich zeitlebens nie äußerte. In dieser fiktiven Autobiographie bricht er sein Schweigen. Palmen lässt ihn auf seine leidenschaftliche Ehe zurückblicken und eine Liebe neu beschreiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Connie Palmen
Du sagst es
Roman
Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers
Diogenes
{5}We think we’re writing something to amuse, but we’re actually saying something we desperately need to share. The real mystery is this strange need. Why can’t we just hide it and shut up? Why do we have to blab? Why do human beings need to confess? Maybe, if you don’t have that secret confession, you don’t have a poem – don’t even have a story. Don’t have a writer.
TEDHUGHES
{7}Für die meisten Menschen existieren wir, meine Braut und ich, nur in Büchern. In den vergangenen fünfunddreißig Jahren habe ich mit ohnmächtigem Grauen zusehen müssen, wie unser wahres Leben unter einer Schlammlawine aus apokryphen Geschichten, falschen Zeugnissen, Gerüchten, Erfindungen, Mythen verschüttet wurde, wie man unsere wahren, komplexen Persönlichkeiten durch klischeehafte Figuren ersetzte, zu simplen Images verengt, für ein sensationslüsternes Leserpublikum zurechtstutzte.
Und da war sie die zerbrechliche Heilige und ich der brutale Verräter.
Ich habe geschwiegen.
Bis jetzt.
Sie hatte etwas von einer religiösen Eiferin, mit diesem hektischen Streben nach einer höheren Form von Reinheit, der heiligen, gewaltsamen Bereitschaft, sich – ihr altes, falsches Selbst – zu opfern, sich umzubringen, damit sie neu geboren werden könne, sauber, frei und vor allem echt.
In den sieben Jahren, die wir zusammen verbrachten, habe ich sie in Gegenwart anderer – auch der unserer Kinder – nie so gesehen, wie sie war, wie ich sie kannte, die Frau, mit der ich lebte, die Frau, die mir bei unserer ersten {8}Begegnung, mit den Füßen stampfend wie eine brünstige Stute, in die Wange biss, dass Blut floss.
Wir fielen uns nicht in die Arme, wir fielen übereinander her.
Schnaubend – vor Wonne, vor Freude – riss ich ihr das rote Haarband vom Kopf, zog ihr die silbernen Ohrringe ab, hätte ihr am liebsten das Kleid zerfetzt, sie von diesem ganzen Firlefanz der Konvention, der Artigkeit und guten Erziehung, der Unechtheit entblößt.
Es war grausam, es tat weh.
Es war echt.
Wir erbeuteten einander.
Keine vier Monate später habe ich sie geheiratet.
Ich hätte wissen müssen, dass eine Frau, die beißt, statt zu küssen, den, den sie liebt, auch bekämpft. Und ich hätte wissen müssen, dass ich mit dem Schmuck nur den äußeren Putz abgerissen und als Trophäe an mich genommen hatte. Wer eine Liebe so beginnt, sollte wissen, dass sich im Herzen dieser Liebe Gewalt und Zerstörung verbergen. Bis auf den Tod. Von Anfang an war es um einen von uns geschehen.
Es hieß, sie oder ich.
In der Urgewalt namens Liebe hatte ich eine Ebenbürtige gefunden.
Ich liebte sie, ich habe nie aufgehört, sie zu lieben. Wenn ihr Selbstmord die Falle war, in der sie mich fangen wollte, um mich zu verschlingen, in sich aufzunehmen, zu einem Körper zu werden, ist ihr das gelungen. Ein Bräutigam, der Geisel des Todes ist, in einer posthumen Ehe auf ewig mit {9}seiner Braut verbunden, so unzertrennlich von ihr, wie sie es wollte.
Ihr Name ist mein Name.
Ihr Tod ist mein Tod.
Ich glaube an so etwas wie ein echtes Selbst, und ich weiß, wie selten es ist, so ein Selbst sprechen zu hören, zu sehen, wie es sich aus dem Kokon der Falschheit und des Nichtssagenden herausschält, aus den Scheingestalten, die wir anderen präsentieren, um ihnen zu gefallen, sie irrezuführen. Je gefährlicher das echte Selbst, desto raffinierter die Masken. Je ätzender das Gift, das wir am liebsten über andere ausspeien würden – um sie zu lähmen, zu töten –, desto süßer der Nektar, mit dem wir sie locken, zu uns zu kommen, in unserer Nähe zu sein, uns zu lieben.
Sie war ein süß duftendes Gefäß voll Venenum.
Ich war nie zuvor jemandem begegnet, bei dem Lieben und Hassen so nah beieinanderlagen, dass es fast keinen Unterschied gab. Sie wollte nichts lieber, als jemanden lieben, aber sie hasste es, wenn sie es tatsächlich tat. Sie wollte nichts lieber, als geliebt werden, aber sie hat jeden, der sie je geliebt hat, gnadenlos für diese Liebe bestraft.
Hinter einer Fassade umwerfender Fröhlichkeit verbarg sich ein scheuer Hase mit einer Seele aus Glas, ein Kind voller Ängste, voll alptraumhafter Bilder von Amputationen, Eingesperrtsein, Stromstößen. Und ich – der verliebte Schamane – betete das zerbrechliche, verwundete Mädchen an, ihr wahres Selbst, wollte tun, was die Liebe vom Liebenden verlangt: ihr Konterfei zertrümmern wie ein zärtlicher {10}Ikonoklast. Weil ich sie liebte, war es an mir, sie als Frau und Schriftstellerin aus der unechten Schale zu pellen, sie dazu zu bewegen, dass sie ihre eigene Stimme zu Gehör brachte. Die bange Stimme, die böse Stimme, die quengelige Stimme, mit der sie über Nichtigkeiten nörgelte, die wortlose Stimme, mit der sie demütigte und schikanierte, die verbotene Stimme, mit der sie wie eine wütende Rachegöttin Bannflüche über jeden aussprach, der sie verletzte. Ihre steinerne Zunge sollte im Versmaß ihrer Seele tanzen können, der schwarzen Seele, vor der sie – zu Recht – Angst hatte. Es war an mir, sie aus diesem Tod auferstehen zu lassen.
Was ich damals nicht sah, war, dass ich damit auch mich selbst zu befreien suchte.
Ihr Wahnsinn ist mein Wahnsinn.
Von meinem dreizehnten Lebensjahr an bin ich mit dem Kopf voller Mythen, Sagen, Volksmärchen umhergelaufen, einer geheimen Welt magischen Wissens, bevölkert von grausamen Göttern, die ihre Söhne verschlingen, und mächtigen Göttinnen in ihrer jeweiligen Gestalt als Jungfrau, Mutter, Monster. Durch meine Schwester kamen noch die Astrologie, die Tarotkarten und das Ouija-Brett hinzu. Mit zwanzig konnte ich für meine Angehörigen, meine Freunde und deren Freundinnen, mit denen sie den Himmel teilen oder von denen sie sich möglichst weit fernhalten sollten, komplette Horoskope berechnen. Jeden Morgen schaute ich mir an, wie die Sterne und Planeten standen und was sie mir zu erzählen hatten.
Wenn ich am Tag unseres Kennenlernens auf das gehört {11}hätte, was sie mir nicht nur leise zuflüsterten, sondern lauthals zujaulten, hätte ich mich an jenem Abend in meinem Zimmer eingeschlossen, wäre nicht zur Präsentation der ersten – und übrigens auch letzten – Ausgabe unserer Poesiezeitschrift gegangen, hätte sie nie kennengelernt, oder vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, einem, da nicht in den Sternen gestanden hätte, dass mich eine verhängnisvolle Begegnung erwarte, ein explosives Aufeinanderprallen astraler Energien, das mein Leben für immer verändern werde.
Ich bin ein skeptischer Sterndeuter, ich habe zu wenig daran geglaubt.
Ich ging.
Es war voll, laut, rauchig wie die Hölle. Unter all den existentialistischen Männern in Rollkragenpullovern und den mir allzu vertrauten blässlichen englischen Frauen erschien sie wie eine langbeinige Göttin. Ihr Ruf an der Universität war ihr schon vorausgeeilt, sie musste die überschwengliche Amerikanerin sein, die schon einiges veröffentlicht hatte.
Vor mir ragte eine große, glänzend herausgeputzte Frau auf, eine Erscheinung aus dem Gelobten Land. Wenn ich ihre Marmorhaut berührte, würde ich die Hand über den Atlantischen Ozean hinweg zur amerikanischen Literatur hin ausstrecken. Mit ihrem perfekt gerundeten Gesicht und ihrer bronzenen Satinhaut sah sie aus wie eine Schauspielerin aus einem Hollywoodfilm. Ein Perlmutterlachen, Zähne so weiß wie die eines Hais, zwischen blutrot geschminkten, wulstigen Lippen blitzend, sonnenscheinblondes welliges Haar, alles, was wild und ungestüm an ihr war, eingeschnürt {12}durch ein eng tailliertes Kleid, rot und schwarz, die Farben des Skorpions. Sie tanzte mit meinem besten Freund Lucas, etwas zu enthemmt, etwas zu schamlos, scheinbar halb in Trance, aber das war sie nicht, sie wollte, dass ich diese Balz anschaute. In der kurzen Stille, in der die Musik der Welt schweigt, die Natur den Atem anhält, um Kraft zu sammeln für einen verwüstenden Orkan, trat sie ein paar wacklige Schritte auf mich zu – meine betrunkene Göttin –, die schwarzbraunen Augen fiebrig vor Paarungsdrang.
Ich ging ihr entgegen, nannte sie bei ihrem Namen.
Ich sagte: »Sylvia.«
Überrascht, dass ich sie erkannt hatte, musste sie schreien, um den fetzigen Jazz und das Getöne der Männer zu überstimmen, und das tat sie, sie schrie, sie blaffte mir wie Hekate meine eigenen Sätze zu, ganze Strophen aus den Gedichten, die sie gerade in unserer Zeitschrift gelesen hatte, sie rief: »›Ich habe es getan, ich.‹«
Sie war in das aufdringliche künstliche Aroma von Lilien und Frühlingsblüten eingehüllt, aber als ich sie packte und von der Tanzfläche wegführte, roch ich ihren echten Duft, schwer wie Moschus, süßsäuerlich wie der Schweiß eines brünstigen Rehs. Mit dem Abdruck ihrer Zähne in meiner Wange ging ich als gebrandmarkter Mann in die Nacht.
Es war der 25. Februar 1956.
Ich war der Ihre.
Nicht vier, sondern siebenundzwanzig Tage später brach unser persönlicher Schalttag an, jenes zweifelhafte Geschenk der Götter, ein Überhang von vierundzwanzig Stunden, der die Summe der Ewigkeit stimmig machen soll. {13}Sie hatte noch einen Tag, bevor sie eine Reise durch Europa antreten würde. Sie schenkte ihn mir. Es war der Freitag, der meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft bestimmen sollte.
Cambridge ist ein Dorf, eine Brutstätte von Klatsch und Tratsch. Auf Umwegen hatte sie erfahren, dass mein Freund Lucas und ich zweimal zu mitternächtlicher Stunde unter ihrem Fenster gestanden und – betrunken, laut ihren Namen singend – Erdklümpchen gegen ihre Scheibe im dritten Stock geworfen hatten, gegen die falsche, wie sich später herausstellte. Nach dem Fehlschlagen dieses derben Romeo-Acts spannte ich Lucas ein, sie in mein Zimmer in London zu bringen. Lucas, selbst Amerikaner aus Tennessee, schämte sich stellvertretend für alles Amerikanische an ihr – die aggressive Oberflächlichkeit, das laute Gehabe und die aufdringliche Unbescheidenheit – und flehte mich an, ihn nicht zum Vermittler einer Liebe zu machen, die verdammt sei, und ihn damit an allem, was noch kommen würde, mitschuldig zu machen.
Ich hörte nicht auf meinen Botschafter.
Er brachte sie zu mir, lieferte sie bei mir in der Rugby Street 18 ab und verschwand.
Auf dem niedrigen Tisch lagen die Trophäen des ersten Tages. Sie flatterte herein wie ein Vogel, quirlig, aufgedreht, nervös, umgeben von einer einzigartigen kobaltblauen Aura. Sie keuchte meinen Namen wie einen Stoßseufzer.
Sie sagte: »Ted.«
Sie sah das Haarband, die Ohrringe und fügte hinzu – als {14}hätte sie mit dem Aussprechen meines Namens zu viel Sehnsucht preisgegeben –, »der schwarze Räuber«. Mit diesem Epitheton bedacht, kam ich mir vor wie der Bösewicht aus einem Kindermärchen, doch ein paar Minuten später begriff ich, dass sie sich mit diesem Bild zitierte. Immer noch mit der Unrast der Reisenden sagte sie, dass sie in den Stunden nach unserer ersten Begegnung ein Gedicht für mich geschrieben habe. Sie setzte sich, zog zwei beschriebene Seiten hervor – ich erhaschte einen Blick auf ihre Handschrift, die pubertären Rundungen eines Backfischs – und präsentierte mir mit amerikanischem Zungenschlag ihr Bild von mir, einem frauenverschlingenden Raubtier, einem Panther, der sie verfolgte.
»›Nicht lang, dann bringt er mir den Tod.‹«
»Ich hoffe, du bist nicht hellseherisch veranlagt«, flachste ich, als sie geendet hatte und mich plötzlich schüchtern ansah.
»Oh, aber das bin ich sehr wohl«, sagte sie vollkommen ernst.
Hunderte Beispiele wird sie mir liefern, wie recht sie damit hatte, Beispiele für diese gruselige Fähigkeit, Gedanken zu lesen, Geschehnisse vorherzusagen, Gefahr zu wittern, aus kilometerweiter Entfernung zu wissen, was ich tue, denke, erlebe. Da ich die Sehergaben meiner Mutter in den Genen habe, schreckt dieses Talent mich nicht. Vielmehr gibt es mir das Gefühl, erneut von einem Schutzengel begleitet zu sein, im selbstverständlichen Kontakt mit den Abwesenden.
Wir saßen einander gegenüber, erzählend, zuhörend, {15}entdeckten eine erstaunliche Gemeinsamkeit nach der anderen, die geteilte Liebe zu Yeats, Blake, Lawrence, Dostojewski. Über das Doppelgängermotiv in dessen Werk hatte sie ihre Abschlussarbeit am College geschrieben, das sie mit Auszeichnung bestand, und sie redete angeregt über das teuflische Schatten-Ich, diese schwarze Seite unseres Selbst, unseren Untergang, unseren Tod. Und dass sie sich nun mit Racine befasse, mit der Leidenschaft als Schicksal in Phèdre – natürlich auch mein kontinentales Lieblingsstück. Unversehens zitierten wir mit verteilten Rollen unsere liebsten Alexandriner – sie als die wahnsinnige Selbstmörderin Phädra, ich als der fälschlich beschuldigte Hippolyt –, womit sich schon damals eine fatale Rollenverteilung abzeichnete. Sie erzählte unter lautem Auflachen, dass sie vor drei Wochen ihren Essay über Phèdre von ihrer Lieblingsdozentin und Tutorin in Cambridge mit einer Randbemerkung zurückbekommen habe, dass ihre Studentin die schicksalshafte Leidenschaft in dieser Tragödie doch ein wenig zu eng gesehen hätte, dass Racine nun wirklich nicht den Holocaust daraus gemacht hätte, den sie darin sehe.
Da ich weiß, wie wir Dichter von den Territorien angezogen werden, die ein anderer Dichter mit seinen Duftmarken abgesteckt und besetzt hat, erzählte ich, dass sie jetzt dort sitze, wo Dylan Thomas einst gesessen und sich mit dem Vater meines Freundes Daniel betrunken habe. Sie stand auf, kniete nieder und küsste den Holzboden. Und ich, der so lange ein Verächter der Liebe gewesen war, verfiel ihr mit jeder der vierundzwanzig Stunden, die sie mir schenkte, mehr, verfiel dieser irisierenden, nicht festzumachenden Schönheit, dem Akzent von Massachusetts, verfiel {16}meiner Doppelgängerin. Als sie sich nach ihrem Kniefall vor dem Barden erhob, um ins Hotel zurückzukehren, drückte ich sie an mich, hob sie hoch, wirbelte sie herum, küsste sie, spürte den Schauer ihrer heftigen Erregung, sog den Moschusgeruch tief durch die Nase ein.
»Bleib«, sagte ich.
»Komm mit«, sagte sie.
Ich ging mit. Wir konnten unmöglich zusammen – unverheiratet – in ihr Hotelzimmer gehen und schlenderten daher Arm in Arm durch die Straßen Londons, blieben an jedem Baum und Strauch stehen, um uns zu küssen, zu reden, einander zu begrapschen.
Wieder und wieder strich sie über das Mal auf meiner Wange, mit dem sie mich gezeichnet und zu dem Ihren gemacht hatte, flüsterte: »Ich habe das getan, ich.« Geistreich, exaltiert, getrieben von dem gierigen Wunsch, sich zu offenbaren, erzählte sie, wie sie vor siebenundzwanzig Tagen ohne mich in die Nacht gegangen war, am Arm ihres Begleiters torkelnd, und mit seiner Hilfe über die mit Pfeilspitzen bewehrte Mauer des Campus geklettert war. Die Nägel durchbohrten ihre Hände.
»Du warst meine Kreuzigung«, sagte sie – strahlend, lachend –, während sie mir die offenen Handflächen zeigte, »aber meine Stigmata bluteten nicht.«
Als sie in so kurzer Zeit mit der Wucht eines Wunders über mich kam, hätte ich erahnen können, welche Rolle mir im dramatischen Narrativ ihres Lebens zugedacht war, doch der Auftakt zu diesem Stück hatte ein Tempo, dem ich nicht folgen konnte, ihre Augen hielten mich gefangen wie {17}das Scheinwerferlicht ein Kaninchen, ihre Stimme machte mich taub, für das Schellen der Zimbeln genauso wie für das Jaulen der Sterne. Was mich noch am meisten bezauberte, war ihr alchimistisches Talent, die bleiernen Fakten umzuschmelzen und als goldene Lava in die Form einer Märtyrergeschichte zu gießen. Sie zog T.S. Eliot, The Cocktail Party, heran und wie sie sich oben auf diesen Eisenspitzen wie die gekreuzigte Celia Coplestone gefühlt habe, die »›einen Weg wählte, der in diesen Tod führte‹«.
Von Kindesbeinen an habe ich die Welt wie ein Buch voller Geheimnisse und vielsagender Zeichen gelesen, und an diesem Abend verstehe ich jedes Omen als Verheißung einer himmlischen Verbindung zwischen einer Frau und einem Mann, die dafür leben, schreiben zu können. Sie ist Dichterin, sie ist schön und geistreich, belesen und brünstig, talentvoll und grimmig, sie ist genial und gefährlich.
Ich hörte zu, schmunzelte, ermunterte sie – hab keine Angst, erzähl mir alles. Sie schaute zu mir auf, ein paar Zentimeter nur, sie war fast so groß wie ich. Ich strich ihr den dicken blonden Pony aus dem Gesicht und legte plötzlich die Lesezeichen ihrer Urgeschichte frei, die geschweiften Klammern an den Schläfen, die, wie ich noch nicht wusste, mit dem Ausrufezeichen unter ihrem rechten Auge korrespondierten. Nun, da ich die Schminke abgeleckt hatte, glomm die Narbe sepiafarben im Licht der Laterne. Sie schien kurz verlegen, beschämt, doch der Alkohol, der König der Gleichgültigkeit, gewann die Oberhand.
»Vor zweieinhalb Jahren habe ich Selbstmord begangen«, sagte sie vergnügt, »und hier stehe ich, so gut wie neu.«
{18}Ich hätte dort Abschied nehmen, fortlaufen können aus dieser Geschichte, fliehen können vor deren Autorin, vor dem Leitmotiv meiner Figur, hätte auf die Stimme hören können, die mich vor der zwangsläufigen Fortsetzung, bedingt durch die Logik der Intrige, warnte, doch angezogen von der Gefahr, unwiderstehlich gelockt vom Gesang der Sirenen, wurde ich nur umso tiefer hineingesogen.
Beim Hoteleingang angelangt, konnte ich sie einfach nicht loslassen, undenkbar, dass wir die Nacht getrennt antraten, zu hartnäckig waren wir ineinander verschlungen, und so schmuggelte sie mich, an sie geklebt, gebückt unter ihrem Regenmantel versteckt, an einem dösenden Nachtportier vorbei ins Hotel hinein, wobei sie kicherte wie ein nervöser Teenager.
Wir liebten uns wie Giganten, mit gierigen Bissen. Ungeduldig erforschte ich die Genüsse ihres wunderbar glatten, geschmeidigen Körpers, der sich wand wie der einer Schlange und der so viel schmaler und zerbrechlicher war, als ihr rundliches Gesicht vermuten ließ. Ich bedeckte ihren Mund, um die Schreie zu dämpfen, mit denen sie unser Versteck hätte verraten können, und als sie erschöpft neben mir lag, musste ich meinen Atem in sie hauchen, damit sie wieder sprechen konnte.
Noch glühend vom Sex, träge und wie unbeteiligt, erzählte sie vom Tod ihres Vaters, als sie acht Jahre alt war, von ihrer Mutter, ihrem Bruder, den Großeltern, die bei ihnen wohnten, der deutschen Herkunft, den Depressionen, ihrer Psychiaterin Dr. Beuscher, der Ablehnung einer Erzählung, der Nichtzulassung zu einem begehrten {19}Schriftstellerworkshop, dass der Wunsch zu schreiben für sie gleichbedeutend sei mit dem Wunsch zu leben, das eine nicht ohne das andere gehe, sie aufgehört habe, das Leben zu lieben, als ihre Einbildungskraft tot zu sein schien, sie befürchtet habe, nie mehr einen Satz zu Papier bringen zu können. Und dass sie insgeheim gehofft habe, dass die Elektroschocktherapie diese Lähmung aufheben könnte, der Strom das betäubte Talent wieder in Gang setzen, den Motor der Einbildungskraft anwerfen würde und sie wie Lazarus aufstehen und schreiben könnte.
Sie sagte, dass sie kurz nach unserer ersten Begegnung beschlossen habe, diese Therapie bis in alle Einzelheiten zu beschreiben, leichtfüßig, frei von Sentimentalität, und die Erzählung unserer Zeitschrift anzubieten.
»Gib sie mir«, sagte ich.
Sie beschrieb ihre Exekution, wie sie es nannte, als handelte es sich um einen schlechten Scherz, mokierte sich über die abgestumpften Henkersknechte, die sie wie ein Tier in einen unterirdischen Raum abführten, mit Lederriemen auf einem Tisch festbanden, ihren Kopf – ihren Tempel – mit einer Dornenkrone aus Elektroden an das Folterwerkzeug anschlossen, ohne Betäubung oder Warnung den Hebel umlegten, 450 Volt durch ihr Gehirn jagten, ihre Träume zerrissen und die zarte Haut an ihren Schläfen verbrannten. Den Geruch verbrannten Fleischs in der Nase – mein armes Kind, mein Mädchen –, küsste ich meine Fingerspitzen und legte sie auf die Satzzeichen ihres Dramas. Sie vertraute mir, ließ es zu, schloss die Augen, seufzte. Als sie sie wieder öffnete, schimmerten sie von einem alten Kummer, doch sie {20}riss sich zusammen – dort wollte sie nicht sein, sie wollte fort von diesem Schmerz, zurück zu der Selbstironie, mit der sie ein Leben lang alles erträglich machte – und erzählte, wie sie an jenem Morgen kurz gedacht habe, sie sei neu geboren worden, aus einem vorübergehenden Tod wiederauferstanden.
»Sterben und wiederauferstehen«, feixte sie, »darin bin ich wirklich gut, man kann wohl sagen, dass ich Gottes eigenen Sohn darin übertreffe.«
Ich lachte nicht, ich fragte nichts.
Ich streichelte die Narbe, das nächste Fragment ihres Dramas.
Die Schockbehandlungen hatten den gegenteiligen Effekt. Statt den schöpferischen Geist wiederzuerwecken, brachten sie jede Stimme, die je in ihr gesprochen hatte, zum Schweigen, töteten sie ab, als hätte sie nie auch nur eine Spur Einbildungskraft besessen, als wäre sie wie alle anderen, vorbestimmt für ein monotones Dasein als Hausfrau in einem Vorort von Boston, dumm, dick und strickend. Sie konnte nicht mehr schlafen, denken, schreiben, sie konnte nicht mehr leben. Sie versuchte, den Selbstmord ihres Idols Virginia Woolf nachzuahmen, und ging ins Wasser, doch der Ozean wies ihr Geschenk zurück und spuckte sie wieder aus. Und dann war Montag, der 24. August, und mit diesem Tag brach eine weitere Woche des Lebens mit einem stummen Kopf an, eine unerträgliche Aussicht. Wie jede unglückliche Seele verfluchte sie den Montag mit seiner tyrannischen Suggestion von Hoffnung und Neuanfang. Ihre Mutter ging an jenem Nachmittag zu einer {21}Filmvorführung, ihr Bruder hatte einen Ferienjob, ihre Großeltern saßen im Garten hinter dem Haus in der Sonne. Sie wusste, wo ihre überfürsorgliche, schwer arbeitende, alleinerziehende Mami das volle Fläschchen Schlaftabletten versteckt hatte, schrieb einen Zettel, unauffällig, mit fester Hand, um keinen Argwohn zu wecken. »Mache einen langen Spaziergang. Bin morgen wieder zu Hause.« Sie öffnete die Metallkassette und nahm die Tabletten an sich, stellte die Kassette sorgfältig zurück, zog eine Decke aus dem Schrank, füllte ein Glas Wasser und ging in den Keller hinunter – in die Unterwelt, wie sie grinsend sagte. Dort befand sich, in Augenhöhe, der Zugang zu einem Hohlraum, der durch Holzscheite für den offenen Kamin verdeckt war. Sie legte den Eingang frei, zog sich hoch, kroch in die Höhle und schichtete die Holzscheite hinter sich wieder vor die Öffnung. In die Decke eingewickelt, schob sie sich so tief wie möglich in den Hohlraum hinein. In einer Haltung wie die Römer beim Bacchanal, halb liegend, auf einen Ellbogen gestützt, schluckte sie die fünfzig Schlaftabletten, ihr letztes Abendmahl. Sie streckte sich aus und wartete auf den Tod. Mit funkelnden Augen sagte sie, als Antwort auf eine Frage, die ich nicht gestellt hatte: »Ja, natürlich!« Als müsse ich wissen, was nun kam.
Und ich wusste es.
»Ich kenne meine Klassiker«, sagte sie spöttisch, »also, ja natürlich habe ich ihn angerufen, gebetet und gefleht und weinend gesagt: ›Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?‹«
{22}Hin- und hergerissen zwischen Bewunderung und Rührung – und auch von einer herrlichen Angst befangen, die ich nicht benennen konnte –, entging mir, dass sie mir schon in unserer ersten Nacht meinen größten Rivalen vorstellte, einen Gottvater, allmächtig abwesend im Tod, und dass der Tod mein Gegner im Kampf um ihre Seele sein würde. Und wer weiß, vielleicht begann ich damals schon, diesen Kampf zu verlieren.
Das Ausrufezeichen war noch nicht gesetzt. Plötzlich müde, ja sogar ein wenig gelangweilt, hob sie zum Schlussabsatz dieser schon geschriebenen, bekannten Geschichte an. Wie nach drei Tagen die Holzscheite vor dem Eingang weggeschoben wurden und sie – weniger glorreich als ihr illustres Vorbild – wie ein Wickelkind herausgezogen wurde, halb bewusstlos, mit verkrustetem Erbrochenem bedeckt und Würmern wie funkelnde Perlen. Unter ihrem rechten Auge klaffte eine blutige Wunde, die sie sich wahrscheinlich zugezogen hatte, als sie sich in dem engen Raum aufgerichtet und dabei das Gesicht an den rauhen Steinen aufgeschürft hatte. Das Scheitern ihrer finalen Liebestat machte sie todunglücklich.
Erst Monate später, nach der Entlassung aus der Nervenklinik, erfuhr sie, dass es ihr mit zwanzig beinahe gelungen wäre, posthumen Ruhm zu erlangen. Dank der zum Wahnsinn treibenden Besorgnis ihrer Mutter – und deren Argwohn, das muss gesagt sein, sie glaubte nichts von dem, was auf dem Zettel stand – war die Polizei praktisch sofort eingeschaltet und über die Depressionen informiert worden. {23}Noch am selben Abend war ihr mysteriöses Verschwinden Thema in den Rundfunknachrichten. An den drei darauffolgenden Tagen stand sie mitsamt Foto auf den Titelseiten einiger Lokalzeitungen.
»Hochbegabte Smith-Studentin aus Wellesley vermisst.«
»Suche nach Mädchen Plath ergebnislos.«
»Smith-Studentin lebend in Keller gefunden.«
Sie lag so warm in meinen Armen, meine auferstandene Göttin, dass ich sie erneut begehrte, hungrig ihre Lust zu wecken begann, ihr das selige Stöhnen entlockte, nicht die englischen, sondern die amerikanischen Seufzer der Wonne. Sie war unter und auf mir, sie klammerte und kratzte, und ich biss und kniff, und in ihr, stoßend, stöhnend, den Blick auf ihr verzerrtes Gesicht gerichtet, entfuhr mir, während ich mich entlud, dieser andere Name mit S und i und l, ein Straucheln der Zunge, die sich – bei reduziertem Bewusstsein – vertat und nicht Sylvia, sondern Shirley daraus machte. Sie gab vor, es nicht gehört zu haben, aber in den Sekunden, da sie die Augen aufsperrte und mich anschaute, sah ich – außer ihrem Entsetzen – sprühenden Hass.
Im Morgengrauen ließ ich sie im Hotel zurück und lief aufgewühlt – ich fühlte mich plötzlich einsamer als je zuvor – nach Hause. Mein Freund Michael übernachtete gerade bei mir, und ich musste so früh am Morgen bei mir selbst anklopfen, um hineinzukommen. Ich schlug den Klopfer dreimal gegen die Tür, das Zeichen für den zweiten Stock. Es dauerte ein Weilchen, bis er das Fenster öffnete und die Schlüssel herunterwarf. Verwundert über meine Aufregung {24}und Verwirrung, ging Michael in die Küche, nahm eine Pfanne und briet Spiegeleier mit Würstchen. Die einzige Antwort, die ich ihm auf seine neugierigen Fragen geben konnte, war: »Sie ist es.«
Nachher – wie oft werde ich mich noch dieses unheilvollen Adverbs bedienen müssen, dieser sinistren Zeitangabe des enthüllenden Post factum, der Androhung einer entlarvenden Retrospektive, mit ihrem Anflug von Bedauern oder mit ihrem bestürzenden Vermögen, die Leidenschaft meines fünfundzwanzigjährigen Ichs zutage treten zu lassen und all dessen Irrtümer und unrichtige Interpretationen –, nachher las ich ihre Tagebücher.
Ich habe niemandem je erklären können, wie entsetzlich das ist.
Auf Hunderten von eng beschriebenen Seiten, deren Handschrift mir mit den jeweiligen Schnörkeln verrät, wie sie sich in dem Moment fühlte, fand ich mich manchmal bis zur Unkenntlichkeit entstellt wieder, in einer verzerrten Perspektive gefangen, unverstanden, meine Taten falsch gedeutet, und lernte sie neu kennen, ohne Tarnfassade, traurig, rachsüchtig, misstrauisch und streitbar.
Im Nachhinein bin ich dadurch, dass ich ihre Version unserer Fakten gelesen habe, die der meinen oft diametral entgegengesetzt ist, meiner frühesten Erinnerungen beraubt worden. Sah ich die unschuldigen Erdklümpchen, die Lucas und ich gegen das falsche Fenster warfen, zu Dreck gemacht und wie sie daraus schließt, dass wir ihren Namen in den Dreck zogen wie den einer Hure. Und auch meine Vision eines Himmelsbundes entpuppte sich als einseitige {25}Sicht eines verliebten Narren. In ihrem Tagebuch konnte ich – musste ich – lesen, dass ich noch nicht der Auserwählte war, sondern einer von vielen lüsternen Kandidaten, die in Erwägung gezogen und abgeklopft wurden, als wären sie Hengste auf dem Pferdemarkt, denen sie ins Maul schaute.
Zu der Morgenstunde, da ich einem unstillbaren Hunger mit dem Frühstück zu Leibe rückte und meine Stimme nur noch dieses eine Mantra – sie ist es, sie ist es – murmelte, bestieg sie, blaugefleckt von der Liebe, das Schiff zum Festland. In Paris, einer Stadt, die sie von einem vorherigen Besuch kannte, begann sie eine Europareise. Sie hatte nicht erzählt – nicht gestanden –, dass sie dort nach dem Mann suchte, dem ihre Seele gehörte, dass es nicht irgendeine Frühlingsreise einer Studentin war – der kulturelle Imperativ eines jeden angehenden Intellektuellen –, sondern dass sie reiste, um ein zerbröckeltes Selbst zu kitten, sich ihre Seele zurückzuholen oder sie für immer diesem Mann zu schenken. In kriecherischen Bettelbriefen an den Geliebten hat sie angedroht, ihren Körper umzubringen, wenn dieser ohne die an den Mann verpfändete Kostbarkeit weiterleben müsse. Und mit einer Mischung aus Mitgefühl und Genugtuung las ich, wie sie in dem Pariser Apartmentgebäude des Rivalen, den ich nicht kenne – und nie kennenlernen werde, der auf beneidenswerte Weise für alle schnüffelnden Biographen und hochgelehrten Leichenfledderer unauffindbar blieb –, von der Concierge eingelassen wurde und bei dieser die knisternden Luftpostkuverts mit ihrem seitenlangen Flehen liegen sah, ungeöffnet, achtlos auf einen Haufen geworfen.
{26}Ungefähr zu jener für sie so schmerzlichen Stunde der Demütigung und Verlassenheit muss ich mich an den Tisch gesetzt haben, um ein Gedicht zu schreiben. Es ist nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich – im Nachhinein – mit Erstaunen lese, wie prophetisch es ist, wie viel weitsichtiger der Dichter war als der verblendete Mann, der seufzende Liebende, der sich nur ihren nackten, athletischen Körper – und alles, was sie damit konnte, jede Empfindung, die sie im seinen zu wecken verstand – zu vergegenwärtigen braucht, um vor Erregung schier zu zerbersten. Der Dichter ist der Diagnostiker, der Heiler, der das Geschwür lokalisiert, bevor der Patient weiß, dass er an einer unheilbaren Krankheit leidet, ja sogar bevor er den Schmerz fühlt, der ihn vor dem Trauma warnt.
»Lächerlich« ist das erste Wort, das er schreibt.
Und während die Lenden des Liebenden winseln, schreibt der Dichter an jenem Tag, dass es lächerlich sei, es Liebe zu nennen, dass sich ihre Abwesenheit anfühle wie die Wunde eines Mannes, der, von einem Schuss getroffen, zu ihr aufschaue – zum Vogel einer Note, eines Schreis, und dann der Tod.
»Verlust« ist das Wort, mit dem er das erste Gedicht für sie beschließt.
Drei Wochen später stand sie mit Paris, München, Venedig und Rom im glänzenden Samsonite vor der Tür von Rugby Street 18, wo ich sie mit vor Begierde straffen Sehnen erwartete. Was Frauen können und Männer nicht, ist, den Geruch anderer auf der Haut ihres Geliebten zu riechen, und ich roch sie nicht, die auf dieser Reise benutzten {27}Liebhaber, ausprobiert und zurückgelassen, gestrichen von der Liste möglicher Bräutigame. Ich glaubte, der Einzige zu sein – nichts wissend von dem verzweifelten Versuch, die Trümmer eines entzweigeschlagenen Selbst zusammenzutragen –, und ich wurde es in dieser Nacht auch. Es war April, der Monat, der von T.S. Eliot zum grausamsten unter seinesgleichen gekürt wurde, und es war Freitag, der dreizehnte.
Wie viel Symbolik verträgt eine Geschichte, verträgt ein Leben?
Der dreizehnte April war, wie ich erfuhr, der Geburtstag ihres Vaters, außerdem sollte Rugby Street 18 eine makabere Rolle an dem letzten Wochenende ihres Lebens spielen, und an einem zukünftigen Freitag, dem dreizehnten, sollte ich uns ins Unglück stürzen.
Die Tage und die Zahlen, die Sterne und die Planeten warnten mich genauso wie meine Freunde, doch mein Glück glich zu sehr dem Glück meiner Kindheit, als ich mit meinem zehn Jahre älteren Bruder in die Natur hinauszog, wir tagelang angelten, Wild jagten, abends am Lagerfeuer nebeneinandersaßen und schwiegen oder ich seinen Indianer- und Gruselgeschichten lauschte, mich so sehr mit einem anderen verbunden fühlte, dass ich danach immer nach einer Zweisamkeit gesucht habe, die dem gleichkam, nach einem Glück, das so stark war, dass ich völlig darin aufging. Die Frau, die dem Kind, das neben seinem Bruder am Ufer des Flusses saß und auf die Wasseroberfläche starrte, die Hand reichte und es in das verlorene Paradies zurückführte, sollte die Meine werden.
{28}Sie war es.
Wer sie nur oberflächlich kannte, konnte nicht ahnen, dass ein Krieger in ihr steckte, dass sie androgyner war, als das brave Mädchen mit dem Pferdeschwanz vermuten ließ. Sie wollte ihre Kräfte mit jemandem messen, sie wollte kämpfen, und dafür hatte sie sich den größten und stärksten Mann ausgesucht, den sie finden konnte.
Mich.
Warum begreifen so wenige, dass ihre Verurteilung, ihre Ablehnung derjenigen, die man liebt, die Liebe gerade vertieft? Ich konnte die Verwunderung über meine Wahl in den Augen aller um mich herum lesen. Bei manchen war es sogar regelrechter Hass. Sie mochten sie nicht. Sie fühlten sich von mir verraten, aber die Schuldige an dem Verrat war sie. Meine Freunde und ich waren Verfechter eines besonderen Lebens, das wir frivol und sorglos so lange wie möglich hinausziehen wollten, und hatten einander vor der Ehe und der Macht der Frauen gewarnt. Die irischen, schottischen und keltischen Balladen, die wir abends bei einem von uns in der Bude oder in einer Kneipe sangen, lehrten uns, auf der Hut zu sein vor der Verführung durch das schwache Geschlecht, der mysteriösen Macht der Frau, einen Mann zu domestizieren, ihn zu einem folgsamen Trottel zu machen. Wahrscheinlich nahmen sie es ihr übel, dass sie mich plötzlich mit anderen Augen sehen mussten. Ich, der spröde Mann aus Yorkshire, zog diese exaltierte Frau allen anderen vor, schenkte mein Herz einem schnatternden, exorbitanten Wesen, einem Prototyp von Schein und Künstlichkeit, schwärmerisch, in allem übertrieben.
{29}Freunde wollen, genau wie die Familie, dass du bleibst, wer du warst, während die Liebe das unzüchtige Vermögen besitzt, dich zu verändern, dich um einen neuen Blick auf alles, was dir vertraut war, zu bereichern. Je mehr sie bei allen in Ungnade fiel, desto hündischer mein Drang, sie gegen eine feindselige Welt zu beschützen, desto stärker meine Überzeugung, dass nur ich wusste, wie sie wirklich war. Nur ich wusste, welches Kreuz sie trug und dass der gefährlichste Feind nicht hinter den Mauern der Häuser anderer lauerte, sondern dass sie ihn wie eine Natter an ihrem Busen nährte.
Ich begann gerade erst, die Mythologie ihres Lebens zu entschlüsseln, und ließ sie die meine lesen. Die Mythen sind das kunstvolle Archiv universeller menschlicher Wahrheiten, entdeckt und niedergeschrieben, um unser Überleben zu sichern, das Verzeichnis des Kampfes, den die menschliche Einbildungskraft im Laufe der Jahrhunderte austrägt, um äußere und innere Welt miteinander zu vereinen. Sie legen das Muster unseres seelischen Dramas frei, enthüllen das Gewebe unseres Charakters, unserer wichtigsten Beziehungen, der Emotionen, die uns antreiben. Jegliche Literatur entspringt einer verletzten Seele, der geistigen Anstrengung des menschlichen Abwehrsystems, uns von diesem Schmerz zu befreien und den Tod zu besiegen. Die Suche nach dem höchsten Wissen – dem über sich selbst – führt zu einem Charakter, dessen Prototypen Held oder Feigling, Gott oder Rebell sind. Und manchmal müssen wir unseren Mythos lesen lernen, um rechtzeitig aus dem narrativen Käfig eines alten Szenarios entkommen zu können, des {30}vorgezeichneten Schicksals, dem die Figur scheinbar willenlos gehorcht.
Du wirst erst dann wirklich unter die Oberfläche schauen können, wenn du lernst, dass du auch für andere eine Figur aus einem Roman oder einer Tragödie bist, und entdecken musst, dass ihre Rollenverteilung nichts mit deiner Wirklichkeit zu tun hat, sie zu anderen Büchern und Figuren greifen, um dich zu deuten. Ich habe sie in allen erdenklichen Gewändern auftauchen sehen, die prototypischen Bösewichte – Blaubart und Lord Byron, Don Juan und Judas, Yorkshire Ripper und Heathcliff –, die dazu dienen sollten, mich in einer obskuren Geschichte von Leidenschaft, Verrat, Rache und Grausamkeit einzusperren.
Sie erweckte den trügerischen Eindruck, dass sie vor niemandem etwas zu verbergen habe – meine schwatzhafte Amerikanerin –, weil sie jede nennenswerte Erfahrung augenblicklich in eine Anekdote ummünzte, lebendig, spannend, häufig ungemein geistreich aufgetischt, durch zahllose Aufführungen vor wechselnder Zuhörerschaft schließlich literarisch vervollkommnet und druckfertig für eine Frauenzeitschrift. An die zaghafte Art englischer Frauen gewöhnt, fand ich sie mit ihrem unaufhaltsamen Sprachfluss beeindruckend wie die Niagarafälle. Sobald sie eine Geschichte erzählte, glitzerten ihre Augen wie Granit, schaukelten die affenartig langen Arme im Rhythmus ihrer Stimme. Gestikulierend untermalte sie Höhen und Tiefen, Beschleunigung und Verlangsamung, kostete jede Silbe wie eine Süßigkeit, bevor sie sie aussprach und der Welt schenkte. Denn was sie tat, war sehr wohl ein Schenken, und wie {31}alle Troubadoure hielt sie mit diesen amüsanten Auftritten die Menschen auf Distanz, während sie doch nichts lieber wollte, als alle näher zu sich heranzuziehen. Wenn ich ihr zusah, sah ich auch immer das kleine Mädchen, das sich an den Beinen von Besuchern festklammerte, sobald diese wegzugehen drohten, und unablässig beteuerte: »Ich liebe Sie, ich liebe Sie.«
Zwei einschneidende Begebenheiten hatte sie im Laufe der Zeit als Erzählungen derart perfektioniert, dass sie sich selbst nicht mehr bewusstmachte, worin deren eigentliche Bedeutung lag, als entfernte sie sich dadurch, dass sie eine Erzählung daraus machte, immer weiter von der Erfahrung, anstatt tiefer in sie einzudringen. Das eine war, wie sie, ohne Ski fahren zu können, tollkühn eine Piste hinuntersauste, stürzte und sich das Bein brach; das andere ein Ritt auf einem durchgegangenen weißen Hengst, Sam, an dessen Hals sie sich festklammerte, während er mitten durch den Verkehr über den Cambridger Makadam schoss. Das seien die beiden Male gewesen, da sie sich ganz gefühlt habe, lebendig, überglücklich, in Ekstase. Als ich einwandte, dass sie doch eine Heidenangst gehabt haben müsse, unsicher, ob sie das überleben würde, sagte sie, dass gerade die Angst vor dem Tod die Erfahrungen färbe und zu den glücklichsten ihres Lebens mache. Ich erinnere mich noch genau, wie sanft sie schaute, als sie daraufhin sagte, dass die Liebe zu mir dem ähnele, einem Beinahe-Sterben, einer Ergebung, die der Ergebung in den Tod gleiche.
War es die Sorglosigkeit meiner Jugend, ein Dichterleiden oder der Einfluss aller Mythen über das Sterben und {32}die Auferstehung, dass ich nie erschrak, wenn sie vom Tod sprach, mir unmöglich vorstellen konnte, dass sie – dieses ausgelassene, lebenslustige junge Wesen – vom Tod des Körpers sprach, den ich so leidenschaftlich liebte, sondern immer an einen symbolischen Tod dachte? Wer schöpferisch sein will, muss in seinem Leben Dutzende Male sterben. Er muss sich loslösen, von geliebten Menschen trennen, vom Boden, vom Land, der Familie, seinen Freunden und vor allem von den Ideen, in die er sich eingekapselt hat. Keine Wiedergeburt, ohne dass zuvor eine Art Tod stattgefunden hat. Die Literatur liebt die Zerstörung, die ein neues Leben ermöglicht. Ich wollte nichts lieber, als ihr wie eine Hebamme bei der Geburt dieses poetischen Selbst zu helfen. Wie für alle Eltern war das Kind für uns die große Unbekannte, und wir ahnten nicht, dass es alles und jeden zerstören würde, auch sich selbst.
Vielleicht war mir das alles damals noch nicht klar, begriff ich es erst, als ich die Tagebücher las und immer wieder darauf stieß, wie eng Liebe mit Wut, Nachgeben mit Kämpfen verknüpft war, welch leichtsinniges Glück sie erfuhr, wenn sie alles aufs Spiel setzte, dass sie den Atem des Todes im Nacken spüren musste, um leben zu können. Abgesehen davon, dass ich dort lesen musste, wie sie die Ekstase des gefährlichen Ritts, am Hals des Hengstes hängend, als Metapher für das Verlangen nach ihrem grausamen Geliebten in Paris benutzte und – mir gegenüber, mit feuchten Augen vor Entzücken darüber, dass sie nun einen Adam hatte – nur den Namen der Figur änderte, um das Bild der Liebe zu mir daraus zu machen, sah ich auch, dass sie die Anekdote {33}endlos wiederholte, weil sie selbst auf der Suche nach deren Bedeutung war. Was sie während der Abfahrt ins Unbekannte und des Ritts auf dem durchgegangenen Pferd erlebte, war das Glück des Kontrollverlusts, der Ergebung in ein echtes Selbst, das einzige Selbst, mit dem sie lieben konnte, ohne sich für diese Liebe zu hassen. Sie war in einer Liebe gefangen, die von Dankbarkeit gefärbt war – dieser schreckliche Fallstrick der Caritas –, und glaubte, jemanden nur dann wahrhaftig lieben zu können, wenn sie haltlos war, im freien Fall, befreit von den Zügeln, an denen sie von fürsorglichen anderen geführt wurde.
Keine vier Monate nachdem sie mich mit einem Biss in die Wange zu dem Ihren gemacht hatte, heirateten wir heimlich, ohne meine Familie und unsere Freunde einzuweihen. Es war eine nüchterne Zeremonie in der Kirche St. George the Martyr, draußen regnete es, und als ich ihr den Ring auf den zitternden Finger schob, weinte sie. Wie sie da stand, zerbrechlich, blass und bibbernd in einem babyrosa Kleid, den erwartungsvollen, tränenbenetzten Blick zu mir erhoben, glühend vor Glückseligkeit, weckte sie alles in mir, was ich an Ritterlichkeit, Zärtlichkeit, Fürsorge und Liebe besitze, in einem Maße, wie ich es nie für möglich gehalten hätte, ein hündisches Verlangen, sie gegen alles Böse zu beschützen und sicher durch den Urwald zu lotsen.
Ich hatte mich noch nie so gewollt gefühlt, so notwendig.
Die überwältigende Liebe, die sie in mir aufrührte, erinnerte mich an den Jungen, der aus dem Wald verletzte Vögel mit nach Hause brachte und ihnen so lange in Milch {34}eingeweichte Brotkrümel in die aufgesperrten Schnäbelchen stopfte, bis sie wieder aus eigener Kraft fliegen konnten.
James Joyce war der Gott, der unserer Verbindung seinen Segen gab. Es war der 16. Juni 1956, Bloomsday, der Tag, mit dem Ulysses beginnt und schließlich endet in einer Litanei von Ja’s: »Ja, ich will, ja.« Und ich wollte es, ja, ich wollte sie, ja, zur Frau, zur Braut, zum Kind, ja, und alles, was sich ängstlich in einem Winkel meiner Seele versteckte, tarnte sich dort als summender Faun, der hin und wieder einen Refrain sang: bloomsday, doomsday.
Das einzige anwesende Familienmitglied war ihre Mutter, aus Amerika herübergekommen, um den Mann kennenzulernen, der ihr Schwiegersohn werden sollte. Obwohl sie einander ähnelten und ich sehen konnte, woher die ausgeprägten Wangenknochen, die charakteristische Nase, die ellenlangen Beine und die kohlrabenschwarzen Augen kamen, hatte ich vom ersten Moment unserer Begegnung an mit Aversionen gegen Aurelias Gesichtszüge zu tun, vor allem gegen ihren Mund und gegen etwas in ihrem Blick, ein jähes Erstarren, bohrend, streng und beängstigend. Das war auch der Blick, mit dem sie mich musterte, den Mann, der mit ihrer einzigen Tochter vor dem Altar stand, in ihren Augen ein in schwarze Lumpen gehüllter Heidebauer aus einfachem Hause, ohne Einkommen oder Besitz, Poet einiger weniger dürftiger Verse, ohne Namen, ohne Ruhm.
Anfangs war ich beeindruckt von ihrer Intelligenz, ihrer Belesenheit und der wachen Neugier, mit der sie alles in ihrer direkten Umgebung beobachtete. Aber es war vor allem die Wirkung auf ihr Junges – ihr ungelenkes Fohlen –, die mich schon bald beunruhigte. Ich hatte in diesen ersten {35}