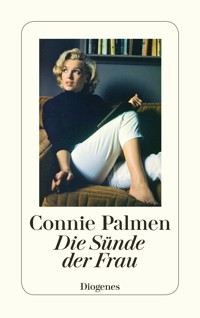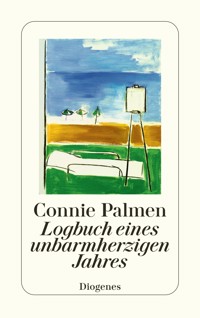
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Schriftstellerin Connie Palmen und den Staatsmann Hans van Mierlo verband eine späte symbiotische Liebe. In diesem Buch beschreibt sie, mit vielen Rückblenden in die Zeit ihres Zusammenseins, seine Erkrankung, seinen Tod und ihren Umgang mit Trauer und Verzweiflung. Bewegende Notizen gegen das Vergessen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Connie Palmen
Logbuch einesunbarmherzigenJahres
Aus dem Niederländischen vonHanni Ehlers
Titel der 2011 bei
Prometheus, Amsterdam,
erschienenen Originalausgabe:
›Logboek van een onbarmhartig jaar‹
Copyright © 2011 by Connie Palmen
Die deutsche Erstausgabe erschien
2013 im Diogenes Verlag
Umschlagillustration: Anna Keel,
›Montauk, Aussicht aufs Meer bei schönem Wetter‹,
Juli 1997 (Ausschnitt)
Copyright © Anna Keel
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2014
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24175 4 (1. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60288 3
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] In Memoriam
[7] »Mädchen, Mädchen, wenn du fällst, mach was draus.«
SONJA GASKELL
[9] 28.April 2010 (achtundvierzig Tage nach seinem Tod) Erste Notizen
Ich wollte einen Roman schreiben, der den Titel Judas tragen sollte – und da starb mein Mann.
Neununddreißig Kilo, Kiefersperre, Mund in Fetzen, Rachen in Brand. Magen greint, Darm jammert laut vor Leere, Herz rast, klopft, pumpt wie verrückt. Innen durch und durch kalt, außen perlt Schweiß an den Körperseiten hinunter wie Tränen. Nachts ist es klamm im Bett von der abkühlenden durchtränkten Wäsche. So sinnlich der Schmerz ist, der mich krank macht, die Organe scheinen nicht zu mir zu gehören, scheinen von mir losgelöst aufzuschreien.
Sie können mich nicht vertreten.
Nichts kann mich vertreten.
Da ist niemand, der zu vertreten wäre.
Ich bin ein einziges großes Defizit.
Es ist ein ständiges Sehnen, ein rasendes Verlangen, ihn zu sehen und zu liebkosen, seinen prachtvollen Körper, gehüllt in diese seidenweiche, sonnengebräunte Haut, sein schwindelerregend schönes Gesicht, seinen Mund, seinen Torso, seine Beine und Arme, seine Hände. Ich will zu ihm, auf ihn, will ihn um mich und in mir haben. Die Erinnerungen an den Sex in all diesen Jahren bestürmen mich Dutzende Male am Tag, kurze Szenen, Bildblitze, in hoher Frequenz abgefeuert, ohne Chronologie, ohne Ton.
[10] In den ersten zwei Jahren schlafen wir ineinander auf einer ein Meter vierzig breiten Matratze. Er ist fast ein Meter neunzig, ich fast ein Meter sechzig und halb so schwer wie er. Wenn er sich auf die andere Seite dreht, klaubt er mich von seinem Rücken wie ein Äffchen und bettet mich in die Beuge von Rumpf und angezogenen Beinen.
»Du kannst uns zusammen auf ein Bügelbrett legen«, beruhigt er eine Gastgeberin, als sie Bedenken wegen ihres schmalen Gästebetts äußert.
Seit Wochen nun schon bleibe ich am liebsten in unserem Bett, unter der Decke seiner und meiner Verlassenheit. Im Bett bin ich bei ihm, bei meinem Kummer über den Verlust meines wundervollen Mannes. Alle Fotos von ihm rauben mir den Atem, er war so lieb, so bezaubernd, so schön, so sexy.
Trauer bedient sich im Körper derselben Sprache wie Verliebtheit, da ist kein Unterschied. Die dummen Organe erzählen von Unruhe und Begierde, ohne eine Ahnung zu haben, dass das Verlangen nach einem Lebenden ein ganz anderes ist als das nach einem Toten. Herz, Darm, Magen, Haut, sie stimmen eine gleichlautende Elegie des Verlusts an. Darin liegt eine Mischung aus Furcht und Sehnsucht, eine Unsicherheit des Verliebten, der ständig zu dem anderen hin möchte, um sich zu vergewissern, ob sie noch lebt, diese Liebe, ob sie nicht womöglich in einem unbewachten Augenblick gestorben ist, einfach verschwunden, das könnte ja sein.
Verliebte haben Todesängste.
[11] Vom Moment des Kennenlernens an sind sich die Liebenden selbst nicht mehr genug, wissen sich keinen Rat mehr mit ihrem Körper, erkennen ihn nicht mehr als etwas von sich selbst, weil er krank ist vor Liebe, zu etwas Unvollkommenem, sehnsüchtig Bedürftigem geworden, das nicht richtig funktioniert, wenn es zu weit von dem anderen Körper entfernt ist. Die schmachtenden Organe des Verliebten beruhigen sich erst, wenn er den anderen sieht, riecht, berührt.
Er ist der Einzige, der meinen Körper beruhigen könnte, und er ist tot.
Trauer ist Verliebtheit ohne Erlösung.
Ich bin panisch ohne ihn.
Außer Un jour tu verras mit seiner Stimme habe ich dauernd eine Liedzeile aus einer Fernsehserie über Annie M. G. Schmidt im Kopf. »Ich würd dich am liebsten in ein Schächtelchen stecken.« Nach ein paar Wochen hört das auf. Kein Gesang mehr, keine Lieder.
Es ist unbegreiflich, dass ein Mensch das überlebt, dass das überhaupt zu überleben ist. Im Haus wacht mein jüngster Bruder über jede meiner Bewegungen, jeden meiner Schritte. Eines Abends bitte ich ihn um die Erlaubnis, sterben zu dürfen. Er verweigert sie mir. Okay, sage ich, dann nicht.
Gegen das rasende Herz bekomme ich Propranolol, einen Betablocker, gegen den unleidlichen Magen Omeprazol. Am liebsten würde ich eine Pille gegen das Leben nehmen, um für eine Weile davon befreit zu sein.
[12] Die Scham, als ich nach Wochen zum ersten Mal auf die Straße hinausgehe, ächzend, keuchend, schnaufend. Ohne ihn kann ich kaum laufen. Wenn ich Blicke auf mir spüre, bin ich mir bewusst, dass andere vor allem jemanden nicht wahrnehmen.
Ich bin jemand nicht.
Ich bin aberwitzig allein.
Manche schlagen die Hand vor den Mund, als sie mich sehen.
Sobald ich im Freien bin, höre ich Krankenwagensirenen. Ich erinnere mich, dass ich das schon einmal hatte, bei dem vorigen Tod, aber damals war auch ein Krankenwagen im Spiel, jetzt nicht. Seinerzeit habe ich mir dauernd vorgestellt, was ich nicht mit eigenen Augen hatte sehen können, das Zusammenbrechen, das Sterben, wie sie seinen Körper auf eine Trage bugsierten, die schmale Treppe hinuntertrugen, in den Krankenwagen schoben und mit heulenden Sirenen die Straße hinunterfuhren, quer durch die Stadt, ins Krankenhaus. Und dass er dort schon tot in diesem Krankenwagen lag, nicht mehr zu retten.
Der neue Tod hatte es etwas weniger eilig.
Hat diese akustische Halluzination mit dem zu tun, was ich zu ihm sage, wenn ich die Sirenen tatsächlich höre: Mensch in Not?
Oder sind die Sirenen das städtische Pendant zu den Totenglocken im Dorf: ein Zeichen dafür, das in einem der Häuser Traurigkeit wütet, weil jemand gestorben ist, der geliebt wurde? Schmerzensmusik. Leidensverkünder: In Ihrem Dorf, in Ihrer Stadt ist etwas Schreckliches geschehen.
[13] Die sensorische Halluzination der Nacht ist angenehmer, dann fühle ich seine Hand auf meinem Kopf, der darin geborgen ist wie in einem Nest. Manchmal fühlt sie sich so kalt an wie die Höhlung der toten Hand, in die ich eine Woche lang jeden Abend meinen Kopf bette, manchmal so warm wie im Leben. Kalt oder warm, vor Angst, die Illusion zu vertreiben, wage ich mich nicht zu rühren.
Nach ein paar Wochen hört auch das auf. Keine Hand mehr auf meinem Kopf, keine Illusionen mehr.
Die Tode unterscheiden sich. Der brüske Tod löste eine monatelang anhaltende Erschütterung aus. Bei dem Tod, dem ein Krankenbett vorangeht, setzt die Trauer im Leben ein. Ohne dass man die Hoffnung aufgibt, ohne dass man an sich heranlässt, dass es kein Kranken-, sondern ein Sterbebett ist, trauert man um das Leben, das noch ist, das man festhalten möchte, während man schon dabei ist, Abschied davon zu nehmen. Man glaubt es nicht, man kann es sich nicht vorstellen, es ist undenkbar – und doch.
Jeden Morgen werde ich wach, bevor gegen halb sechs die Vögel zu singen beginnen. Ich erwache anders als nach dem ersten Tod, als es nur eines Sekundenbruchteils bedurfte, bis mir die Realität bewusst wurde, die mich für den Rest des Tages zersplitterte. Jetzt erwache ich mit einer Mischung aus Schmerz und einem Fünkchen Freude über das Erwachen.
Ich bin wieder da.
Wenn ich an ihn denke, bilde ich mir ein, dass er in diesem Tod nicht mehr allein ist.
[14] Als ich widerwillig auf die eine Frage antworte, die ich eigentlich nicht beantworten will, verspreche ich mich. Ich sage: Ich bin in seinen Armen gestorben.
Manche fragen schon nach zwei Wochen, ob ich schreibe. Großer Gott, nein, allein schon der Gedanke! Diejenigen, die mich das fragen, wissen nichts von der Hölle, in der ich mich befinde, der Hölle, in der man nichts ist, nichts kann. Als ich schließlich hiermit anfange, mit diesem Logbuch eines unbarmherzigen Jahres, achtundvierzig Tage nach seinem Tod, streite ich es noch ab, sage, dass man es nicht Schreiben nennen könne, dass ich Notizen über Liebe und Tod mache, dass es mit meinem sonstigen Schreiben nichts zu tun habe, eher ein Hinkritzeln von Sätzen sei, als ritze ich mit dem Stift die Haut des Schmerzes. Ich tue es, weil ich weiß, dass man dies vergisst, diesen Horror der ersten Monate, des ersten Jahres, man vergisst es, wie man Zahnschmerzen vergisst – oder Wehenschmerzen, wie man erzählt. Man weiß noch, dass es schlimm war, schrecklich, der schlimmste Schmerz, den man je hatte, aber fühlen kann man es nicht mehr.
Vergessen dient einem Zweck: Niemand würde je wieder ein Kind bekommen oder einen anderen lieben wollen, wenn er noch genau wüsste, wie weh es getan hat, das Liebste zu bekommen, und wie weh, es eines Tages verlieren zu müssen.
Nicht anders als vor fünfzehn Jahren, als sich der Tod zum ersten Mal hereinschlich, suche ich andere, die mir erzählen können, ob sie diesen erschütternden Schmerz auch hatten, versuche ich, ihren einstigen Kummer zum Maßstab [15] zu nehmen und ihn mit dem meinen zu vergleichen, will ich wissen, wie lange die Geißel währt und ob es ein Mittel gibt, damit man weniger leidet, und sei es nur ein kleines bisschen. Antworten bleiben aus. Sobald ich den Schmerz anspreche, sehe ich, wie sich etwas Leeres in die Gesichter schleicht, eine für sie nicht mehr fassbare Erinnerung.
Es war furchtbar, sagen sie. Und es dauerte lange, jahrelang.
Ich mache diese Notizen gegen den Abschied des Vergessens, denn ich ertrage keinen Abschied mehr. Schreiben kann man es nicht nennen. Man schreibt, wenn man eine Form gefunden hat, eine Struktur, die die Sätze miteinander verbindet, einen gedanklichen Rahmen, der sie zusammenhält, antreibt und lenkt. Diese zügellosen Notizen verdienen es nicht, Schreiben genannt zu werden.
Ich schäme mich dafür.
Ich schäme mich, dass ich schreibe und wie ich schreibe.
Das Wort Tagebuch sagt mir nicht zu. Ein Tagebuch ist regressiv, mädchenhaft, weckt zu viele Erinnerungen an die Zeit, da ich tatsächlich Tagebuch führte, von meinem zehnten bis zu meinem fünfundzwanzigsten Lebensjahr, ein ohnmächtiges Schreiben als Gegengewicht zu meinem Verschweigen. »Logbuch« erscheint mir besser. Man kann ein Log in den Strom des Kummers senken, dessen Geschwindigkeit messen, dessen Tiefe peilen. Da darf man auch tagelang untätig liegen bleiben, weil man nicht mehr weiter kann, weil das Log im Schlamm stecken geblieben ist oder weil man an der eigenen Ohnmacht angelegt hat. Anfangs ist es eine intuitive Entscheidung, weil ich das vermaledeite [16] Tagebuchgenre umschiffen will, doch als mir ein zur See fahrender Freund erklärt, was ein Log eigentlich ist, wie es funktioniert, passt es auf einmal sehr gut zu dem, was ich vorhabe. Mit einem Log kann man die Schiffsgeschwindigkeit messen. Man senkt es an einer mit Knoten versehenen Leine ins Wasser, die man durch seine Hände gleiten lässt. Die Knoten auf der Leine haben einen festgelegten Abstand voneinander, der einer verstrichenen Zeit entspricht. Fahrtrichtung und Kurs auf offener See kann man damit zwar nicht bestimmen, wohl aber die Distanz, die man von da nach dort zurückgelegt hat, und somit die Position.
Wo bin ich?
Das möchte ein Kind als Erstes wissen, wenn es aus einem bösen Traum erwacht, angsterfüllt, mit ausschnitthaften Erinnerungen an den bedrohlichen Ort, in dem es vor wenigen Sekunden umherrirrte. Oder wenn es zum ersten Mal anderswo schläft und beim Aufwachen nicht gleich die Anker einer vertrauten Umgebung wahrnimmt. Wo bin ich?
Das Leben gleitet Knoten für Knoten durch meine Handfläche.
Jede Stunde einer.
Nach einem Monat schon fängt es an, zeigen sich die ersten feinen Risse in den Erinnerungen an die sechs Wochen und drei Tage Krankenbett, die seinem Tod vorangingen, an die erste Woche mit einem toten Mann, an die Wochen danach. Das Verblassen der Erinnerungen hat etwas von einem zusätzlichen Tod, von einem Verrat an der Liebe. Ich muss gegen das Vergessen anschreiben. Egal wie. »Do not go gentle [17] into that good night«, mahnt mich der Dichter. »Rage, rage against the dying of the light.«
Dylan Thomas dichtete über das Sterben.
Schriftsteller schreiben gegen den Tod an.
29.April 2010
Heute Nacht panisch aufgewacht, weil ich keine Ahnung habe, wo ich seine Tagebücher über die ersten Jahre unserer Liebe suchen soll. Soweit ich mich erinnere, hat er mir zuletzt in der Wohnung an der Prinsengracht daraus vorgelesen. Ich bin mir zwar sicher, dass ich es noch nicht verkraften würde, sie zu lesen, aber ich muss wissen, wo sie sind, wo seine Handschrift ist. Ich will sie nahe bei mir haben, im Bett, an meiner Seite. Mittags stelle ich an der Prinsengracht alle Schränke auf den Kopf, suche, wo sie unmöglich sein können, unter dem Bett, im Gartenhaus, zwischen der Bettwäsche in der Kommode. Ich höre erst damit auf, als mein Herz wieder stampft wie ein tollwütiger Stier.
30.April 2010
Was mag nur so beruhigend daran sein, umhergefahren zu werden? In den ersten Wochen nach seinem Tod machen mein Bruder und meine Freunde lange Autofahrten mit mir. Wir fahren durch die Polder, durch Naturgebiete im Norden Hollands, durch Städte. Unterwegs nach nichts und [18] nirgendwo. Solange die Fahrt dauert, lässt sich mein Körper täuschen und verhält sich ruhig.
Als ich heute zum ersten Mal die hundertachtzig Kilometer fahre, die mich von meiner Mutter trennen, sitzt er neben mir und singt Lieder. Er singt Helder in de kelder, boter bij de vis,Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen, Kann denn Liebe Sünde sein, und er singt Un jour tu verras von Anfang bis Ende, sämtliche Strophen.
Un jour tu verras
On se rencontrera
Quelque part, n’importe où
Guidés par l’hasard
Er ist der zweite Mann in meinem Leben, der dieses Chanson von Mouloudji auswendig kennt. »Immer, wenn du das singst, wünsche ich mir, es wäre wahr«, sage ich zu ihm. »Ich wünsche es mir sogar, wenn du neben mir sitzt.«
3.Mai 2010
Der einzige Ort, an dem sich die Tagebücher sonst befinden können, ist der Safe in seinem Arbeitszimmer. Sowie die Sekretärin auf meine Bitte hin den Panzerschrank geöffnet hat, erkenne ich die beiden Hefte im Folioformat mit dem schwarz und dem hellblau marmorierten festen Einband. Bevor die Sekretärin sie anfassen kann, schnappe ich sie mir und drücke sie an meine Brust. Im Bett lege ich sie dorthin, wo sein Körper liegen sollte.
[19] 11.Mai 2010
Hans ist zwei Monate tot. Meine Freundin Marleen Stoltz schickt mir eine SMS aus Frankreich. »Und heute ist der Elfte.« Für mich noch derselbe.
13.Mai 2010
Simon Spaapen, der Mann seiner Schwester Oliviera, ist tot. Er starb in dem Pflegeheim, in dem er die letzten Jahre untergebracht war. Hans musste oft an unseren Besuch bei Simon denken, als er gerade erfahren hatte, dass er Alzheimer hatte. »Simon schaute auf die Uhr, und an der Angst in seinem Blick konnte ich ablesen, dass er nicht mehr wusste, wie spät es ist.«
14.Mai 2010
Die Einfachheit der Deutung sollte mich warnen, aber trotzdem, mein schon von Natur aus großes, jetzt aber allmählich an Wahnsinn grenzendes Misstrauen gegen eine bestimmte Art von Menschen – die Schleimer, die Frömmler, die Kriecher und Dienstfertigen – lässt meine Spinnenphobie in einem erhellenden Licht erscheinen. Darin liegt die Angst vor dem Netze spinnenden Tier, vor einem Gliederfüßer, der Mittelpunkt eines Gespinstes mit anderen, Netzwerken, Familien, Freundeskreisen, ist. Netze werden mittels gemeinsamem Wissen und Diskretion gesponnen. Sie sind die [20] feinmaschig gewobenen Verbindungen von Eingeweihten, und aus ihnen ergeben sich grausame Ausgrenzungen. Wer außerhalb des Netzes ist, kann nur darin gefangen werden. Dann ist er eine Beute.
Arachnophobie ist die – zweifellos auch mit Neid gepaarte – Angst vor der Fähigkeit anderer, Verträge miteinander zu schließen und Bündnisse einzugehen, vor der Macht der Exkommunikation, die sie haben, sowie sie Teil einer Gruppe sind. Andere spinnen Netze, auf geheimnisvolle Weise, mit einem Talent für oberflächliche, aber dennoch wertvolle Kontakte, einem Talent, an dem es mir fehlt. Ich bin nur gut im eins zu eins, Haut an Haut, hautnah, wie es im Deutschen heißt. Wenn ich den einen habe, kann ich auf die Welt verzichten. Aber jetzt habe ich diesen einen nicht mehr und muss Netze spinnen. Ich finde das erniedrigend.
Der Schriftsteller ist erklärtermaßen indiskret. Er ist der Verräter, der Enthüller, der Entdecker. Er ist der Feind des stillschweigenden Übereinkommens, des dunklen Familiengeheimnisses, der finsteren Verschwörung, der Gruppe, des Klubs, des Verbands. Schamvoll, umsichtig, diskret, introvertiert und einnehmend im Umgang – sobald der Schriftsteller zur Feder greift, ist er ein Judas.
16.Mai 2010
Du musst trinken, sage ich mir, ein Glas Wasser holen, eine Brausetablette Vitamin C 1000mg darin auflösen, das ist gut für dich, davon wirst du dich besser fühlen. Ich tue nicht [21] so, als hörte ich ihn, als kümmerte er sich noch so fürsorglich um mich, wie er sich immer um mich gekümmert hat, als wäre es seine Stimme, die mich anspornt, für mich zu sorgen.
Ich folgere, dass ich das nicht tue.
Ich frage mich, ob das bedauerlich ist – ja, doch, das bedaure ich – und ob ich es mir aus irgendeinem blödsinnigen Grund untersage. Oder, schlimmer noch, leugne, dass es sehr wohl seine Stimme in mir ist, die mich anspornt. Und ich ihn damit toter mache als unbedingt notwendig.
Mir wird immer klarer, dass ich keinen Roman schreiben werde. Nicht, weil ich keine Fiktion daraus machen könnte, sondern weil ich in reinster Fiktion lebe, weil ich ganz und gar der Einbildung ausgeliefert bin. Ich erlebe die Gegenwart nicht. Alles, was ist, bei mir selbst angefangen, ist vor allem etwas nicht. Stunde für Stunde, Minute für Minute bin ich in der Einbildung seiner Anwesenheit.
Er ist überall nicht.
Man kann es nicht Denken nennen, nicht Schöpfen, es bringt mir nichts Neues. Es ist ein passiver Zustand des Ausgeliefertseins an das, was war. Das Ersinnen widerstrebt mir. Diesem Zustand Sinn zu verleihen ist unmöglich. Mich tröstet einzig und allein, dass es fair ist, dieses Leiden. Es ist eine Nachzahlung. Es ist der Tribut für diese Liebe, dieses Glück.
Annus horribilis, eine beschämende, fast schon unglaubwürdige Häufung von Unglück. Älteste Tochter aggressiver Brustkrebs, jüngste Tochter gerade von einem Sohn entbunden [22] und danach verraten und verlassen, bester Freund des Sohnes an ALS dahinsiechend, liebste Schwiegertochter Krebs, zwei Schwager tot, Bruder einer Freundin Krebs, eigener Bruder nur mühsam genesend nach schwerer Operation, präventiv, um schneller zu sein als der Krebs.
27.Mai 2010
Ich habe keine Schwestern. Die einzige Frau in meinem Leben, mit der ich direkt verwandt bin, ist meine Mutter. Daher ist es wundersam, was zwischen seiner ältesten Tochter Marie und mir geschieht, und zwischen seiner Schwester Doll und mir. »Marie und Doll sind die größten Geschenke, die du mir gemacht hast«, sage ich zu ihm. Sie sind Verwandte und sind es doch nicht.
Doll ist seine zehn Jahre jüngere Schwester, die schon seit zweiundvierzig Jahren in Rom lebt. Dort liegt sie im Sterben, Lungenkrebs, mit Metastasen im Gehirn. Als Doll mich mittags anruft und ich ihre Stimme höre, ihr munteres Plappern, bald begleitet von einem leichten Keuchen, das sie nirgendwo unterbinden will oder kann, muss ich verbergen, dass ich zusammenbreche vor Sehnsucht, sie in meiner Nähe zu haben, und vor rasender Angst, dass sie sterben wird. Conneke, sagt sie, mia carissima sorella, sagt sie. Doll ist die einzige Frau in meinem Leben, die das Verlangen nach dem, was ich nie hatte, weckte und zugleich befriedigte; sie ist die einzige Frau, an die ich denke wie an eine Schwester. Doll ist scharfsinnig und geistreich, kritisch und herzlich. Ich weiß nicht, warum, aber wir suchen gegenseitig [23] nach einer weiteren Verkleinerungsform für unsere Kosenamen und sagen selten Dolly, Connie, sondern Dolleke, Conneke.
Am Telefon bringt Doll zum Ausdruck, wie froh sie sei, dass Hans das alles nicht miterleben müsse, er hätte es nicht ertragen, dass sie Krebs hat. Ich kenne diese Argumentation. Die hatte ich beim vorigen Tod. Jetzt besitze ich diesen Hochmut nicht. Hans konnte besser mit Miseren umgehen als ich, größer, ruhiger. Sein Freund Boebie Brugsma hat ihn einmal einen Tranquilizer von neunzig Kilo genannt. Für mich war das gerade ausreichend.
In der Anfangszeit unserer Liebe verblüffte mich diese Ruhe. Ich erinnere mich an das eine Mal, als er telefonisch die Nachricht erhielt, dass die Tochter einer Freundin auf einer Afrikareise verunglückt sei. Ich höre ihn den Namen der Tochter aussprechen. Aus einer Reihe von Sätzen kann ich schließen, dass ihr etwas Schreckliches zugestoßen sein muss, aber von seinem Gesicht kann ich das Ausmaß des Unglücks nicht ablesen und denke deshalb, dass es wohl nicht so ernst ist. Als er den Hörer auflegt, sagt er: »Barbara ist tot.« Er ist verdutzt, als ich in Tränen ausbreche, zur Garderobe renne, um unsere Mäntel zu holen, und ihn dazu bewege, zu seinen Freunden zu gehen. Er hat die Realität schon abgelegt. Es dauert eine Weile, bis ich weiß, wie er das macht. Zum einen hilft ihm der Prinz in seinem Kopf, ein Alter Ego, das in allem perfekt ist, aber nur in seinem Kopf wohnt, und zum anderen nimmt er eine treffende Metapher, eine bildhafte Umschreibung, eine dramatische Geschichte zu Hilfe – in einem Interview, das er 1967 mit Bibeb führte, hat er das literarisieren genannt. In diesem Interview [24] spricht er mit ihr über seinen Abschied vom Glauben an Gott, mit einundzwanzig. »Ich war ein bisschen enttäuscht, dass es so leicht ging. Ich hätte mehr erwartet, ein größeres literarisches Abenteuer. Ich tendiere immer dazu, Erschütterungen in meinem Leben zu literarisieren.«
Er verwendet noch einen Neologismus: verpublifiziert. Den verwendet er, als ich ihn erst einen Monat kenne und er eines Morgens benennt, was für ihn an dieser Liebe neu ist: »Die Welt zu zweit.« Dann erläutert er, wie er jahrzehntelang vor vollbesetzten Sälen gesprochen hat, die Menschen zum Lachen und zum Weinen bringen konnte und dabei allein dastand und zu niemandem sprach. »Da merkte ich, dass ich das nicht mehr mit einem jemand konnte. Ich war verpublifiziert.« Ein paar Monate später, als ich von den zahllosen Auftritten absorbiert bin, die das von mir geschriebene Bücherwochengeschenk 1999 nach sich zieht, findet er mich auch verpublifiziert. »Ich habe Heimweh nach uns«, sagt er bekümmert.
Bibeb starb am 18.Januar 2010, wenige Tage bevor dieses unbarmherzige Jahr seinen Lauf nahm. Der Montag, an dem sie eingeäschert wird, ist der Tag, an dem Hans mir behutsam beibringt, dass er morgen ins Onze Lieve Vrouwe Gasthuis müsse, nur für ein paar Tage, zur Beobachtung. Es ist Montag, der 25.Januar 2010. Der Internist, mit dem er gerade gesprochen hat, hält seine Beschwerden für zu divergent und möchte einige Untersuchungen vornehmen. Hans hat Atembeschwerden und ist furchtbar müde. Er ist sogar zu müde, um zu Bibebs Einäscherung mitzugehen. Ich habe plötzlich Angst und beschließe, bei ihm zu bleiben.
[25] Bibeb interviewte mich im Winter 1995 in ihrem Haus an der Scheveninger Promenade. Sie war imposant und schön, lebendig und lachlustig, geistreich und gierig, um nicht zu sagen heißhungrig. Es war Februar. Wir hatten uns zu einem letzten, abschließenden Gespräch verabredet, als Ischa am 14.Februar, seinem zweiundfünfzigsten Geburtstag, einer Herzattacke erlag. Sie rief mich ganz außer sich an, geschockt über seinen Tod. Ich versprach ihr, dass wir das Interview abschließen würden, wie auch immer. Aus Dankbarkeit dafür, dass ich mein Versprechen hielt, schenkte sie mir ein Fläschchen Shalimar, das Parfüm, dessen Duft sie einhüllte und mir, wie ich ihr gesagt hatte, sehr gut gefiel. Mochte ihre Gesundheit in den darauffolgenden Jahren auch zusehends schwächer werden, sie erschien treu zu allen meinen Buchpräsentationen, jedes Mal mit einem Nachfüllfläschchen des Parfüms für den Schmuckflakon, den sie mir beim ersten Mal geschenkt hatte.
Wenn ich Shalimar rieche, denke ich an Bibeb – und an den Tod.
Es ist ein süßer Duft.
Er macht mich ruhig.
Nachmittags, nach Dolls Anruf, lädt Robbert Ammerlaan mich zum Essen ein. Wir haben eine Besprechung mit dem Testamentsvollstrecker Theo Bremer hinter uns, in der es darum ging, wie am besten mit dem intellektuellen Nachlass, den Vorträgen, Reden, den Memoiren, an denen er arbeitete, zu verfahren ist. Und wer in Frage käme, eine Biographie über ihn zu schreiben. Hans hat in den vergangenen Jahren meinen Verleger Mai Spijkers schätzen gelernt, fühlte [26] sich aber an seine früheren Versprechen gegenüber Robberts Verlag De Bezige Bij gebunden. Dort ist er von seinen Freunden umringt, von Harry Mulisch, Cees Nooteboom, Hugo Claus. (Ich merke, dass ich mir immer öfter den Animismus gestatte, den Toten zu umhegen, für ihn zu sorgen, ihm etwas Gutes zu tun.) Als mir Robbert im Restaurant gegenübersitzt, sagt er, noch bevor wir bestellt haben, dass er mir etwas Furchtbares erzählen müsse, von dem noch niemand wisse, aber ich würde es morgen oder übermorgen ohnehin erfahren. Tonio, der Sohn von Adri van der Heijden und Mirjam Rotenstreich, ihr einziges Kind, ist vor wenigen Tagen, in der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag, tödlich verunglückt.
Mitleid hat abstrakt zu sein, aber ich stelle mir die Körper von Vater und Mutter vor, Körper, in denen jetzt der Schmerz rast, mit dem ich seit elf Wochen zu leben versuche.
Leid kennt keine Hierarchie, heißt es, aber es gibt sie natürlich sehr wohl. »Ein Kind zu verlieren ist das Schlimmste, was es gibt.« Insgeheim ist jeder dieser Meinung. Obwohl ich ganz genau weiß, dass sich der Körper derselben Organe bedient, mit denen der Schmerz über und die Angst vor dem Verlust verspürt werden (weitere Instrumente, die Musik des Schmerzes zu spielen, hat er nicht zur Verfügung), das tiefe Leid ist etwas anderes. Kinder zu bekommen ist Teil der natürlichen Ordnung. Es ist der Trick der Natur, dem Leben Sinn zu verleihen oder zumindest die Illusion dessen. Wenn das Kind stirbt, verliert man ein natürliches Glück, und man verliert eine natürliche Bedeutung und Identität. [27] Gezeugt, ausgetragen, geboren, gestillt. Der Mensch ist ein schönes Tier. Das Kind macht einen Menschen zu Mutter oder Vater. Das Kind, das er bekommt, kennt er nicht, er weiß noch nicht, wer es ist, wer es werden wird. Und er kennt sich selbst noch nicht. Er weiß nicht, was für einen Vater oder was für eine Mutter das Kind aus ihm machen wird. Jedes Kind macht einen anderen Vater, eine andere Mutter aus ihm.
Die Entscheidung für einen Mann oder eine Frau liegt bei jedem Menschen selbst, bei dem, der er geworden ist, mit ebender durch eine Vergangenheit, eine Kultur und alle Entscheidungen, die er je getroffen hat, zusammengeschusterten Identität. Trotz Pheromonen, Oxytocin, Serotonin und anderen unsichtbaren Ketten der Biologie hast du das Gefühl, dass du dir deinen Mann selbst auswählst und dass du von ihm selbst ausgewählt wirst. Ohne die Wahl und die Verantwortung, die so eine Wahl mit sich bringt, keine Leidenschaft. Der Mann ist zuvor schon begehrt, geliebt, verlassen worden. Der Mann hat zuvor schon begehrt, geliebt, verlassen. Er ist von Geschichte gezeichnet. Du entscheidest dich für jemanden, der jemand ist.
Vor Jahren, als Adriaan Morriën und ich uns regelmäßig trafen, unterhielten wir uns einmal über den Tod. Morriën konnte in samtweichem Ton die härtesten Bemerkungen machen. Er war damals in den Achtzigern und meinte, dass es schlimmer sei, wenn ein alter Mensch sterbe, als wenn ein junger Mensch sterbe.
»Mit einem Kind wirfst du so wenig weg«, sagte er.
»Im Gegensatz zu dir«, sage ich.
[28] 31.Mai 2010
Dieses Schreiben ödet mich an. Dieses Ziellose, von nichts anderem angetrieben zu werden als der profanen Uhrzeit, statt von der Ewigkeit einer Idee, eines Zusammenhangs, einer Struktur. Es ödet mich genauso maßlos an, wie mich mein Leben jetzt anödet, die endlosen Tage, die Zerstreuung an den Abenden, die Leere der Nacht.
Das kommende Jahr und noch länger leben zu müssen, ohne Lust dazu zu haben, sich vor jedem Tag zu grausen, der vernichtet, zertrümmert, durchgenagt, beseitigt, hinter mich gebracht werden muss, um den nächsten anzugehen, der ganz genauso verwüstet werden muss.
Ich frage mich, ob ich das durchhalte.
Das heißt, nicht ich, diese sowieso schon verlorengegangene Einheit, sondern dieser Körper.
Falling apart, dieser englische Ausdruck für das Zusammenbrechen, für einen Zustand des Wahnsinns, trifft den Kern dessen, was geschieht, wenn ein geliebter Mensch stirbt: Es ist ein Sturz ins Abgespaltensein. Weil etwas auseinandergerissen wird, das zusammengehört. Man fällt aus dem heraus, was einen zusammenhielt, der Form dessen, was man ist, und damit fällt man aus sich selbst heraus, aus der Einheit, die ein Selbst ist, die aber nur dank des anderen besteht. Für Liebende gilt das harte Gesetz: Sobald das Wir nicht mehr da ist, bricht das Ich zusammen, zerfällt in Bruchstücke, zertrümmert, kaputt, durch nichts anderes zusammenzuhalten und zu definieren.
Nicht nur er ist tot, mein liebstes Ich ist es auch.
Der Tod hat mich abgespalten.
[29] Das Wort Symbolon hallt oft durch meinen Kopf. Manchmal kommt die Umgebung hinzu, in welcher sich der Mann bewegt, der das Wort beinahe wispert und immer mit unterschwelliger Skepsis erläutert. Die Umgebung ist ein Seminarraum in einem der Gebäude der Amsterdamer Universität, der Mann ist Cornelis Verhoeven, Professor für klassische Philosophie. 1988 soll ich bei ihm und Professor Hubert Dethier mein Examen in der Geschichte der Philosophie ablegen, aber noch fange ich gerade erst an und höre ihm zu. Er widmet der Übersetzung und Auslegung des Wortes Symbolon eine volle Stunde. Sümbolon spricht er es aus. Das sei eine Tonscherbe, erzählt er. Auf die Scherbe sei ein Geheimnis geschrieben, ein Geheimnis, das man mit jemandem teile. Um das Geheimnis zu bewahren und ein Zeichen der Zusammengehörigkeit zu haben, die durch das gemeinsame Wissen geschaffen worden sei, breche man die Scherbe in zwei Stücke. Damit mache man die Schrift für andere unlesbar. Das Symbol, das Zeichen, werde für die Außenwelt erst dann lesbar und damit bedeutungstragend, wenn man die Scherbenstücke zusammenfüge. Symbolon sei vom Verb symballein abgeleitet. Im Griechischen habe dieses Verb, wie nahezu alle Verben, mehrere Bedeutungen, aber für den guten Versteher hätten diese allesamt etwas miteinander zu tun: zusammenwerfen, begegnen, vergleichen.
Zusammen bedeutet wir etwas, als Symbol, als Zeichen, als Sprache. Das Paar ist eine Form, die Verkörperung eines Wir. Für andere ist man Sprache. Nur er und ich wussten auch, was wir bedeutet, wenn wir getrennt waren, jeder die Hälfte der Scherbe, auf der das Geheimnis dieses Wir geschrieben stand. Manchmal sehe ich es so vor mir, dass die [30] Hälfte des Symbolon begraben ist und ich das Wissen um das Wir noch in mir trage, während es in Wirklichkeit verschwunden ist. Unter der Erde begraben, unlesbar geworden.
Irgendeine Frau erzählte mir, dass sie nach dem Tod ihrer Tochter angefangen habe, intensiv Sport zu treiben. Das ist das Gegenteil von meinem zerstörerischen Rauchen und Trinken, aber es hat wahrscheinlich denselben Grund, es ist die Suche nach einem verlorengegangenen Ganzen, der Versuch, mit dem eigenen Körper eins zu werden, ihn wieder auszufüllen, jemanden daraus zu machen. Die Kummervollen geißeln ihren Körper, weil er beängstigend leer ist.
1.Juni 2010
Wie andere Freunde, die weit entfernt wohnen, schickt Kristien Hemmerechts mir regelmäßig Mails, um mich wissen zu lassen, dass sie an mich denkt. Vor zwei Wochen schickte ich ihr eine ausführliche Mail zurück.
verschickt:18.Mai 2010 12:41
AN:Kristien Hemmerechts
THEMA: Lies!
Vor zwei Wochen schenkte mir eine Freundin das Tagebuch der Trauer von Roland Barthes, und seither gelingt mir das Lesen wieder, wenn es denn um Schmerz und Unglück und das Am-Boden-Sein geht. Ich habe mein Leid-[31] Regal an der Prinsengracht ausgeräumt und lese jetzt dein Sprache ohne mich noch einmal. Und ich habe mir Der Tod hat mir einen Antrag gemacht gekauft. Ich verkehre also täglich stundenlang mit deiner Stimme und sehne mich danach, sie auch tatsächlich zu hören. Können wir uns nicht sehen? Noch stopfe ich meine Abende voll, weil mir so davor graut, aber es gibt reichlich Lücken in der Zukunft. Will sagen, sie erscheint mir als gähnende Leere.
Treu wie sie ist, steht sie heute an der Herengracht vor der Tür. Ihr gegenüber schäme ich mich nicht für das, was sie sieht. Sie kennt das. Wir haben uns noch nicht mal hingesetzt, da reden wir schon über die Todessehnsucht, die Thema ihres letzten Buches ist. Dass das ein Tabu sei, sagt Kristien. Ich gestehe ihr, dass ich Der Tod hat mir einen Antrag gemacht vorerst beiseitegelegt habe, weil ich mich vor dem Tag fürchte, da es ihr im Buch bessergeht und sie nicht mehr von einer Sehnsucht schreibt, die sie immer begleitet, zumindest seit dem Tod ihrer beiden Kinder, sondern von einer Depression, etwas, das vorübergehender Natur ist. »Hätte ich es düsterer machen müssen?«, fragt sie, eher sich selbst als mich. Zum Beweis, dass ihr Buch schwärzer ist, als ich mutmaße, erzählt sie, dass nach seinem Erscheinen zwei Menschen Selbstmord begangen hätten. Beide Selbstmörder seien aus dem Fenster gesprungen. Der eine, eine Frau um die sechzig, sei auf einem Mann gelandet, der diesen Selbstmord nicht überlebt habe. Es ist typisch für das, was sie und mich verbindet, dass wir über diese Geschichte lachen müssen, hinter vorgehaltener Hand und mit geächzten [32] Entschuldigungen, das schon, aber es ist ein Slapstick, wir können gar nicht mehr aufhören zu lachen, wir ersticken fast daran. Seit ich sie kenne, weinen wir zusammen vor Lachen. Manchmal fängt das schon an, wenn wir noch gar nichts zueinander gesagt haben, uns nur ansehen. Jetzt erst, da ich dies aufschreibe, wird mir bewusst, dass das mit dem Tod zu tun hat, mit dem Wissen vom Tod. Wer sagte noch, dass Humor eine Paarung von Intelligenz und Verzweiflung ist? Freud? Das ist der Humor, mit dem auch Marie sich durchs Leben spielt, etwas, das, wie Hans sagt, ihre Rettung ist. Marie verlor ihr erstes Kind. Sie musste es als kleine Leiche einige Tage in sich tragen und dann tot zur Welt bringen. (Diese grausame Realität hat sie an Harry Mulisch ausgeliehen, der in Die Prozedur Literatur daraus machte. Laura wurde darin zu Aurora.) Marie bekam vor einundzwanzig Jahren ein Hodgkin- und danach, während sie mit ihrer jüngsten Tochter schwanger war, ein Non-Hodgkin-Lymphom. Diesmal musste Marie ihrem Vater, ihrem kranken Vater, ihrem sterbenden Vater, erzählen, dass sie Brustkrebs hat. (Nein, nicht diese Szene, stopp, Schluss mit dem Erinnern, denk an was anderes.)
»Wenn ich Freunde besuche, die gerade ein Kind bekommen haben, denke ich, ohne es zu wollen, immer einen Moment, dass dieses Kind mir nichts, dir nichts sterben kann, dass so etwas möglich ist und die Eltern sich das nicht klarmachen. Und was für eine böse Überraschung das für sie wäre«, sagt Kristien.
Ich war in Lissabon, als ihr Mann dort tot auf dem Gehweg der Rua Marquês de Sá da Bandeira lag. Das war am 22.Mai [33] 1997. Mit Adriaan van Dis und Margriet de Moor saß ich auf einem Sofa in der Hotellounge, bevor wir zusammen zur Eröffnung des Literaturkongresses im Museu Calouste Gulbenkian spazieren wollten. Ich weiß nicht, worauf wir warteten. Ich weiß nur, dass das beängstigende Gerücht die Runde machte, jemandem von der Gruppe der niederländischen und flämischen Dichter und Schriftsteller sei unwohl geworden. Vielleicht warteten wir deswegen, glaubten, im Hotel eher zu erfahren, um wen es sich handelte. Adriaan und ich hatten uns angesehen und stumm die Befürchtung geteilt, dass es Hugo Claus sei. An der Rezeption läutete in einem fort das Telefon. Wir versuchten etwas vom Gesicht des Rezeptionisten abzulesen, der den Hörer abnahm und ihn nach wenigen Sätzen wieder auflegte. Adriaan ging zu ihm hin und erkundigte sich in einem Sprachenmischmasch nach dem Befinden des unbekannten Kollegen. It is not good, senhor. Man, woman? Man. Nombre? Don’t know. Male? Yes, serious. Hospital? No, senhor.