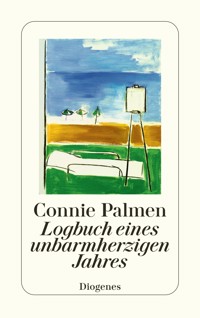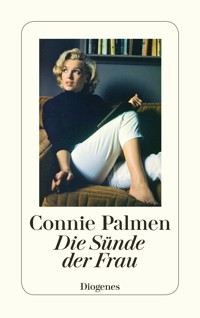18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Schon ihr ganzes Leben ist Connie Palmen fasziniert von weiblichem Künstlertum. Von schöpferischen Frauen wie Virginia Woolf, Sylvia Plath, Olivia Laing oder Joan Didion, die sich, jede auf ihre Art, von den Normen und Konventionen ihrer Zeit emanzipiert haben. In ihren Essays bewundert Palmen die Schaffenskraft, Autonomie und Einzigartigkeit ihrer intellektuellen Gefährtinnen – und eines Gefährten – und erkundet darüber hinaus ihr eigenes Leben als Schriftstellerin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Connie Palmen
Vor allem Frauen
Über Virginia Woolf, Sylvia Plath, Joan Didion u. a.
Aus dem Niederländischen von Lisa Mensing
Diogenes
Persönliche Essays sind zwangsläufig intim. Die Frauen und der eine Mann in diesem Buch wecken in mir das Verlangen, so oft wie möglich in ihrer Nähe zu sein, und teilen damit das wichtigste Merkmal aller echten Freunde und Geliebten: Ihre Anwesenheit macht mein Leben schöner, spannender, geistreicher, komplexer und verständlicher. Um sie zu würdigen, habe ich hier für jede Person eine der Eigenschaften ausgewählt, die in ihrem Werk besonders hervorsticht. Zusammen formen sie die Errungenschaften der Schriftstellerin, die ich am liebsten wäre.
Connie Palmen
Virginia Woolf
Autonom
Ich messe die Zeit anhand der Dauer von Aufbruch zu Aufbruch, vom Kinderzimmer in meinem Geburtshaus bis zu den Zimmern im Grachtenhaus, wo die Reise enden wird. Worte sind Welten. Für eine Frau ist es nahezu unmöglich, über ein Zimmer zu schreiben, ohne sich vor Virginia Woolf zu verneigen. In ihrem kühnen Essay aus dem Jahr 1929, Ein Zimmer für sich allein, behauptet sie, eine Frau benötige ein eigenes Zimmer, Geld und Muße, um Schriftstellerin sein zu können. Sie konkretisiert das, nennt einen Betrag, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts für ein gewisses Maß an Unabhängigkeit ausreichte, und stellt an das Zimmer die Anforderung, abschließbar zu sein. Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt werden, kann eine Frau die Fähigkeit entwickeln, selbstständig zu denken, eigene Ideen zu verfolgen und die ungeheure, autonome Arbeit zu verrichten, die das Schreiben von Literatur schließlich ist.
Dass endlich jemand behauptet, selbstständiges Denken sei eine Fähigkeit, die man entwickeln müsse, etwas, wofür Muße nötig sei, wofür man sich den Raum und die Zeit nehmen müsse, dass es nichts sei, was man morgens mal eben so unter der Dusche mache, bevor man das Frühstück für die Kinder zubereite und zu seiner richtigen Arbeit gehe, schon allein das ist bemerkenswert. Denken ist die Arbeit.
Ich hatte immer ein eigenes Zimmer. Und ich hatte immer Geheimnisse. Sie gehören zusammen, in ihrer Verflechtung waren sie in meinen Jugendjahren die nötige Voraussetzung für meine Selbstständigkeit.
Immer noch schließe ich die Tür ab, schließe andere aus, und immer noch habe ich viele Geheimnisse und wenige Vertraute. Bei allen Zimmern, die ich je bewohnt habe, erinnere ich mich daran, welche Bücher ich dort gelesen und was ich dort geschrieben habe, und bei allen Zimmern erinnere ich mich daran, was ich in jener Zeit, in der ich sie bewohnte, vor anderen verschwieg. Die Geheimnisse waren nötig, um mich abzuschirmen, mich ungesehen zu wissen und mir so die Autonomie zu bieten, die ich benötigte.
Ich schließe keine mir feindlich gesinnte Welt aus, sondern gerade die Menschen, die ich am meisten liebe. Oben in meinem Mädchenzimmer widerstand ich dem Lockruf der Familie, den Klängen, die mich vom Erdgeschoss aus zu sich riefen, dem hellen Sopran meiner Mutter, der sonoren, beruhigenden Stimme meines Vaters, den überschwänglichen Gesprächen zwischen meinen drei Brüdern und ihren Freunden, die Musik, die sie hörten. Eagles. The Kinks. Jackson Browne.
Ich wollte dabei sein, und ich wollte nicht dabei sein.
Als einziges Mädchen wusste ich, dass die vertraute Stimmung zwischen den Jungen sofort umschlug, sobald ich das Zimmer betrat, dass ich durch meine Anwesenheit alles vernichtete, von dem ich ein Teil sein wollte. Ich belächle jeden, der den Unterschied zwischen Jungen und Mädchen leugnet.
Unter der Matratze versteckte ich ein Tagebuch. Hinter einer verschlossenen Tür schrieb ich über alles, nur nicht darüber, was ich sah, erlitt, erlebte, glaubte, dachte. Das hielt ich geheim. In den Jahren und den Zimmern danach waren es die Freunde, die Liebhaber und schließlich die Geliebten, vor denen ich die Tür verschloss, hinter der ich mich zurückzog, vorübergehend oder langfristig abgeschirmt vor der Liebe, die sie geben wollten, und vor der Liebe, nach der sie verlangten.
Worte sind Welten. Bevor ich mit einer Geschichte anfange, bitte ich die Sprache um Unterstützung. Ich suche nach der Herkunft eines Wortes, um herauszufinden, in welchem Boden es wurzelt, wie es sich in der Geschichte verzweigt, welche Reise es gemacht hat, was die Genese eines Begriffs mir zu erzählen vermag. Es ist wie mit Menschen: Wenn man weiß, woher sie kommen, aus welchem Land, welcher Familie, welchem Sprachraum, dann versteht man sie besser. Von dem niederländischen Wort kamer (Zimmer) weiß ich, dass es zur gleichen Wortfamilie wie Geheimnis und Freundschaft gehört. In camera, in secret. Das Sekret, die Absonderung, das Verborgene und das Verlangen nach Reinheit und Echtheit sind miteinander verbunden, es sind meine Kameraden, es sind die notwendigen Bedingungen für die Autonomie, die das Schreiben erfordert. Sie haben mir das Leben schön und schwer gemacht. Für das Hegen von Geheimnissen zahlt man den hohen Preis der eingebüßten Intimität – dabei war gerade sie es, die ich mir von Freundschaft und Liebe erhoffte. Ein Dilemma, mit dem ich zu leben gelernt habe.
Ein Kamerad ist jemand, mit dem man sein Zimmer, eine kamer, teilen kann, jemand, vor dem man vielleicht nicht nichts, aber doch wesentlich weniger zu verbergen hat als vor denjenigen, die draußen bleiben. In meiner Jugend sehnte ich mich maßlos nach einer Freundschaft, die die Einsamkeit des Schweigens lindern würde. Ich sehnte mich nicht so sehr danach, mit jemandem meine Geheimnisse zu teilen – ich sehnte mich nach jemandem, der es ertrug, dass ich sie hatte. Der Raum, in dem ich mich absonderte, eine Trennung erschuf zwischen mir und den anderen, ist auch der Ort, an dem ich alle ausschlaggebenden Entscheidungen über den Verlauf meines Lebens traf, die Beschlüsse fasste, durch die ich mich von allen, die ich so lächerlich liebhatte, unterscheiden und absondern sollte.
Ich wollte allein und zusammen sein.
Oben, im Kinderzimmer, in dem Haus, in dem ich geboren wurde, begannen die ersten Balanceakte, um mich zwischen diesen Extremen bewegen zu können, zwischen Souveränität und Intimität, zwischen Verbergen und Enthüllen. Jetzt, so viele Jahrzehnte später, stehe ich in den Zimmern meines letzten Hauses noch immer schwankend auf dem Balken.
Das größte Geheimnis war stets das Schreiben. Und ist es bis heute. Es ist nicht das Schreiben selbst, das anmaßend ist, sondern der Grund, warum ich es mache.
Einer Wortherkunft nachzuspüren ist auch eine Möglichkeit, die Zeit zu dehnen, noch eine Weile die Worte zu umkreisen und so ihre drohende Geiselnahme hinauszuzögern. Solange sie mir in keinem Satz dienen müssen, sie nicht von mir eingeschlossen und eingeschränkt oder mit anderen Wörtern vermählt werden, sind sie in ihrer ungebundenen Freiheit ausdrucksstärker. Die Erregung, die ich empfinde, wenn ich einem Wort nachspüre, wenn das Denken durch die jahrhundertealte Sprache angekurbelt wird, die Bestätigung von vermuteten und die Entdeckung von unvermuteten Zusammenhängen ist unvergleichlich. Dieses spannende Enthüllen, das detektivische Verfolgen der Spuren, die ein Wort in der Biografie seiner Existenz hinterlassen hat, der Ketten, durch die es an andere Wörter gefesselt ist, die genealogische Schatzsuche nach einem entfernten Cousin, einem unheimlichen Familienmitglied, einer unverheirateten Tante, diese Freude des Aufdeckens muss hinter einer verschlossenen Tür stattfinden, ungesehen. Jedem solitären Genuss wohnt etwas Perverses und zugleich Sakrales inne. Das Unvermögen, es mit einer geliebten Person zu teilen, ist eine der Formen, die das Glück der Einsamkeit annehmen kann. Es ist das Glück, das Geliebte einander gönnen.
Ich würde nicht nachdenken und schreiben, wenn ich keine Probleme lösen müsste, wenn ich nicht auf der Suche nach größeren Einblicken in mein Leiden und Handeln und das von anderen wäre, in den wiederkehrenden Plot von Konflikten, das sich wiederholende Drama des Verlassens, die Hartnäckigkeit von Irrtümern, in das Muster des Bösen, die Struktur des Guten. Virginia Woolf lässt sich in Ein Zimmer für sich allein von Dutzenden Schriftstellern, Dichtern und Figuren begleiten, sie wandert von Buch zu Buch, um ihren Geist zu schärfen und ihre Sicht auf das Thema zu untermauern. Mit diesen Bruchstücken stützte ich meine Trümmer.
Worte sind Welten. Mein etymologisches Lieblingswörterbuch steht in einem der Bücherregale, mit denen die Wände meines Arbeitszimmers verbarrikadiert sind. Es heißt Origins, es bündelt wertvolles Wissen über die Ursprünge des modernen Englischs, und es wurde mir von meinem Freund René Gude geschenkt, ein Jahr vor seinem Tod 2015. Um einem wuchernden Knochenkrebs Einhalt zu gebieten, war sein rechtes Bein amputiert worden. Mit einem unvorstellbar langen und aufrechten Rücken behauptete er sich heldenhaft gegen diesen Schicksalsschlag, auch wenn es ihn zerfraß. Eines Tages stieg er mir nichts, dir nichts mit seinem einen Bein in ein Taxi und stattete mir, ein Buch unter den Arm geklemmt, unangekündigt einen Besuch ab. Er wurde von der bangen Vorahnung getrieben, dass ich verzweifelt war, weil eine enge Freundschaft Risse bekam und ich nichts dagegen tun konnte. Der Kokon, den ich nach und nach um mich gesponnen habe, den ich genauso oft verfluche, wie ich ihn zu schätzen weiß, ist unsichtbar, aber stark, weshalb es nur selten vorkommt, dass jemand unangekündigt bei mir vorbeischaut. Ich öffnete die Tür, sah ihn dort stehen, kurzatmig vom hüpfenden Erklimmen der paar Stufen zum Absatz, zwischen den beiden Krücken hängend, und ich brach innerlich zusammen. »Das dachte ich mir schon«, sagte er. Das Buch unter seinem Arm war Origins, das Geschenk war liebevoll und bedeutsam. Weil er mir damit zeigte, wie stark unsere Freundschaft war und wie gut er mich kannte. Er wusste, dass ich verzweifelt war, weil sich ein ursprüngliches Drama in meinem Leben wiederholte. Wie all die anderen Male stand ich der Entfaltung des Plots machtlos gegenüber, weil ich in diesem Stück nicht das Opfer bin, sondern die Protagonistin.
Immer bin ich es, die fortgeht.
Schreiben ist Sprechen und Schweigen zugleich, es ist Verhüllung durch Enthüllung, es ist Anwesenheit durch Absonderung, Existenz durch die eigene Auflösung. Ich kann erst erzählen, was ich gesehen und gedacht habe, wenn ich andere ausschließe, mich in mein Zimmer zurückziehe, die Tür zumache, mir die Zeit nehme, Wörter für die von mir erfahrene Wirklichkeit zu suchen, um die alchimistische Verbindung zwischen außen und innen herzustellen, diese spannende Vermengung von faktischer Realität und persönlicher Erfahrung. Was ich alles denke und vertusche, während ich schweige, ist manchmal durchaus, aber oft nicht sanftmütig. Jeder, der mit dem Geheimnis verschwiegenen Wissens lebt, mit Erfahrungen, von denen er weiß, dass er sie eines Tages wahrscheinlich ans Licht bringen wird, ist von einem Hauch der Selbstverachtung umgeben. Judas ist der Dämon eines jeden Schriftstellers, er ist Geheimnis und Autonomie zugleich. Judas ist derjenige, der offenbart, und jede Offenbarung ist ein Verrat. Mit dem Verrat lässt sich nur leben, weil das Verlangen nach Wahrhaftigkeit am Ende die stärkste Triebfeder des Schriftstellers ist. Und es ist selten die Wahrhaftigkeit des anderen, die zur Diskussion steht, sondern meistens die Echtheit des Protagonisten, des Täters, des Schriftstellers selbst, die gefährdet ist.
Ich habe alle Zeit der Welt. Wenn ich nicht will, muss ich mein Haus nicht verlassen, nirgendwo zu einer bestimmten Zeit erscheinen, niemanden sprechen, und das tagelang, wenn mir danach ist. Ab Januar 2020 führte die drohende Ansteckung mit dem Coronavirus zu einem landesweiten Lockdown. Jeder stellte für jeden eine Gefahr dar. Die ganze Welt lebte plötzlich hinter verschlossenen Türen. In meiner direkten Umgebung sah ich, wie viel Ruhe und Glück ein paar Freunde und Bekannte durch die erzwungene Isolation erfuhren. Draußen lauerte die Gefahr, willkürlich und demokratisch wie der Tod. Das geteilte Schicksal und das dadurch entstandene abstrakte Gefühl der Verbrüderung bremste bei einigen auch das hektische Verlangen, immer und überall dabei sein zu müssen. Eine vom äußeren Lockruf verursachte innere Unruhe verschwand. Niemand litt mehr unter der Angst, eine amüsante Zerstreuung zu verpassen, von einer erlesenen Gesellschaft bei einem Dinner ausgeschlossen zu werden, nicht in den Genuss einer Vorstellung oder eines Festes zu kommen, kein Bestandteil eines Publikums zu sein, das einen einzigartigen und nicht wiederholbaren Abend erlebte. Das äußerst ansteckende Virus entpuppte sich als Heilmittel für das soziale Virus, das abgekürzt als FOMO (fear of missing out – Angst, etwas zu verpassen) mit aller Macht sein Unwesen treibt. Ich habe es in den letzten Jahren wie eine Lepra der Seele um sich greifen sehen, eine verunstaltende Krankheit. Das Bedürfnis zu einer Gesellschaft oder Gruppe zu gehören und genau wie andere wahrgenommen, unterhalten und betrachtet zu werden, ist der Feind von Konzentration und Muße, die für jede Form der Autonomie, Originalität und des selbstständigen Denkens nötig sind. Doch die Angst davor, draußen etwas zu verpassen, ist auch eine Quelle des Leids. Einige Jahrhunderte bevor Virginia Woolf ein eigenes Zimmer für jede Frau, die schreiben wollte, als notwendig erachtete, stellte sich Blaise Pascal die Frage, was die Ursache allen menschlichen Unglücks sei, und kam zu dem Schluss, es entspringe dem Unvermögen des Menschen, drinnenzubleiben.
Die allgegenwärtige Gefahr einer möglicherweise tödlich endenden Ansteckung löst anscheinend das Verlangen nach Läuterung aus, nach Reinigung. Wenn ich an die Pandemie zurückdenke, bin ich keineswegs über den plötzlichen Impuls verwundert, die Zimmer in meinem Haus rigoros aufräumen zu wollen – stattdessen erstaunt mich, was mir zuerst in den Sinn kam. Eine Krise kann radikale Entscheidungen auslösen, den Wunsch, Wertvolles von Wertlosem zu unterscheiden, danach, aufräumen zu wollen, dem Wertlosen zu entsagen. Die Wurzeln des Wortes »Krise« greifen ineinander: das Geheimnis, die Unterscheidung und das Verlangen nach Reinheit sind miteinander verwachsen. Das Erste, woran ich dachte, waren die Briefe von Geliebten. Die störten mich, die mussten weg. Das war kein Impuls. Ihr jahrelanges Aufbewahren lastete in gleichem Maße auf mir wie die aufgehobenen Tagebücher meiner Jugend.
Ich mag das Entsorgen genauso gerne wie das Aufbewahren, das Wegwerfen vielleicht noch etwas lieber. Während des zeitweisen Lockdowns wanderten hinter einer verschlossenen Tür Dutzende Briefe durch meine Hände, fast immer rührte mich das Erkennen einer Handschrift, selten weckten sie meine Neugier auf den Inhalt. Wenn ich anfing, einen Brief von einer Person aus meiner Vergangenheit zu lesen, langweile ich mich innerhalb kürzester Zeit. Je schlechter der Schreiber, desto länger die Episteln, so lautet das Gesetz. Meistens reichte ein Absatz aus, um die gleiche Anklage wiederholt zu sehen: wie der Freund oder die Freundin oder der Bekannte sich derartig in mir geirrt haben konnte, wie zugänglich ich mich gegeben hatte, wie unzugänglich ich in Wirklichkeit war.
Das Szenario des eigenen ursprünglichen Dramas zeigt sich erst im Laufe des Lebens, wenn sich bestimmte Szenen regelmäßig wiederholen, ohne dass man durchschaut, wie sie zusammenhängen und warum sie geschehen. Für Virginia Woolf und alle Schriftstellerinnen ist das ursprüngliche Drama gerade das Drama ihrer Ursprünglichkeit, der Originalität ihres Geistes, der Genialität ihres Verstands. Die Eigenheit ihres Charakters und damit verbunden ihrer Sprache, die Unnachahmbarkeit ihres Denkens, alles, was sie abgrenzt, macht sie zu einer Außenseiterin, ungeeignet für ein risikoloses, gewöhnliches Leben.
In meinem ursprünglichen Drama bin ich eine Zerstörerin, die Urheberin des Bruchs, diejenige, die andere verlässt, manchmal, indem ich still und heimlich aus einem Leben verschwinde, manchmal, indem ich mir mit rasselndem Säbel einen Weg bahne. Wenn ich überhaupt Rechenschaft für meinen Fortgang ablege, erfinde ich einen Grund, von dem ich hoffe, dass er für den anderen erträglich ist. Ich erzähle selten die Wahrheit. In meinem Leben ist es nicht oft vorgekommen, dass ich mein Bedürfnis nach Autonomie und mein Bedürfnis nach Intimität in Einklang bringen konnte, aber die Male, dass es mir gelang, konnte nur der Tod diesem immensen Glück ein Ende bereiten.
Sylvia Plath
Wahrhaftig
Am 26. Juni 1953 nimmt Sylvia Plath den Fahrstuhl zur Dachterrasse des Barbizon Hotel an der Ecke Lexington Avenue und 63rd Street. Sie ist zwanzig. Es ist der letzte Tag ihres Aufenthalts in New York, wo sie einen Monat lang Gastredakteurin bei dem Frauenmagazin Mademoiselle