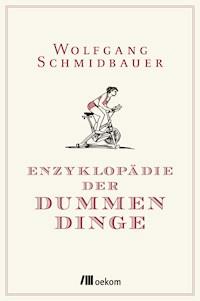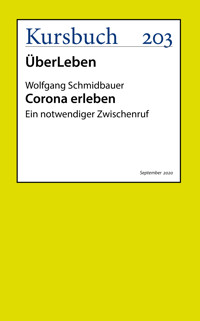9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Alle träumen wir davon, einen Partner zu finden, mit dem wir uns verstehen und der uns versteht. Doch wie oft endet die schönste Partnerbeziehung mit dem gegenseitigen Vorwurf: «Du verstehst mich nicht!» Der Psychoanalytiker und Paartherapeut Wolfgang Schmidbauer leuchtet hier die (meist unbewußten) Hintergründe aus, die Frauen und Männer so oft aneinander leiden lassen. Wer dieses Buch liest, versteht sich selber besser und wird so wieder fähiger zum Verstehen des geliebten Partners. «Denn vor allem», sagt Schmidbauer, «sollte man nicht aufhören zu lieben, wo man nichts mehr versteht und sich nicht verstanden fühlt. Die Menschen sind so verschieden, ihre Verständigungsmöglichkeiten so begrenzt, daß es sehr kalt wird in der Welt, wenn wir die Fackel nicht auch dorthin weitertragen, wo uns kein Licht mehr entgegenkommt.»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Wolfgang Schmidbauer
«Du verstehst mich nicht!»
Die Semantik der Geschlechter
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Alle träumen wir davon, einen Partner zu finden, mit dem wir uns verstehen und der uns versteht. Doch wie oft endet die schönste Partnerbeziehung mit dem gegenseitigen Vorwurf: «Du verstehst mich nicht!»
Der Psychoanalytiker und Paartherapeut Wolfgang Schmidbauer leuchtet in diesem Buch die (meist unbewußten) Hintergründe aus, die heute Frauen und Männer so oft aneinander leiden lassen.
Wer dieses Buch liest, versteht sich selber besser und wird so wieder fähiger zum Verstehen des geliebten Partners. «Denn vor allem», sagt Schmidbauer, «sollte man nicht aufhören zu lieben, wo man nichts mehr versteht und sich nicht verstanden fühlt. Die Menschen sind so verschieden, ihre Verständigungsmöglichkeiten so begrenzt, daß es sehr kalt wird in der Welt, wenn wir die Fackel nicht auch dorthin weitertragen, wo uns kein Licht mehr entgegenkommt.»
Über Wolfgang Schmidbauer
Wolfgang Schmidbauer, geboren 1941 in München, studierte Psychologie und promovierte 1968 über ‹Mythos und Psychologie›. Tätigkeit als freier Schriftsteller in Deutschland und Italien. Ausbildung zum Psychoanalytiker. Gründung eines Instituts für analytische Gruppendynamik. 1985 Gastprofessor für Psychoanalyse an der Gesamthochschule Kassel; Psychotherapeut und Lehranalytiker in München.
Er ist Autor zahlreicher Bücher; im Rowohlt Verlag erschienen: «Die Kentaurin», «Wenn Helfer Fehler machen», «Eine Kindheit in Niederbayern», «Mit dem Moped nach Ravenna», «Ein Haus in der Toscana», «Psychologie. Lexikon der Grundbegriffe», «Ist Macht heilbar?», «Alles oder nichts», «Liebeserklärung an die Psychoanalyse», «Weniger ist manchmal mehr», «Helfen als Beruf», «Hilflose Helfer», «Kein Glück mit Männern», «Jetzt haben, später zahlen», «Die Angst vor Nähe».
Inhaltsübersicht
Vorwort
Es ergab sich so, und ich sage dies eher zur Vorbereitung denn als Rechtfertigung: Meine Untersuchung der sexuellen Semantik entwickelt sich ähnlich wie die Psychoanalyse eines Menschen oder eines Paars. Sie beginnt bei den drängendsten Konflikten, versucht ein Stück Klärung, begegnet einem neuen Problem, greift es auf. In einer ruhigen Stunde blickt man zurück auf die Kindheit, aber eine aktuelle Belastung schiebt sich dazwischen. Der Analytiker lernt im Lauf der Zeit, daß es seiner Wahrheitssuche nicht förderlich ist, Druck auszuüben und den Abschluß eines Themas zu erzwingen. Ich hatte mich entschlossen, ein möglichst lebensnahes, praktisches Buch zu schreiben, und entnahm während der Arbeit daran viele Anstöße aus der Tätigkeit meines Alter ego, des Therapeuten. Als ich versuchte, die unsystematischen, essayistischen Entwürfe zu ordnen, war mir Gudrun Brockhaus eine große Hilfe, weil sie mit viel Aufmerksamkeit und Geduld das Manuskript durchging und half, rote Fäden einzuspinnen und Mäander zu begradigen. Aber da Geschriebenes ein Eigenleben gewinnt und ein Autor, der mit seinem Text ringt, keineswegs immer den Sieg davonträgt, bin ich nicht sicher, ob ihre Mühe genügend gefruchtet hat. Ich jedenfalls kann mich des Empfindens nicht erwehren, daß ich meinen Gegenstand nicht durchdrungen habe, sondern eher um ihn herumgewandert bin, um ihn unter verschiedenen Blickwinkeln in Augenschein zu nehmen. Das mag viele Gründe haben, angefangen von der professionellen Deformation durch die ständige Beschäftigung mit freien Einfällen und mit den spontanen Inszenierungen der Gruppentherapie, bis hin zur schwer durchschaubaren Natur der sexuellen Beziehungen, in denen sich doch Eigeninteresse, Forschungsimpuls und unbewußte persönliche Prägung nicht weniger mischen als Ansätze der verschiedensten Disziplinen von Biologie und Medizin bis zu Geschichte und Sozialwissenschaft. So tröste ich mich mit dem Gedanken, daß zwar der kürzeste Weg von Europa nach Neuseeland durch einen Tunnel führt, den ein Reisender mit übermenschlichen Fähigkeiten wohl zu bohren wüßte, die Reise um den Globus herum, durch die verschiedensten Landschaften, Völker und Klimazonen, immerhin aber auch Reize bietet.
Mein Dank gilt den Kollegen in meiner Supervisionsgruppe, die seit vielen Jahren meine Arbeit begleiten, den vielen Feundinnen und Freunden in der Gesellschaft für analytische Gruppendynamik und in der Münchner Arbeitsgemeinschaft für Psychoanalyse, den Analysandinnen und Analysanden, den angehenden Analytikern, mit denen ich erste Behandlungen besprechen durfte. Ihnen allen schulde ich eine Vielzahl von Hinweisen, Informationen, von szenischem Material, das in meinen Fallbeispielen verwendet wurde. Ich will hier aus Gründen der Diskretion niemanden mit Namen nennen und möchte auch bitten, meine Beispiele nicht mit existierenden Personen in Verbindung zu bringen, denn obwohl sie diesen alles verdanken, sind sie doch aus verschiedenen Informationsquellen so zusammengesetzt, daß jede Identifizierung dem vermeintlich Getroffenen nur Unrecht tun kann.
München, am 6.12.1990
W.S.
Einleitung
Vor sechs Jahren schrieb ich ein Buch über «Die Angst vor Nähe». Der Titel war nicht neu. Ich hatte ihn bereits in einer früheren Arbeit über «Helfen als Beruf» als Kapitelüberschrift verwendet, um Merkmale des Verhaltens der sozialen Professionen zu beschreiben. Für einen Text über die Beziehungen zwischen Mann und Frau, der auf Ratschläge verzichtet und sich in dem Grenzgebiet psychotherapeutisch-sozialpsychologischer Überlegungen bewegt, ist die «Angst vor Nähe» erstaunlich viel gelesen und mit gelegentlich unzweideutigen Absichten verschenkt worden. Meine Leserinnen (mehr als die Leser) reagierten oft heftig und für mich unerwartet auf das Buch. Sie fanden es fordernd, zum Teil bedrückend, zu scharf formuliert, unbarmherzig.
Dank meiner Doppelexistenz als Autor und Analytiker gerate ich gelegentlich in die verwirrende, aber aufschlußreiche Situation, Beziehungen untersuchen zu können, welche eine Leserin oder ein Leser zu einem Buch von mir aufnimmt. Viel eingehender als in Rezensionen oder in Gesprächen mit Freunden möglich, erfahre ich dann, auf welche Weise sich Text und Erleben verwoben haben, welche meiner Absichten ich erreiche, welche von mir nicht intendierten Folgen eintreten. Solche Erlebnisse erzeugen eine Mischung aus Neugier und Skepsis. Sie belehren über die Schwierigkeiten, fremde Theorie in eigene Praxis umzusetzen. Mir fallen dann Metaphern ein, wie jene von den Gedanken, die – wie unsere Kinder – zwar durch uns zustande kommen (was wir uns, genaugenommen, möglicherweise ebenfalls nur einbilden), dann aber eigene Wege gehen, so daß wir sie schließlich kaum mehr wiedererkennen.
In der «Angst vor Nähe» suchte ich die landläufige Gegenüberstellung von Männern, die Beziehungen scheuen oder abweisen, und Frauen, die sie sehnsüchtig suchen, durch Beispiele zu überwinden, wie beide Geschlechter in gleicher Weise durch gesellschaftliche Prozesse, vor allem durch ein auch in die Intimsphären vordringendes Leistungsdenken, in ihren Gefühlsmöglichkeiten unter Druck geraten. Die «Symbiosekriege» zeigten illusionäre Erwartungen, destruktive Abhängigkeit und Schuldzuweisungen von beiden Seiten. Männer wie Frauen rangen um Liebesbeweise und rechneten einander das Versagen vor, eine «gute Beziehung» aufzubauen. Obwohl skeptisch gegenüber Ratschlägen und Botschaften, hatte ich doch eine Absicht: angesichts des Anpassungs- und Verwöhnungsdrucks, den die Konsumgesellschaft auf zunehmend isolierte Individuen ausübt, Sensibilität für erschwerte Liebes-Bedingungen zu wecken, Paare zu ermutigen, öfter Gnade vor vermeintliches Recht zu setzen.
Von den meisten Grundthesen über die «Angst vor Nähe» bin ich nach wie vor überzeugt. Aber in mindestens einem Punkt scheint es notwendig zu differenzieren. In der Sehnsucht nach Gleichheit, nach einer idealen, alle anderen ausschließenden Beziehung, nach Treue und Verläßlichkeit unterscheiden sich Frauen von Männern. Die Auseinandersetzung mit der Arbeit von Psychoanalytikerinnen (Nancy Chodorow, Jessica Benjamin und Christa Rohde-Dachser, um nur einige zu nennen) und Linguisten (David Graddol, Joan Swann, Deborah Tannen) verknüpfte sich schrittweise mit Beobachtungen aus Einzelanalysen und Paartherapien zu dem Bild, das in dieser «Semantik der Geschlechter» gezeichnet wird. Vielleicht können wir heute, dank der fortschreitenden politischen Gleichstellung von Männern und Frauen, wieder freier über ihre psychologischen Unterschiede nachdenken und müssen uns nicht mehr von solchen Betrachtungen abwenden, weil sie ein Abweichen der Frauen von einem männlichen Standard implizieren.
Ich selbst habe mich während dieser Arbeit in einigen Punkten kritisieren gelernt. Ein Beispiel: Während einer längeren Bahnfahrt fragt eine Frau ihren Mann: «Hast du Hunger?» – «Nein!» In der Folge verschlechtert sich ihre Stimmung, schließlich meint sie ärgerlich: «Ich esse jetzt aber etwas! Dich interessiert anscheinend nicht, wie es mir geht!» Früher hätte ich dieses Verhalten der Frau als «symbiotisch» mit dem Stigma der Unreife versehen. «Man» sollte doch nicht erwarten, daß Bedürfnisse sichtbar werden, ohne daß sie ausgesprochen sind. Heute erkenne ich eher den semantischen Unterschied. Die Botschaft der Frau ist keine rein sachliche Frage, sondern ein Ausdruck ihrer Fürsorge. Wenn sie nur auf einer Sachebene beantwortet wird, bleibt diese Qualität unerwidert. Ihr Ärger ist verständlich.
Für Angehörige der helfenden Berufe scheint mir die Auseinandersetzung mit der Semantik der Geschlechter besonders lehrreich, weil die Helfer ohnedies in einem Zwischenreich angesiedelt sind. In einigen früheren Texten habe ich die Kulturen der «Fühler» und der «Macher» beschrieben[*], in denen sich pointiert auch der Unterschied zwischen einer vorwiegend von Frauen verwendeten «Beziehungssprache» und der «Sachsprache» im männerdominierten, juristisch-technischen Bereich spiegelt. Die «neuen Helfer» oder «Beziehungshelfer», zu denen auch ich gehöre, spielen in diesem Rahmen eine ähnliche Rolle wie die Meisterköche in einer kulinarischen Welt, in der traditionell und vorwiegend Frauen die Speisen zubereiten. Sie professionalisieren «Dienste», machen sie zu «Dienstleistungen», die sonst vorwiegend von Frauen ohne solche Qualifikationen erbracht werden. Experten schreiben Ratgeber über die «richtige» Kindererziehung, die «richtige» Zweierbeziehung.
Wenn ich in den «hilflosen Helfern» untersucht habe, weshalb es vielen Ärzten oder Sozialarbeitern so schwer fällt, selbst Hilfe anzunehmen, scheinen mir die soziolinguistischen Arbeiten, etwa von Deborah Tannen, eine gute Ergänzung.[*] Sie zeigen, wie Männer das Angebot von Hilfe als Erniedrigung, als Zuweisung eines geringeren Status interpretieren, während Frauen sich in der Regel viel selbstverständlicher darauf einlassen können, weil für sie ein Hilfsangebot den Wunsch nach einer emotionalen Beziehung enthält.
Als nicht zufällige und doch überraschende Übereinstimmung erkannte ich, daß meine Titelidee für die Semantik der Geschlechter «Du verstehst mich nicht» ziemlich nahe an den Titel eines neuen Buchs von Deborah Tannen kam – «You Just Don’t Understand» –, lange bevor ich dieses in die Hand bekam. Dieses Feld ist so geräumig, daß kein Autor dem anderen Platz wegnimmt; mir scheint sogar, daß sich eine Linguistin mit lebhaftem Interesse für die psychotherapeutischen Seiten des «Genderlects»[*] und ein Psychoanalytiker ergänzen, der sich mit den semantischen Folgen der körperlichen Funktionsunterschiede und der frühen Objektbeziehungen beschäftigt.
Wir leben gegenwärtig mit den Partnern unserer intimen Beziehungen in einer Situation, die ich mit einem Vergleich aus der Kunstgeschichte «historistisch» nenne. Anything goes[*]; wie im 19. Jahrhundert jeder Architekt aus einem Fundus von antiken, gotischen, renaissancehaften und barocken Formen wählte, um ein Mietshaus oder einen Vorstadtbahnhof zu gestalten, so müssen die Paare der Gegenwart aus einem breiten Angebot traditioneller, konfessioneller, emanzipierter, nostalgischer, progressiver, feministischer Vorstellungen wählen, wenn sie ihre Beziehung gestalten. Das setzt sehr viel mehr Verständigung und sehr viel mehr Verständnis für die Eigenart des jeweils anderen Geschlechts voraus, als es sich unsere Eltern hätten träumen lassen. Es gibt nicht mehr eine Norm, ein Vorbild, das von Müttern und Vätern übernommen und unter dem Segen der Kirche in der eigenen Ehe verwirklicht werden kann, sondern einen Baukasten mit ganz verschiedenen Modellen und Rezepten, die von Situation zu Situation ausgehandelt sein wollen. Manchmal werden sie in einer Spirale von sich steigernder Hektik durchprobiert, weil jedes Konzept zunächst eine glückliche Lösung verspricht, dann aber Nachteile und Schattenseiten entfaltet, die von der nächsten Lösung wiederum überwunden werden sollen. Häufig trennen sich Paare, wenn die Harmonie-Illusion der Verliebtheit zerplatzt und unterschiedliche Vorstellungen von Liebe und Bindung ausgehandelt werden müßten. Andere zahlen einen so hohen Preis für die wechselseitige Anpassung, daß sie bis an das oft lange hinausgeschobene Beziehungsende wie überschuldete Hausbesitzer drückende Zinsen in Form latenter Wut, heimlicher Verweigerung oder dauernder Schuldgefühle tragen. Kinder, von denen man einst annahm, sie würden eine Beziehung kitten, sprengen sie heute oft, weil ein prekäres Arrangement der wechselseitigen Autonomieopfer aus dem Gleichgewicht gerät. Die bisherige Ordnung der Beziehung erweist sich als brüchig, ohne daß eine neue Ordnung auch nur gemeinsam diskutiert werden kann – so schmerzlich sind die Kränkungen.
Die juristisch formulierte, praktisch allmählich fortschreitende Gleichberechtigung von Männern und Frauen wird oft so interpretiert, daß beide Geschlechter, von den unabweisbaren anatomischen Unterschieden abgesehen, gleich denken, empfinden, die gleiche Sprache sprechen und die Welt auf eine gleiche Weise wahrnehmen. Die historistische Beziehungskultur unterstützt diese Illusion und zehrt eine Weile von ihr, um sie in ihren Krisen radikal, bis zur Sprachlosigkeit und zu den getrennten Welten von Frauen- und Männergruppen zu verlassen. Die Illusion der Gleichheit wird deshalb so hartnäckig verteidigt, weil sie, wie viele Vorurteile, das Leben scheinbar erleichtert. Sie bringt eine komplexe Wirklichkeit auf einen schlichten Nenner.
In der Technik, vor dem Bildschirm des Computers, in der Wirtschaft und in den mathematisch disziplinierten Wissenschaften sprechen Männer und Frauen nicht nur dieselbe Sprache, sondern meinen auch das gleiche mit den verwendeten Worten. Aber wenn die für unser persönliches Glück gewiß nicht weniger bedeutungsvollen Liebesbeziehungen in den Mittelpunkt rücken, wird sichtbar, daß Männer und Frauen unter «Liebe», «Begehren», unter einer «guten Beziehung», unter «Entwicklung» oder «Grundlage» des Kontakts, unter einer «richtigen Trennung», unter Freundschaft und Sexualität ganz verschiedene Dinge verstehen und eine Verständigung weit schwieriger ist, als es die Illusion der Gleichheit erwarten läßt.
Auch die Vorstellungen der Wissenschaft über das jeweils andere Geschlecht entwerfen keine objektiven Bilder, sondern Schimären, Phantasien, welche das Selbstgefühl des jeweils Erkennenden stützen. Musterbeispiele sind die Freudsche These vom Penisneid der Frau oder die bei feministischen Autorinnen gelegentlich beliebte Aussage über die Beziehungsunfähigkeit, über den Egoismus der Männer, welche einsichtige Frauen doch endlich in Ruhe lassen sollten.
Die Semantik hat zur Grammatik in der Sprachwissenschaft ungefähr dasselbe Verhältnis wie die Anatomie zur Funktion in der Biologie. Die Lehre von den Bedeutungen sammelt (darin dem Psychoanalytiker vergleichbar) Assoziationen, Beziehungen, Hintergründe, um zu finden, was mit einer Aussage gemeint ist. Während die Grammatik eine Sprache reduziert und gewissermaßen ihr Skelett bloßlegt, die Mechanik ihrer Verknüpfungen prüft, erweitert und vertieft die Semantik die Perspektive einzelner Aussagen und entwickelt den Kontext, der sie bedeutungsvoll macht. Die These vom Penisneid etwa reduziert den Unterschied zwischen dem männlichen und weiblichen Körper auf die Anatomie – also ein Strukturprinzip der Leiche. Freud hat nur wenige Bedeutungen der körperlichen Funktionsunterschiede erkannt. Seine Auswahl hat Abwehrcharakter.
Nicht nur körperliche Merkmale führen Männer in einen anderen Kreis von Beziehungsphantasien als Frauen. Mindestens ebenso wichtig ist die Tatsache, daß in unserer Gesellschaft Mädchen fast immer als ursprüngliche, oft bestimmend bleibende reale Bezugsperson einen Menschen ihres eigenen Geschlechts haben, während Knaben mit einer Person des anderen Geschlechts aufwachsen. Dieses frühe Erleben von Gleichheit bzw. Verschiedenheit hängt mit der Sehnsucht nach Gleichheit und der «egoistischen» Hinnahme von Verschiedenheit zusammen, welche nicht wenige Beziehungsdebatten bestimmen. Unsere Gefühle, unverstanden zu sein oder uns nicht genügend verständlich machen zu können, wurzeln oft darin, daß wir nicht fähig sind, das Gesagte oder Gehörte in einen umfassenden Kontext einzuordnen. Die Verwechslung von Gleichheit und Gerechtigkeit kann diesen Unterbau für eine Verständigung in einen trügerischen Sumpf verwandeln. Sie führt zu dem Versuch, unterschiedliche Gefühle einer gemeinsam-rationalen Norm zu unterwerfen, und blockiert die Chance, das andere Geschlecht zu erkennen, seine Sprachregelungen und Sitten mit dem Interesse des Ethnographen zu beobachten und auf diese Weise Bruchstücke einer bisher fremden Sprache zu enträtseln.
Der Brennpunkt, in dem sich biologische, gesellschaftliche und familiäre Komponenten dieses Unterschieds verdichten, ist das Einzelschicksal von Frauen, Männern, ihren Liebes- und Haßbeziehungen. Wer es erforscht, steht immer einer ungeheuer großen Menge an Informationen gegenüber, die sich nicht ohne gewaltsame Schnitte aus ihren Vernetzungen trennen lassen. Eine Ahnung davon, wie diese Datenmengen zusammenhängen, gewinnt der Betrachter, wenn er Empathie und Intuition ins Spiel bringt, subjektive Qualitäten, die mit seiner eigenen Person und Geschichte zusammenhängen. Aus ebendiesen Gründen gab und gibt es in der Psychologie mächtige Strömungen, welche lieber die weitgehende Belanglosigkeit der untersuchten Phänomene ertragen, als solche in ihren Augen unwissenschaftliche Beliebigkeit in Kauf zu nehmen. Die Psychoanalyse hat eine andere Lösung gewählt, mußte es tun, denn sie ist auch Therapie, will in der Praxis wirken und strebt nicht nur nach dem Platz in den Ehrenhallen wissenschaftlicher Akademien. Sie bezieht das beobachtende, reflektierende, theoriebildende Subjekt in den Erkenntnisprozeß ein, prüft dessen «Gegenübertragung» und gewinnt dadurch Aussagen, die zwischen der Ausweitung des Subjekts in der schönen Literatur einerseits, der objektivierenden, existentielle Qualitäten des Menschen nicht fassenden Psychologie andererseits stehen. Solche Forschung darf nicht in Widerspruch zu dem geraten, was meßbar und bewiesen ist, aber sie muß über es hinausgehen.
Die Semantik der Geschlechter und die Psychobiologie der Geschlechtsunterschiede sind nicht nur wegen der Vielfalt möglicher Gesichtspunkte bisher wenig durchleuchtet, sondern auch deshalb, weil es schwierig ist, über dieses Thema ohne verborgene Interessen und heimliche Zwecke zu sprechen und zu schreiben. Die Aussagen treffen das Zentrum unserer Identität. Wer ist hier nicht verwundbar, bestrebt, sich zu schützen, so gut es geht? Unser Geschlecht ist immer mit mächtigen sexuellen Wünschen und Phantasien verbunden, deren mögliche Erfüllung zumindest unserem Unbewußten wichtiger ist als die genaue Wahrnehmung der Wirklichkeit des/der anderen. Ist das, was ich als wissenschaftlich-psychologische Aussage über den Geschlechtsunterschied mache, ideologisch – d.h., von versteckten, oberflächlich rationalisierten Absichten bestimmt? Geht es um Wissenschaft oder um Politik? Kaum haben Biologen einen angeborenen sexuellen Unterschied im Gruppenverhalten von Pavianen entdeckt, wollen sie den Leser überzeugen, daß es ganz natürlich ist, wenn im Obersten Sowjet keine einzige Frau sitzt.[*] Die Konstruktion eines überlegenen und eines unterlegenen, eines guten und eines bösen, eines auf Transzendenz und eines auf Immanenz hin orientierten Geschlechts eignet sich, die historistische Unsicherheit zu mildern, welche gegenwärtig in jeder ernsthaften Beziehung zwischen einer Frau und einem Mann entsteht.
1 «Du verstehst mich nicht …»
«Wir verstehen uns nicht mehr» ist neben «Wir haben uns auseinandergelebt» die Alltagserklärung für die Trennung zweier Menschen, die sich einst liebten. Was ein Paar zusammenhält, scheinen nach diesen Formulierungen «Verstehen» und «Miteinanderleben» zu sein. In einer anderen Metapher wird dieses beziehungsstiftende Element als refueling[*], als Auftanken beschrieben. Die Partner gehen getrennte Wege. Der eine arbeitet hier, die andere dort. Sie lesen verschiedene Bücher und finden unterschiedliche Musik reizvoll. Aber wenn sie sich als Paar erleben sollen, muß es immer wieder Perioden geben, in denen sie zusammen sind und etwas tun, was sie als gemeinsam erleben – Zärtlichkeiten austauschen, zusammen essen, miteinander sprechen, sich versichern, daß sie in einer genügend großen Zahl von Themen und Taten übereinstimmen. Eine meiner Hypothesen in dem erwähnten Text über «Die Angst vor Nähe» war, daß diese Übereinstimmung um so größer sein muß, Abweichungen um so stärkere Mißklänge auslösen, je schwächer die liebevollen Gefühle entwickelt sind und je weniger stabil das gute innere Objekt beschaffen ist.
Die Verläßlichkeit dieser Wiederkehr des Gemeinsamen nennen wir Treue, eine utopische Tugend.[*] Es ist sinnvoll, zwischen positiver und negativer Treue zu unterscheiden. Die erste, die positive Treue, bezieht sich auf den Partner selbst, der sicher sein darf, kontinuierlich das Ziel liebevoller Gedanken oder Handlungen zu sein; die zweite, die negative Treue, auf das Umfeld des Partners. Sie stellt den Anspruch, daß niemand sonst Ziel von Gedanken oder Handlungen sein darf, die mit denen verglichen werden können, welche man sich vom Partner wünscht. Mangelhafte Übereinstimmung hinsichtlich dieser beiden Formen der Treue kann die Wurzel sehr tiefgreifender Beziehungsstörungen sein. Die Entsublimierung, welche den Übergang zur Konsumgesellschaft markiert (vgl. S. 124), ließ Treue als veralteten Wert erscheinen, der emotionale Freiheit und erotische Befriedigung knebelt. Das führt gelegentlich zu dem merkwürdigen Phänomen, daß Partner in einem gemeinsamen Bekenntnis zur Untreue fest verbunden sein können.
In einer Therapiegruppe für Paare berichtet eine Frau von Ängsten, die durch eine flüchtige Liebschaft ihres Partners ausgelöst wurden. Sie wird darauf von einem Mitglied heftig angegriffen, daß sie feige sei, ihren Mann manipuliere, der sich das törichterweise auch noch gefallen lasse. Die ganze Atmosphäre in der Gruppe sei verlogen, alle täten so, als ob sie keine Lust auf außereheliche Beziehungen hätten, was ihnen in Wahrheit fehle, sei der Mut. Er und seine Frau hätten längst beschlossen, sich diese Freiheit zu gestatten, das sei kein Problem mehr in ihrer Ehe, beide fänden sie solche Außenbeziehungen bereichernd und fruchtbar.
«Aber wir sind doch wegen einer solchen Außenbeziehung hier», sagte jetzt seine Frau.
«Das ist etwas ganz anderes», sagte er. «Du wolltest ja ein Kind von dem Mann, und ich sollte es mit dir aufziehen. Das geht zu weit. Da mache ich nicht mehr mit.»
Ein Paar will eine Behandlung beginnen, weil der Mann mit einer Untreue seiner Frau nicht fertig wird. Sie sind über zwanzig Jahre verheiratet und haben bereits vor acht Jahren ihre nie sonderlich befriedigende sexuelle Beziehung einschlafen lassen. Beim Aufräumen im Arbeitszimmer seiner Frau entdeckt der Mann ein Bündel Briefe, die ihn von einer (inzwischen beendeten) Urlaubsliebe seiner Frau im letzten Jahr unterrichten. Er ist sehr betroffen, verfolgt seine Frau mit Anklagen, Trennungsdrohungen, Forderungen nach detaillierter Information über alle Einzelheiten dieses Seitensprungs. Im Verlauf dieser Auseinandersetzungen nimmt das Paar seine sexuelle Beziehung wieder auf, ohne daß dadurch die Eifersuchtsanfälle, Trennungswünsche und Depressionen verschwinden.
«Ich verstehe meine Frau nicht», sagt ein fünfundvierzigjähriger Mann, der mit grauem Gesicht und geröteten Augen in die Beratung kommt. «Seit sie erfahren hat, daß ich diese Liebschaft begonnen habe, ist sie nicht mehr wie früher. Dabei liebe ich sie, ich würde sie nie verlassen, sie hat mir diese Seitensprünge früher immer verziehen, und ich habe auch bei ihr nicht gefragt, wenn sie nach einem Faschingsball erst am Morgen nach Hause kam. Sie läßt es sich nicht erklären. Sie ist so schrecklich unglücklich, und das halte ich nicht aus. Wir waren so glücklich, ich habe immer gerne mit ihr geschlafen, das ist doch nicht selbstverständlich nach achtzehn Jahren Ehe! Meine Freundin hat ihr sogar einen Brief geschrieben, daß sie mich ihr und den Kindern auf keinen Fall wegnehmen möchte, aber sie ist nur noch wütender geworden, obwohl ich das ganz süß fand von der jungen Frau, da gibt es ganz andere, die sich kein Gewissen machen, in eine Ehe einzubrechen.»
Alle drei Szenen beleuchten den Konflikt, der in einem Paar durch den Einbruch von Unordnung entsteht. Die unbewußt verallgemeinerte Treuevorstellung, der Glaube daran, daß für den Partner gilt, was für einen selbst Gesetz ist, wird erschüttert. Damit ist die ganze Beziehung in Frage gestellt, eine Situation, die beide betrifft, während doch ursprünglich nur einer betroffen war. Die Möglichkeit der Befriedigung ist an ein Vertrauensverhältnis gebunden. Dieses wiederum hängt davon ab, daß jeder Partner sein inneres Bild des anderen mit dessen tatsächlichem Verhalten in Übereinstimmung bringen kann. «Ich verstehe dich nicht» heißt dann «Es kann doch nicht wahr sein, daß du meine Ordnung so grob verletzt!» Der oder die andere wird nur allzugut verstanden. Seine Botschaft paßt aber nicht in die etablierte Ordnung der Beziehung. «Ich verstehe dich nicht» lautet dann, übersetzt: «Ich bin nicht deiner Ansicht, wär’s aber gerne, bitte sage etwas anderes.» Oder: «Du bist’s nicht, nach dem ich mich sehne, geh weg, aber laß mich nicht allein!»
«Ich bin unglücklich, weil ich so allein bin», klagt ein vierzigjähriger Mann in einer Therapiegruppe. «Seit vier Jahren habe ich keine Beziehung zu einer Frau. Noch nie habe ich mir eine ausgesucht. Die Partnerinnen, die ich früher hatte, kannte ich alle aus der Arbeit, und daraus wurde dann schließlich eine intime Beziehung. Ich kann keine Frau ansprechen, ich weiß nicht, warum. Ich mag keine Frauen mehr treffen, die nur Kaffee trinken oder ins Kino gehen wollen.»
«Als ich dich zum ersten Mal sah, bin ich erschrocken, weil du mich so verächtlich angesehen hast», sagt eine achtundzwanzigjährige Frau.
«Mir haben schon viele gesagt, daß ich arrogant wirke», stellt er fest.
«Du hast eine Art muffiger Koketterie», bemerkt eine andere Frau. «Aber wenn ich mit dir nach der Gruppe zur Kneipe gehe, fällt mir vor allem auf, daß du auf einmal weg bist. Da sind Löcher, gerade warst du noch ganz freundlich, auf einmal ist gar nichts mehr.»
«Dann warte ich darauf, daß du auf mich zugehst!»
«Woher soll ich das wissen?»
«Ich fühle mich nicht verstanden von der Gruppe, nicht ernst genommen.»
In dieser Szene wiederholt sich die Lebenssituation. Kontakt wird ersehnt. Der Mangel an Gefühlsbeziehungen ist leidvoll bewußt. Er soll aber nicht durch Gefühlsausdruck, sondern durch Tips und Tricks hinsichtlich einer besseren Frauen-kennenlern-Technik behoben werden. Im Dialog wird deutlich, wie bedrohlich die ersehnten Geliebten sind. Hinter der Enttäuschung, daß es wieder bei einer «kameradschaftlichen» Situation gemeinsamen Kinogehens und Kaffeetrinkens geblieben ist, steckt Erleichterung. Wieder einsam in der Wohnungsburg, mit klassischer Musik und Siamkatze, ist’s sicherer, sich zu sehnen. Das quälende Gefühl, sich nicht verständlich machen zu können, hängt damit zusammen, daß außen gesucht wird, was nur innen zu finden ist. Die Frau, mit der er sachlich und distanziert Kaffee trinkt, müßte ihm das Gefühl geben, daß er verliebt ist. Sie müßte ihrer Gefühle so sicher sein, daß diese auf ihn übergreifen und seine Kritik überrennen. Dann hat sie ihn «verstanden», gewinnt die Beziehung eine Aussicht auf Erfolg. Folgende Komponenten lassen sich in diesem Lähmungszustand herausgreifen:
Die Vorstellung einer reinen und perfekten Liebe.
Aggressive Gefühle können nicht in eine Liebesbeziehung integriert werden.
Die Handlungsmöglichkeiten sind durch gleichzeitig bestehende Nähe- und Distanzwünsche gelähmt.
Schuldgefühle wegen der eigenen Hemmungen und Aggressionen, damit verbunden ein Gefühl verminderter Attraktivität.
Neid auf Menschen, die in ihren Beziehungen nicht in dieser Weise behindert sind.
Schuldgefühle über diesen Neid.
Gesteigerte Ansprüche an die Liebesbeweise potentieller Partner oder Partnerinnen.
Versuch, auf einer intellektuellen Ebene zu bleiben, um sich nicht diesen quälenden Gefühlen auszusetzen.
Verminderte emotionale Ausdrucks- und Abfuhrchancen.
Gesteigertes Bedürfnis nach Sicherheit, Ordnung und Kontrolle mit dem Anspruch der perfekten Lösung.
In unserem Modell ist das innere Objekt eine Metapher für die Möglichkeit, eine geliebte Person zu hassen, sich von ihr zu trennen und sich wieder an sie anzunähern, zu ertragen, daß sie einen nicht «versteht», und doch dem oben beschriebenen Lähmungszustand zu entgehen. Das innere Objekt ist die Voraussetzung jener Magie der Liebenden, die glauben, kraft ihrer Gefühle auch die Liebe des anderen erwecken zu können. Wenn es genügend gut ist, werden sie die erstaunlichsten Erfolge haben.
«Am Freitag ist’s mir sehr schlecht gegangen. Ich war bei meinem Freund zu einem Fest eingeladen. Er hatte für die Gäste gekocht. Ich kam später, als schon alles abserviert war. Er saß am Tisch, blieb sitzen, als ich hereinkam – früher ist er mir entgegengekommen, hätte mich umarmt –, winkte mir zu und unterhielt sich weiter mit Freunden, die eigens zu seinem Geburtstag gekommen waren. ‹Hast du Hunger?› fragte er mich, zeigte auf die halb abgegessene Platte mit Käse. Und obwohl mir die Schwarte krachte, konnte ich nichts mehr herausbringen, konnte ich nicht sagen, daß ich etwas wollte, ich hab alles abgelehnt, bin den ganzen Abend stumm dagesessen und habe gedacht, daß er mich nicht mehr liebt, daß ihm alle anderen Menschen wichtiger sind als ich. So wenig bedeutete ich ihm, daß er mir nichts zu essen aufhob, alle anderen hatte er gefüttert und mich nicht. Es war schrecklich, ich konnte einfach nicht anders empfinden und wußte doch, daß ich zu spät gekommen war. Nachher, als wir zusammen im Bett lagen und er mich fragte, warum ich so still sei, konnte ich es ihm endlich sagen. Er hat sich sehr gewundert, es war noch Essen im Kühlschrank und im Herd, er hätte mir ganz leicht etwas geben können, wenn ich’s gesagt hätte, aber es ging einfach nicht, es war unmöglich, ja es wurde noch schlimmer, weil ich mich so schämte und ihm doch nicht recht verzeihen konnte, daß er mich in diese Situation gebracht hatte, an der doch, genau besehen, nur ich selber schuld war.»
In dieser Szene aus der Analyse einer vierzigjährigen Frau läßt sich die Brüchigkeit des guten Objekts zeigen. Es war ein Konflikt vorausgegangen, wie er für den Übergang der Verliebtheit in den Alltag charakteristisch ist. Der Freund hatte sein altes Hobby, das Restaurieren von Oldtimern, wiederaufgenommen. Sie interessierte sich nicht für Autos. Er hätte sie gerne öfter in seiner Werkstatt gehabt, war über ihr Abwinken gekränkt und brauchte ebenso ihre Zuwendung wie sie die seine. Die Distanz hatte die Ambivalenzspannung verstärkt. Charakteristisch für die brüchige Objektkonstanz der Analysandin war nun, daß sie sich in dieser Situation in erhöhtem Maß auf Liebesbeweise ihres Partners angewiesen fühlte und proportional dazu unfähig war, selbst Wünsche zu äußern. Solange sie die Beziehung nicht wieder «in Ordnung» fand, war sie unfähig, ihre Triebbedürfnisse autonom zu erleben, d.h., ihren Hunger auszudrücken und zu befriedigen, wie es ihr in einer neutralen Situation gewiß möglich gewesen wäre; sie war sonst keineswegs schüchtern. Die Empfindung, ungeliebt und überflüssig zu sein, führte zu einer emotionalen Starre, die dem Verhalten des Tieres vergleichbar ist, das sich totstellt, wenn es sich von einem übermächtigen Feind bedroht fühlt. Erst im Bündnis mit dem Therapeuten, der sich an ihre Seite stellt, bemerkt die Analysandin, wie sich blitzschnell die Wut auf den enttäuschenden Freund in Depression umwandelt. Schließlich ist sie es gar nicht wert, daß er sich um sie kümmert. Weil sie nicht fragt, sich nicht bemerkbar macht, muß sie hungrig bleiben, und es geschieht ihr gerade recht.
Diese psychischen Regulationen, welche unsere Stimmungen steuern, geben immer neue Rätsel auf. Woran liegt es, daß Menschen sich lieber die Zunge abbeißen als einen Wunsch äußern würden, der sie aus diesem eingemauerten, höchst qualvollen Zustand erlöst, in den sie durch eine Kränkung geraten? Die erste Kränkung scheint eine Kettenreaktion auszulösen. Wie stürzende Dominosteine potenziert der Wunschverlust die Kränkung, die Kränkung den Wunschverlust, die narzißtische Wut das Schuldgefühl und das Schuldgefühl die Selbstbestrafung durch Versagungen, die sich der Betroffene auferlegt. Er war so dumm, sich auf die kränkende Situation einzulassen, er ist so böse geworden durch die Kränkung, da geschieht es ihm eben recht, wenn er nichts, aber auch gar nichts mehr bekommt. Solche Frustration rechtfertigt seine Wut; die Wut erhält einen Zustand aufrecht, in dem nichts angenommen werden kann. So rächt sich das Opfer am Täter und im gleichen Zug an sich selbst. Es verbietet sich, zu nehmen, denn dann würde ihm auch der Grund für seine Wut und Enttäuschung genommen und mit ihnen deren Rechtfertigung.
«Männer lieben, wo sie begehren; Frauen begehren, wo sie lieben.» Dieses Sprichwort drückt einen relativ typischen Verhaltensunterschied zwischen den Geschlechtern aus (wobei auch hier die individuellen Variationen eine größere Spielbreite haben als die Geschlechtskategorie). Im allgemeinen findet ein Mann seine Beziehung «in Ordnung», wenn seine Partnerin mit ihm schläft, während eine Frau sich nur dann sexuell öffnen kann, wenn sie die Beziehung «in Ordnung» findet. Der mit diesem Thema verknüpfte Konflikt wird oft auf die Formel gebracht: «Unsere Partnerschaft wäre viel besser, wenn wir öfter zusammen schlafen würden – wenn unsere Partnerschaft besser wäre, würde ich auch öfter mit dir schlafen wollen.» Der Mann ist zärtlich und gesprächsbereit, wenn seine Frau mit ihm verkehrt hat; diese will nur mit ihm verkehren, wenn er gesprächsbereit und zärtlich ist, sie nicht unter Druck setzt, jetzt erst einmal sexuell zusammenzukommen, «als ob nichts wäre».
Die schlichte Zusammenfassung dieses Sachverhalts ist, daß der Geschlechtsverkehr für den Mann etwas anderes bedeutet als für die Frau. Eine ebenso schlichte Ableitung dieser Auffassung wäre, daß die Frau schließlich bei diesem Akt schwanger werden kann, während dem Mann keine solche körperliche Konsequenz auferlegt ist. Müssen wir davon ausgehen, daß solche Urphantasien auch in Zeiten noch verhaltensbestimmend sein können, in denen Empfängnisverhütung zumindest technisch keine großen Schwierigkeiten macht? Vermutlich ja, denn in jedem Fall ist es der Frau auferlegt, sich über die Verhütung Gedanken zu machen. Mißlingt sie, ist sie weit einschneidender betroffen.
Der Ordnungsanspruch einer Frau in einer sexuellen Beziehung ist in der Regel höher als der eines Mannes. Sie nimmt ihn viel stärker in ihr Leben hinein, räumt ihm einen Platz ein in ihrem Inneren, während er sie draußen läßt und eher als Versorgungseinrichtung, in der Art einer Tankstelle, eines Kontaktdepots benützt. Wenn in der Verliebtheit die Symbiose hergestellt und die gemeinsame Beziehung genügend idealisiert werden kann, glaubt jede(r) vom anderen, daß die eigene Vorstellung auch die gemeinsame ist. Das Erwachen aus dieser Illusion ist oft sehr schmerzhaft. Der Mann braucht dazu oft gröbere Reize als die Frau. Sie reagiert bereits auf ein Nachlassen der Gesprächsbereitschaft, auf das Einschlafen kleiner Gesten. Der Partner findet das krampfig, nervig, überempfindlich. Er will nur seine Ruhe, mal ausspannen, an etwas anderes denken. Indessen ist der Frau ein größerer oder kleinerer Teil ihrer erotischen Interessen abhanden gekommen. Sie hat keine Lust, weist ihn ab, bleibt passiv. Darauf reagiert nun er, schockiert, mit Vorwürfen, mit weiterem Rückzug, um sich vor dieser Kränkung zu schützen und sie unter Druck zu setzen. Gerade wenn es während der Verliebtheitsphase sexuell «gut geklappt» hat, ist den Beteiligten oft rätselhaft, wie verletzlich diese scheinbar solide körperliche Basis ist, wie sich Verweigerung und gekränkter Rückzug potenzieren können, so daß in wenigen Wochen Krampf, Zwang und Vorwurf in der Beziehung überhandnehmen. Die Geschwindigkeit, mit der sich Verliebtheitsglück auflöst, ist ein Zeichen dafür, wie instabil das innere gute Objekt bei mindestens einem Beteiligten ist. Die drohende Vereinsamung führt bei vielen Betroffenen zu einer Trennungsschwäche bei gleichzeitiger Bindungsangst. Gerade weil das innere gute Objekt so brüchig ist, man sich so wenig auf es verlassen kann, wird an dem äußeren Objekt, das in der Verliebtheit doch diesen Mangel auszugleichen versprach, mit aller Macht festgehalten. Das Versagen, im eigenen Inneren ein gutes Objekt zu finden, läßt sich dabei nicht zuletzt dadurch bewältigen, daß dem äußeren Objekt in unermüdeter Vorwurfsarbeit die Erinnerungen an das einstige Liebesversprechen vorgehalten werden. Was hat es alles verheißen und so auf den Leim gelockt, wie wenig hat es gehalten, wie groß ist seine Bosheit, die leichter erträglich scheint als dieser unheimliche Verlust des Guten im eigenen Erleben. Der Haß, der innere Objektverlust und der moralische Vorwurf an den Partner, in seinen versprochenen Liebesbeweisen versagt zu haben, sind die unheilige Dreifaltigkeit der unglücklichen Liebe.
2 Weibliche Treue und männliche Untreue
Heinrich von Kleist hat einmal versucht, das physikalische Modell der Polarität auf seelische Phänomene anzuwenden. Die Natur, so sagt er, verabscheut alles, was einen überwiegenden und unförmlichen Wert angenommen hat. Wenn sich zwei Körper nähern, von denen einer elektrisch geladen ist, bildet sich in dem bisher neutralen ebenfalls eine Ladung, die der des ersten entgegengesetzt ist. In der moralischen Welt gilt ein ähnliches Gesetz: «dergestalt, daß ein Mensch, dessen Zustand indifferent ist, nicht nur augenblicklich aufhört, es zu sein, sobald er mit einem anderen, dessen Eigenschaften, gleichviel auf welche Weise, bestimmt sind, in Berührung tritt: sein Wesen sogar wird, um mich so auszudrücken, gänzlich in den entgegengesetzten Pol hinübergespielt; er nimmt die Bedingung + an, wenn jener von der Bedingung –, und die Bedingung –, wenn jener von der Bedingung + ist.»[*]
Neben anderen Beispielen erwähnt Kleist auch eine Szene aus seinem eigenen Leben: «Ich … lebte vor einigen Jahren aus gemeinschaftlicher Kasse in einer kleinen Stadt am Rhein mit einer Schwester. Das Mädchen war in der Tat bloß, was man im gemeinen Leben eine gute Wirtin nennt; freigebig sogar in manchen Stücken; ich hatte es selbst erfahren. Doch weil ich locker und lose war und das Geld auf keine Weise achtete: so fing sie an zu knickern und zu knausern; ja, ich bin überzeugt, daß sie geizig geworden wäre und mir Rüben in den Kaffee und Lichter in die Suppe getan hätte. Aber das Schicksal wollte zu ihrem Glücke, daß wir uns trennten.»[*]
In seinem Roman über «Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins» wendet Milan Kundera dieses Prinzip auf die Treue in einer Beziehung an: je verläßlicher sich die Frau an den Mann bindet, desto stärker wird dessen Impuls, Abenteuer mit anderen Frauen zu erleben; je deutlicher sie diese Untreue erlebt, desto mehr konzentriert sie sich auf ihn. Kleist greift diese Polarisierung im Zusammenhang mit einem Vorschlag zur moralischen Erziehung auf: Kann man, da gute Vorbilder so wenig überzeugen, nicht mit schlechten Beispielen die Tugend hervorlocken, welche sich angesichts einer scheinbar unerschütterten anderen Tugend versteckt?
Gehen Männer und Frauen unterschiedlich mit «Treue» in sexuellen Beziehungen um? Es ist schwierig, dieses Thema zu verfolgen. Das Areal ist von einer jahrhundertelang gepredigten Moral bis in die Sprache hinein verseucht und zusätzlich dadurch unterminiert, daß diese Moral zwar beiden Geschlechtern vorgeschrieben, Verfehlungen jedoch bei Frauen ungleich härter sanktioniert wurden. Wie man über kontaminierten Zonen ein Gegengift versprüht, etwa eine Lauge, die eine Säure neutralisieren soll, so wurde gegen die Sklaverei der Triebe in der Treue die Freiheit der sexuellen Befriedigung gepredigt. Keine «bürgerlichen» Besitzansprüche mehr! Als ob Eifersucht und Treueschwur erst vom Bürgertum erfunden worden wären.
Der Analytiker hält zu Moralvorstellungen eine kritische Distanz, ob sie nun viktorianisch oder feministisch eingefärbt sind. Wenn das Geschlechterverhältnis unter moralisch-politischen Gesichtspunkten betrachtet wird, unterscheiden sich die Ergebnisse von denen des Psychoanalytikers, der einen therapeutischen Auftrag erfüllt. Er wird Schuldzuweisungen und Strafmaßnahmen nicht unterstützen, sondern in Frage stellen. Gerade im Hinblick auf die Dynamik von Treue und Untreue spielen Schuldgefühle eine zentrale, oft verborgene und unterschätzte Rolle.
Fall 1, Sieglinde und Leonhard. Beide kennen sich schon seit ihrer Schulzeit. Sie studierte Psychologie, er Theologie. Solange noch nicht geklärt war, ob Leonhard sich für den Zölibat entscheiden würde, verzichteten sie auf die sexuelle Erfüllung, die sich beide wünschten. Einmal verliebte sich Sieglinde in einen Kommilitonen, was Leonhard mit so heftiger Eifersucht erfüllte, daß er sich entschloß, die Aussicht auf eine Laufbahn als katholischer Priester aufzugeben. Er bestand aber darauf, getrennt von Sieglinde zu wohnen, was diese, ermutigt durch Leonhards ersten Schritt, akzeptierte. Leonhards Distanz-Nähe-Schwankungen führten zu manchmal grotesken Situationen. – In einigen Nächten pendelte er zwei- bis dreimal zwischen den verschiedenen Wohnungen hin und her, weil er es weder im Bett neben Sieglinde noch allein in seiner Klause aushielt. Sieglinde begegnete diesen Schwankungen mit gleichbleibender Geduld und Verständnis. Der erste Schritt war getan. Leonhard versprach immer wieder, wenn er erst sein zweites Studium als Lehrer abgeschlossen, sich beruflich fest etabliert, die Trennung von seiner kirchlichen Vergangenheit ganz bewältigt habe, würde er sicherlich eher in der Lage sein, auf ihre Wünsche einzugehen. Die Freunde des Paares hatten den Eindruck, daß Sieglinde Schritt für Schritt die Zähmung des Nähe-Ängstlichen gelang. Sie setzte durch, daß sie eine gemeinsame Wohnung nahmen, freilich mit getrennten Schlafzimmern, so daß Leonhards Hinundher bequemer zu bewerkstelligen war. Nach einigen weiteren Jahren wurde geheiratet. Sieglinde fühlte sich am Ziel ihrer Wünsche. Den letzten Schritt, den sie ersehnte, das gemeinsame Kind, würde sie auch noch durchsetzen. Immer noch sprach Leonhard viel von seinem Bedürfnis, für sich zu sein, über sich nachzudenken, zu meditieren. Er wollte nach dem ersten Ehejahr wieder allein in Urlaub fahren. Sieglinde akzeptierte. Sie mußte ihm schließlich seinen Freiraum lassen. Als er von einer dieser «einsamen» Reisen zurückkehrte, die ihn um die halbe Welt führten, gestand er schuldbewußt, er habe eine andere Frau kennengelernt, eine Kollegin, und – um sie nicht zu kränken – diese Beziehung verschwiegen. Jetzt ertrage er den Betrug nicht mehr. Er müsse wieder ausziehen, vielleicht würde ihm dann klar, mit wem – und ob überhaupt – er eine Beziehung leben könne.
Fall 2, Sarah und Bernd. Kurz bevor sie zum Studium in eine ferne Großstadt zog, lernte Sarah Bernd kennen. Sie war Jungfrau, ein wenig schüchtern, künstlerisch begabt, hatte die Aufnahmeprüfung an der Kunstakademie bestanden. Bernd wollte Anwalt werden. Er verfolgte Sarah mit Briefen und Telefonaten, besuchte sie, sooft er konnte, befragte sie eifersüchtig nach Kontakten zu anderen Männern. Sobald es ihm möglich sei, werde er sie heiraten und genug verdienen, um ihr diesen lästigen Beruf (Sarah wollte Kunsterzieherin werden) zu ersparen. Sarah liebte ihre Malerei, war aber unsicher, ob sie sich in der Schule durchsetzen konnte, und gab schließlich nach. Während Bernd Karriere machte, konzentrierte sie sich auf den Haushalt und die beiden Kinder. Sie war sich seiner sehr sicher, denn er war eifersüchtig, wollte genau wissen, was sie in der Kirchengemeinde (in der sie sich engagierte) tat, wohin sie abends ging, warum sie mit diesem Gast so intensiv gesprochen habe. Es wäre ihr nie eingefallen, ihrerseits Bernd zu fragen, was er bei den geschäftlichen Terminen mache, die ihn oft bis weit in die Nacht hinein von der Familie fernhielten. Als er ihr schließlich von seiner Freundin erzählte, schien für Sarah eine Welt einzustürzen. Bernds Versuche, sie zu trösten, erbitterten sie noch mehr: die Freundin sei eine patente Frau, wolle gewiß nicht die Familie zerstören, er habe ihr Bilder der Kinder gezeigt, sie sei da sehr verantwortungsbewußt, vielleicht könne man in einem Gespräch zu dritt klären, wie es weitergehen solle. Sarah brach zusammen, fand mit Depressionen und Selbstmordgedanken in eine Psychotherapie. Sie begann, sich von Bernd zu distanzieren, schlief nicht mehr mit ihm, begann eine Berufsausbildung und stellte fest, daß es ihm um so schlechter ging, je mehr sie sich erholte; er schien seine Freundin seltener zu treffen, verschanzte sich in seiner Arbeit, nahm ein möbliertes Zimmer, als sie ihn bat, auszuziehen – «er lebt so karg, um mir ein schlechtes Gewissen zu machen, aber ich lasse mich auf nichts mehr ein!»