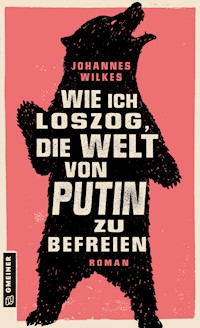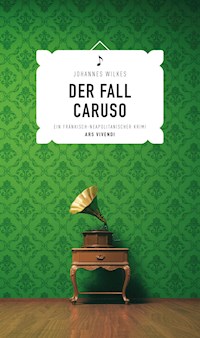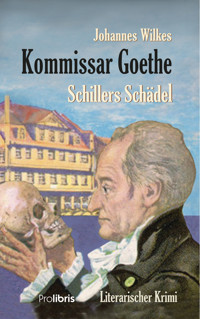Samstag
»Sauwetter«, brüllte Karl-Dieter gegen den Sturm.
»Das kannste laut sagen.«
Es stürmte. Ein böiger Nordwest peitschte heftige Regenschauer über den Hafen von Spiekeroog, als Mütze und Karl-Dieter mit einer Schiffsladung von Inselhungrigen über den Steg an Land liefen. Sich unterzustellen und zu warten, bis das Gröbste vorbei war, hatte keinen Zweck. Noch auf der Fähre hatte Karl-Dieter einen Blick auf das Smartphone seines Banknachbarn
geworfen, eines missmutig aus dem Fenster schauenden Pensionärs.
»Studienrat maximus«, spöttelte Karl-Dieter, »vermutlich Geschichte und Latein«.
»Geschichte und Religion!« Auf seinen Lateinlehrer ließ Mütze nichts kommen.
Was auch immer der Herr unterrichtet haben mochte, auf dem Regenradar seines
Handys war nur eine Farbe zu sehen gewesen: ein triefnasses Blau.
»Dann nehmen wir eben ein Taxi.«
»Sehr witzig!« Mütze wusste genau, dass es weder Taxis auf Spiekeroog gab noch sonstige Autos.
Das war ja gerade das Schöne an Spiekeroog. Vor allem bei Sonnenschein, wenn man über die Insel bummeln konnte, ohne auf einen Straßenverkehr achtgeben zu müssen. Ein solcher Regen jedoch war nicht normal, nicht Anfang August.
Zum Glück hatte Karl-Dieter an die Fahrradcapes gedacht. Nach einem leichten Knurren
hatte Mütze eingesehen, dass Karl-Dieter Recht hatte. Noch auf der Toilette der Fähre hatten sie sich umgezogen, nacheinander natürlich, sie wussten schließlich, was sich gehörte.
Herausgekommen waren sie wie zwei zu groß geratene Gartenzwerge. Karl-Dieter, rundlich und kompakt, hatte sich das rote
Cape übergezogen, Mütze, großgewachsen und athletisch, steckte im gelben Umhang. Auch unten herum
unterschieden sich die Freunde signifikant. Während aus Mützes Cape behaarte Muskelbeine herauswuchsen, waren Karl-Dieters Schenkel glatt und glänzend wie ein Babypopo. Der Bühnenbildner pflegte seine Beine von jeglichem Bewuchs frei zu halten. Der
Kriminalkommissar musste sich immer wegdrehen, wenn sich Karl-Dieter mit entschlossener Miene die
erkaltete Wachsschicht von den Beinen zog. Einfach furchtbar! Karl-Dieters
gepflegte Füße steckten in Adiletten, während Mütze aus Protest Aldiletten trug. Man müsse ja nicht jeden Modeblödsinn mitmachen.
So gekleidet trotzten sie am Kai dem Regen. Als alte Spiekeroog-Profis hatten
sie ihre Koffer im Hafen von Neuharlingersiel in den letzten der Blechcontainer
gewuchtet. »Die letzten werden die ersten sein«, hatte Mütze mit erfahrener Miene festgestellt.
Mit ihren Koffern schnell wiedervereint, zogen sie gegen die Sturmböen weiter zum Deich. Einer der dort auf dem Kopf liegenden Transportkarren
wartete auf sie. Bloß welcher?
»Da vorne! Der da, sieh doch, da steht Schwubbe drauf.«
Schwubbe hieß ihr Vermieter. Für vierzehn Tage würden sie in seinem Dachgeschoss unterschlüpfen. Haus Schwubbe lag einsam im äußersten Westen der Insel. Karl-Dieter hatte sich das so gewünscht, in diesem Urlaub sei mal wieder eine Ferienwohnung dran. »Wenn deine Seligkeit davon abhängt«, hatte Mütze geseufzt und wehmütig an die Linde gedacht, an das nostalgische Inselhotel. Nun hatten sie den Salat. Bis zum
Westend brauchte man sicher eine halbe Stunde, im Kampf gegen Wind und Regen
eine gefühlte Ewigkeit. Die beiden Freunde drehten den Karren um, luden ihre Koffer auf
und schnappten sich die nasse Deichsel.
»Daheim mach ich uns einen Tee«, rief Karl-Dieter, während er sich die Kapuze fester um das Kinn band.
»Aber bitte mit Schuss!«
Zum wievielten Mal waren sie schon auf Spiekeroog? War es wirklich bereits ihr fünfter Besuch? Zuletzt waren sie vor zwei Jahren auf der Insel gewesen, ein
Urlaub nicht ohne Tragik, hatten sie doch drei gute, alte Freundinnen verloren,
zumindest Karl-Dieter.
»Sieh’s positiv«, hatte Mütze ihn zu trösten versucht, »besser kurz und schmerzlos im Watt ertrunken, als quälend langsam von Herrn Alzheimer um den Verstand gebracht.«
»Es gibt doch noch was dazwischen«, hatte Karl-Dieter protestiert.
»Dazwischen? Du meinst, von Herrn Alzheimer ins Watt geführt zu werden?«
»Idiot!«
Was sich liebt, das neckt sich.
Als die beiden endlich ihr Quartier erreicht hatten, klitschnass und
durchgefroren, und ihnen ihr Vermieter, ein liebenswürdiger, aber leicht verpeilt wirkender Ostfriese, die Schlüssel überreicht hatte, hatten sie sich sogleich daran gemacht, es sich gemütlich zu machen. Um genau zu sein, Karl-Dieter hatte sich darangemacht. Mütze hingegen streckte sich erst mal genüsslich auf der Couch aus. Karl-Dieter hatte nichts dagegen, sich um die Wohnung
zu kümmern, nicht das Geringste. Im Gegenteil, er liebte es. Da konnte das beste
Hotelzimmer nicht mithalten. Hier würde er sich einrichten, wie es ihm behagte. Was gab es Schöneres? Vieles hatte Karl-Dieter mitgenommen, das er jetzt auspackte, um es am
passenden Ort zu platzieren. Da war als Erstes das Foto von Tante Dörte. Ziemlich vergilbt war die Aufnahme bereits, doch gerade deshalb liebte
Karl-Dieter sie. Tante Dörte kam auf den kleinen Sims bei der Essecke. Dann wickelte er vorsichtig eine
KPM-Vase aus dem Zeitungspapier und stellte sie auf den Wohnzimmertisch. Für Blumen würde er morgen sorgen. Wie hätte es ihn gefreut, wenn Mütze ihm welche schenken würde, aber Mütze hatte keinen Sinn für Blumen. »Sind morgen doch bereits wieder verwelkt«, pflegte er zu sagen. Das war es ja gerade! Dass Mütze das nicht verstand. Wahre Schönheit war eben vergänglich. »Deine nicht«, hatte Mütze mal gemeint, worauf Karl-Dieter zart errötet war. Es war sicher nur so dahingesagt gewesen, trotzdem hatte es ihn
gefreut.
»Der Tee ist fertig!«
»Gibt’s auch ein Bierchen?«
*
Will man auf Spiekeroog eine Leiche verschwinden lassen, bieten sich zwei Möglichkeiten an: die Land- und die Seebestattung. Bei beiden Alternativen muss
das Für und Wider sorgfältig abgewogen werden. Die Seebestattung hat den Nachteil größerer Unsicherheit über den weiteren Verbleib des Körpers. An der Nordsee sind die Strömungen, bedingt durch die kräftigen Gezeiten, nicht eindeutig zu berechnen, hinzu kommt ein oft wechselnder
Wind. Will man sichergehen, dass der Tote nicht gefunden wird, sollte man sich
für die Ankerlösung entscheiden, zumindest für ein schweres Gewicht, dass die Leiche dauerhaft unter Wasser hält.
Aber selbst dann muss man sich klarmachen, dass auch diese Variante kein
sicheres Grab garantiert. Sei es, dass ein heftiger Orkan den Seeboden dermaßen aufwühlt, dass sogar ein schwerer Betonklotz an Land gespült werden kann, sei es, dass der Körper zunehmend an Substanz verliert. Dazu trägt zum einen die Verwesung bei, die auch unter Wasser voranschreitet, zum
anderen der Fisch- und Seehundfraß. Schlimmstenfalls lösen sich einzelne Knochen, oder gar der komplette Schädel, und treiben an den Badestrand, wo sie für unschöne Reaktionen sorgen. Zugegeben, Sie könnten natürlich argumentieren, bis dies geschieht, hätten Sie schon einen hübschen Vorsprung, auch sei es nicht auszuschließen, dass aufgrund der verwischten Spurenlage kein Gewaltverbrechen mehr
nachweisbar ist und man die Vermisstenakte mit dem Vermerk »vermutlich Badeunfall« schließen wird. Blöd ist nur, wenn der Schädel ein Loch aufweist. Dann kommt schnell der Verdacht einer unnatürlichen Todesart auf, speziell bei kreisrunden Löchern mit deutlicher Impressionsfraktur, die Teile des Knochens nach innen gedrückt hat.
Sonntag
So schnell der Regen aufgezogen war, so schnell hatte der Wind ihn wieder
vertrieben. In der Nacht war noch ein letzter Schauer gegen die Fenster
geklatscht, am Morgen aber machte die Sonne unmissverständlich klar, wem dieser Tag gehörte.
»Lass nur, ich fahr schon«, sagte Mütze vergnügt, warf sich seine Schimanski-Jacke über und eilte zur Wohnungstür hinaus.
Karl-Dieter sah ihm gerührt hinterher. Eigentlich war ausgemacht, dass er die Brötchen holen sollte, war es doch Karl-Dieters Idee gewesen, dieses abgelegene
Quartier zu beziehen.
Mütze lief um das niedrige Haus herum, das mitten in den Dünen stand, und zog das alte Hollandrad aus dem grünen Schuppen. Das war ein kleiner Ausgleich für die Randlage. Man bekam Fahrräder gestellt, die man Touristen üblicherweise nicht zugestand. Er schwang sich in den Sattel und radelte den
schmalen Weg Richtung Dorf.
Dort angekommen, sprang Mütze vorschriftsmäßig ab und schob sein Rad durch die kleine Fußgängerzone. Es war wenig los, die meisten Inselgäste schliefen wohl noch oder saßen beim Frühstück. Als Mütze an der Linde vorbeikam, dem altehrwürdigen Inselhotel, in dem sie in den letzten Jahren zu Gast gewesen waren, sah
er einen einzelnen Herrn auf der Terrasse sitzen, der ihm irgendwie bekannt
vorkam. Die hohen Wangenknochen, die buschigen Brauen, das energische, leicht
nach oben gebogene Kinn, die wettergegerbte Haut. Er mochte Ende vierzig sein,
vielleicht auch älter, allerdings mit erstaunlich dunkler und voller Haarpracht. Wo war er diesem
Menschen schon einmal begegnet? Dem Herrn wiederum schien Mütze ebenfalls nicht unbekannt zu sein, jedenfalls fixierte er ihn aufmerksam und
ihre Augen begegneten sich für einen kurzen Moment.
Dann verschwand Mütze in der nahen Inselbäckerei. Während er in der Schlange stand, ging ihm das Gesicht nicht aus dem Kopf. Er
hatte doch sonst ein Gedächtnis wie ein Elefant, warum kam er nicht drauf, woher er diesen Menschen
kannte? Zugleich beschlich Mütze ein Gefühl des Unwohlseins, jedenfalls drängte ihn nichts danach, mit dem Mann ins Gespräch zu kommen. Es schien keine erfreuliche Bekanntschaft gewesen zu sein, wenn es
überhaupt eine war. Als Mütze mit dem prall gefüllten Brotbeutel am Lenker wieder an der Linde vorbeischob, hörte er den Frühstücksgast schallend lachen und mit dröhnender Stimme rufen: »Mensch Mütze, ist es denn wahr?«
Nun wusste Mütze, wer der Mann war. Ein Mensch kann sich verändern, nicht aber seine Stimme. »Heiko! Heiko van Gehlen!«
»Unglaublich! Komm rauf, setz dich zu mir. – Ober, Champagner und zwei Gläser!«
Heiko van Gehlen. Sie hatten zusammen die Schulbank gedrückt, auf ihrer alten Dortmunder Penne, wie man im Ruhrpott das Gymnasium zu
nennen pflegte. Heiko war erst zu ihnen gestoßen, nachdem er in der Mittelstufe eine Ehrenrunde gedreht hatte. Trotz dieses
Makels hatte er sich unter seinen neuen Mitschülern schnell ein gewisses Ansehen erworben, denn er akzeptierte keine Autoritäten und begegnete den Lehrern mit Spott und sogar unverhohlenem Sarkasmus. Diese
Freiheiten konnte er sich herausnehmen, weil sein alter Herr ein hohes Tier bei
den Nickelwerken war und die Schule kräftig unterstützte. Die Vereinigten Nickel-Werke waren ein echtes Großunternehmen, nicht so groß wie Hoesch oder Krupps, dafür aber äußerst erfolgreich. Ein väterlicher Scheck für den Förderverein besänftigte den Schulleiter schnell wieder, wenn Heiko es mal zu bunt trieb. Etwa
als er mit zwei seiner Untertanen, wie Mütze und seine engsten Freunde mit deutlicher Verachtung seine Fans nannten, die
Ente ihres Geo-Lehrers so zwischen zwei Betonpfosten geschoben hatte, dass
dieser weder vor noch zurücksetzen konnte. Nicht nur auf die Lehrer hatte Heiko herabgeschaut, auch auf
viele seiner Kameraden. Sie erschienen ihm wie unreife Kinder, die nicht
begriffen, wie das System tickte. Mütze war von Heiko ebenfalls stets von oben herab behandelt worden.
»Weißt du noch, wie du versucht hast, DocMü dazu zu bringen, die Schulaufgabe über den Citratzyklus zu verschieben?«
Natürlich erinnerte sich Mütze. Sie hatten in der Woche bereits in Mathe und Deutsch eine Probe
geschrieben, eine dritte war laut Schulordnung nicht zulässig. Als Klassensprecher hatte er ihren Chemielehrer darauf hingewiesen. DocMü jedoch hatte nur schallend gelacht.
»Tja, und dann hab ich ihn mir mal vorgenommen und plötzlich ist die Verschiebung kein Thema mehr gewesen.«
Es war nicht auszuhalten. Heiko war immer noch der Alte. Ob man sich nie veränderte? Nicht im Kern seines Wesens? Diese Arroganz, diese verdammte
Selbstzufriedenheit.
»Du hattest ihm gedroht, dass er sein Spektrometer nicht bekommt.«
»Gedroht?«
Wieder lachte van Gehlen auf, in einer Art, die Mütze Schmerzen bereitete, ein blechernes, übertriebenes Gelächter, das jedes Gespräch drumherum augenblicklich verstummen ließ. Vielleicht hatte er Heiko auch daran wiedererkannt, dachte sich Mütze. Hatte er damals nicht auf dieselbe Weise über Althaus gelacht? Althaus war ihr Deutschlehrer gewesen, ein feiner,
gebildeter, aber an einem naturwissenschaftlichen Gymnasium, das traditionell von Jungen dominiert wurde, ein völlig überforderter Mann, der kurz darauf einem Herzinfarkt erlag. Wie war der arme
Kerl rot angelaufen, als beim Aufklappen der Tafel und unter dem Gelächter Heikos ein Pin-up-Girl erschienen war.
»Gedroht! Was für ein hässliches Wort. Wir haben lediglich ein kleines Geschäft miteinander gemacht. Alles im Leben ist ein Geschäft.«
Der Ober kam und wollte den Champagner entkorken.
»Gestatten Sie? Das übernehme ich!«
Mit seiner Linken drehte van Gehlen gekonnt den Draht auf, schüttelte die Flasche kräftig und jagte den Korken in die Krone der alten Linde, so laut, dass die Möwen krächzend davonflogen. Mütze hätte sich am liebsten auf der Stelle wieder entfernt.
»Auf die alten Tage!«, lachte Heiko.
»Auf Spiekeroog«, erwiderte Mütze.
Er kam natürlich viel zu spät. Karl-Dieter war verschnupft. Mütze erklärte ihm in knappen Worten, was ihn aufgehalten hatte. »Es war der größte Idiot unserer Klasse, ein echtes Stinktier.«
»Und warum trinkst du dann Champagner mit ihm?«
»Ist ein Fehler gewesen, kommt nicht wieder vor.« Mütze ärgerte sich über sich selbst. Am meisten wurmte es ihn, dass er auf Heikos Frage, mit wem er
seinen Urlaub verbringe, Karl-Dieter erwähnt hatte.
»Ehrlich? Du bist schwul, Mütze?«, hatte Heiko gelacht. »Nein, nein, jetzt sei doch nicht gleich wieder beleidigt, das bist du damals
schon immer gewesen. Ist ja nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Ich bin ein
aufgeklärter Zeitgenosse, ist heutzutage wirklich kein Problem, das kommt in den besten
Familien vor. Komm, trink noch ein Glas.«
Spätestens in diesem Moment hätte er aufstehen und gehen müssen. Das überhebliche Gelaber, der Champagner, all das sollte nur eines sagen: Egal, wie es damals in der Schule
gelaufen ist, egal, was du aus deinem Leben gemacht haben magst, zwischen uns
bleibt doch alles beim Alten, beim Wettlauf von Hase und Igel. »Ich bin schon da!«, kriegst du von mir nur zu hören oder besser: »Ich bleib für immer hier oben und du für ewig da unten!« Das wird für alle Zeiten so sein, da kannst du dich abstrampeln wie du willst. Und
obendrein noch dieser angewiderte Gesichtsausdruck, als ihn Mütze, um das Thema zu wechseln, gefragt hatte, wie es ihm in der Linde gefalle.
»Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich in diesem alten Schuppen logiere? Ich
wohne in meiner Yacht am Hafen. Nur zum Sektfrühstück hat es mich hierher verschlagen.«
»Er hat eine eigene Yacht?«, fragte Karl-Dieter, während er sein Ei köpfte.
»Es gibt nichts, was er nicht hat. Bis auf das Abi.«
»Wieso das? Ich dachte, ihr seid in derselben Klasse gewesen.«
»Hat die Prüfungen nicht bestanden, musste er auch nicht, nicht als van Gehlen.«
»Van Gehlen? Doch nicht etwa einer von den van Gehlen?«
»Allerdings. Einer von den van Gehlen. Geldscheißer«, sagte Mütze verächtlich und biss krachend in sein Krabbenbrötchen. Es wollte ihm nicht schmecken.
Welches Gesetz befahl einem, ehemalige Mitschüler ein Leben lang zu duzen? Und warum sollte man so tun, als ob einen etwas
Besonderes mit ihnen verbände? Das war doch nichts als Blendwerk, nichts als dümmste Nostalgie, die man im Nachhinein auf verkrampfte Weise als Kameradschaft
verbrämte. Hatte man sich seine Mitschüler etwa aussuchen können? Da wurde eine Zwangsgemeinschaft, von der man froh war, ihr endlich
entronnen zu sein, im trügerischen Licht der Erinnerung zu einer Art Familie hochstilisiert. Frieden
ihrer Asche. Nichts Grausameres, als auf diese dunkle Lebensperiode
angesprochen zu werden.
Jedenfalls empfand Mütze so. Nicht so Karl-Dieter. Er hatte offensichtlich mehr Glück mit seiner Klasse gehabt, so viel, dass er jetzt zum Vorbereitungskreis ihres
dreißigjährigen Abijubiläums gehörte, ja, das Klassentreffen war Karl-Dieters Idee. Den Ausschlag gegeben hatte
eine schlimme Nachricht, der plötzliche Tod eines Mitschülers, der an metastasiertem Hautkrebs gestorben war.
Diese Unglücksmeldung hatte Karl-Dieter tief schockiert. Schon immer hypochondrisch
veranlagt, hatte er sogleich damit begonnen, seine Leberflecken zu beobachten.
Mütze musste alle zwei Wochen ein Foto von seinem Rücken schießen. Karl-Dieter verglich diese Aufnahmen an seinem Computerbildschirm. Und wehe,
er glaubte eine kleine Veränderung zu bemerken! Dann wurde er ganz hibbelig und war überzeugt, selbst an Krebs erkrankt zu sein, bis sein Hautarzt Entwarnung gab und
Mütze das nächste Foto schoss.
Ein Regisseur vom Theater Erlangen, an dem Karl-Dieter als Bühnenbildner angestellt war, hatte Karl-Dieter geraten, die Ängste durch Aktivität zu besiegen. Die Panik vor dem Krebs speise sich einzig und allein aus der
empfundenen Hilflosigkeit dem gegenüber, was eine Entgleisung der eigenen Körperzellen mit einem machen könne. Hilflosigkeit aber sei ein starker Angstfaktor. »Organisiere ein Klassentreffen. Dann ergreifst du in der Sache die Initiative
und kannst der Bedrohung ins Auge schauen.«
Karl-Dieter hatten diese Worte eingeleuchtet, auch, weil der Regisseur zwei
Semester Psychologie studiert hatte. Gleich am nächsten Tag hatte Karl-Dieter damit begonnen, den Kontakt zu seinen alten
Klassenkameraden herzustellen. Die Jungen ausfindig zu machen, war nicht schwer gewesen,
komplizierter war es, an die Adressen der Mädchen zu kommen, die ja oft bei einer Heirat den Namen ihres Mannes angenommen
hatten. Karl-Dieter hatte sich von einer zur anderen gehangelt, manchmal hatten
die Eltern der Gesuchten helfen können. Karl-Dieter war mächtig stolz, alle verschollenen Mitschüler bis auf drei gefunden zu haben. War es nicht seltsam, dass Mütze zufällig zur gleichen Zeit einen alten Schulkameraden traf?
»Häng dem armen Herrn Zufall bitte nicht jedes Verbrechen an.«
»Ach komm, Mütze. Vielleicht hat dein alter Kumpel auch seine versteckten guten Seiten.«
Was für ein prächtiger Tag! Alles strömte zum Strand. Bald herrschte am Badeabschnitt das lustigste Leben.
Karl-Dieter, der es liebte, alles bis ins Detail zu planen, hatte schon vor
Wochen im Internet einen Strandkorb reservieren lassen. Nichts Schlimmeres, als
vor Wind und Sonne ungeschützt im Sand zu hocken. Mütze hatte vorgeschlagen, eine Strandmuschel zu kaufen. Die koste nur dreißig Euro, ein Strandkorb unverschämte 9,50 € am Tag. Ein Zelt rentiere sich also bereits ab dem vierten Tag. Karl-Dieter
hatte nur den Kopf geschüttelt. Das war typisch Mütze, kein Sinn für Romantik. Wahres Strandvergnügen kam doch erst auf, wenn die Umgebungsgeräusche durch den Korb gedämpft wurden und man durch den rechteckigen Ausschnitt nichts anderes sah als
blauen Himmel, Strand und Meer.
Mütze riss sich die Kleider vom Leib und stürzte sich in die Wellen. Nachdem er eine Viertelstunde das Meer durchkreuzt
hatte, legte er sich zu Karl-Dieter in den Strandkorb und die beiden Freunde dösten vor sich hin. Man verlor ein paar IQ-Punkte im Urlaub, hatte Karl-Dieter
mal gelesen, aber war das wirklich schlimm? Zufrieden musste er gähnen und schon war er eingeschlafen.
*
Er war froh, die Landlösung gewählt zu haben. Das Land war entschieden zuverlässiger als das Meer. Doch durfte man auch bei einer Erdbestattung nicht nachlässig zu Werke gehen, zumal auf einer Insel wie Spiekeroog, auf der gar keine
Erde existierte und flüchtiger Sand der eigentliche Herrscher war. Sand erschien manchem vielleicht für die Beseitigung einer Leiche ideal, weil sehr leicht wegzuschaufeln. Das
stimmte und stimmte nicht. Bei Sand bestand nämlich das Problem, dass er immer wieder in die Grube zurückrieselte. Man bekam einfach keinen stabilen Schacht hin. Der Lehm auf dem
Festland war zwar schwer und schmatzte, wenn man in ihm grub, dafür brachen die Seitenwände nicht zusammen. Sand jedoch verabscheute klare Linien, alles wollte er
weichzeichnen, er liebte das Runde, liebte Kurven und Hügel, nicht aber die Gerade und schon gar nicht die Senkrechte. Ein Vorteil des
Sandes war wiederum, dass man nach getaner Arbeit die Spuren schnell wieder
verwischen konnte, was bei einem Lehmgrab deutlich schwieriger war.
Sehr wichtig, ja vielleicht das Wichtigste überhaupt, bei einer Inselbestattung war die Wahl des Standorts. Dabei konnte man
die größten Fehler machen. Manch einer wäre vielleicht auf die Idee gekommen, die dem Dorf abgewandte Seite einer Düne, also die Seeseite, für die Beerdigung im Sand zu wählen. Davon ist jedoch dringend abzuraten. Dünen waren unglaublich dynamisch, selbst wenn die ein oder andere Festlandsratte
sie für Berge halten mochte. Sie bewegten sich, wanderten mit dem Wind, der die feinen
Sandkörner mit nie nachlassendem Eifer über sie hinwegwehte, um sie auf der windabgewandten Seite wieder abzulegen.
Begrub man eine Leiche an der Seeseite einer Düne, so würde mit ziemlicher Sicherheit in kürzester Zeit ein Arm oder Bein unschön heraushängen. Wählte man hingegen die Dorfseite, so wurde der Körper immer tiefer durch den Sand verschüttet. Natürlich würde irgendwann einmal die Düne komplett über ihn hinweggewandert sein und die Knochen würden auf der anderen Seite wieder auftauchen, das war jedoch ein
Jahrhundertwerk. Mord verjährt zwar nicht, bei einem hundert Jahre alten Skelett aber würde sich kein Kommissar der Welt auf Mörderjagd begeben. »In der Hölle findet jede Strafverfolgung ihr Ende«, lachte er in sich hinein.
*