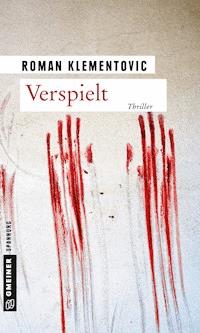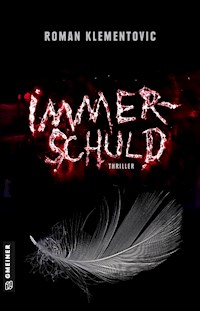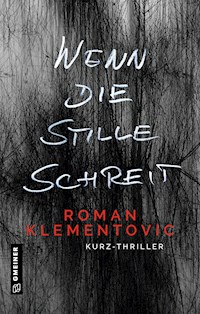Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein seit Jahrzehnten stillgelegtes Kurhotel tief im Wald ist Simons neuer Arbeitsplatz. Er soll dem einstigen Luxustempel zur baldigen Wiedereröffnung verhelfen. Doch das Gebäude entpuppt sich als Bruchbude und die sonderbaren Besitzer scheinen etwas zu verbergen. Als Simon von dem mysteriösen Verschwinden einer jungen Frau erfährt, regt sich in ihm ein schlimmer Verdacht: Hat jemand aus der Hoteliersfamilie etwas damit zu tun? Er macht sich in dem riesigen Haus auf die Suche und ahnt dabei nicht, dass er längst in der Falle sitzt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roman Klementovic
Dunkelnah
Thriller
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Peter H / Pixabay
ISBN 978-3-7349-3334-9
Zitat
»Woher willst du denn wissen, dass ich verrückt bin?«,fragte Alice.
»Das musst du doch sein«, sagte die Katze. »Sonst wärst du ja gar nicht hergekommen.«
Aus »Alice’s Adventures in Wonderland« von Lewis Carroll1
1 übersetzt von Roman Klementovic
Prolog
»Bleib stehen!«, schrie er hinter ihr. Viel zu nah.
Sie zuckte im Laufen zusammen.
Scheiße! Scheiße! Scheiße!
Ihr Herz raste. Sie war voller Panik. Bekam vor Aufregung auf einmal kaum noch Luft in ihre Lungen.
Aber sie hatte die Treppe erreicht.
Runter! Nichts wie runter! Sie musste hier raus!
»Bleib stehen, verflucht!«, brüllte er, und die Worte waren scharf wie Peitschenhiebe.
Weiter!
Sie nahm gleich zwei Stufen auf einmal.
»Glaubst du wirklich, du kommst hier raus?«
Sie hatte es fast die Treppe hinuntergeschafft.
Da passierte es.
Sie rutschte über eine Stufenkante. Verlor das Gleichgewicht. Und hatte plötzlich alle Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Sie schaffte es gerade so. Doch es hatte sie Zeit gekostet. Sekundenbruchteile, die sie nicht gehabt hatte.
Jetzt ging alles ganz schnell: Zuerst traf sie die Erkenntnis, dass dies der entscheidende Fehler gewesen war. Unmittelbar darauf traf sie ein Stoß in den Rücken. Wuchtig wie von einer Abrissbirne. Sie schrie auf. Verlor abermals das Gleichgewicht. Und kippte vornüber. Sie ruderte mit den Armen durch die Luft. Wollte nach dem Geländer greifen. Doch sie verfehlte es und griff ins Leere. Sie fand keinen Halt. Und stürzte. Es gelang ihr gerade noch so, sich ein wenig zur Seite zu drehen. Doch dafür knallte sie jetzt mit der Hüfte hart gegen eine der letzten Stufenkanten. Sie wollte die Arme schützend vors Gesicht reißen. Doch auch das gelang ihr nicht mehr rechtzeitig. Sie schlug heftig mit ihrer Schläfe auf dem Boden auf. Eine Schmerzgranate explodierte in ihrem Schädel. Raubte ihr den Atem. Und brachte alles in ihrem Kopf zum Dröhnen.
Sie war am Fuße der Treppe zum Liegen gekommen.
Sie stöhnte vor Schmerzen. Versuchte, sich gegen die Benommenheit zu wehren. Aber ihre Umgebung drehte sich und wurde immer schneller. Gleichzeitig wurde alles um sie herum dunkel und dumpf.
Sie bekam noch mit, dass er lachte. Und dass er daraufhin etwas sagte. Nur die Worte verstand sie nicht mehr. Denn schon einen Augenblick später verlor sie das Bewusstsein.
Als sie wieder zu sich kam, konnte sie erst nicht sagen, ob sie Stunden oder bloß einige Sekunden weggetreten gewesen war. Sie versuchte, die Benommenheit zurückzudrängen. Doch erst, als sich eine Schmerzwelle in ihrem Schädel auftürmte und diese schließlich mit voller Wucht gegen die Innenseite ihrer Schläfe prallte, war sie wieder voll da.
Ihr entkam ein Stöhnen.
Sie begriff jetzt, was gerade passierte. Sie wurde auf dem Rücken liegend weitere Stufen hinuntergezerrt.
Die Kellerstufen!
»Hilfe!«, krächzte sie, obwohl sie wusste, dass da weit und breit niemand war, der sie hätte hören können. Es war ohnehin kaum mehr als ein Flüstern gewesen, das sie noch über die aufgerissenen und blutverschmierten Lippen gebracht hatte. Trotzdem versuchte sie es noch einmal. Weil sie es ganz einfach nicht akzeptieren wollte. Und ihr nichts anderes mehr übrig blieb. »Bitte … Hilfe!«
Er schnaufte verächtlich durch die Nase.
Der Griff um ihre Handgelenke war fest. Sie wurde weiter die Stufen nach unten geschleift. Jede einzelne der harten, spitzen Kanten kratzte ihr über den Rücken.
»Bitte … lass mich … gehen«, flehte sie.
Er zog sie weiter.
Bis sie im Keller angekommen waren.
Dort ließ er endlich von ihren Händen ab. Doch ehe sie wusste, wie ihr geschah, spürte sie plötzlich eine Last auf ihrer Brust. So heftig, dass es ihr alle Luft aus den Lungen presste. Er hatte sich auf sie gestürzt. Und schon im nächsten Augenblick schlangen sich seine Hände um ihren Hals und drückten zu. Wie ein Schraubstock. Der Druck in ihrem Kopf stieg sprunghaft an. Ihre Augen begannen zu tränen. Sie röchelte. Versuchte, sich zu wehren und seine Hände von ihrem Hals wegzubekommen. Sie zerrte daran, aber das brachte nichts – er war einfach zu stark. Sie trat mit den Beinen aus, doch die fuhren nur ins Leere. Sie schlug benommen um sich und mit den Fäusten auf ihn ein. Aber auch das zeigte keine Wirkung. Sie hatte kaum noch Kraft. Und die Hände um ihren Hals gaben keinen Millimeter nach.
»Hör auf, dich zu wehren!«, zischte er.
Spucketröpfchen trafen sie im Gesicht.
Da wich ihre Panik. Und obwohl ihre Benommenheit wieder anschwoll, war ihr klar, was gerade passierte. Sie erkannte den flammenden Zorn in seinen Augen. Und die Entschlossenheit. Sie hatte keine Hoffnung mehr. Sie wusste: sie würde dieses Haus nicht mehr lebend verlassen.
Dabei hatte sie es doch geahnt. Nein, kein Grund mehr, sich etwas vorzumachen. Sie hatte es gewusst! So lange bereits. Sie hätte auf ihre innere Stimme hören sollen, die sie in den letzten Wochen und Monaten immer vehementer zur Flucht gedrängt hatte. Es war ihr doch klar gewesen. Sie war hier nicht sicher gewesen. Zu keinem Zeitpunkt. Stattdessen hatte sie sich einzureden versucht, bloß Gespenster zu sehen.
Jetzt war es zu spät!
Dieses verfluchte Haus war ihr zur Falle geworden. Der Wald würde ihr zum Grab werden.
»Es … es tut mir … leid«, presste sie mit letzter Kraft heraus. Aber es war nicht zu verstehen gewesen.
Es hatte ohnehin keine Bedeutung mehr. Sie beide wussten, dass es eine Lüge gewesen war. Nichts tat ihr leid. Absolut gar nichts.
Dieses Haus war die Hölle gewesen!
Und er der Teufel!
Ein hassgetränktes Zischen über ihr: »Du verlogene Schlampe!«
Es hatte bereits dumpf und weit entfernt geklungen.
Sie schloss die schmerzenden Augen. Gab sich ihrem Schicksal hin. Nur um zu merken, dass auf einmal der Druck auf ihren Hals nachließ. Und die Hände von ihr abließen.
Sie rang nach Luft. Musste husten.
Hoffnung keimte in ihr auf. Allerdings nur ganz kurz. Denn schon im nächsten Moment spürte sie, wie sie an den Haaren gepackt wurde. Und ihr Kopf daran angehoben wurde.
»Und jetzt stirb!«
Unmittelbar darauf wurde ihr Kopf mit voller Wucht zurück auf die steinharten Bodenfliesen geschmettert.
Der Schmerz war überwältigend. So heftig, dass sie nicht einmal schrie. Nur ein Stöhnen entkam ihr.
Seine Hände schlangen sich wieder mit voller Kraft um ihren Hals. Der Druck wurde so gewaltig, dass es ihr die Augen aus den Höhlen trieb.
Sie brachte kein Wort mehr heraus. Hatte keine Kraft mehr, um sich zu wehren. Sie schloss die Augen. Und ließ es geschehen. Denn ihr war klar, dass es gleich vorbei sein würde.
»Stirb endlich!«
Der Druck auf ihren Kehlkopf nahm noch weiter zu.
Quälende Sekunden verstrichen.
Der Moment schien sich in alle Ewigkeit zu dehnen.
Dann war es endlich so weit.
Sie spürte etwas brechen. Sie hörte es sogar. Einen Sekundenbruchteil später entsprang ein eiskalter Schmerz ihrem Hals. Blitzschnell breitete er sich aus und flutete ihren ganzen Körper.
Sie verlor das Bewusstsein.
Und alles wurde schwarz.
Für immer.
Vier Monate später
Kapitel 1
Als ich das Hotel zum ersten Mal mit eigenen Augen sehe, regt sich etwas in mir. Ein mieses Gefühl. Nein, mehr noch: ein tiefes Unbehagen, das rasch anschwillt und sich vom Magen aus in meinem ganzen Körper auszubreiten beginnt. Ich vermag es nicht zu greifen. Kann lediglich fühlen, wie es mir jetzt den Nacken hochkriecht.
Verschwinde von hier!, zischt eine Stimme tief in mir.
Ich ignoriere sie. Und versuche, mein mulmiges Gefühl als lächerlich abzutun. Weil es das ja schließlich auch ist. Ich bin doch kein Kind mehr, das Angst vor einem alten Gebäude und den Geistern darin hat. Trotzdem schaffe ich es nicht, mich in Bewegung zu setzen. Stattdessen kaue ich an meiner Unterlippe und verharre weiter am Rande der Lichtung. Und das, obwohl ich ohnehin schon viel zu spät dran bin.
Ich streife den bleischweren Rucksack ab und lasse ihn ins feuchte Gras fallen. Einen Augenblick lang verspüre ich Erleichterung. Doch dann setzt sofort wieder der stechende Schmerz im Kreuz ein und arbeitet sich über den Nacken bis zu den Schläfen hoch.
Mir entkommt ein Stöhnen.
Ich kneife die Augen zusammen und fasse mir an die Schläfen, bis das Stechen in meinem Schädel wieder ein wenig nachlässt. Dann stemme ich die Hände in die Hüften, lege den Kopf in den Nacken und lasse ihn kreisen, um meinen Nacken zu dehnen. Doch es schafft keine Abhilfe. Stattdessen überkommt mich jetzt auch noch ein leichtes Schwindelgefühl.
Ich schließe erneut die Augen. Warte darauf, dass es abklingt. Und fühle den kühlen Wind, der mir um die Ohren bläst.
Überall um mich herum ächzt und knarrt es.
Ich öffne die Augen wieder. Richte meinen Blick hoch auf die wankenden Tannenwipfel. Und auf die dunkle Wolkenschicht, die sich nicht weit darüber vorwärtsschiebt. Jede Wette, dass es nicht mehr lange dauert, bis die ersten Tropfen vom Himmel fallen. Ich kann den Regen bereits riechen. Ich sollte also besser zusehen, dass …
Auf einmal ist da ein Knirschen. Direkt hinter mir.
Ich fahre herum.
Doch zu meiner Verwunderung ist da nichts. Die mit Schlaglöchern übersäte Kiesstraße ist menschenleer und auch im Unterholz und zwischen den Bäumen zu beiden Seiten ist nichts und niemand zu entdecken. Kein Schatten, der da nicht hingehört. Kein Farbklecks. Keine Bewegung. Nichts. Und dennoch hat mich dieses Unbehagen wieder ein wenig fester im Griff. Ich bin mir fast sicher, einen stechenden Blick auf meiner Haut zu spüren. Ich schlucke. Halte die Luft an. Und scanne noch einmal die Umgebung. Aber auch jetzt kann ich nichts und niemanden ausmachen. Vermutlich war es also bloß ein Tier, das von einer auf die andere Seite der Straße gehuscht und längst wieder in den Tiefen des Waldes verschwunden ist.
Ich sollte mich wohl besser an solche Geräusche gewöhnen. Immerhin bin ich hier tief im Wald. Und ich bin der Fremdkörper hier.
Ich bin über ein kleines trostloses Dorf, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, hierhergekommen. Eine gefühlte Ewigkeit bin ich der Kiesstraße danach durch den Wald gefolgt. Habe den klobigen Koffer wie ein trotziges Kind hinter mir hergezogen und immer wieder Halt gemacht, weil sich Steinchen in den ratternden Kunststoffrollen verklemmt hatten. Der Rucksack schien mit jedem Schritt schwerer zu werden und der Weg kein Ende nehmen zu wollen. Ich fürchtete schon, mich verlaufen zu haben. Und das Hotel nie zu finden.
Jetzt, da ich es endlich geschafft habe und meinen Blick wieder auf das Gebäude richte, frage ich mich, ob das nicht besser gewesen wäre. Ich sollte auf meine innere Stimme hören und gleich wieder verschwinden. Den guten ersten Eindruck kann ich mir aufgrund der Verspätung ohnehin abschminken. Doch ich kann mich nicht dazu durchringen. Im Grunde weiß ich ja auch, dass ich gar keine andere Wahl habe, als hierzubleiben.
Ich stehe also weiter bloß da. Versuche, meine immer noch anschwellenden Kopfschmerzen zu ignorieren, und starre auf das Gebäude.
Ich bin müde. Verunsichert. Und auch ein wenig schockiert.
Gut, ja, in der Anzeige stand, dass es vor der Wiedereröffnung gründlich renoviert werden müsse. Schließlich bin ich ja genau deshalb hier. Aber war da nicht auch von einer baldigen Wiedereröffnung die Rede? Jetzt, da ich es mit eigenen Augen sehe, halte ich das für völlig ausgeschlossen. Ich frage mich, was das soll. Und wie dieses marode Ungetüm jemals wieder Gäste beherbergen soll.
Das Hotel liegt auf einer weitläufigen Lichtung, über deren feuchtem Boden feine Nebelschwaden wabern. Kaum merkbar trüben sie die Luft und den Blick auf das Gebäude, das aus einem vierstöckigen Hauptteil und zwei dreistöckigen Nebengebäuden besteht. Zudem gibt es noch einige verwinkelte Anbauten. Das Ganze wirkt nicht wirklich durchdacht. Es scheint vielmehr aus der Not heraus entstanden zu sein. Sicher war das Hotel ursprünglich deutlich kleiner gewesen. Und im Laufe der Zeit waren mit der steigenden Nachfrage die Nebengebäude nach und nach ein wenig planlos dazu gebaut worden.
Über der zweiflügligen Eingangstür, zu der fünf breite Steinstufen und eine seitliche Rampe hinaufführen, prangt in großen Lettern der Schriftzug WALDHOF. Das F hat sich aus der oberen Verankerung gelöst und hängt um 180 Grad nach unten. Der schwarze Lack der metallenen Buchstaben ist kaum noch vorhanden. Zum größten Teil schimmern sie in rostigem Braun.
Die Fassade war sicher einst strahlend weiß. Doch mittlerweile hat sie sich zu den verschiedensten Grautönen verfärbt und bröckelt an allen Ecken und Enden. An vielen Stellen kommen die darunterliegenden Ziegelsteine zum Vorschein. Selbst aus der Entfernung ist zu erkennen, dass große und kleine Fassadenteile in der Wiese und im Gestrüpp um das Gebäude herumliegen. Efeu rankt sich die feuchten Mauern hoch. Es wirkt nicht idyllisch. Vielmehr wie eine Krankheit, die sich auf dem Haus ausgebreitet hat.
Dunkelbraunes Fachwerk durchzieht den Großteil des Hotels. Es wirkt genauso morsch wie das Holz der vielen kleinen mit leeren Blumentrögen bestückten Balkone. Einige von ihnen scheinen vornüber zu kippen, manche sogar jeden Moment zu Boden zu stürzen. Ich kann nur hoffen, nie einen davon betreten zu müssen.
Hinter den meisten der verdreckten Fenster sind vergilbte Vorhänge zu erahnen. Eine Scheibe im dritten Stock ist mit einer schwarzen Plastikplane abgeklebt. Die leichte Brise lässt sie rascheln.
Das Dach ist steil, verwinkelt und voller Giebel und kleiner Türmchen. Außerdem ist es großflächig mit Moos bedeckt. Manche der roten Schindeln sind durch dunkelgraue ersetzt worden. Andere fehlen ganz. Hoch über dem Haupteingang ragt ein Rundturm aus dem Dach, auf dessen Spitze ein krummer unbestückter Fahnenmast thront. Er wirkt noch instabiler als die Balkone. Würde mich nicht wundern, wenn der beim nächsten Sturm hinunterkrachte.
Vor dem Gebäude erstreckt sich ein asphaltierter Parkplatz. Die Bodenmarkierungen sind kaum noch auszumachen. Regenpfützen schimmern im düsteren Licht. Und unzählige kleine Punkte, die wie Glassplitter wirken. Unkraut hat sich durch die vielen Risse im Asphalt gedrängt. An manchen Stellen ist es zu regelrechten Büschen herangewachsen. Obwohl die Fläche sicher 25 bis 30 Autos Platz bietet, steht da nur ein einsamer VW Käfer. Der rote Lack ist ausgeblichen und mit Rostflecken und Matschspritzern durchsetzt. Ein Sprung zieht sich über die gesamte Heckscheibe. Der Wagen hat kein Nummernschild, zumindest hinten nicht. Der Seitenspiegel und das Auspuffrohr hängen weit hinab. Die Reifen scheinen viel zu wenig Luft zu haben. Ich bezweifle, dass die Schrottkiste noch anspringt. In der Mitte des Parkplatzes spiegelt ein stillgelegter brüchiger Brunnen, der von einem ausgedörrten Blumenbeet umgeben ist, den Zustand der Anlage wider.
Vor dem rechten Nebengebäude türmt sich ein gut zwei Meter hoher und fünf Meter breiter Erdhaufen auf. Ein Schubkarren mit plattem Reifen steht dort. Ein Spaten liegt daneben im Gras. Außerdem etwas, das aus der Ferne wie ein einsamer Arbeitshandschuh aussieht.
Mann …!
Das muss ich erstmal verdauen. Ich reibe mir das Gesicht und die Augen, als hätte ich bloß ein Trugbild vor mir, das dadurch verschwinden würde. Aber es wird nicht besser.
Ein Rascheln zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. Eine Plastiktüte wird vom Wind über den Parkplatz gejagt – wie eine Taube von einem Kind. Sie bleibt kurz an der Stoßstange des Käfers hängen, löst sich aber schnell und treibt dann weiter. Ich verliere sie wieder aus den Augen.
Nein, das hier ist keine Täuschung. Wo bin ich bloß gelandet? Das alles sieht aus wie die Kulisse eines schlechten Horrorfilms. Nichts, absolut gar nichts an diesem Ort wirkt einladend.
Du solltest nicht hier sein!, meldet sich die Stimme in mir zurück. Hau ab!
Als hätte ich eine Wahl!
Es ist ja nicht so, dass ich grundlos mein altes Leben zurückgelassen habe. Dass ich den erstbesten Job, der mir fernab von zu Hause angeboten worden war, angenommen habe – und das, ohne Fragen zu stellen. Dass ich Hals über Kopf aufgebrochen und hierher gereist bin. Von einem Tag auf den anderen. Mit nichts mehr als dem alten Koffer und dem Rucksack bei mir.
Und natürlich den Erinnerungen.
Ich will sie nicht zulassen. Nicht schon wieder. Ich versuche, sie mit aller Macht von meinem Verstand fernzuhalten. Doch ich bin chancenlos. Wie ein einsamer Wachmann, der einer aufgebrachten Meute gegenübersteht, die bereits alle Absperrungen niedergerissen hat und nun geradewegs auf ihn zustürmt. Ehe ich mich versehe, blitzen die blutverschmierten Bilder schon vor meinem geistigen Auge auf. Und schnüren mir die Kehle zu. Ich spüre, wie der Druck hinter meinen Lidern sprunghaft ansteigt. Wie meine Augen nass werden. Und sich schon eine erste Träne daraus löst und mir die Wange hinunterläuft. Ich wische sie mir mit dem Handrücken weg. Reibe mir das Gesicht. Hole tief Luft. Aber ich werde die Bilder nicht los. Ich fühle schon, wie die nächste Träne mir übers Gesicht läuft und meine Lippen zu zittern beginnen.
Ja, es hat verdammt noch mal einen Grund, warum ich hier bin! Ich sollte besser …
Auf einmal werde ich aus meinen Gedanken gerissen. Denn zwei Dinge passieren fast zeitgleich. Erst glaube ich, hinter einem der Fenster im ersten Stock eine Bewegung wahrzunehmen. Doch das trübe Tageslicht spiegelt sich darin und ehe ich mir sicher bin, ist da noch etwas anderes: ein Knacken. Direkt hinter mir. Und plötzlich auch ein Knurren.
Ich wirble herum.
Ach du Scheiße!
Da steht ein Mann, keine zehn Meter von mir entfernt. Er hat ein Gewehr auf mich gerichtet.
Kapitel 2
»Rühr dich nicht von der Stelle!«, brummt der Fremde über den Gewehrlauf hinweg und ich bin mir nicht sicher, wem die Aufforderung gilt – mir oder dem Rottweiler zu seinen Füßen.
Der Köter hat mich mit seinen dunklen Augen fixiert. Er knurrt und strotzt nur so vor Aggressivität. Jeder Muskel seines Körpers scheint angespannt. Ich bin überzeugt: schon bei der leisesten Bewegung würde er sich auf mich stürzen. Aber ich wage es ohnehin nicht, mich zu rühren. Dabei würde ich so gerne in meine rechte Hosentasche greifen – auch wenn mir das, was sich darin befindet, gerade nicht weiterhelfen würde. Nur mein Blick hetzt hin und her – zwischen dem Hund und der immer noch auf mich gerichteten Waffe.
»Wer bist du?«, faucht der Mann mich an und zuckt mit dem Gewehrlauf. Seine Stimme ist tief und kratzig. Und sie trieft nur so vor Abscheu.
Er ist wohl Ende 50, vielleicht auch schon Anfang 60. Und ein regelrechter Berg von einem Mann. Das rot-schwarz karierte Flanellhemd spannt über seinem gewaltigen Oberkörper – einer Mischung aus Muskeln und Fett. Aus der Brusttasche schaut eine Zigaretten-Packung heraus, was auch den Klang seiner Stimme erklärt. Er hat schütteres, kurzgeschorenes Haar und ein kantiges Gesicht, das von grau melierten Bartstoppeln durchsetzt ist. Seine Haut wirkt ledern. Die Nase ist ein gewaltiger Zinken mit vielen roten Äderchen. Und so schief wie ein gefällter Baum, dessen Fall von den Ästen der umstehenden Bäume aufgehalten wurde. Die Beine wirken stämmig und ein wenig zu kurz geraten. Sie stecken in schmutzigen Jeans. Dafür scheinen seine Füße besonders groß ausgefallen zu sein. Die abgewetzten festen Lederschuhe gehen wohl auf Größe 50 zu.
»Ich habe dich etwas gefragt!«, herrscht er mich an.
Ehe ich antworten kann, bellt der Köter wütend auf. Ich zucke vor Schreck zusammen. Das macht das Tier nur noch aggressiver und es fletscht die Zähne.
Ich bringe kein Wort heraus. Mache mir beinahe in die Hose.
»Ruhig!«, weist der Kerl den Hund an. »Ganz ruhig!« Dann wieder an mich gerichtet: »Ich frage dich jetzt zum letzten Mal. Wer bist du? Und was zum Teufel hast du hier zu suchen?«
Ich begreife erst jetzt, dass ich die Hände hoch halte und am ganzen Körper zittere. Es ist nicht mehr als ein krächzendes Gestotter, das ich herausbringe: »Ich … ich bin der … Handwerker. Ich …«
»Handwerker?«, unterbricht er mich.
»Ja, genau.«
»Was für ein Handwerker?«
»Ich … also, ich …« Ich schlucke.
»Na, wird’s schon!«
Ich atme tief durch. Versuche, mich zu fassen, was ihm offenbar zu langsam geht.
»Wir brauchen keinen Handwerker!«
»Ich habe mit …«
Der Hund kläfft und bringt mich wieder aus dem Konzept.
»Ich will, dass du verschwindest!«
Ich hole noch einmal tief Luft. Fasse Mut. »Vielleicht könnten Sie ja …«
Er lässt mich wieder nicht ausreden. »Hörst du schlecht? Du sollst abhauen!«
Mein Herz hämmert wie verrückt. Meine Gedanken rasen. Ich begreife einfach nicht, was das alles soll. Wer zur Hölle ist der Kerl? Wie hat er sich so unbemerkt an mich ranschleichen können? Und warum ist er so aggressiv? Was, verdammt noch mal, hat er gegen mich? Ich will hier weg. Und zwar sofort. Da gibt es allerdings noch das Problem, dass ich es nicht wage, mich zu rühren. Dieser Köter …
Plötzlich höre ich Geräusche in meinem Rücken. Wohl eine Tür, die zugeknallt wird. Gefolgt von harten Absätzen, die hastig über Asphalt klappern. Und einer schrillen Frauenstimme, die ruft: »Spinnst du? Schluss jetzt! Aber sofort!«
Ich widerstehe dem Drang, mich umzudrehen. Starre weiter den Mann an. Und sehe, wie seine Mimik schlagartig an Aggressivität verliert. Ja, wie sein Gesicht geradezu verfällt.
Das Klappern kommt immer näher.
»Ausgerechnet jetzt …«, murmelt er, ohne mich aus den Augen zu lassen. Oder den Gewehrlauf von mir zu nehmen.
Der Rottweiler knurrt nicht mehr. Die spitzen Zähne sind in seinem Maul verschwunden. Seine Körperspannung hat sich verflüchtigt. Er weicht zurück, sucht hinter den Beinen seines Herrchens Zuflucht.
Das gibt mir Sicherheit. Ich wage einen Blick hinter mich. Und entdecke eine Frau in einem schwarzen knöchellangen Kleid, die auf uns zustürmt. Ich bemerke erst jetzt, dass es zu nieseln begonnen hat.
»Alfred, bist du verrückt geworden?«, kreischt sie und ihre Stimme überschlägt sich förmlich. »Lass den armen Mann in Ruhe, aber sofort!«
Er murmelt etwas Unverständliches.
Der Hund ist mucksmäuschenstill.
Die Frau hat uns erreicht und baut sich zwischen mir und dem Mann auf. Schnaufend streicht sie sich eine Strähne, die sich aus ihrer Hochsteckfrisur, in der auch eine Blume steckt, gelöst hat, aus dem Gesicht und streckt mir ihre ausgemergelte Hand entgegen. »Sie sind sicher Herr Winter, richtig?«
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich nicke. Da das Gewehr aber immer noch auf mich gerichtet ist, wage ich es nicht, die Arme runterzunehmen.
Sie räuspert sich, murmelt ein »Nun ja …« und zieht ihre Hand zurück. »Ich bin jedenfalls Eleonora Reiter, die Besitzerin des Waldhofs.«
Sie streckt die Arme aus, als hätte sie eben einen Zaubertrick vollbracht. Dabei versucht sie sich in einem Lächeln, was ihr jedoch gründlich misslingt. Da ist einfach viel zu viel Anspannung in ihrem mageren Gesicht.
»Herzlich willkommen!«, sagt sie und streckt mir ein zweites Mal die Hand entgegen.
Ich bin perplex, lasse ihre Hand weiter in der Luft hängen.
Sie kämpft immer noch mit ihrem Lächeln. Ihre Wangen und Augen zucken dabei unkontrolliert.
Nun wage ich es endlich, die Hände runterzunehmen und ihre Hand zu schütteln.
»Es freut mich so«, sagt sie und aus irgendeinem Grund glaube ich ihr das nicht so ganz.
»Was hat der hier zu suchen?«, will der Mann wissen.
So feindselig er auch klingt, seine Stimme hat eindeutig an Schärfe verloren. Dennoch hat er immer noch das Gewehr auf mich gerichtet.
Sie beachtet ihn erst gar nicht und bemüht sich weiter um Höflichkeit. »Bitte entschuldigen Sie meinen Mann, Herr Winter. Ich brauche Ihnen wohl nicht zu erklären, dass seine Umgangsformen manchmal leider ein wenig zu wünschen übrig lassen. Es gibt Situationen, da möchte man glauben, dass er direkt von Orang-Utans abstammt und bloß adoptiert wurde.«
»Ich will wissen, was …!«, setzt er an.
Doch sie fährt ihm scharf dazwischen: »Ruhe jetzt!«
Ich zucke ein wenig zusammen. Wo bin ich da nur hineingeraten?
Wieder versucht sie zu lächeln. Ihre spitzen Wangenknochen ragen dabei hervor. Ihr rechtes Augenlid zuckt kaum merkbar. Die Strähne ist ihr wieder ins Gesicht gerutscht. Sie streicht sie sich erneut zurück.
»Wozu brauchen wir einen Handwerker?«, will er wissen.
»Ist die Frage dein Ernst? Hast du dich schon einmal hier umgesehen?«
»Kannst du mir erklären, wie wir den Kerl beza…?«
Sie fährt herum. Und bringt ihn mit einem vernichtenden Blick zum Schweigen. Zwei, drei Sekunden verharrt sie so, um ihren Standpunkt ein für alle Mal klar zu machen. Dann wendet sie sich wieder mir zu.
»Wissen Sie, Herr Winter, mein Mann meint es nicht so. Leider weiß er manchmal eben nicht, was sich gehört. Meine Theorie mit den Affen kennen Sie ja bereits.« Dann wendet sie sich noch einmal um und drückt endlich den Gewehrlauf zu Boden. »Und jetzt pack gefälligst dieses Ding weg! Es ist ja geradezu lächerlich, wie du dich aufführst!«
»Ich lasse mir von dir nicht …!«
»Und ob!«
»Hör auf damit, mir immer …!«
»Schluss jetzt!«
Der Rottweiler ist inzwischen zahm wie ein Dackel. Er wagt es kaum noch, zwischen den Beinen seines Herrchens hindurchzulugen.
Der Mann will zum letzten Protest ansetzen, doch sie lässt ihn gar nicht erst zu Wort kommen.
»Hast du etwa nichts zu tun?«, will sie von ihm wissen. »Ich bin wirklich gespannt, wie lange es noch dauert, bis dieser hässliche Erdhaufen endlich verschwunden ist! Was macht denn das für einen Eindruck, frage ich dich?«
Er murmelt etwas Unverständliches.
Sie fährt herum. »Wie bitte?«
Er versucht, ihrem Blick standzuhalten. Gibt aber schnell auf.
»Ach, vergiss es!«, brummt er, schnauft und schultert sein Gewehr. »Los komm, Oskar!«
Der Rottweiler lässt sich nicht zweimal bitten. Er folgt ihm aufs Kommando und die beiden verschwinden in Richtung des rechten Nebengebäudes. Nach ein paar Schritten hält er jedoch inne, dreht sich noch einmal um und streckt mir den Zeigefinger entgegen: »Zimmer 467 ist für dich tabu, hast du verstanden! Ach was, der ganze vierte Stock. Wenn ich dich dort erwische, dann …«
»Alfred!«
Er ignoriert sie und zeigt mit dem Finger auf mich. »Sag später nicht, ich hätte dich nicht gewarnt!«
Jetzt ist sie es, die unverständliche Flüche murmelt, während Mann und Hund sich wieder abwenden und ihren Weg fortsetzen. Ich betrachte sie von der Seite. Ihre Kieferknochen mahlen und ihr Augenlid zuckt erneut. Dann, von einem Moment auf den anderen, setzt sie wieder dieses angestrengte Lächeln auf und streift ihr feuchtes Kleid an den Hüften glatt.
Ansatzlos packt sie meine Hand und schüttelt sie energisch. »Also, wie dem auch sei. Noch einmal herzlich willkommen! Ich darf doch Simon sagen?«
Ich nicke, bin aber immer noch von der Rolle. Dieser Empfang hat mich schlichtweg überfordert.
Sie hält meine Hand weiter fest. »Alfred meint es nicht persönlich, das kann ich Ihnen versichern, Herr Simon. Die letzten Tage waren nicht gerade leicht für uns, müssen Sie wissen. Es gab da leider ein paar Unannehmlichkeiten. Nicht sehr prickelnd, das können Sie mir glauben. Vielleicht haben Sie ja gehört, dass …« Sie bricht den Satz ab. Lässt jetzt endlich meine Hand los. Räuspert sich in ihre Faust. Lächelt. Und macht eine Handbewegung, als möchte sie damit das eben Gesagte aus meinem Gedächtnis wischen. »Ach, was soll’s, vergessen Sie’s einfach! Und bitte lassen Sie sich von dem alten Griesgram bloß nicht die gute Laune verderben.«
Nun, dieser Zug ist wohl abgefahren. Aber so was von.
Ich nutze die Gelegenheit und lasse meine Hand in die rechte Tasche meiner Jeans gleiten. Taste nach dem kleinen runden Metall. Presse eine Kante unter meinen Fingernagel. Und genieße die vertraute, beruhigende Wirkung.
Über ihre Schulter hinweg sehe ich, dass der Mann und sein Köter die Seitentür des Nebengebäudes erreicht haben. Er öffnet sie, schickt den Hund voraus und wirft mir noch einen giftigen Blick zu, ehe er ihm folgt und die Tür heftig hinter sich zuknallt – ein letztes deutliches Statement darüber, was er von meiner Ankunft hier hält.
»Am besten, ich zeige Ihnen gleich Ihr Zimmer«, sagt sie, um gleich wieder meine Aufmerksamkeit zu bekommen. »Dann können Sie sich rasch umziehen und sofort loslegen. Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber es gibt jede Menge Arbeit für Sie.«
Sie wartet erst gar nicht eine Reaktion von mir ab. Während ich noch zögere, ist sie schon auf halbem Weg zum Haupteingang. Ich blicke die Kiesstraße zurück, der ich eben hierher gefolgt bin. Vielleicht sollte ich ja einfach …
»Nun kommen Sie schon, Herr Simon!«
Ich seufze. Schultere den Rucksack und folge ihr, den widerspenstigen Koffer im Schlepptau, durch den Regen. Dabei meldet sich meine innere Stimme zurück – noch eindringlicher als zuvor: Du machst einen großen Fehler! Verschwinde, solange du noch kannst!
Kapitel 3
»Nur keine Müdigkeit vortäuschen!«, trällert die Hausherrin. Sie ist die fünf Stufen regelrecht hochgeflogen und bereits am Haupteingang angekommen. Ungeduldig zappelt sie dort von einem Fuß auf den anderen. Wie ein kleines Mädchen, das es nicht erwarten kann, ihrer neuen Freundin endlich ihr tolles neues Prinzessinnen-Zimmer zeigen zu können. »Nun kommen Sie schon!«
Als ich den Koffer mit seinen ratternden Rollen die Rampe hochgezogen und zu ihr aufgeschlossen habe, hat sie sichtlich Mühe, die schwere Eingangstür aufzubekommen. Sie zerrt daran. Ich will ihr helfen, aber sie drängt mich zur Seite.
»Lassen Sie nur, Herr Simon!«, presst sie zwischen ihre Zähne hindurch. »Manchmal klemmt dieses schmucke Ding leider ein wenig, müssen Sie wissen! Aber das werden sie ja sicherlich rasch beheben können, nicht wahr?«
Ich ringe mir ein Lächeln ab und hoffe, dass es ihr als Antwort genügt.
»Fein. Und wenn wir erst mal wiedereröffnet haben, bleibt sie sowieso durchgehend offen. Wir müssen dann so eine Wärmeluftdüse installieren. Heißt das so?«
Ich habe keine Ahnung, wovon sie spricht.
»Wissen Sie, so eine, wie sie die feinen Läden in den Einkaufsstraßen heute haben. Bringt zwar die Frisur ein wenig durcheinander, aber dafür bleibt die kalte Luft draußen.«
»Ja«, sage ich nur, weil ich nicht weiß, was ich sonst darauf antworten soll.
»Nun, also bitte!« Sie hat die Tür endlich aufbekommen und macht eine einladende Geste. »Nur herein in die gute Stube.«
Ich setze zu einem Schritt an, aber sie schneidet mir den Weg ab und schlüpft selbst zuerst hinein.
Kurz bin ich irritiert.
Dann betrete ich das Hotel.
Im selben Moment zuckt ein Gedanke durch meinen Verstand. Jedoch viel zu schnell, als dass ich ihn fassen könnte. Ehe ich ihn begreife, ist er auch schon wieder verschwunden. Nur ein mieses Gefühl bleibt zurück.
Mir bleibt keine Zeit, darüber nachzudenken. Zu viele Eindrücke prasseln auf einmal auf mich ein. Das düstere Licht. Der muffige Geruch. Die Kälte, die unmittelbar hinter der Schwelle gelauert zu haben schien. Die Stille. Und dieses erdrückende und einengende Gefühl – trotz der Weitläufigkeit der Empfangshalle.
Ich bin überwältigt. Weil ich mich in eine längst vergangene Zeit zurückkatapultiert fühle. Und ich unter all dem Staub und den vielen Spinnweben den einstigen Prunk erahne. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Bruchbude vor vielen Jahrzehnten eine ausgezeichnete Adresse gewesen war. Und dass Menschen einst bereitwillig eine Stange Geld für den Aufenthalt hier bezahlten. Das hier war sicher kein Ort für die gemeine Masse. Garantiert blieben hier der Adel, Ärzte, Anwälte, Direktoren, Unternehmer und derengleichen unter sich. Fast ist es so, als wären deren Stimmen hinter all der Stille noch ganz, ganz leise zu erahnen. Und als hingen deren teure Parfüms noch immer in der Luft. Aber eben nur fast.
All das ändert nämlich nichts daran, dass ich erschüttert bin. Denn so marode das Gebäude von außen auch aussieht, es ist nichts im Vergleich zu seinem Innenleben. Hier drinnen schreit einfach alles nach einer Abrissbirne.
Die beigefarbenen Bodenfliesen sind mit Matschspritzern und Schuhabdrücken besudelt. Sogar dünne Reifenspuren, vermutlich von einem Fahrrad, kann ich entdecken. In der Mitte der Eingangshalle stehen zwei einander zugewandte dunkelgrüne Sofas. Schon alleine der Anblick reicht aus, um zu spüren, wie sich die Sprungfedern in mein Gesäß bohren. An einer Lehne ist der verschlissene Stoffbezug gerissen und der Schaumstoff quillt heraus. Zwischen den Sofas steht ein rundes Holztischchen mit kunstvoll geschnitzten Beinchen. Darauf thront eine Porzellanvase, in der frische rosa und weiße Schnittblumen stecken. Lilien, vermute ich. Aber ich kenne mich mit Blumen nicht aus.
Im linken Bereich der Halle befindet sich ein lang gezogener Tresen, über dem golden »Rezeption« an der mit dunklem Holz vertäfelten Wand prangt. Unter dem Schriftzug hängt ein gut ein Meter hoher und drei Meter breiter Schlüsselkasten. Die meisten der Haken sind leer. Nur an wenigen hängen Schlüssel mit schweren goldfarbenen Anhängern. Auf dem Tresen selbst steht ein überquellender Papierkorb. Das war es an Deko.
»Also, noch einmal herzlich willkommen, Herr Simon!«, sagt Frau Reiter mit einem unüberhörbaren Stolz in ihrer Stimme und streckt mir ein randvolles Schnapsgläschen entgegen.
Keine Ahnung, wo sie das auf einmal her hat. Ich nehme es ihr ab und bedanke mich. Ich hasse so ein Zeug.
Sie leert ihres in einem Zug. Stöhnt zufrieden und wischt sich mit dem Handrücken über den Mund.
»Nun machen Sie schon, runter damit!«, drängt sie mich.
»Ich würde lieber nicht …«
»Keine Ausreden, wir müssen doch Ihre Ankunft feiern!«
»Es ist nur so, dass …«
»Und machen Sie sich keine Gedanken. Ihre Arbeit wird so ein kleiner Schluck schon nicht beeinträchtigen, was?«
Normalerweise bin ich nicht so. Wirklich nicht. Ich habe meine Meinungen und vertrete meine Standpunkte gerne. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass eine Diskussion mit dieser Frau schon im Vorhinein zum Scheitern verurteilt ist. Augen zu und durch, denke ich mir also und kippe den Inhalt, ein furchtbar starkes und geschmacklich völlig undefinierbares Gesöff, in einem Zug hinunter.
»So ist’s gut«, sagt sie, als wäre ich ein Hund. »Ein Arbeiter braucht Energie, Herr Simon!«
Ich wische mir mit dem Handrücken über den Mund und muss ein wenig husten, weil das Brennen in meiner Mundhöhle und dem Rachen erst jetzt so richtig einsetzt.
Sie lacht, als würde ich einen Witz machen. »Ich dachte, Sie seien ein Mann, Herr Simon.«
Ich fange mich wieder.
»Na also. Noch ein Gläschen?«
Bloß nicht! »Nein, danke!«
»Ach, kommen Sie schon!«
»Nein, wirklich …«
»Sie Spielverderber! Das muss ich Ihnen wohl noch beibringen, was?« Sie nimmt mir mein Glas ab. Will es aber offenbar immer noch nicht wahrhaben. »Sicher nicht noch eines?«
»Ganz sicher.«
»Hm, wie Sie meinen.«
Sie verschwindet mit den Gläsern hinter dem Rezeptionstresen, wo sie sich selbst noch einen einschenkt und hinunterkippt. Sie stöhnt zufrieden, geht in die Hocke und verschwindet aus meinem Sichtfeld – vermutlich weil sie die Gläser irgendwo verstaut. Während das Brennen in meinem Rachen allmählich abklingt, lasse ich noch einmal die Empfangshalle auf mich wirken. Es wird nicht besser.
»Der Waldhof verfügt über mehr als 100 Zimmer«, sagt sie, weil sie meine Blicke offensichtlich ganz genau verfolgt.
Wenn die im gleichen Zustand sind wie das, was ich bisher gesehen habe, dann ist dieses Gebäude verloren. Aber das sage ich ihr nicht. Stattdessen nicke ich bloß und versuche, mich beeindruckt zu geben. Das bin ich in gewisser Weise ja auch.
Im rechten Bereich der Empfangshalle, gegenüber der Rezeption, befinden sich drei Türen, über denen »Safes«, »Garderobe« und »Hoteldirektion« steht. Das Milchglas jener, die zur Hoteldirektion gehört, ist eingeschlagen. Große und kleine Scherben liegen davor auf dem Boden verstreut. Die Tür muss also von innen eingeschlagen worden sein. Ein paar Meter weiter steht ein Feuerlöscher. Unmittelbar daneben ein roter Damenschuh mit Schwindel erregend hohem Absatz.
»Und, was sagen Sie, Herr Simon?«, fragt sie und gesellt sich wieder zu mir. »Beeindruckend, nicht wahr?«
Ich ringe mir ein weiteres Lächeln ab. Gleichzeitig frage ich mich, ob sie mich vielleicht bloß auf den Arm nehmen will. Ich suche in ihren glänzenden Augen nach einem Anzeichen dafür, finde aber keines. Ich fürchte, es ist ihr voller Ernst. Wie kann sie nicht begreifen, dass jeder Cent und jede Minute, die man in dieses Gebäude investiert, die reinste Verschwendung sind? Sie hat wohl schon viel zu viele Gläser intus. Oder gibt es da etwas, das ich noch nicht gesehen oder begriffen habe?
»Keine Frage, es liegt natürlich noch ein wenig Arbeit vor uns«, sagt sie. »Aber wenn hier erst mal ein wenig sauber gemacht ist, dann sieht das alles gleich ganz anders aus.«
Ich bin davon überzeugt, dass die vielen Schäden dadurch nur noch deutlicher zum Vorschein kommen werden. Aber das sage ich nicht. Stattdessen nicke ich nur.
Sie redet weiter, aber ich höre ihr nicht mehr zu. Ich grüble darüber, wie ich ihr am besten verklickern kann, dass alles bloß ein riesengroßes Missverständnis war. Und dass ich mich dazu entschlossen habe, doch nicht hierbleiben zu wollen. Soll ich ihr die Wahrheit sagen? Oder soll ich behaupten, am Rande der Lichtung eine Tasche vergessen zu haben und einfach abhauen? Oder soll ich vielleicht zu drastischeren Mitteln greifen und einen Schwächeanfall vortäuschen? Ein wenig schwindelig wäre mir ja. Und die dazu passenden Kopfschmerzen hätte ich auch.
Aber ehe ich mich für eine Option entschieden habe, legt sie mir die Hand in den Rücken und schiebt mich vorwärts. »Kommen Sie weiter, Herr Simon! Das wird Ihnen bestimmt gefallen.«
Kapitel 4
Frau Reiter drängt mich an den Sofas vorbei und zwischen zwei mächtigen Marmorsäulen hindurch. Hinein in einen angrenzenden Saal.
»Et voilà, der große Speisesaal«, verkündet sie voller Stolz und breitet wieder die Arme aus, als hätte sie ihn eben erst aus einem Hut gezaubert.
»Wow«, entkommt es mir. Und ich bin tatsächlich erst mal von diesem dunklen Ungetüm von einem Saal überwältigt. Ich lasse ihn auf mich wirken. Bis ich Klicklaute und Gemurmel wahrnehme. Mir wird klar, dass Frau Reiter immer wieder den Lichtschalter drückt und dabei zusehends ungeduldiger wird.
»Mist«, flucht sie, weil es dunkel bleibt. »Blöder Mist!«
Als sie bemerkt, dass ich sie beobachte, findet sie rasch ihre Fassung wieder und lächelt. »Das passiert leider manchmal. Die alten Leitungen, Sie wissen ja sicher …«
Ich nicke, obwohl ich von alten Leitungen keine Ahnung habe.
»Ich hoffe, dass Sie auch ein guter Elektriker sind«, sagt sie.
»Ich werde mein Bestes geben.«
Du musst hier weg!
»Fein.«
Sie versucht es noch zweimal, dann lässt sie fluchend von dem Schalter ab.
Ich gehe ein paar Schritte tiefer hinein und lasse meinen Blick weiter durch den Saal streifen. Es fällt kaum Licht durch die nassen und mit schweren, vergilbten Vorhängen verhangenen hohen Fenster herein. Vielleicht wirkt der Saal gerade deshalb so groß. Und zugegeben: auch ein wenig unheimlich. Trotz des düsteren Lichts ist nicht zu übersehen, dass das Fischgrätparkett schwer lädiert ist. So auch die Decke, durch die sich viele meterlange Sprünge ziehen. Die feinen Stuckaturen bröckeln an allen Ecken und Enden. Die schweren Kronleuchter wirken, als würden sie jeden Moment zu Boden krachen. Die Wände sind mit weinroter Tapete verkleidet. Düstere Ölgemälde mit ländlichen Motiven in vergoldeten Rahmen hängen daran. Die sicher einst strahlenden Farben der Bilder sind mittlerweile von einem matten Schatten überlagert. Zwischen den Gemälden ragen prunkvolle Wandleuchten hervor. Ein Großteil der Fassungen ist leer.
Der ganze Saal ist mit großen und kleinen runden Tischen ausgefüllt. Auf einigen sind weiße Tischdecken ausgelegt. Vereinzelt stehen leere Kerzenständer oder verstaubtes Geschirr darauf. Auf dem Tisch zu meiner Rechten krabbelt eine Spinne und verschwindet in einer zerknüllten weißen Stoffserviette. Einige Stühle sind an die Tische geschoben, manche liegen umgekippt auf dem Boden. Etwa in der Mitte des Saals thront sogar einer auf einem Tisch. Der Großteil aber – es müssen an die 100, wenn nicht noch mehr sein – stapeln sich in einer der hinteren Ecken des Saals.
»Also ich weiß ja nicht, wie es Ihnen dabei geht, Herr Simon. Aber ich bin jedes Mal aufs Neue von diesem Saal fasziniert«, sagt sie, sieht mich an und wartet auf eine Reaktion. Weil ich mich außer dem Nicken für keine entscheiden kann und bereits ein paar Sekunden verstrichen sind, fügt sie noch hinzu: »Eindrucksvoll, nicht wahr?«
»Ja«, bringe ich gerade so heraus, weil es das ja auch tatsächlich ist. Eindrucksvoll, ja, aber nicht im positiven Sinne. Wie alles andere hier. Diese ersten Momente hier im Hotel überwältigen mich schlichtweg.
Ist mir deshalb so schwindelig? Oder liegt es an Frau Reiters grauenvollem Gesöff?
»Der Saal wird das Highlight des ganzen Hauses. Wir werden hier natürlich auch große Feste feiern«, schwärmt sie und streckt schon wieder die Arme aus. Ich glaube schon, dass sie sich jeden Moment zu drehen beginnt und einen Tanz imitiert. Aber dann macht sie doch bloß ein paar Schritte tiefer in den Saal hinein, zeigt auf verschiedene Punkte und erklärt dazu: »Dort hinten könnten wir eine Bühne für Musiker und Stargäste aufbauen, dann hätten wir trotzdem noch genügend Platz für eine großzügige Tanzfläche. Und links und rechts davon könnten wir noch zwei oder vielleicht sogar drei Tischreihen einfügen. Das wären dann natürlich die besten und teuersten Plätze. Für Promis und so.«
»Natürlich«, stimme ich ihr zu und schüttle im Geiste den Kopf.
Sie ahnt davon nichts, strahlt auf einmal übers ganze Gesicht, und scheint durch meine Zustimmung nur noch motivierter. »Was meinen Sie, Herr Simon, was könnte man für so einen exklusiven Tisch gleich neben der Tanzfläche verlangen? Und bedenken Sie bitte, dass Promis ja meistens reich sind!«
»Also, das weiß ich wirklich nicht.«
»Nun kommen Sie schon, nur raus mit der Sprache!«
»Keine Ahnung, ehrlich.«
»Jetzt trauen Sie sich, es gibt keine falsche Antwort!«
»Tut mir leid.«
Sie lässt nicht locker. »Inklusive eines mehrgängigen Gala-Menüs selbstverständlich! Mit einem großem Salat- und einem noch größeren Dessertbuffet. Kaviar, Trüffel, das ganze Zeugs, von dem diese Schickimickis nicht genug bekommen können. Und Champagner natürlich, bis zum Abwinken.«
Sie starrt mich an und wartet auf eine Antwort.
Ich zucke mit den Schultern. »100 vielleicht?«
»Euro?«, wird sie ganz schrill.
Ja, was denn sonst? Ich nicke und ziehe gleichzeitig die Schultern hoch.
»Also das halte ich für falsch!«
»Okay«, sage ich bloß.
»Oder wollen Sie mich etwa auf den Arm nehmen?«
»Nein, ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich keine …«
Sie fährt mir dazwischen: »Dafür könnte man doch sicher mindestens 500 Euro oder noch mehr verlangen. All Inclusive, die ganze Nacht! Stellen Sie sich das nur mal vor!« Sie sieht mich eindringlich an und klopft sich auf die Schläfen, als wolle sie mir damit eine Anleitung geben, wie ich meine Vorstellungskraft erweitern kann.
»Sie haben wahrscheinlich recht«, sage ich in der Hoffnung, diese sinnlose Diskussion damit beenden zu können.
Aber nicht mit ihr.
»Wir könnten auch einen Schokoladenbrunnen aufstellen!«, schreit sie auf einmal und ihre Augen sind ganz groß geworden.
Sicher ist ihr der Gedanke eben erst gekommen. Diese Frau ist verrückt.
»Mögen Sie Schokoladenbrunnen, Herr Simon?«
»Ich weiß nicht.«
»Meinen Sie, würde das den Gästen gefallen?«
»Da bin ich überfragt.«
»Oder finden Sie das altmodisch?«
Ihre Fragen werden immer skurriler. Verarscht sie mich etwa? Am liebsten würde ich sie direkt danach fragen und mich nach Kameras umsehen. Springt etwa gleich ein Showmaster im knallbunten Anzug und mit roter Fliege irgendwo hervor und brüllt: »Willkommen, Herr Winter, bei der Versteckten Kamera!«? Aber irgendwie scheint mir ihre Verwirrung – zumindest jetzt, in diesem Moment – zu authentisch, um bloß gespielt zu sein. Ich beschließe also, ihr ab sofort einfach bei allem recht zu geben.
»Vielleicht ein wenig altmodisch, ja«, sage ich deshalb.
»Hm, schade.«
Ja, ihre Enttäuschung wirkt absolut echt.
»Aber es gibt sicher viele Menschen, die so etwas lieben«, füge ich deshalb noch hinzu. Keine Ahnung, warum ich nicht einfach meinen Mund halte. Vielleicht, weil sie mir sogar ein wenig leidtut.
Jedenfalls zeigen meine Worte Wirkung und es ist wieder da: ihr strahlendes Lächeln. »Ja, das stimmt wohl!«, sagt sie und reibt sich die Hände. »Jetzt, wo ich so darüber nachdenke: Glauben Sie, wären 1.000 Euro für so ein Exklusiv-Paket übertrieben?«
Ich wollte ihr ja bei allem recht geben. Aber es geht ganz einfach nicht. »Das klingt schon nach sehr viel, um ehrlich zu sein.«
»Hm«, macht sie und überlegt kurz. »Naja, das muss man natürlich noch gründlich durchkalkulieren, das ist ja klar. Aber ich finde, das geht schon in die richtige Richtung.«
»Womöglich, ja.«
»Ich sage Ihnen, ich kann es kaum erwarten. Ich kann die Musik schon förmlich hören. Und das ausgelassene Lachen der vielen Gäste.«
Wieder wirkt sie nicht wie eine erwachsene Frau, sondern vielmehr wie ein kleines Mädchen.
»Können Sie es auch hören, Herr Simon?«
»Ja.«
»Fein«, sagt sie, klatscht in die Hände und schüttelt verträumt den Kopf. Sie wirkt durch meine Zustimmung noch angespornter. »Zu Weihnachten könnten wir die schönste Tanne im Wald fällen und dort hinten aufstellen. Mindestens fünf Meter hoch muss die natürlich sein. Und wir werden sie dann mit roten und goldenen Kugeln und einem funkelnden Stern an der Spitze schmücken.«
»Also, um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass man einfach so einen Baum im Wald fällen darf.«
»Ach, ich bitte Sie, das merkt doch niemand.«
»Aha.«
Ich sehe mich unauffällig um, ob ich nicht doch noch irgendwo einen Showmaster entdecke.
»Wo wir schon dabei sind: Mögen Sie Lametta?«
»Ja.« Es ist mir egal.
»Fein.« Ihr entkommt ein rundum zufriedenes Seufzen. Dann zeigt sie auf die Fenster. »Die Rahmen und die Sprossen müssen natürlich unbedingt noch frisch lackiert werden.«
Ihre Prioritätensetzung ist der Hammer.
»Die Fenster sind das Erste, was man sieht, wenn man den Raum betritt.«
Mir sind sie hinter den dicken Vorhängen kaum aufgefallen.
»Und Blumen natürlich. Wir brauchen die schönsten Blumen, die wir nur bekommen können. Und ganz, ganz viele davon. Jeder Tisch soll mit einem prächtigen Strauß geschmückt sein. Und überhaupt. Überall müssen frische Blumen sein, damit es gemütlich wirkt und schön duftet.«
Hallelujah, diese Frau hat einen Knall!
»Ihnen ist doch sicher der Strauß in der Empfangshalle aufgefallen, oder?«, will sie wissen.
»Ja«, sage ich. »Sehr schön.«
»Eben. Sag ich doch. Wenn man hier ankommt, muss der erste Eindruck passen. Nicht auszudenken, wenn …«
Sie redet weiter, doch ich blende ihre Stimme aus. Mir ist etwas ins Auge gestochen, das meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Auf einem Tisch, keine fünf Meter entfernt, liegt ein Farbfoto – das Porträt einer Frau, soweit ich das aus der Distanz erkennen kann. Ich kann nicht sagen, wieso, aber aus irgendeinem Grund fühle ich mich davon angezogen. Ich gehe also hinüber, nehme es in die Hand und betrachte es näher. Dabei läuft es mir kalt den Rücken hinunter, keine Ahnung, weshalb. Und es passiert etwas in meinem Magen. Es fühlt sich an, als wäre er voller Ameisen und jemand habe mit einem Zweig darin zu wühlen begonnen.
Das Bild ist zum Unterschied zu allem anderen hier kein Überbleibsel aus vergangenen Tagen, sondern ziemlich sicher neu. Die Frau darauf scheint Anfang 30 zu sein, vielleicht auch schon Mitte. Sie hat schulterlanges braunes Haar, das sie sich auf einer Seite hinters Ohr gesteckt hat. Die weißen Perlenohrstecker kommen dadurch besonders zur Geltung. Die Andeutung eines Lächelns liegt in ihrem Gesicht, Grübchen sind in ihren Wangen zu erahnen. Ihre haselnussbraunen Augen leuchten auf eine ganz besondere Art und Weise und ziehen mich regelrecht in ihren Bann. Sie erregen ein sonderbares Gefühl von Vertrautheit in mir. Ich frage mich, an wen sie mich bloß erinnert. Aber so sehr ich mich auch zu konzentrieren versuche, ich komme einfach nicht drauf.
Ich habe gar nicht bemerkt, dass Frau Reiter mir gefolgt ist. Jetzt steht sie jedenfalls unmittelbar neben mir, hat den Kopf geneigt und mustert mich eindringlich.
»Sie ist wunderschön, nicht wahr?«, sagt sie.
Sie ist noch ein kleines Stück näher an mich herangekommen. Sie ist mir viel zu nah. Ich trete einen Schritt zur Seite, nicke und ärgere mich gleichzeitig darüber. Es geht sie nichts an, ob mir diese Frau gefällt oder nicht. Wie kommt sie überhaupt darauf, so etwas zu fragen? Was ist bloß los mit ihr? Ist es etwa ihre Tochter? Und spricht der Stolz einer Mutter aus ihr? Dann müsste Frau Reiter sehr jung Mutter geworden sein, denn ich schätze sie auf Anfang 50. Aber möglich ist es natürlich. Doch selbst, wenn dem so wäre, fände ich ihre Frage nicht angebracht.
Ihr Blick wird noch aufdringlicher. Da ist kein Lächeln mehr. Nur noch das Stechen ihrer Augen, das mir eine Mischung aus Neugierde und Anspannung vermittelt.
Ich mache einen weiteren Schritt von ihr weg.
»Kennen Sie sie, Herr Simon?« Ihre Stimme hat auf einmal einen seltsamen Unterton, den ich nicht zu deuten vermag.
Was? Spätestens jetzt bin ich mir sicher: Sie ist nicht ganz dicht! Unklar ist mir nur, wer von den beiden den größeren Knall hat – sie oder ihr Mann, dieser aggressive, minderbemittelte Pavian.
Ich gebe ihr keine Antwort. Stattdessen warte ich auf eine Erklärung für ihre absurde Frage.
Doch sie lässt mich im Unklaren. Sie hält meinem Blick stand. Noch zwei, vielleicht drei Sekunden lang. Dann ist da plötzlich wieder dieses aufgesetzte Lächeln in ihrem Gesicht, und sie sagt: »Nun, wie dem auch sei. Sie können es sicher kaum erwarten, endlich Ihr Zimmer zu sehen, was? Nummer 117. Eines der allerschönsten im ganzen Hotel, das kann ich Ihnen versprechen. Sie werden es lieben.«
Kapitel 5
Ob es in diesem alten Gebäude einen Aufzug gibt, weiß ich nicht. Falls ja, hält Frau Reiter es offenbar nicht für notwendig, ihn zu benutzen und es mir so ein wenig einfacher zu machen. Sie führt mich über ein abseits gelegenes steiles Treppenhaus hoch in den ersten Stock. Wegen des sperrigen Koffers und des bleischweren Rucksacks habe ich alle Mühe, mit ihr Schritt zu halten.
»Treppensteigen ist gesund, Herr Simon«, trällert sie.
Ich würde gerne etwas nach ihr werfen.
Oben angekommen stelle ich fest, dass die Flure hier nicht so sind, wie man das aus Hotels heute kennt – also breit, lichtdurchflutet und geradlinig. Diese hier sind nicht nur eng und verwinkelt, sondern auch weitgehend fensterlos und unbeleuchtet. Ich frage mich, ob der Strom hier ebenfalls nicht funktioniert oder Frau Reiter es schlichtweg nicht für notwendig hält, das Licht für mich anzumachen. In der Dunkelheit übersehe ich eine Stufe mitten im Flur und kann mich gerade noch so auf den Beinen halten. Ein paar Schritte später stolpere ich über einen schweren Teppichvorleger, dessen Rand sich aufgewölbt hat. Wieder schaffe ich es nur mit Mühe, nicht hinzufallen. Danach habe ich Frau Reiter jedoch aus den Augen verloren. Ich kann nur noch das hektische Klappern ihrer Absätze auf dem Holzboden hören. Ich folge ihr auf gut Glück. An einer Gabelung angekommen, bin ich jedoch ratlos. Ihre Schritte hallen zwischen den Wänden und helfen mir nicht weiter. Ich entscheide mich für die rechte Abzweigung, und schon beim ersten Schritt laufe ich in ein Spinnennetz.
Mist!
Während ich mir fluchend die Fäden aus dem Gesicht zupfe, höre ich sie rufen.
»Hierher, Herr Simon! Sie müssen nach links!«
Ich befreie mich immer noch von dem klebrigen Zeug, da bilde ich mir auf einmal ein, einen Blick in meinem Nacken zu spüren. Ich schaue hinter mich. Und entdecke in den tiefen Schatten am Ende des Flurs, den ich gerade entlanggekommen bin, eine Gestalt. Sie steht da ganz still. Und starrt mich an. Ein Mädchen wahrscheinlich. Vielleicht aber auch eine besonders zierliche Frau. Ich kann es aus der Entfernung nicht sagen.
»Hallo!«, rufe ich ihr zu.
Ich bekomme keine Antwort.
Dafür schreit Frau Reiter wieder nach mir: »Nach links, hören Sie nicht? Sie müssen nach links!«
Dann eben nicht!, denke ich mir.
Wenn sie nicht reden will, soll es so sein. Ich lasse die Frau am Ende des Flurs stehen, wende mich ab und folge Frau Reiters Anweisungen. Dabei übersehe ich fast wieder eine Stufe, und schon ist da eine weitere Gabelung.
Mein Gott, das hier ist der reinste Irrgarten!